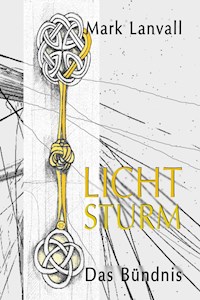Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lichtsturm
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Sardrowain, der dunkle Albenmeister, greift in beiden Welten nach der Macht. Ben von Hartzberg, die Schwertmeisterin Larinil und hunderte Verwandelte sammeln sich in Neuseeland. Dort bereiten sie sich auf den Widerstand vor. Ihre Hoffnung ruht auf einem verschollenen Schwert. Nur die Waffe des Keltenkriegers Kellen hat die Kraft, die sie brauchen, um gegen den übermächtigen Gegner bestehen zu können. Doch längst rüstet auch Sardrowain in der Anderswelt zum Krieg. Er plant einen Schlag gegen die Menschen, von dem sie sich nicht wieder erholen sollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Lanvall
Lichtsturm III
Kellens Schwert
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Bisher bei Lichtsturm:
Albtraum
Der Sänftensklave
Hinrichtung
Der Pfad des Schwertes
Das große Meeting
Die schützende Mauer
Der Coup
Im Netzwerk
Pandrai!
Das Nest
Kellens Schwert
Ein neues Monster?
Die Sternenhalle
Verrat
Die Warnung
Das Licht
Übergang
Impressum neobooks
Bisher bei Lichtsturm:
Ein blutiger Bürgerkrieg tobt in Lysin’Gwendain, der Anderswelt. Geschlagen und verfolgt fliehen abtrünnige Alben unter Führung des Großmeisters Geysbin und dessen Tochter Larinil in die Welt der Menschen, finden Zuflucht in der weißen Bergfestung Galandwyn. Aber auch dort sind sie vor dem Zorn ihrer Feinde nicht sicher. Die siegreichen Herrscher der Anderswelt stellen gegen sie ein Heer aus Gorgoils und Pandrai auf - monströse Kreaturen, geschaffen aus dunkler Magie. Dabei hilft ihnen der skrupellose, keltische Druidenhäuptling Bram, der als Belohnung für seine Dienste ein Elixier erhält, das ihm ein jahrhundertelanges Leben ermöglicht.
Geysbin und den Alben Galandwyns gelingt es, eine Schlacht gegen die Gorgoils und Pandrai zu gewinnen. Dennoch fürchten sie, den Krieg am Ende zu verlieren. Und dass der Welt der Menschen eine dunkle Zeit bevorsteht. Deshalb wirkt Geysbin einen Zauber an drei Keltenkriegern - darunter Kellen, in den sich Larinil verliebt. Der Großmeister verbirgt tief im Inneren der Krieger einen Keim, der Generationen später aus ihren Nachfahren Alben werden lässt. Sein Plan ist, dass diese Verwandelten eines Tages über die Menschen wachen und einer Bedrohung aus der Anderswelt entgegentreten. Geysbin selbst will den neuen Alben dabei beistehen und sie unterweisen. Zusammen mit seiner Tochter Larinil begibt er sich daher in einen jahrhundertelangen Schlaf.
Doch sein Plan geht schief. Erst zwei Jahrtausende später erwacht der Großmeister. In der langen Zeit hat er sein Gedächtnis und seine magischen Fähigkeiten eingebüßt. In seiner Verwirrung löst er die Verwandlung Hunderter ahnungsloser Nachfahren der drei Kelten aus.
Darunter ist der frustrierte Ben, den die seltsame Veränderung seines Körpers zunächst ratlos macht. Ebenso wie eine Serie von Mordanschlägen gegen ihn und andere Verwandelte. Bald stellt sich heraus, dass der nun mehr als 2000 Jahre alte Bram hinter den Angriffen steckt. Er sieht die Verwandelten als Erben der Galandwyn-Alben und damit als seine Feinde an. Außerdem hofft er auf eine weitere Belohnung aus der Anderswelt, denn sein Elixier reicht nur noch für eine einzige Verjüngung.
Die junge Wissenschaftlerin Natalie findet den verwirrten Geysbin und seine Tochter Larinil in den Bergen. Sie kümmert sich um die beiden und hilft ihnen dabei, in der den Alben fremden Welt nach Verwandelten zu suchen. Bald gründen sie, Larinil, Geysbin, Ben und dessen Freunde Maus und Viktoria eine Stiftung, deren Aufgabe es ist, die Verwandelten vor den zunehmenden Anfeindungen und Übergriffen durch Menschen zu schützen. Außerdem sollen sie erfahren, was sie jetzt sind, und lernen, ihre übermenschlichen Fähigkeiten zu nutzen. Ihren Sitz hat die Stiftung in einem abgelegenen Anwesen auf der Atlantikinsel Madeira. Ben und Natalie verlieben sich auf der Insel ineinander. Allerdings sind beide unsicher, ob es zwischen einem Menschen und einem Verwandelten klappen kann. Larinil macht ihnen Mut, indem sie von ihrer Liebe zu Kellen und der glücklichen, wenn auch kurzen Zeit, die sie mit ihm hatte, erzählt.
Aber auch auf Madeira sind die Verwandelten nicht sicher. Der dunkle Albenmeister Sardrowain - ein Gefolgsmann der Herrscher - spürt, dass sich in der Welt der Menschen etwas tut. Er fürchtet, dass dort mit Geysbin ein alter Feind wieder stark werden könnte. Und er wittert die Chance, seinem träge gewordenen Volk endlich zur Herrschaft über beide Welten zu verhelfen. Denn nachdem sich die monsterhaften Gorgoils in der Anderswelt gegen ihre Schöpfer gewandt haben, verschanzen sich die Alben dort seit Jahrhunderten in einer silbernen Stadt hinter einer gewaltigen Mauer. Zusammen mit Andrar, einem Offizier der Anderswelt, geht er in die Welt der Menschen und sucht dort den Kontakt zu Bram. Nach der letzten Verjüngung hat dieser die Identität des Milliardärs van den Berg angenommen. Unterstützt von dessen Söldnern greift Sardrowain die Stiftung auf Madeira an. Er entfacht einen Lichtsturm, den Larinil und Ben nur mit großer Mühe abwehren können. Die Alben der Stiftung bezwingen die Angreifer - auch deshalb, weil der Offizier Andrar zu ihnen überläuft. Sardrowain flieht in die Anderswelt und entführt dabei einen von Larinils Schülern, den Verwandelten Timo Hemander.
Noch einmal konnten sich Larinil, Ben und die anderen behaupten. Sie ahnen aber längst, dass sie Geysbins verlorene Kräfte brauchen werden, um gegen Sardrowain bestehen zu können. Bens Freunde Maus und Viktoria suchen deshalb nach einem von drei Albenschwertern, die Geysbin vor langer Zeit den drei Keltenkriegern gegeben hat. In Karfunkelsteinen im Knauf der Waffen schlummern Kräfte, die - so glaubt Larinil - ihrem Vater die Erinnerungen und Fähigkeiten zurückgeben können. Eine Spur führt ins Dahner Felsenland, wo eines der Schwerter vergraben sein soll.
Geysbin, Larinil und Andrar brechen unterdessen auf. Sie verlassen Madeira auf der Suche nach einer neuen Zuflucht.
Für Evi und Amelie,
meine Albenköniginnen
Albtraum
Eine Lanze aus Feuer schneidet durch die himmelhohen Türme. In ihren gläsernen Fassaden spiegelt sich das grelle, flackernde Licht - bevor diese zerbersten und einen Regen aus Scherben und Trümmern über die Straßen ausschütten. Mauern brechen mit erschreckender Leichtigkeit - als wären sie aus dürren Ästen. Steine fallen, stürzen in die Tiefe, bohren sich mit Wucht in den Boden, bringen Tod und Verwüstung. Die Menschen schreien gegen das lärmende Chaos an. Und auch gegen ihre Verzweiflung und ihre Machtlosigkeit. Denn für sie gibt es kein Erbarmen. Die gleißende Feuerlanze hat leichtes Spiel, sie zermalmt, zerdrückt und verbrennt sie. Oder zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg, sodass sie haltlos in die Tiefe stürzen.
Die gewaltige Lanze ist so plötzlich über die Menschen und ihre Türme gekommen. Mit Zischen und dumpfem Prasseln hat sich das Unheil zwar leise angekündigt. Ein Flackern in der Ferne, eine viel zu warme Brise. Aber niemand hat die Gefahr rechtzeitig erkannt. Zu sehr waren die Menschen mit ihrem Alltag beschäftigt. Mit den üblichen Sorgen, die sie plagten und die nun mit einem Mal so unbedeutend sind.
Ein Turm steht in hellen Flammen. Die Feuerlanze hat ihn zunächst nur gestreift. Jetzt aber trifft sie ihn mit aller Wucht, zerschneidet ihn, als wäre er ein Stück warmes Brot. Wieder brechen Mauern ein. Wieder werden Straßen zu Trümmerfeldern, zu mörderischen Fallen, zu engen Gräbern. Aber dann irgendwann endet das Inferno. Die Lanze verschwindet. Stille legt sich wie ein Leichentuch über das Chaos. Blutrot sticht die Sonne durch den grauen Rauch. Die Stadt ist zerstört. Jetzt gibt es keine Türme mehr und auch keine Menschen. Jetzt gibt es nur noch Zerstörung, Leid und Tod.
Geysbin wachte auf. Sein Atem ging schwer. Dieser Traum! So oft hatte er ihn gequält. Nur dieses Mal hatte Geysbin ihn bis zum Ende geträumt. Diesmal hatten ihn nicht das Grauen und die Wut vorher aufschrecken lassen. Ein Schaudern lief durch Geysbins Körper. Er seufzte. Der einstige Großmeister von Galandwyn wusste, was seine Träume bedeuten konnten. Sie warnten ihn, zeigten ihm beizeiten auch die Zukunft. So deutlich hatte ihm dieser Traum die Gewalt eines Lichtsturms offenbart. Zu deutlich, um als bloßes Angst-Gespinst abgetan zu werden.
„Du bist wach, Vater?“ Larinils Stimme klang besorgt. Natürlich war seiner Tochter nicht entgangen, dass er geträumt hatte. Und dass es kein guter Traum gewesen war. Auf seiner Stirn stand Schweiß und seine Hände zitterten. Zwar nur leicht, aber Larinils Sinne waren scharf. Und niemand kannte ihn besser als sie. Niemand war ihm in dieser fremden Welt vertrauter.
Mit einem Mal verdrängte ein starkes Gefühl der Wärme die Schwere, die der Traum in ihm hinterlassen hatte. Ein Bild aus der Vergangenheit hatte sich nun in Geysbins geschundenem Geist eingenistet. Es zeigte ihm ein kleines Mädchen mit weichen Zügen und großen Augen. Hilfesuchend sah es ihn an. Ein Wimmern stahl sich über die Lippen der Kleinen, obwohl sie doch so offensichtlich hatte tapfer sein wollen. Ihr Knie blutete. Wieder einmal hatte sie sich verletzt, als sie in den hohen Bäumen am Rande der silbernen Stadt herumgeklettert war. Eine Berührung, ein machtvolles Wort und ihre Wunde würde heilen. Doch viel zu schnell war das Bild wieder verschwunden. Geysbin wusste, dass es aus den Tiefen seiner Erinnerung gekommen war. Dass es ihm Larinil, seine Tochter zeigte. Es war ein Bild aus jenen Tagen, in denen sie ein glückliches Leben in Lysin'Gwendain, der Anderswelt, geführt hatten - vor so langer Zeit.
Viel war seitdem passiert. Dinge, die sein Gedächtnis nur in wenigen Bruchstücken behalten hatte. Aber Larinil hatte ihm davon erzählt. Vom Lorrwain, dem Krieg, der das Volk der Elvan jal'Iniai spaltete. Von der Flucht in die Welt der Menschen, der weißen Festung Galandwyn in den Bergen. Von dem nicht enden wollenden Kampf. Mit einem gewagten Zauber sollte er, Geysbin, schließlich die Entscheidung gesucht haben, hieß es. Jahrhundertelang schliefen Larinil und er tief im Fels. Als sie schließlich erwachten, hatte er seine Erinnerungen und seine Kräfte verloren. Dieser Zauber! Menschen verwandelten sich durch ihn in Elvan jal'Iniai, zu Kriegern wider Willen. Denn der Kampf ging weiter. Ein erstes Gefecht konnten sie auf Madeira für sich entscheiden. Kein Sieg. Kaum mehr als eine erfolgreiche Verteidigung. Und einmal mehr waren sie auf der Flucht.
„Ja, ich bin wach, meine Tochter“, sagte Geysbin und seufzte noch einmal. „Wo sind wir?“
Larinil zwinkerte ihm aufmunternd zu. „Im Bauch eines riesigen Walfischs, der uns verspeist hat, während wir geschlafen haben.“
Geysbin setzte sich auf und sah sich um. Der Raum war hoch und karg. Die metallenen Wände waren fensterlos und mit weißer Farbe dick bestrichen. Kisten aus Eisen und Holz stapelten sich an manchen Stellen bis unter die Decke. Geysbin und Larinil hockten auf dem Boden. Dünne Matten bescherten ihnen bescheidenen Komfort, nahmen ein wenig die Kälte, die die stetig sanft vibrierende Oberfläche abstrahlte. Geysbins Blick fiel auf Andrar, den Schwertführer, der einst den Feinden gedient hatte, aber dann auf ihre Seite gewechselt war. Er schlief noch immer. Larinil hatte seine tiefe Wunde in der Schulter geheilt. Auf ihrer langen Reise war er genesen. Allein Andrars rechtes Ohr zeugte noch immer vom Kampf gegen Sardrowain. Sein einstigen Meister, jener mächtige Handlanger der drei Herrscher Lysin'Gwendains hatte Andrar mit einem Bolzen seiner Armbrust getroffen. Nun klaffte ein fingerdickes Loch in der Muschel. Und die Spitze des Ohrs neigte sich leicht zur Seite. Ein Makel, der den ehemaligen Schwertführer im Heer der Herrscher wohl stets an den Konflikt erinnern würde, den er in seinem Inneren ausgefochten hatte. An dessen Ende hatte Andrar eine schwere Entscheidung getroffen, seinen Eid als Soldat gebrochen und sich gegen seinen Meister gestellt. Eine Tat, die größten Mut verlangte. Geysbin schuldete dem jungen Krieger dafür Respekt und bedingungslose Freundschaft. Er hatte sich geschworen, über ihn zu wachen mit all seinen Kräften, so bescheiden sie inzwischen auch sein mochten.
„Ein Walfisch aus Stahl, dem wir vermutlich sogar dankbar sein müssen, weil er uns dorthin bringt, wohin wir wollen“, sagte Geysbin.
Larinil nickte. „Gut, dass du dich erinnerst, Vater. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Dein böser Traum hatte immerhin ein Gutes: Er hat dich zur rechten Zeit geweckt.“
Geysbin schob sich das graue Haar hinter die Ohren und versuchte, den Schleier des Schlafes aus den Augen zu reiben. Das Alter machte sich längst bei ihm bemerkbar. So viele Jahrhunderte hatte er gesehen. Doch erinnern konnte er sich nur an die wenigen Monate seit seinem Erwachen. Er hätte verzweifeln können, hätte die Last des Lebens gerne abgeworfen. Doch das durfte er nicht. Sein Weg war noch nicht zu Ende, ebenso wenig wie der Kampf, den er seit mehr als 2000 Jahren ausfechten musste.
„Das Ziel, sagst du? Ein neues Land, eine neue Sprache. Ich hoffe, dieses Ziel bringt uns mehr Glück als das letzte“, sagte er und klang dabei missmutiger als beabsichtigt.
Larinil zog die Mundwinkel zurück. „Ich verstehe dich, Vater. Auch ich würde mich unseren Feinden lieber in offener Schlacht stellen, als mich im Bauch stählerner Schiffe zu verstecken. So oft sind wir schon geflohen. Und trotzdem hat uns der Krieg immer wieder eingeholt.“
Sie seufzte. Ihr Blick richtete sich ziellos auf eine Stelle am Boden vor ihr, eine Schraube, die Geysbin noch rostiger vorkam als all die anderen. „Aber der Tag der Entscheidung wird kommen, Vater. Eines Tages. Das ist sicher. Wir müssen nur Geduld haben.“
Geysbin nickte, als wären damit alle Probleme geklärt. „Nun“, sagte er und versuchte, dabei zuversichtlich zu klingen. „Natalie und Ben haben sicher auch diese neue Zuflucht klug gewählt. Ich vertraue ihnen. Sie sind klug und vorsichtig.“
Larinil lächelte, während nun auch in Andrar neben ihr nach und nach das Leben zurückkehrte.
„Es ist ein gutes Land, sagen sie. Eines, das die verwandelten Elvan jal'Iniai achtet und bei sich aufnimmt. Und die Sprache werden wir schnell lernen. Es heißt, dass sie mit der der Deutschen verwandt ist.“
„Das ist gut“, knurrte Andrar und setzte sich benommen auf. „Es hat mich zwei Wochen gekostet, bis ich mich mit den deutschen Menschlingen hinlänglich austauschen konnte.“ Er blickte sich um und man sah ihm an, wie sich die Dinge erst allmählich in seinem Kopf zu einem sinnvollen Bild zusammensetzten. „Werden Ben und Natalie uns hier erwarten?“, fragte er dann.
„Guten Morgen, Schwertmeister Andrar“, sagte Larinil etwas spitz und schüttelte dann den Kopf. „Nein, sie werden erst später kommen können. Aber es gibt andere, die uns empfangen und in die Zuflucht bringen werden. Es ist für alles gesorgt. Hat dir der Schlaf gutgetan?“
Andrar betastete vorsichtig seine verletzte Schulter. Überrascht zog er dann die Augenbrauen hoch.
„Ihr seid nicht nur eine unbezwingbare Kaijadan-Meisterin, Larinil, sondern auch noch eine ausgezeichnete Heilerin. Ich muss euch einmal mehr danken.“
Larinil lachte. Es war ein wohlwollendes Lachen, eines, das Zuneigung offenbarte, stellte Geysbin zufrieden fest. Der Groll seiner Tochter auf den abtrünnigen Schwertführer war wohl endgültig verflogen. Das war gut.
„Jetzt aber sollten wir unsere Sachen zusammensuchen“, mahnte Larinil dann. „Ich höre Schritte. Der Mann, der uns hier unten einen Platz besorgt hat, vermute ich. Er will uns offenbar wissen lassen, dass wir angekommen sind.“
Das Vibrieren des Bodens hatte aufgehört. Auch Geysbin bemerkte das jetzt.
„Das wird er wohl“, erwiderte er und erhob sich langsam. „Bevor er das unerhört viele Geld, das Ben ihm gegeben hat, im Hafen dieser Stadt ausgeben wird.“
„Neuseeland? Larinil, Geysbin und Andrar sind in Neuseeland? Wie cool ist das denn?“ Maus stolperte fast vor Begeisterung, während er den viel zu schmalen Pfad entlang stapfte, der ihn auf den Kamm zwischen den beiden Bergen bringen sollte. Er vergaß für einen Moment sogar die Erschöpfung, die sich nach den ersten zehn Minuten ihrer Expedition in seinen fülligen Gliedern breitgemacht hatte. Und er vergaß die Schmerzen in seiner Brust, die Nachwehen einer heftigen Rippenprellung, die ihm der verräterische Albe Hensson auf dem Dach des Straßburger Münsters verpasst hatte. Neuseeland war eben cool.
„Wusstest du, dass die da 'Herr der Ringe' und die 'Hobbit'-Filme gedreht haben?“
„Klar weiß ich das. Jeder weiß das, Dicker. Geb mal nicht so an!“, schimpfte Viktoria. „Und vor allem: Schrei hier nicht so laut herum! Das mit Neuseeland ist natürlich geheim. Eigentlich hätte ich dir gar nichts sagen dürfen.“
Maus sah sich um. Dr. Kassandra Moureau konnte unmöglich verstehen, was sie sagten. Sie war auf dem Weg bestimmt 30 Meter zurückgefallen. Nicht etwa, weil sie noch schlechter zu Fuß unterwegs war als er. Bei ihr lag es daran, dass sie zwischendurch immer wieder stehen blieb, um Fotos zu machen oder sich wer-weiß-schon-was in der Landschaft anschaute. Maus vermutete, dass sie sich ausmalte, wie hier früher irgendwelche mittelalterlichen Gemetzel stattgefunden hatten. Das würde zu ihr passen. Aber so war die Alte wenigstens beschäftigt und nervte Maus nicht mit ihrem ständigen Gequatsche über alte Schwerter, Lanzen und Morgensterne.
Die kleinwüchsige, schräge Moureau war der Grund dafür, dass sie hier waren. Sie war Expertin für außergewöhnliche Waffen und hatte sie auf die Fährte eines der albischen Schwerter gebracht, die Geysbin vor 2000 Jahren drei keltischen Kriegern geschenkt hatte. Es waren magische Schwerter und sie konnten Geysbin möglicherweise das Gedächtnis und einen Sack voll großartiger Fähigkeiten zurückgeben. Möglicherweise. Jetzt waren sie jedenfalls hier, in der Einöde des Dahner Felsenlandes, und suchten nach einem der Schwerter. Anfangs hatte Maus diese Expedition noch für abgefahren gehalten. Jetzt, drei erfolglose Tage später, an denen sie mit Schaufel und Spaten bewaffnet durch die Wildnis irrten, hatte er die Nase eigentlich voll.
„Süße, du weißt: Für mich bist du die Größte. Aber wieso sollten Ben und Natalie nur dir das Neuseeland-Geheimnis anvertrauen und mir nicht?“
„Vielleicht, weil deine Klappe manchmal genauso groß ist wie deine Wampe.“
Autsch. Das saß. Unter normalen Umständen wäre Maus jetzt sauer auf seine Freundin gewesen. Aber was war in diesen Zeiten schon normal? Innerhalb weniger Monate war Viktoria zweimal fast erschossen und einmal beinahe vom Straßburger Münster geworfen worden. Maus fand, dass sie ein paar fiese Frechheiten gut hatte. Allerdings schien Viktoria in diesem Moment selbst gar nicht mehr so glücklich mit ihrer Bemerkung zu sein. Auf ihrer Stirn hinter der übergroßen Brille bildeten sich ein paar Falten und rund um die Mundwinkel ein bitteres Lächeln.
„Sorry, Maus“, sagte sie und streichelte seinen Oberarm. „War vielleicht ein bisschen viel Action in letzter Zeit. So ein richtig spießiger Urlaub würde uns, glaube ich, jetzt ganz gut tun.“
„Du meinst: Sonne, Strand, Cocktails und dick belegte Sandwiches? Ohne albischen Zauberkram und schwer bewaffnete Killer, die uns umnieten wollen?“
„Genau das.“
„Weiß nicht“, grinste er. „Klingt langweilig. Ich steh nun mal auf Abenteuer-Urlaub. Bin mittlerweile ziemlich verwöhnt, was das angeht.“
Viktoria lachte. „Oha. Du bist also wieder im Indiana-Jones-Modus angekommen. Sehr gut. Wer weiß, wie viele Felsen uns die Moureau hier noch besteigen lässt.“
Als hätte sie Viktorias Bemerkung gehört, stieß die skurrile, kleine Dame hinter ihnen plötzlich ein schrilles Jauchzen aus. Maus und Viktoria blieben abrupt stehen und drehten sich zu ihr um.
Unter Maus' skeptischem Blick schloss die Moureau mit erstaunlich schnellen Schritten zu ihnen auf.
„Monsieur Werrn“, schrie sie und fuchtelte wild mit ihren Ärmchen in der Luft herum. „Das ist es. Wir haben es gefunden. Das ist der steinerne Drache.“
Maus sah sich die wulstige Felsformation an, die sich unmittelbar vor ihnen erhob. Er konnte nicht wirklich erkennen, dass sie sich von den vielen anderen Felsen unterscheiden sollte, die sie bisher untersucht hatten. Das Dahner Felsenland war voll davon. Auf den bewaldeten Kämmen langgezogener Hügel brachen die mächtigen Steine aus dem Boden, formten hier und da gewaltige Platten oder von Höhlen und Bögen durchbrochene Felswände. Beeindruckend, wenn man darauf stand, durch die Natur zu stapfen. Maus hätten unter normalen Umständen ein paar schöne Fotos davon auch gereicht.
„Der steinerne Drache?“, murrte er und sah auf die Karte, die er sich gekauft hatte, als er gemerkt hatte, dass sein Handy hier in weiten Teilen keinen Empfang hatte. „Bei mir heißt das Ding 'ruhender Hase'.“
Die Moureau lachte schrill auf. „Aber Monsieur Werrn. Sie glauben doch nicht, dass jemand wie Ritter Rudloff von Thanbarr einem Felsen wie diesem so einen banalen, ja geradezu lächerlichen Namen gegeben hätte. Wir reden hier von einem Recken, von einem Helden, der sich rühmt, finstere Dämonen erschlagen zu haben. Einer wie er hat nichts übrig für Kleintiere. Nein, der 'ruhende Hase' ist die wenig originelle Erfindung eines Fremdenverkehrsbeamten. Das hier ist der 'steinerne Drache'. Nichts anderes. Wir sind am Ziel.“
Maus sah sich das Felsgebilde noch einmal genauer an. Tatsächlich konnte man mit etwas Fantasie darin einen liegenden Drachen sehen. Ein gehörnter Kopf mit hohlen Augen und zwei weit nach vorne gestreckte Pranken. Warum nicht?
„Könnte hinhauen“, stellte auch Viktoria fest, die von der Moureau im selben Moment etwas grob zur Seite geschoben wurde.
„Los, los!“, mahnte die kleine Frau und begann, das Ritterlied zu zitieren, das ihrer Meinung nach den entscheidenden Hinweis auf den Ort gab, an dem sich das Schwert des Ritters befand.
„Dort, wo des Lindwurms grässlich Klaue
Der Pranke Last wie Speere weit
des Recken Tand verborgen lag.
Auf dass er nimmermehr in aller Zeit
der Sonne Antlitz schauen mag.“
Die Moureau rannte zielsicher zu dem Teil des Felsen, den sie offensichtlich für die vorgeschobene Klaue eines Drachen hielt. Als würde das irgendetwas ausrichten, trat sie zweimal gegen den Stein und riss dann direkt vor den Drachenzehen ein paar Grasbüschel aus.
„Zugegeben: eines der schlechteren Gedichte rund um den Thanbarr. Umso mehr glaube ich, dass es einen Hinweis geben soll. Der Ritter hat seinen 'Tand' hier versteckt. Damit können nur seine Rüstung und seine Waffen gemeint sein. Was sonst von Wert hatte er schon besessen?“
„Aber warum sollte er seine Sachen hier vergraben?“, fragte Viktoria. Entgegen ihrer Natur stellte sie die naiveren Fragen. Maus und sie hatten sich der Moureau gegenüber als steinreiches Pärchen ausgegeben - mit einem Hang für ungewöhnliche Waffen. Dass sie nach einem steinalten albischen Schwert mit obskuren Kräften suchten, hatten sie ihr besser verschwiegen.
Die Moureau stieß einen abschätzigen Seufzer aus und schenkte Viktoria durch ihre lupendicken Brillengläser einen mitleidigen Blick.
„Rudloff von Thanbarr war ein eitler Ritter. Als er spürte, dass sich seine Zeit dem Ende entgegen neigte, sorgte er dafür, dass all das, was ihn unverwechselbar gemacht hat, mit ihm verschwand. Natürlich hätte er Waffen und Rüstung einschmelzen lassen können. Doch wie unwürdig wäre das für diese Dinge gewesen? Er schätzte und ehrte sie und brauchte deshalb einen angemessenen Platz dafür. Und welcher ist besser geeignet als unter der Tatze eines Drachen? Ich vermute, dass es unter diesem Felsen einen Hohlraum gibt. Wir müssen ihn nur finden“, sagte sie und juchzte.
Maus stöhnte und packte den Klappspaten aus, den er in seinem Rucksack verstaut hatte. „Nur finden“, wiederholte er.
Eine dunkelblonde Frau mit kleinen, wachen Augen hatte Larinil, Geysbin und Andrar vom Hafen abgeholt. Mit den Dokumenten und Schriften, die sie bei sich hatte, konnten sie überall passieren und in das Land „einreisen“, wie die Frau es nannte. Larinil hatte vom ersten Moment an, seit sie den Bauch dieses mächtigen Schiffes aus Metall verlassen durfte, ein gutes Gefühl. Die Luft hier war klar und würzig, verhieß eine an Pflanzen reiche und von den Einflüssen der Menschen unbelastete Natur. So viele Monate waren vergangen. Doch noch immer hatte sich die Kaijadan-Meisterin nicht vollständig an die neue Welt der Menschen gewöhnen können. Sie war voll und der Lärm in ihr schien allgegenwärtig. Grund war stets das, was die Menschen 'Motoren' nannten - jene Maschinen, mit denen die Autos, Motorräder, Eisenbahnen und Flugzeuge bewegt wurden. Jeder Mensch, so kam es Larinil vor, glaubte, fortwährend auf Reisen sein zu müssen. Und die Geräusche, die all die vielen Motoren verursachten, waren der Preis, den sie bereitwillig dafür bezahlten. Das war noch anders gewesen in jener Zeit, in der Larinil in der weißen Festung gelebt hatte. Es hatte so viel weniger Menschen gegeben. Weit verstreut wohnten sie meist in kleinen Dörfern und Höfen, nur wenige in den Ländern südlich der Berge auch in Städten. Sie reisten auf Pferden oder in Ochsenkarren. Oft aber verbrachten sie ihr Leben dort, wo sie waren - glücklich, wenn sie von Krankheit und Krieg verschont blieben. Larinil war sich nicht sicher, ob ihr Leben damals deshalb besser war. Aber es war ganz gewiss sehr viel leiser.
Auch hier in diesem Land gab es Lärm und Motoren. Dennoch schien ein unsichtbarer Teppich der Ruhe über allem zu liegen, einer, der den Dingen die Geschwindigkeit nahm. Die Menschen waren freundlich, nahmen wohl keinerlei Anstoß daran, dass sie Elvan jal'Iniai waren. Und als sie schließlich die Stadt verlassen hatten und bald nur noch an dichten Wäldern, zartgrünen Hügellandschaften vorbeifuhren, spürte Larinil, dass sich ihr Puls verlangsamt hatte. Ein Zustand wohliger Entspannung umfing sie, während die milde Luft durch den Spalt im Autofenster blies und mit ihren offenen Haaren spielte. Und dann sah sie die Berge. Groß und machtvoll schoben sie sich in den Himmel, gekrönt von einer Kappe aus reinem, weißen Schnee. Spitz oder schroff, manchmal rund, aber immer erhaben sahen ihre Gipfel auf sie hinab. Larinil wusste, dass es nicht jene Berge waren, in denen einst Galandwyn, die weiße Festung, stand. Aber sie waren ihnen ähnlich und sie erinnerten die Elvan jal'Iniai daran. Es waren gute Erinnerungen, solche an Liebe und Geborgenheit, solche an Schönheit und Vollkommenheit. Sie verdrängten in diesem Augenblick all jene, die mit Leid und Tod zu tun hatten. Larinil ließ sie nicht zu. Nicht jetzt.
Sie neigte den Kopf und erhaschte einen Blick auf ihren Vater und auf Andrar. Beide schienen, so wie sie, in Gedanken versunken. Welche mochten das sein? Erinnerte sich auch ihr Vater womöglich an die weiße Festung? Holte der Anblick der Berge Bilder in sein Gedächtnis zurück, die vergessen waren? Larinil hätte gefragt, aber sie wollte ihn nicht stören, wollte ihm seine Gedanken lassen. Auch er hatte ein wenig Frieden verdient.
Und Andrar? Eine Furche durchzog seine Stirn. Wird auch der Schwertführer aus Lysin'Gwendain eines Tages seinen Frieden finden können? Vom treuen Offizier im Heer der drei Herrscher war er zum Verräter geworden. Er hatte das, woran er sein Leben lang geglaubt hatte, abgestreift wie ein zerschlissenes Hemd. Und wofür? Für sein Gewissen, für die Wahrheit und für eine ungewisse Zukunft. Denn Sardrowain, der dunkle Meister, hätte ihn in seine Heimat, nach Lysin'Gwendain zurückbringen können. Larinil konnte das nicht, Geysbin nicht mehr. Er war in dieser Welt gefangen. Es war nicht möglich zu sagen, welche Gefühle Andrar gerade empfand. Aber es waren gewiss keine guten. Zweifel, Furcht und Zorn mochten dabei gewesen sein. Und Larinil hatte auf einmal den starken Drang, ihm zu helfen, ihm Trost zu geben und Hoffnung. Andrar war ein mutiger Krieger, einer der mutigsten, die sie kannte.
„Ich hab in den letzten Tagen für die Stiftung viele Verwandelte in Christchurch abgeholt und nach Squirrels Burrow gebracht“, sagte Agnes unvermittelt. Sie ließ ihre Stimme dabei ein wenig lustlos klingen. Bisher hatte sie noch nicht viel gesagt. Am Hafen hatte sie vor allem mit den Menschen dort in deren Sprache geredet. Agnes wirkte auf Larinil wie jemand, der genau wusste, was er tat. Ihr Blick war fest, das streng zu einem Knoten gebundene Haar unterstrich ihre Erscheinung - ebenso wie die schlichte Linie ihrer dunklen Kleidung. Sie war jemand, der stets den geraden Weg erkannte und nahm, auch wenn ein Umweg vielversprechender aussehen mochte. Larinil war aber auch nicht Agnes' Anspannung im Hafen entgangen, die sie für unerfahrene Augen fabelhaft verbergen konnte. Erst nachdem sie die Stadt verlassen und einige Zeit durch das Land gefahren waren, hatte sie sich gelöst. Jetzt sprach sie in der Sprache der Deutschen - mit einem leichten Akzent, den Larinil nicht kannte.
„Sie drei stechen aus der Masse der Spitzohren hervor, wenn ich das so sagen darf. Das könnte natürlich daran liegen, dass Sie heimlich angereist sind und ich Sie mit falschen Pässen in Empfang nehmen musste. Kein Ding. Was sein muss, muss eben sein.“
'Falsche Pässe' klang bei Agnes so, als würde sie über eine besonders unappetitliche Speise reden.
„Aber das ist es nicht nur, habe ich recht?“, fügte sie hinzu und blickte forschend in den kleinen Spiegel, der links von ihr am Autodach hing.
Larinil konnte Agnes weder Neugier noch Misstrauen übelnehmen. Sie arbeitete für die Elvan-Stiftung und sie tat es sicher, weil sie deren Ziele für gut erachtete. Dennoch: Etwas getan zu haben, das gegen die Gesetze der Menschen verstieß und sie wohl auch in eine gewisse Gefahr gebracht hatte, gefiel ihr nicht. Mehr noch: Die drei, für die sie das auf sich genommen hatte, hatten noch nicht ein Wort des Dankes und der Anerkennung an sie gerichtet. Larinil schämte sich dafür und es ärgerte sie, dass sie das erst jetzt erkannt hatte. Wenn sie in diesem Kampf bestehen wollten, dann brauchten sie Menschen wie Agnes. Dessen war sie sich bewusst. Larinil wollte ihr antworten, aber Andrar kam ihr zuvor.
„Ich bitte in aller Form um Verzeihung, Agnes. Dafür, dass wir wohl annahmen, die außergewöhnlichen Umstände unserer Reise könnten Ihnen entgehen.“ Seine Stimme klang sanft wie reinste Seide. „Und ich danke Ihnen, dass Sie diese Bürde für uns auf sich genommen haben. Offensichtlich hat unser Benehmen unter den geheimnisumwobenen Bedingungen und dem zweifelhaften Komfort dieser Reise gelitten. Dennoch ist das unverzeihlich. Und ich hoffe, dass wir sehr bald einen Weg finden werden, um uns erkenntlich zu zeigen. Im Moment führen wir leider nichts von Wert mit uns, das diesem Zweck gerecht werden könnte.“
Larinil war verwirrt - fast so sehr wie Agnes. Doch anders als offenbar sie, durchschaute die Albin die Gehaltlosigkeit solcher Worte. Die feinen Mädchen San'tweynas mochte Schwertführer Andrar damit beeindrucken, nicht aber sie. Agnes dagegen lächelte und nickte anerkennend.
„Immerhin ein Mann, der mit Worten umgehen kann. Alte Schule, aber nicht schlecht. Ich komme darauf zurück, junger Mann. Darauf können Sie schon mal den weißen Stab mit dem Riesen-Karfunkel oder eines der angeblich wertlosen Schwerter verwetten, die ich für Sie ins Land geschmuggelt habe.“
Larinil konnte ein leises Schnaufen nicht unterdrücken. Wie konnte Agnes nur auf diese plumpe Rede ansprechen? Niemand hatte Larinils Empörung zum Glück bemerkt - außer ihrem Vater, der nach ihrer Hand griff und sie leicht drückte.
„Es ist sein Weg, eine Barriere einzureißen“, sagte er leise in der Sprache der Elvan jal’Iniai. „Es ist ein kluger Weg. Mehr aber nicht.“
Geysbin lächelte dazu und Larinil fragte sich, was das zu bedeuten hatte. Glaubte er etwa, dass sie für Andrar etwas empfand? Der Junge war noch keine hundert Jahre alt und damit weit jünger als sie.
„Verehrtes Publikum. Wir haben unser Ziel jetzt erreicht“, sagte Agnes plötzlich und klang dabei bedeutend gelassener als zuvor. „Willkommen in Squirrels Burrow!“
Es gab Tage, die waren so überflüssig, wie ein Batzen Staub oder eine tropfende Nase. Viktoria hatte das Gefühl, schon zu viele dieser Tage erlebt zu haben. Ihr Konto war eigentlich voll und sie fand, dass sie ein bisschen mehr Glück verdient hatte. Am meisten tat es ihr aber für Maus leid. Der Dicke war alles andere als eine Sportskanone. Trotzdem hatte er sich - ungeachtet seiner Rippenprellung - in dieses 'Abenteuer' gestürzt, war drei Tage lang durch die Pfalz getrabt und hatte schließlich mit ihr dieses beachtliche Loch unter dem Felsen freigelegt. Jetzt standen dicke Schweißperlen auf seiner Stirn und er war so blass wie ein Stück Parmesan-Käse. Am meisten Sorgen machte Viktoria aber, dass er sogar mit seinem Genöle aufgehört hatte. Maus war fertig. Er hatte Schmerzen und war maßlos enttäuscht.
So wie auch sie. Die Spur des Albenschwertes endete in einem dunklen Loch, vollgepackt mit altem Kram: Rüstungen, Helme, einem Morgenstern, Tafeln. Auch ein Breitschwert war darunter, aber eben nicht das Schwert, das die albischen Meisterschmiede vor zwei Jahrtausenden in der weißen Festung Galandwyn geschaffen hatten. Geysbin, der Großmeister des Lichts, hatte es den drei Kelten Morcant, Domhnall und Kellen gegeben. Sie und ihre Nachfahren sollten es behalten, bis der Zauber des Großmeisters seine Wirkung entfaltete. Aber die drei Schwerter waren über die vielen Jahrhunderte verloren gegangen. Das hier war die beste Spur bisher gewesen. Und sie hatte sich als Pleite erwiesen. Nur Madame Moureau schien damit kein wirkliches Problem zu haben. Sie war auch die einzige, die nicht schwitzte - einfach deswegen, weil sie sich an der Buddelei unter dem Verweis auf ihre Statur nicht beteiligt hatte.
„Das sind faszinierende Stücke, die wir hier gefunden haben. Sie sind ein Vermögen wert.“ Ihre Augen blinzelten euphorisch.
„Kann sein. Für uns sind sie aber eher scheißegal“, brummte Viktoria. Es gab keinen Grund mehr, die Naive, Stille zu spielen.
„Aber nein. Sie sind großartig. Bitte. Seien sie nicht zu enttäuscht“, protestierte die kleine Waffenexpertin. „Es kommt oft vor, dass sich so außergewöhnliche Waffen wie das Schwert auf dem Gemälde des Ritters als Legende entpuppen. Ein Maler hatte wohl zu viel Fantasie. Aber das hier ...“ Sie zeigte auf die mit Erde überzogenen Fundstücke. „Das hier ist faszinierend. Wir müssen die Sachen rasch von hier wegbringen.“
„Einen Dreck werden wir tun“, sagte Viktoria. „Wir haben nicht das gefunden, was wir finden wollten. Das Zeug hier können wir nicht gebrauchen.“
Die Moureau sah flehend zu Maus. „Monsieur Werrn. Bitte. Was wir getan haben, war illegal. Das wissen Sie. Wir können die Fundstücke nicht hierlassen. Man wird uns auf die Schliche kommen.“
„Na gut“, flüsterte er zu Viktorias Überraschung. „Aber das kostet sie exakt das Geld, das wir Ihnen für die verkorkste Scheiß-Aktion schulden. Wir schleppen ihnen den Schrott zum Aston Martin, heizen zurück nach Straßburg. Dann sind wir quitt.“
Der Mund von Madame Moureau stand weit offen und sie vergaß zu blinzeln.
„Außerdem packen Sie gefälligst mit an!“, ergänzte Viktoria. Es tat so gut, wieder boshaft sein zu dürfen. Und sie freute sich auf Neuseeland. Was auch immer sie dort erwartete. Es konnte nur besser werden.
Squirrels Burrow, die Anlage in den Bergen Neuseelands erinnerte Larinil am Abend nach ihrer Ankunft kaum noch an Galandwyn. Die Lage in einer Senke zwischen schneebedeckten Gipfeln, schroffen Zacken, die sich in die Höhe reckten, mochte ähnlich sein. Aber Galandwyn suchte nun mal seinesgleichen - jene weiße Bergfestung, die sich so lange gegen den Ansturm der Gorgoils behauptet hatten, die der Vollkommenheit so nahe war. Jener Ort, der so lange ihr Zuhause gewesen war, hatte nichts mit Squirrels Burrow gemein. Und dennoch wirkte die Anlage für Larinil auf ihre Weise behaglich und einladend.
Es gab ein paar größere Holzhäuser am talseitigen Rand, an dem auch die Zufahrt lag. Sie boten Platz für Räume, in denen gearbeitet werden konnte und wo Gespräche stattfanden, vermutete Larinil. Denn die vielen kleinen Wohnhütten waren woanders. Sie verteilten sich über den sanft ansteigenden Hang, den die einsetzende Dämmerung gerade in ein warmes Licht tauchte. Der Anblick weckte in Larinil Gefühle der Geborgenheit und der Ruhe. Fast kam es ihr so vor, als hätte jemand die Hütten willkürlich verteilt. Als hätte er hier mal eine auf ein Stück grüne, freie Wiese gesetzt, dort mal eine inmitten von dicht wucherndem Gestrüpp, an dem wie kleine Glocken rote und orangefarbene Früchte hingen. Und eine Hütte thronte regelrecht auf einem wuchtigen Felsen und blickte hinab ins Tal. Mattweise Blumen wuchsen dazwischen dicht an dicht. Ihre Blüten waren groß und sanft gerundet. Und sie schienen sich nicht im Mindesten daran zu stören, dass sich zwischen ihnen immer mal wieder kleine grellgelbe Sterne abmühten, ebenfalls einen Platz an der Sonne zu erobern. Obwohl Larinil wusste, dass die Anlage bestenfalls Jahrzehnte alt war, kam es ihr so vor, als gehörte Squirrels Burrow seit Anbeginn der Zeit in diese urwüchsige Landschaft. Ein Grund dafür war wohl, dass auf den steilen Giebeldächern der Holzhütten sattgrünes Gras wuchs und dass die Dachseiten beinahe bis an den Boden reichten. Larinil hatte sich anfangs gefragt, ob der Rest der Hütten womöglich unter der Erde verborgen war. Aber so war es nicht. Es gab nur eine Ebene, in der auf kleinem Raum Schlafzimmer, Bad und eine kleine Küche untergebracht waren. Eine sicher bescheidene Unterbringung. Dennoch hatte Larinil nicht das Gefühl, eingeengt zu sein. Denn die Fenster waren ungewöhnlich groß und beinahe jedes offenbarte bei Tag einen Blick auf sattgrüne Wälder, grauweise Gipfel oder das Farbenspiel blühender Wiesen. Hier zu wohnen, gab Larinil ein Gefühl der Freiheit, wie sie es lange nicht verspürt hatte.
Natürlich entging der Kaijadan-Meisterin aber nicht, dass Squirrels Burrow daneben ein Ort war, der gut verteidigt werden konnte. Es war schwer, sich ihm unbemerkt zu nähern, denn es gab nur einen echten Zugang - jedenfalls, wenn man nicht vorhatte, über steile Wände und abschüssige Geröllhänge zu klettern. Außerdem umschloss ein hoher Zaun aus festem Metall die Anlage vollständig. Er sah neu aus. An mehreren Stellen arbeiteten Menschen. Sie befestigten Drähte, die mit messerscharfen, kleinen Klingen bestückt waren. Oder sie montierten technische Geräte, deren Zweck Larinil nicht genau kannte. Sie dienten offenbar der Überwachung, nahmen wahr, wenn sich jemand näherte, und gaben dann Alarm. Jedenfalls war sich Larinil sicher, dass Maus diese Geräte mögen würde. Er liebte solche Dinge. Und er konnte gut mit ihnen umgehen. Maus, Natalie und Ben würden dafür sorgen, dass es hier so sicher war, wie nur irgendwie möglich. Squirrels Burrow war zwar keine Festung, so wie Galandwyn. Aber dieser Ort schenkte Larinil Zuversicht und Hoffnung. Von hier aus würden sie den Kampf in diesem sinnlosen Krieg neu aufnehmen.
Agnes hatte ihnen bei ihrer Ankunft erzählt, dass Ben Hartzberg die Anlage von seiner Mutter geerbt hatte. Abseits von den Unternehmungen der Hartzbergs hatte sie versucht, dort einen Ort der Erholung aufzubauen. Doch bevor sich der Erfolg einstellen konnte, hatten sich sie und Bens Vater selbst getötet. Squirrels Burrow lag daraufhin brach. Larinil erinnerte sich, was sie über Ben erfahren hatte. Vor seiner Verwandlung in einen Alben hatte er der Welt den Rücken zugekehrt, hatte ein Leben ohne Hoffnung und Freunde geführt. Vermutlich war ihm lange gar nicht klar gewesen, welchen Schatz er da besaß.
Er war in jenen Tagen noch ein Mensch gewesen, einer, der nicht ahnte, welche Macht in ihm schlief. Larinil lächelte bei dem Gedanken an Ben. Er weckte ein Gefühl der Wärme in ihr. Die Elvan jal’Iniai hatte lange darüber nachgedacht, was es war, das dies in ihr auslöste. Liebte sie ihn? Aber ja. Allerdings war es nicht die Art von Liebe, die sie einmal für den Keltenhäuptling Kellen empfunden hatte. Bei Ben war es mehr ein Gefühl tiefer Verbundenheit. Das Licht war so stark in ihm wie bei ihr. Stärker noch. Aber das allein war es nicht. Und Larinil ahnte, woran das lag. Sie wusste es.
„Der Mond in dieser Welt erscheint mir kleiner. Und er ist blasser als der in Lysin'Gwendain.“
Andrar war zu ihr getreten. Sie stand abseits der Hütten, im oberen Teil der Anlage, hatte ihre Gedanken schweifen lassen, den Frieden der Natur in sich aufgenommen. Sie hatte die Einsamkeit gesucht. Andrar war leise herangeschlichen. Er hatte Steine und herumliegende Zweige geschickt gemieden. Aber Larinil hatte ihn natürlich dennoch bemerkt. Seine Schritte mochten die eines ausgebildeten Soldaten sein. Doch es waren bei weitem nicht die eines erfahrenen Kriegers.
Die Elvan jal’Iniai drehte sich nicht zu ihm um. Ihr Blick ruhte tatsächlich auf der fahlen, silbernen Scheibe, die einsam am Firmament hing. Die Sonne war hinter den Bergen abgetaucht, warf ihr rötliches Licht nur noch auf einige der umliegenden Gipfel. Schnell wurde es dunkler, aber noch war es zu hell, als dass das Licht der Sterne hätte durchbrechen können.
„Ich bitte um Verzeihung, Kaijadan-Meisterin“, sagte Andrars weiche Stimme. “Es steht mir nicht zu, eure Ruhe zu stören.“
Er wollte gehen. Sanft legte Larinil ihre Hand an seinen Oberarm, hielt ihn zurück. Sie wollte, dass er blieb. Er störte sie nicht. Es fühlte sich richtig an.
„Mehr als einmal habe ich mich gefragt, ob es in beiden Welten der gleiche Mond ist“, sagte sie leise. „Ist das möglich, Andrar?“
Er ließ sich Zeit mit seiner Antwort. Er gehörte nicht zu denen, die leichtfertig etwas sagten. Er wählte seine Worte klug, auch diesmal.
„Er ist schön. In dieser und in der anderen Welt. Ob es der gleiche ist, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht sollten wir das die Menschen fragen. Sie haben den Mond betreten, heißt es.“
Larinil lächelte. „Unglaublich. Ja. Er ist so weit weg! Und hast du all die Krater und Furchen gesehen, die seine Oberfläche zerschneiden? Es gehört viel Mut und Entschlossenheit dazu, festen Boden zu verlassen, um sich auf eine so gefährliche und ungewisse Reise einzulassen.“
Sie sah ihn an und er erwiderte ihren Blick - ernst, aber voller Wärme. Zu ihrer Überraschung fiel es ihr schwer, in seinem Gesicht zu lesen. Da waren kein Zorn, keine Traurigkeit, keine Mutlosigkeit. Nichts von dem, was sie erwartet hatte. Andrar schien ihr stattdessen voller Zuversicht zu sein, voller Tatendurst sogar, als habe er die Akademie San’tweynas eben erst als junger Offizier verlassen. Er war wie diese Menschen, die auf den Mond geflogen waren. Und mit einem Mal war ihr klar, dass Andrar nicht zu ihr gekommen war, weil er Trost suchte. Konnte das wirklich sein? Wie dreist, ging es Larinil durch den Kopf. Wie unverschämt! Sie musste lächeln, drehte ihr Gesicht wieder dem Mond zu, einen Augenblick zu spät.
Er kam ihr näher, nah genug, dass sie die Wärme seines Körpers spüren konnte. Der junge Soldat spielte mit seinem Leben, dachte Larinil und kämpfte weiter vergeblich gegen dieses Lächeln an. Was erwartete er von ihr? Sie war 2000 Jahre vor ihm auf die Welt gekommen. Sie hätte seine Ahnin sein können. Aber so alt fühlte sie sich nicht, nicht in diesem Moment. Ihr Körper war in der Zeit des Schlafens im tiefen Fels nicht gealtert. Noch immer sah sie aus wie eine Elvan jal’Iniai von wenigen hundert Jahren. So wie damals, als sie und Kellen … Ihr Lächeln verschwand mit einem leisen Seufzen.
„Ich fürchte, die Menschen werden uns eine Antwort schuldig bleiben, Andrar“, sagte sie bitter. „Obwohl sie so viel wissen, obwohl sie all diese lärmenden Maschinen bauen können: Von Lysin'Gwendain ahnen sie nichts. Und nichts von dem, was auf sie zukommt.“
Andrar schwieg. Sicher, weil das Gespräch die Leichtigkeit verloren hatte, die er sich gewünscht hatte. Sie spürte, dass er einen Schritt zurücktrat und ein Teil von ihr bedauerte das.
Sie wandte sich ihm wieder zu. Was sollte sie nur sagen? Er hatte es nicht verdient, zurückgewiesen zu werden.
„Du bist ein mutiger Krieger, Andrar. Und ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben.“
Die aufmunternde Parole der Heerführerin, die sie einmal war! War das wirklich alles, was ihr einfiel? Sie hätte ihm wohl auch einen Schlag ins Gesicht versetzen können.
Andrar senkte die Augen, deutete eine Verbeugung an. Er war verletzt, bemühte sich aber beinahe erfolgreich, nichts davon zu zeigen.
„Ich danke euch, Meisterin des Lichts“, sagte er demütig. Dann sah er ihr wieder in die Augen. Erkannte er ihre Unsicherheit? Ihr Bedauern? Ein keckes Lächeln huschte plötzlich über sein Gesicht. War sie so leicht zu durchschauen?
„Nun, Larinil. Der Mond wird auf uns warten. Beide Monde, wenn es denn so ist. Aber wie wird es nun mit uns weitergehen? Was wird geschehen?“
Sie erschrak über so viel Direktheit. Meinte er mit 'uns' etwa sie und ihn? Larinil war sich auf einmal nicht mehr sicher.
„Du redest davon, mit welcher Taktik wir unseren Feinden die Stirn bieten wollen?“, fragte sie.
Andrar nickte. Sein Grinsen verriet ihr allerdings, dass er die Zweifel genoss, die er mit der Uneindeutigkeit seiner Frage bei ihr bewirkt hatte.
„Natürlich. Es sei denn, es gibt noch andere Schlachten zu schlagen, von denen ich nichts weiß.“
Diese freche Hochnäsigkeit! Larinil lächelte. Sie würde viel Spaß mit Andrar haben, wenn es an die ersten gemeinsamen Schwertübungen mit ihm ging. Sie freute sich auf das Gesicht, das Andrar an seinem ersten Tag im Goyl jal’Kaijadan, dem Pfad des Schwertes, machen würde. Sie hatte vor, einen neuen zu konstruieren. Hier war Platz dafür. Hier waren die Zeit und der Ort für einen neuen Übungsparcours, einer, der den von Galandwyn womöglich an Tücke noch übertreffen sollte.
„Du willst also wissen, wie wir unseren Feinden begegnen werden? Nun, wir werden diesmal nicht auf sie warten. Wir werden sie schmerzvoll treffen. Maus würde es wohl so ausdrücken: Wir treten den Mistkerlen jetzt gehörig in den Arsch!“
Andrar zog überrascht die Augenbrauen hoch. „Was für eine ungebührliche Wortwahl für eine Meisterin des Lichts!“ Dann lachte er laut auf. „Die Idee allerdings gefällt mir.“
„Du bist so still. Stimmt etwas nicht?“, sagte Natalie und ließ sich in den orangefarbenen Plastiksitz neben Ben sinken. Sie hatte Hunger bekommen und einen Schokoriegel gekauft. Ben wollte nichts. Er hatte zwar in den letzten Tagen genauso wenig gegessen wie sie. Aber anders als sie war er ein Albe. Er musste deutlich weniger essen, trinken und schlafen. Die Strapazen der letzten Zeit hatten ihm körperlich weit weniger zugesetzt als ihr. Eigentlich hätte sie ihn dafür beneiden müssen. Aber natürlich wusste sie, dass dafür ganz andere Dinge auf ihm lasteten. Sein Leben hatte sich in den vergangenen Monaten so grundlegend gewandelt, wie es überhaupt nur möglich war. Und zuletzt hatten sie wochenlang mit den Behörden auf der Insel herumgekämpft, hatten Berichte, Formulare ausgefüllt, Erklärungen abgegeben, Bußgelder bezahlt - ja sogar einmal Bestechungsgeld, als sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten. Die Beamten wollten sie zwar, so schnell es ging, loshaben. Allerdings kamen auch sie nicht darum herum, eine sinnvolle Erklärung für das, was passiert war, in ihre Akten zu schreiben. Eine Gruppe hochgerüsteter Profi-Killer hatte immerhin das Gebäude der Stiftung angegriffen, inmitten eines rätselhaften Sturms, der ebenso schnell gekommen war, wie er wieder verschwand. Und am Ende gab es ein halbzerstörtes Gebäude mit Toten darin - einige hatten üble Brandverletzungen, andere tiefe Schnittwunden. Das war harter Tobak. Aber schließlich hatten sie es aufgegeben und die Verwandelten ziehen lassen. Alle hatten die Insel bereits verlassen. Ben und sie waren die Nachhut. Der Besitz auf Madeira musste noch verkauft, ihre neue Basis in Neuseeland organisiert und ein Ticket dorthin gebucht werden - via Kapstadt.
Denn Europa war für Alben zurzeit alles andere als ein Spaß. Die Anfeindungen und Übergriffe hatten zugenommen und sie waren immer besser koordiniert. Behörden und Regierungen gingen nur halbherzig dagegen vor. Im Gegenteil. Sie heizten die Hetze noch an, indem sie eine Meldepflicht für Alben erließen oder ihnen verboten, ihre Augen und Ohren zu verstecken. Für Natalie hatte das nichts, aber auch gar nichts mehr mit freiheitlichen Grundprinzipien zu tun. Aber den Menschen war das egal. Sie fürchteten und verachteten die Alben, die so plötzlich in ihre Welt gekommen waren.
„Es geht mir gut, Natalie. Danke“, sagte Ben. Er klang müde, obwohl er das eigentlich nicht war.
Natalie legte sanft ihre Hand auf seinen Oberschenkel. „Lügner. Was ist los? Flugangst?“
Er lächelte kurz. „Das wäre immerhin eines der wenigen Probleme, die mit Alkohol zu lösen wären.“
„Kein Problem ist mit Alkohol zu lösen!“, antwortete sie. „Schon gar nicht, wenn man ein Albe ist. Ihr müsstet schon einen ganzen Weinkeller leer saufen, um irgendetwas zu spüren.“
Er schenkte ihr einen amüsierten Blick. Den ersten seit Tagen. „Ein verlockender Gedanke.“
„Also, was bedrückt dich?“
Ben zeigte auf die andere Seite des breiten Ganges, der die Abflughalle des Flughafens von Funchal trennte. Dort, auf einer Plastiksitzreihe, hatte sich eine Touristenfamilie niedergelassen: ein bierbauchiger, nervös dreinblickender Mann mit zu großem „Miami-Beach“-T-Shirt, kurzer Hose und Sandalen, zu denen er weiße Socken trug. Sein linker Fuß wippte aufgeregt auf und ab. Die Frau hatte sich in ein wallendes, buntes Kleid gehüllt und kam sich mit rot gefärbten Haaren und der übergroßen Sonnenbrille offenbar überaus mondän vor. Ein etwa fünfjähriges Mädchen daddelte teilnahmslos auf dem Smartphone vor sich hin. Ihr Bruder, der offenbar ein paar Jahre älter war, kniete auf der Sitzfläche und redete energisch auf seinen Vater ein. Sein ehemals gelbes T-Shirt war über und über mit Ketchup bekleckert. Natalie konnte nicht verstehen, worüber sich die Leute unterhielten. Ihr war aber klar, dass es Ben mit seinen albischen Ohren vermutlich anders ging.
„Du erinnerst dich sicher, dass ich beim Einchecken meine Mütze und die Sonnenbrille abnehmen musste“, erklärte Ben.
„Verstehe. Sie haben gesehen, dass du ein Albe bist.“
Ben nickte. „Der Kleine hat vorher noch nie einen von uns gesehen und kann sich deshalb jetzt kaum mehr beruhigen.“
Natalie sah, dass der Junge mehrfach aufgeregt zu ihnen hinübersah. Der Vater dagegen versuchte krampfhaft, genau das nicht zu tun.
„Vermutlich nicht gerade ein Albenfan - deiner Laune nach zu urteilen.“
„Nicht wirklich. Der Kleine hat seinen Vater gefragt, ob wir im selben Flugzeug sitzen und ob das überhaupt erlaubt sei, dass Mutanten fliegen dürfen.“
„Ach je“, stöhnte Natalie. Sie wollte Ben raten, einfach nicht mehr hinzuhören. Aber sie wusste, dass er das nicht tun konnte. Den wachsenden Hass auf die Alben sah er als ein Problem an, dem sie sich stellen mussten, eines, dass sie bekämpfen mussten. Und ihr ging es genau genommen nicht viel anders. Es hatte keinen Sinn, es zu ignorieren.
„Der Vater meint, dass man uns Alben alle einsperren müsste, wenn es nach ihm ginge. Er glaubt, dass die Politiker Angst vor uns haben, sonst hätten sie das schon längst getan. Und er fragt sich gerade, ob er mich anzeigen solle, weil ich meine Mütze und die Brille wieder aufhabe. Wenn ich nicht so furchtbar vernünftig wäre, würde ich zu ihm rübergehen und die Sache mit ihm durchdiskutieren - von Albe zu Mensch.“
Natalie grinste. „Ein verlockender Gedanke. Aber vermutlich keiner, der uns hilft, hier so reibungslos wie möglich wegzukommen. Außerdem hat er da leider Pech. In Portugal gilt das Vermummungsverbot für Alben nicht - noch nicht.“
Ben schob die Brille mit aller Gelassenheit ein Stück weit die Nase hinab und blickte mit seinen strahlend hellen Albenaugen über den Brillenrand hinweg zu der Familie. Der Vater fuhr wie vom Blitz getroffen zusammen, spreiselte von seinem Sitz auf und wies seine Familie wild gestikulierend an, den Platz zu wechseln. Die vier ließen sich schließlich eine Reihe weiter auf einer ihnen abgewandten Sitzreihe nieder.
„Ich bin beeindruckt“, sagte Natalie. „Die magische Kraft des Lichts!“
„Eher die magische Kraft der Angst und der Dummheit. Ist eine weit verbreitete und ziemlich gefährliche Kombination.“
Natalie seufzte. Wie recht Ben damit hatte.
„Ich hoffe, Neuseeland macht mehr Laune. Die Leute dort weigern sich bisher standhaft, euch zu hassen. Vermutlich seid ihr ihren geliebten Tolkien-Elben dafür zu ähnlich.“
„Oder sie brauchen uns als Attraktion für ihren Mittelerde-Freizeitpark. Unter anderen Umständen wäre das ein Job mit Zukunft. So oder so: Ich bin jedenfalls froh, dass es außer Island und der Antarktis noch einen Ort gibt, wo wir unsere Spitzohren mit Stolz tragen dürfen.“
Natalie nickte.
„Ich bin sicher, wir werden uns dort wohlfühlen. Maus und Viktoria sind gestern dort angekommen und finden es - ich zitiere - ‚endgeil‘. Sogar Larinil hat sich in Squirrels Burrow verliebt. Sie klang am Telefon erfrischend ausgeglichen. Und fast schon wieder ein bisschen kämpferisch. Ich hätte gedacht, die Nachricht, dass Viktoria und Maus mit dem Schwert Pech hatten, würde sie mehr mitnehmen.“
Die scheppernde Stimme der Flughafendurchsage unterbrach sie und rief mit leiernder Lustlosigkeit ihren Flug auf. Sie nahmen ihre Sachen und standen auf. Natalie sah die Erleichterung in den Gesichtern der Touristenfamilie, als diese das bemerkte. Der böse Mutant würde also in ein anderes Flugzeug steigen und dort sein Unwesen treiben. Blödes Volk, dachte Natalie. Gefährliches Volk!
Maus‘ Logbuch der Rache, Tag 1
Der erste Schritt ist getan. Ich habe einen passenden Namen für dieses geheime Tagebuch gefunden. Immerhin ein Anfang. Und ich bin fest entschlossen, es weiter zu führen und mit Inhalten anzufüttern, die dem hochtrabenden Namen gerecht werden. Denn, verdammte Axt, ich will Rache. Die Drecksäcke haben uns zweimal im Chiemgau angegriffen, fast in Stücke geschossen und gesprengt. Und dann diese hinterhältige Sauerei von Kampfmutant Hensson, der uns vom Straßburger Münster werfen wollte. Okay, wir leben noch. Glück gehabt. Scheiße. Ein paar Blessuren und ne Menge Albträume. Aber irgendwann muss damit Schluss sein. Ich habe keinen Bock mehr, Zielscheibe zu spielen. Und noch weniger mag ich, wenn jemand versucht, meiner Viktoria etwas anzutun, dem schönsten, liebenswertesten und verdammt noch mal wertvollsten Menschen diesseits und jenseits des Rio Grande. Aber ich will nicht unheroisch klingen. Ich habe dieses Tagebuch und überhaupt mein ganzes Leben der Rache verschrieben. Kampfmutanten halten mich dabei ebenso wenig auf wie Rückschläge. Ich kämpfe mit meinen Waffen und ja, ziehe es durch. Ich schwör’s. Um den Druck zu erhöhen, gelobe ich hiermit feierlich, auf Chips und Currywurst zu verzichten, bis das Ding erledigt ist. Mist, jetzt ist es raus.
Das Übel, dem ich mich voller Inbrunst stellen werde, hat einen Namen: Pieter van den Berg. Milliardenschwerer Investor mit Sitz in London. Und außerdem Verbündeter der Herrscher Lysin’Gwendains hier in der Welt der Menschen. Larinil hat uns kürzlich mit dem Verdacht geschockt, dass van den Berg ähnlich viele Lenze auf dem Buckel haben muss wie sie. Sie glaubt, in ihm den Druidenhäuptling Bram erkannt zu haben. In der Zeit der Kelten hat der mit den albischen Gegnern Geysbins und Larinils gemeinsame Sache gemacht und ein ganzes Heer aus menschlich-tierischen Hybrid-Monstern, Gorgoils, für sie gezüchtet. Das Heer hat damals die weiße Festung Galandwyn angegriffen - mit freundlicher Unterstützung von ein paar tausend fliegenden Feuerfressern (Albisch: Pandrai). Die Alben Galandwyns konnten sie abwehren. Bram allerdings erwischten sie nie. Mit ein bisschen Optimismus sind sie wohl davon ausgegangen, dass er nach der üblichen menschlichen Lebensspanne über die Wupper gegangen sein sollte. Ist er aber wohl nicht. Denn Larinil könnte tatsächlich recht haben.
Ich habe das recherchiert. Details erspare ich dem geneigten Leser meines Logbuchs der Rache. Ich nenne nur zwei Stichworte: Gesichtserkennung und Spurenlesen. Das erste erklärt sich eigentlich von selbst. Jeder Mensch hat ein Gesicht, das es wie einen Fingerabdruck nur einmal gibt. Abstand der Augen, Länge der Nase, Wölbung der Stirn, Form des Mundes und so weiter. Ich nehme die Parameter von Pieter van den Bergs Hackfresse und lasse sie durchs Netz laufen (und durch ein paar feine historische Datenbanken, auf die ich eigentlich keinen Zugriff haben dürfte). „Spurenlesen“ ist einen Ticken komplizierter: Ich folge der Spur seines Imperiums. Van den Berg hat die Braxton Holding von seinem Mentor William Braxton III. geerbt. Der wiederum hatte in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Metallfabrik in Liverpool und einen Kunsthandel in Brügge von einem Belgier namens Fred Laurée übernommen. Und so weiter. Drei Namen, aber ein und dasselbe Gesicht. Die wenigen Fotos, die es von van den Berg, Braxton und Laurée gibt, kommen zwar aus völlig unterschiedlichen Zeiten und zeigen Männer verschiedenen Alters. Trotzdem: Die Parameter stimmen immer verblüffend genau überein - bis hin zu einer Narbe auf der Stirn. Und jetzt kommt der Hammer: Ich habe außerdem das Porträt eines britischen Freibeuters aus dem 16. Jahrhundert gefunden, das sich ebenfalls bestens einreiht. Die gleichen Züge, die gleiche Narbe. Der Maler muss dankenswerterweise ein Faible fürs Detail gehabt haben.
Kurz gesagt: Bram schafft es wohl irgendwie, den Zahn der Zeit auszuschmieren und immer wieder gerne als Jungspund aufzukreuzen. Wie er das macht? Keine Ahnung. Vermutlich haben die Alben der Anderswelt Lysin’Gwendain ihre Hände im Spiel. Es wird ihm so oder so nicht helfen, wenn er - Achtung: Pathos - den kalten Atem meiner Rache zu spüren bekommen wird. Ich habe eine Idee. Ich werde ihn da treffen, wo es richtig wehtut. An einer Stelle, die er so gar nicht auf dem Radar hat.
Der Sänftensklave
Timo blieb liegen. Es war gegen jede Vernunft, aber er konnte einfach nicht mehr. Nein, er wollte nicht mehr. Es tat nämlich ziemlich gut, einfach am Boden zu bleiben und in den wolkenlosen Himmel zu blicken. So, als könnte man die Welt damit einen Moment lang einfrieren und diesen ganzen Schwachsinn stoppen. Außerdem fühlte sich die Regenpfütze unter seinem Rücken gut an. Sie kühlte die Striemen und die Prellungen, die ihm Nallundor mit seinem Stock am Tag davor verpasst hatte. Und auch die von der Woche davor, die gerade dabei waren zu verheilen. Die Sonne wärmte sein Gesicht. Ihr Licht war rötlicher als das der Sonne aus seiner Welt. Aber es funktionierte genauso gut. Es gab Timo Kraft. Die Strahlen prickelten angenehm auf der Haut - ein bisschen wie ein frisch eingelassenes Schaumbad. Ihre Energie drang in ihn ein und machte, dass er sich wenigstens ein klein wenig wohler fühlte. Timo lächelte - auch dann noch, als ihm jemand den Fuß in die Seite rammte.
„Shoywa, Bassai. Shoywa!“, brüllte der Albe. Lange, hellrote Haare umrahmten sein knochiges Gesicht. Die Augen waren größer als bei anderen Spitzohren. Und bedeutend bösartiger. Sie erinnerten ein bisschen an die eines Rieseninsektes. Der Antreiber war ein Sklave - wie Timo. Aber er gehörte zu der Sorte, die dem feisten Nallundor voll und ganz ergeben waren. Ein Speichellecker, einer, der für ein bisschen Macht und ein paar Privilegien seinen Stolz verkauft hatte. „Shoywa!“, brüllte er noch einmal und hob drohend den Stock. Timo bemerkte einen Schweißfleck unter der Achsel seines ansonsten klinisch reinen, grauen Hemdes. Ein Makel, freute er sich. Diese Alben schwitzten normalerweise nicht. Jedenfalls diejenigen, die nicht wie Timo als Menschen auf die Welt gekommen waren und sich später verwandelt hatten. Und ihre Klamotten sahen immer so aus, als kämen sie geradewegs aus der Premium-Reinigung. Keine Falten, jeglicher Schmutz - Blut ausgenommen - perlte ab wie von einer superglatten Lackschicht. Auch das dreckige Pfützenwasser, das seinen Rücken gerade so schön kühlte, würde Timo schnell wieder los haben. Seine viel zu weite graue Hose und sein ebenso graues Schlabber-Hemd waren an Fadheit kaum zu toppen. Aber sie waren aus dem gleichen raffinierten Material wie die Kleider aller Alben hier in der Anderswelt. Eigentlich schade. Dreck wäre immerhin etwas, das ihn von diesen Mistkerlen hier unterscheiden würde.
Die Anderswelt! Sie hatte ihn fasziniert, als er sie noch nicht kannte. Damals auf Madeira hatte er sich gewünscht, hierher zu kommen. Hierher, in diese sagenhafte Welt fernab von allem, was für normale Menschen erreichbar war. Eine geheimnisvolle E-Mail hatte ihn vor einiger Zeit dazu aufgefordert, sich den Alben dieser Stadt anzuschließen. Der Gedanke an ein Reich, in dem Spitzohren wie er das Sagen hatten, war verlockend. Ein Ort, an dem ihn keiner als Freak beschimpfte oder ihn umbringen wollte, an dem man ihm mit Respekt begegnete. Eine idiotische Idee, wie er inzwischen wusste. So grandios und überirdisch diese Stadt auch wirkte, Timo war hier wieder nur ein Gefangener. Schlimmer noch: Ein Sklave für die niedersten Drecksarbeiten, die es zu verrichten gab. Ein Nichts. Er hätte es wissen müssen. Timos Leben war und blieb das eines Verlierers.
Der Schlag traf ihn an der linken Schulter. Ein weiterer blauer Fleck auf der Landkarte seines lädierten Körpers, mehr nicht. Der rothaarige Antreiber hatte nicht mit voller Wucht zugeschlagen. Er wollte zwar, dass Timo endlich wieder aufstand. Aber er hatte ganz sicher auch Angst, dass diese hässliche kleine Angelegenheit zu groß werden könnte. Timo wusste inzwischen, dass Nallundor in der Öffentlichkeit nicht gerne als der brutale, feige Drecksack dastehen wollte, der er war. Deshalb schlug er im Freien weniger hemmungslos zu. Und seinen Antreibern war das ebenso wenig erlaubt.
„Shoywa!“ Diesmal klang der Befehl des Rothaarigen fast schon ein bisschen flehend. Wie erbärmlich er aussah. Die Augen flatterten, wanderten unruhig zwischen Timo und dem Portal des Gebäudes hin und her. Der Antreiber hatte jetzt richtig Angst. Gut so. Für einen niederen Sklaven, den er in der Öffentlichkeit nicht im Griff hatte, würde er von seinem Herren bestraft werden. Ein paar Fußgänger sahen bereits interessiert zu ihnen hinüber. Zwei junge Alben grinsten sogar unverhohlen. Das könnte interessant werden.
Nallundor würde nicht mehr lange brauchen. Timo und die andere Trägersklaven - drei stumpf dreinblickende Kerle, die mit Dingen wie Träumen oder eigenen Bedürfnissen längst abgeschlossen hatten - hatten den fetten Sack in seiner Sänfte vor ein paar Stunden am Badetempel abgesetzt. Ob der prächtige silberne Bau wirklich ein Badetempel war, wusste Timo natürlich nicht wirklich. Aber es sah ganz danach aus. Denn: Immer wenn Nallundor ihn verließ, dann hatte er einen penetrant-süßlichen Duft an sich und nicht mehr, wie meistens, den nach Öl und Gebratenem. Ekelhaft war natürlich auch diese weibische Note, gegenüber dem Normalzustand aber war sie ein Gewinn. Keine Frage: Der Kotzbrocken mit den rosigen Bäckchen ließ sich im Badetempel aufpimpen, war hinterher sauberer als vorher. Meist tat er das, wenn er etwas vorhatte oder Besuch anstand. Immer dann also, wenn es etwas gab, das noch wichtiger war als die ständigen Fressorgien und Exzesse, mit denen Nallundor sein dekadentes Leben sonst so verbrachte. Aber auch in diesem Zustand war er kilometerweit von dem überstrahlten Bild entfernt, das Timo Hemander bisher von den „echten“ Alben gehabt hatte. Trotz seines fehlenden Gedächtnisses verkörperte für ihn der alte Geysbin die Erhabenheit und Weisheit von Jahrhunderten. Und noch nie hatte Timo jemanden gesehen, der sich graziler und dabei so kraftvoll bewegen konnte wie Larinil. Timo wurde erst jetzt klar, dass es die beiden waren, die er in den Wochen bei der Elvan-Stiftung auf Madeira als Prototyp eines Alben vor Augen gehabt hatte. Sie waren die Vorbilder seines neuen Lebens als Spitzohr gewesen. Nur: Er hatte es nicht wahrhaben wollen. Stattdessen hatte er weiter mit seinem Schicksal gehadert, hatte seinem menschlichen Leben nachgetrauert und gleichzeitig davon geträumt, als Super-Rächer all denen in den Arsch zu treten, die ihm einmal Böses gewollt hatten. Wie saublöd er doch war!