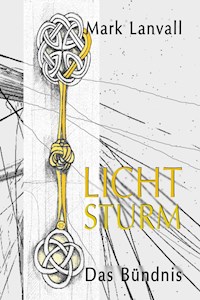Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lichtsturm
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Kellen hätte tot sein müssen. Das Schwert eines feindlichen Keltenkriegers hat seine Brust durchbohrt. Aber er lebt und wacht in einer Festung auf - geheilt durch die Kraft einer schönen, aber rätselhaften Frau. Schon bald muss Kellen entscheiden, welchen Platz er im brutalen Spiel uralter Mächte einnimmt. Bens Leben ist ein Desaster. Er wohnt auf dem Campingplatz, schrubbt Duschräume und verschwendet seine Zeit mit den schrägen Aktionen einer Gruppe Computer-Nerds. Sein verkorkstes Leben endet, als Ben aufhört, ein Mensch zu sein. Gejagt von einem Unbekannten macht er sich auf die Suche nach Antworten. Zwei Jahrtausende trennen die beiden Männer. Verbunden sind sie durch einen Zauber, der sie tief in den Überlebenskampf eines geheimnisvollen Lichtvolks verstrickt. "Lichtsturm - Die weiße Festung" war 2016 für den "Indie Autor Preis" nominiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Lanvall
Lichtsturm
Die weiße Festung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Im Land der Freien
Verfolgt
Die Zuflucht
Erwachen
Himmelsbarken
Blutprobe
Die Macht des Steins
Motorräder
Die Buche
Die Patientin
Gorgoils und Pandrai
Das ganze Bild
Das verborgene Heiligtum
Begegnung
Schwarze Wolken
Bomben
Das dunkle Heer
Die Ruine
Abschied
Die Zusammenkunft
Leseprobe aus Lichtsturm II:
Impressum neobooks
Im Land der Freien
Kellen konnte die Bedrohung spüren. Wie schwerer Nebel lag sie über dem Waldland, verlieh dem tiefen Meer aus dicht gewachsenen Bäumen eine angsteinflößende Düsternis. Nur hier und da streute die untergehende Sonne Nuancen von Rot in das satte Grün der Nadeln und Blätter. Zu wenig allerdings, um dem Häuptling das klamme Gefühl zu nehmen, das sich in seinem Herzen so plötzlich eingenistet hatte.
Da war nichts, versuchte sich Kellen einzureden. Bei den Göttern! Vielleicht war er einfach nur zu lange schon unterwegs, in dieser menschenverlassenen Wildnis. Vielleicht hatte der endlose Ritt auf schmalen Pfaden zwischen Dickicht und turmhohen Bäumen seine Spuren hinterlassen, ließ ihn Gefahren sehen, die es gar nicht gab. Kellen überlegte kurz, wie viele Tage es nun schon her war, dass er mit Fürst Morcant, den beiden Reiterkriegern und dem vorlauten Druidenschüler aufgebrochen war. Zehn? Oder waren es etwa doch schon elf?
Kellen atmete tief ein, ließ die kühle Luft im Innern seines Körpers ihre Wirkung tun. Dann, ganz langsam, ließ er sie wieder entweichen. Kellens Muskeln lockerten sich etwas. Er ließ sich auf den kühlen Felsboden sinken, legte das Schwert dicht neben sich und lauschte wachsam in den Wald hinein. Die Grillen zirpten an diesem Abend anders als sonst, da war er sich sicher. Ihr Kratzen war kurz, riss immer wieder schroff ab. Der Klang war hell, wirkte beinahe ängstlich. Nein, er täuschte sich nicht. Etwas stimmte hier nicht. Kellen wusste den Klang der Grillen zu deuten. Er hatte das schon als kleiner Junge gelernt.
Für einen Moment ließ er zu, dass seine Gedanken abschweiften, zurück in jene Tage seiner Kindheit, als er versucht hatte, das Geheimnis dieser rätselhaften Tierchen zu lüften. Wie war es ihnen nur möglich, diese durchdringenden Geräusche zustande zu bringen, so klein, wie sie waren?
„Das ist nun mal das Werk der Götter“, hatte ihm damals seine Mutter erklärt - an einem dieser Sommerabende, an denen das Zirpen ein ruhiges Gespräch fast unmöglich gemacht hatte. „Entweder du glaubst daran“, sagte sie mit einem warmen Lächeln. „Oder du wirst es wohl herausfinden müssen.“
Der kleine Kellen nahm sich daraufhin eine Grille vor, tötete und zerteilte sie, hoffte, so etwas wie eine Rassel zu finden oder ein Waschbrett, über das die Grille ihre Beine schabte. Aber er fand nichts davon. Dabei wäre es gut gewesen, wenn er das Rätsel damals hätte lösen können! Es hätte immerhin den Spott erträglicher gemacht.
„Kellen, der Grillentöter. Allein der Name reicht, damit Feinde weiß im Gesicht werden, ihre Hose nass machen und davonrennen, so schnell sie können“.
Die anderen Jungen lachten lauthals über die bissigen Sprüche seines Vetters Breac. Seine Grobheiten unterhielten sie weit besser als die dürftigen Erkenntnisse des kleinen Kellen, der in ihren Augen so gar nichts tat, um wie ein Mann zu sein. Breac war gut darin, Grobheiten auszuteilen. Außerdem bewunderten die Jungen ihn, weil er stark und geschickt war. Schon im Alter von drei Jahren hatte ihn sein Vater im Schwertkampf unterrichtet. Mit fünf war er besser als die anderen Jungen im Dorf, mit 14 konnte er es sogar mit einigen der großen Krieger aufnehmen. Schon wenige Jahre später zog er in die Schlacht und kam gleich mit zwei abgeschlagenen Köpfen wieder zurück. Voller Stolz nagelte Breac sie über die Pforte seines Elternhauses.
„Das ist ein Krieger, wie es keinen Zweiten im Volk der Kelten gibt“, rief damals sein Vater und fachte die Begeisterung der Dorfbewohner mit einem gebratenen Wildschwein und einem Fass Honigbier an. Breac war fortan ein Held - eben auch deshalb, weil Helden viele Gründe zum Feiern boten.
Mit 18 aber traf Breac bei einem Scharmützel im Norden auf einen Krieger, der es mit ihm aufnehmen konnte. Er verlor gegen ihn und von diesem Tag an schmückte sein Schädel das Haus eines anderen Helden in einem anderen Dorf.
Kellen empfand keine Genugtuung darüber. Doch Breacs Spott, den er sich stets so zu Herzen genommen hatte, verlor damit alle Bedeutung. Das ruhmlose Ende seines Vetters war so völlig ohne Sinn. Er war im Kampf um ein karges Stück Flussufer gestorben - im Glauben an Ruhm und Ehre. Er hätte besser auch Grillen zerstückelt, dachte Kellen damals.
Und dann, als Breac schon lange tot und vergessen war, wurde Kellen zum Häuptling seines Dorfes bestimmt. Die Leute dort vergötterten zwar ihre Helden. Allerdings war ihnen wohl auch klar, dass ein Anführer mehr sein musste als nur mutig und stark. Kellen wusste, dass er zwar als übertrieben neugierig, aber auch als besonnen und gerecht galt. Die Menschen schätzten ihn. Und inzwischen hatte er auch gelernt, mit dem Schwert umzugehen.
Die Geräusche der unruhigen Pferde mischten sich in das kratzige Konzert der Grillen und rissen Kellen aus seinen Gedanken. Er erhob sich, um nach seiner Stute zu sehen. Sie trippelte nervös um den Baum herum, an dem sie festgebunden war. Die Lederriemen verhedderten sich im Geäst, ein Nadelzweig pikste ihr unsanft in die Flanke. Die Stute wieherte leise. Kellen strich ihr über die Nüstern und kraulte ihre hellbraune Mähne. Sie schnaubte. Auch die Pferde hatten es also bemerkt, dachte Kellen. Bei den Ahnen! Ihm war, als würde etwas auf sie lauern. Irgendwo. Im Waldland. Oder am Himmel?
Kellens Blick wanderte nach oben. Die schneeweißen Wolken hatten Tupfer in zarten Rot- und Orangetönen bekommen. Die Sonne war hinter den Wipfeln der hohen Tannen und Kiefern verschwunden. Sie hatte gerade noch genug Kraft, um dem Tag die letzten Minuten abzutrotzen. Und dann sah er sie. Feuerfresser. Es waren Hunderte. Als hätten die Götter den Himmel mit einem dunklen, flatternden Teppich bedeckt. So zogen sie über Kellen hinweg. Träge, als hätte die Zeit an Geschwindigkeit verloren. Ihre gewaltigen Silhouetten zeichneten sich scharf von den Abendwolken ab.
„Ihr Götter, steht uns bei!“, flüsterte Kellen. Er hatte von diesen Kreaturen gehört. Doch ihr Anblick ließ sein Herz starr werden. Mächtige, scharfe Krallen ragten aus dem dunkelgrauen Federkleid. Kraftvoll schlugen zottige, schwere Flügel. Und einen Augenblick lang glaubte Kellen, dass die Augen der Feuerfresser rot glommen, als wären sie glühende Kohlen. Eine der Kreaturen öffnete den langen, spitzen Schnabel, stieß ein schrilles, langgezogenes Kreischen aus. Kellen erinnerte es an die letzten gequälten Laute, die ein Schwein beim Schlachten hervorbrachte. Nur dieser Schrei war um Einiges durchdringender und schärfer. Selbst die Grillen waren mit einem Mal verstummt.
„Löscht das Feuer!“, schrie Murddin, der Reiterkrieger. Als wäre er wahnsinnig geworden, rannte er auf den Lagerplatz zu - mit dem Schwert in der Hand.
„Sie sehen uns sonst. Beim allmächtigen Lug. Sie werden uns töten. Einen nach dem anderen.“
Das Leinenhemd hing dem Krieger halb aus der bunt karierten Hose. Die hellbraunen Haare fielen ihm zottig ins blasse Gesicht und erreichten fast den mächtigen Schnurrbart, der Murddins Oberlippe schmückte.
Domhnall, der zweite Krieger im Gefolge des Fürsten, sprang auf. „Lass das, Murddin! Nicht! Sie werden vorbeiziehen. Hörst du? Das tun sie immer“, rief er seinem Gefährten zu und sah dabei ängstlich erst zu Kellen und dann hinüber zu Fürst Morcant. Doch der bedachte ihn mit keinem Blick. Als wäre nichts geschehen, saß er weiter regungslos auf einem Felsen und blickte unbeirrt in die Ferne.
Kellen allerdings wusste es besser. Er kannte ihn, den Herrscher über so viele Dörfer und Höfe. Dem Fürst war nicht egal, was da eben geschah. Der Häuptling war sich sicher, dass er die Feuerfresser am Himmel bemerkt hatte, ebenso wie den panischen Ausbruch seines Reiterkriegers. Und Kellen wusste, dass er so etwas nicht duldete. Es beleidigte Morcants ausgeprägten Sinn für Ordnung und Pflichterfüllung. Jetzt konnte es für Murddin gefährlich werden. Der Häuptling musste etwas unternehmen. Besser er als der Fürst. Mit großen Schritten rannte Kellen zur Feuerstelle. Er rammte Murddin den Ellbogen in den Hals und brachte ihn mit einem schnellen Tritt auf den Unterschenkel zu Fall. Murddins Schwert fiel in den Staub. Der Arm des Kriegers zuckte, bewegte sich in Richtung seiner Waffe. Aber bevor er zugreifen konnte, bekam er schon den Druck von Kellens Fuß am Kinn zu spüren.
„Überleg dir gut, was du jetzt tun willst, Reiterkrieger Murddin!“, sagte Kellen ruhig und sah ihm in die Augen. Murddins Pupillen flatterten in alle Richtungen. Aber bald wurden sie ruhiger und blickten schließlich starr geradeaus. Der Krieger schnaufte tief. Nur die Haare seines Bartes zitterten noch.
Wieder kreischte ein Feuerfresser. Diesmal aber deutlich leiser. Die Kreaturen zogen tatsächlich weiter - den Ahnen sei Dank.
„Ihr müsst keine Angst haben. Wir sind ihnen so wichtig wie unseren Pferden die Ameisen unter den Hufen. Sie greifen uns nicht an. Sie wollen nichts von uns.“ Ardric, der flaumbärtige Druidenschüler, war aus dem Wald zurückgekehrt. Er trug ein Bündel Kräuter in der linken Hand. Seine bronzene Sichel steckte neben dem Dolch in seinem Gürtel. Sein Wams war wie immer sauber. Kellen fragte sich, wie er das machte: In den Bäumen herumzuklettern, ohne sich die Kleider zu zerreißen oder auch nur schmutzig zu machen. Und er fragte sich, wie es dem jungen Kerl gelang, immer im unmöglichsten Augenblick aufzutauchen, um etwas Unüberlegtes zu sagen.
„Es ist nämlich so: Die Feuerfresser führen Krieg gegen andere aus dem dunklen Volk“, erklärte Ardric unbeirrt weiter und steckte seinen Daumen in den Gürtel. Er lächelte. Seine großen Augen verrieten, wie überlegen er sich in diesem Augenblick mit all seinem Wissen über die Geschäfte der Druiden fühlte. Der Junge war klug, dachte Kellen. Aber wenn er nicht lernte, mit seinem Mundwerk ebenso geschickt umzugehen wie mit seiner Sichel, dann würde er seine Druidenweihe nicht erleben.
Kellen gab Murddin frei. Der Krieger hustete, griff sich an die Kehle und warf dem Druidenschüler einen feindseligen Blick zu.
„Schlaue Worte! Aber wer weiß schon, ob die Feuerfresser nicht eines Tages Hunger auf Menschenfleisch bekommen?“ Mühsam quälte er die Worte hervor. „Ich sage: Du und deine Druidenmeister hätten besser ein Opfer gebracht - vor unserer Reise. Das hätte die Götter besänftigt. Nun sind sie womöglich zornig und schicken diese Vögel.“
Domhnall hustete laut vernehmlich und hob dann beschwichtigend seine mächtigen Hände. „Halt den Mund und leg dich wieder schlafen, Murddin! Morgen siehst du die Dinge in einem anderen Licht. Ein großer Krieger wie du hat Angst vor ein paar kreischenden Vögeln? Ha!“
Murddin rappelte sich brummend auf, packte sein Schwert und trollte sich, nicht ohne vorher einem unsichtbaren Gegner eine ordentliche Ohrfeige verpasst zu haben. Seine unmissverständliche Art, zu zeigen, was er gerade fühlte.
„Die Feuerfresser sind im Krieg. Das ist richtig“, sagte Ardric noch einmal in belehrendem Ton. „Aber nicht gegen uns. Es heißt, sie nähren sich von den Anderen. Mein Meister hat mit Männern aus dem Norden gesprochen. Sie sagen, wir haben nichts zu fürchten. Außerdem ...“
Es reichte. Kellen drehte ruckartig den Kopf in Ardrics Richtung. Seine Augen sandten eisige Blicke. Der Druidenschüler stockte. Seine Lippen zitterten. Noch war sich sein Verstand offenbar nicht sicher, ob er fortfahren sollte. Dann entschied er sich aber richtig.
„Ich denke, ich lege mich besser etwas hin“, haspelte er. Dann verschwand auch er.
Kellen wusste, dass sich Ardric in eine der vielen Felsnischen auf der westlichen Seite des Plateaus zurückziehen würde, dorthin, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Es gab unzählige solcher Nischen an diesem Ort. Fürst Morcant hatte den Platz klug gewählt. Er lag auf einer Anhöhe, auf der sich eine Gruppe riesiger Felsbrocken türmte. Einige hatten die Naturgewalten über die Jahrtausende aufgerissen, sodass es die Nischen und sogar ein paar kleine Höhlen gab. Von der glatten Ebene des größten Felsbrockens aus sah man über das dunkelgrüne Meer, das sich aus unzähligen Baumwipfeln zusammensetzte. In der Ferne brandeten die grünen Wogen gegen ein graubraunes Steilufer, das fast bis zum Himmel emporschoss und dort in weißen, gezackten Spitzen endete. Die Großen Berge! Die Götter mussten sie geschaffen haben, glaubte Kellen. Vielleicht, um den Menschen zu zeigen, wie klein auch der mächtigste Fürst im Vergleich zu ihnen war.
Allerdings hatte Morcant den Platz gewiss nicht wegen der Aussicht für die Nacht gewählt. Er hatte ihn gewählt, weil er gut zu verteidigen war. Nur zwei schmale Wege führten auf den Gipfel der Anhöhe. Sollte es jemand wagen, anzugreifen, dann würde er schnell entdeckt werden. Und er würde einen hohen Blutzoll zahlen müssen, wenn er das Plateau erreichen wollte.
Ein Hustenanfall schüttelte Domhnall - wieder einmal. Seit Tagen ließ ihn diese Qual nicht in Ruhe und Kellen konnte sehen, wie sehr sich der große, kräftige Krieger vergeblich abmühte, seine Schwäche zu verbergen. Diese Reise forderte ihren Preis. Schon jetzt. Und Kellen hoffte, dass Morcant so vernünftig war, ihre Rückkehr nicht weiter hinauszuzögern als unbedingt erforderlich. Als Domhnalls Husten nachgelassen hatte, strich er sich energisch durch den roten Vollbart - als könne er die lästige Krankheit damit wegwischen.
„Verzeiht Murddin!“, sagte er dann zu Kellen. Seine vollen Wangen hatten wieder etwas Farbe bekommen und verliehen dem grobschlächtigen Kerl beinahe so etwas wie Wärme.
„Murddin war schon in vielen Schlachten und kämpft wie kaum ein anderer. Aber er hat es gerne, wenn seine Gegner zwei Beine haben und einen Kopf, den man abschlagen kann.“
Kellen lachte gequält. Wie einfach doch die Welt der Krieger war. Breacs, Murddins und Domhnalls Welt. Wie beneidenswert einfach. Und doch schien der massige Domhnall wenigstens hin und wieder das zu gebrauchen, was sich hinter seinem Bart und unter dem eisernen Helm verbarg.
„Du hast Ehre und Verstand, Domhnall“, sagte Kellen und ließ sich neben ihm nieder. „Murddin kann froh sein, einen solchen Gefährten zu haben.“
Der große Krieger nickte.
„Allerdings, Häuptling Kellen. Und mein Verstand sagt mir, dass Murddin Glück hat, noch am Leben zu sein.“
Domhnalls banger Blick wanderte zum Fürsten, der noch immer einer Statue gleich auf seinem Felsen saß und in die Weite des Waldlandes blickte.
„Es heißt, Morcant verzeiht Kriegern nicht, deren Zorn und Angst mächtiger sind als der Verstand“, fügte Domhnall hinzu.
Kellen zog die Augenbrauen hoch. „Es wird viel über Morcant geredet. Es ist viel Unsinn dabei.“
Der Krieger sah ihn fragend an.
„Aber in diesem Fall stimmen die Geschichten über ihn“, ergänzte Kellen und sah in Domhnalls erschrockenes Gesicht. Dann fing er an zu lachen. Der Krieger zögerte einen Moment, dann lachte auch er.
Kellen wachte zitternd auf. Ihm war kalt. Je näher sie den Großen Bergen kamen, desto weniger Kraft hatte der Frühling. Er lauschte. Kein Grillenzirpen, kein Kreischen, keine Stimmen. Aber es war hell. Und das bedeutete, dass Morcant bereits wach sein musste. Der Fürst war immer der Erste, der aufstand, seine Dinge ordnete und - natürlich - seinen Blick in die Ferne richtete. Er war stark, klug, diszipliniert und sehr seltsam. Die Frage, ob man ihn mochte oder nicht, stellte sich nicht, denn Morcant war den Menschen, die ihn umgaben, fremd und fern. Andererseits fürchteten und achteten sie ihn, weil er ein guter Fürst war. Gerechtigkeit, Ordnung und Wohlstand waren ihm wichtiger als Ruhm und Ehre. Kriege vermied er, wenn es ging. Falls er aber doch ins Feld ziehen musste, dann mit einer Härte und Schlagkraft, die seine Gegner zittern ließ. Und er war ein Mann, der Handel trieb. Mit anderen keltischen Stämmen tauschte er Tuch, Vieh, Werkzeuge, Waffen und Salz - für den Bedarf seines Volkes, aber auch für Händler aus fernen Ländern. Immer häufiger kamen Etrusker und Griechen aus dem Süden, Germanen und Britannier aus dem Norden, weil sie wussten, dass in Morcants Dörfern all das zu bekommen war, was im Volk der Kelten Wert hatte. Sein Stamm war mächtig und reich. Und an die letzte Hungersnot konnten sich nur noch die Alten erinnern.
Aber Kellen wusste eben auch, dass der Fürst vielen in seinem Volk ein Rätsel war. Sicherlich, weil er den Kampf scheute. Obwohl er mit dem Schwert umgehen konnte wie nur wenige andere, schmückte kein einziger Schädel sein Haus. Und er trug noch nicht einmal einen Bart. Morcant war sehr weit weg von dem, was Männern wie Breac oder Murddin wichtig war. Kellen hätte Morcant dafür mögen können, wenn das möglich gewesen wäre. Er musste lächeln, als er sich fragte, ob auch der Fürst schon eine Grille zerteilt und untersucht hatte. War ihm so viel Neugier zuzutrauen? Sicher. Aber wer wusste schon genau, was in Morcants Kopf vorging? Bei den Göttern! Morcant hätte mit einem Heer hierher ziehen können. Stattdessen hatte er eine Handvoll Männer mitgenommen. Ein Wagnis, dessen Sinn Kellen nicht ganz verstehen konnte.
Ein Schleifen und Stapfen. So leise, fast hätte es Kellen überhört. Da war jemand, jemand der tunlichst darauf achtete, nicht bemerkt zu werden. Vorsichtig schob Kellen sein Fell beiseite und legte die Hand auf den Griff seines Schwertes. Von seiner Nische aus konnte er liegend nur in zwei Richtungen sehen. Niemand. Gut. Wer auch immer sich in das Lager schlich, hatte ihn aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht entdeckt. Lautlos und langsam zog Kellen das Schwert aus der Scheide und setzte sich behutsam auf. Er blieb in der Hocke, lehnte sich gegen den kühlen Fels und lauschte. Das Schleifen war etwas lauter geworden. Nun hatte sich auch ein tiefes Schnaufen dazugesellt. Das war kein Mensch!
„Wer weiß, ob die Feuerfresser nicht eines Tages Hunger auf Menschenfleisch bekommen.“
Hatte Murddin recht gehabt? Kellen fröstelte. Falls ja, dann wäre es ein kurzer Kampf. Gegen Geschöpfe aus dem Dunkelreich konnten Menschen niemals bestehen.
Er schloss die Augen, dachte nach. Würden Feuerfresser nicht aus der Luft angreifen? Dann wären sie im Vorteil. Andererseits: Machte das wirklich einen Unterschied? Was hatten sie schon von ein paar Menschen zu befürchten?
Steine bröckelten, bahnten sich ihren Weg über Fels und Geröll. Ein kurzes empörtes Brummen. Das Geschöpf war nahe - sehr nahe! Fliehen konnte Kellen nicht mehr. Seine einzige Chance war ein schneller Überraschungsangriff.
Kellen spannte seine Muskeln an. Mit aller Kraft sprang er in die Höhe - und blickte in den Höllenschlund: scharfe Zähne, das Dunkelrot eines weit aufgerissenen Mauls und ein dumpfes zerstörerisches Brüllen. Noch ehe der Häuptling einen Hieb führen konnte, traf ihn ein Schlag mit der Wucht eines Baumstamms an der Schulter. Er stürzte und schlitterte drei Mannslängen weit über den blanken Fels. Arme und Beine schmerzten. Mit allem, was er aufbieten konnte, hielt er den Schwertgriff umklammert.
Ein lautes Brüllen. Vor ihm baute sich die Bestie zu ihrer vollen Größe auf. Sie hatte dichtes, dunkelbraunes Fell und hätte Kellen um bestimmt zwei Köpfe überragt, wäre er noch auf den Beinen gewesen.
Kein Feuerfresser, ging es ihm durch den Kopf und er spürte ein wenig Erleichterung. Obwohl es seine Lage kaum besser machte, denn der Bär kam nun direkt auf ihn zu. Kellen rollte sich nach hinten weg und kam mit Schwung wieder auf die Beine.
„Haaaa!“, schrie er so laut er konnte und hob das Schwert. Der Bär zuckte und blieb stehen. Verunsichert schüttelte er sich. Dann ging er wieder zum Angriff über. Eine Klaue schnellte vor und verfehlte Kellen nur knapp.
Abwarten!, befahl sich der Häuptling. Noch gefährlicher als ein wütender Bär war ein verwundeter wütender Bär. Sein erster Hieb musste ihn tödlich treffen!
Er wich ein paar Schritte zurück und hielt inne, als sein Tritt ins Leere ging. Das Plateau endete hier und fiel schroff gute fünf Mannslängen in die Tiefe hinab. Und der Bär war nahe. Zu nahe, um noch einen starken Hieb zu führen. Kellen schlug zu und traf das Tier an der rechten Flanke. Sofort schoss Blut aus der Wunde. Aber der Bär war nicht schwer verletzt.
Er brüllte wütend auf und stürzte sich auf Kellen. Im selben Augenblick rutschte der Häuptling ab, schrammte über die Felskante. Das Schwert fiel klappernd in die Tiefe. Seine Finger krallten sich in den Stein, schabten schmerzhaft über die schroffe Oberfläche und bekamen einen schmalen Vorsprung zu packen. Kellen stöhnte auf.
Wieder brüllte der Bär. Er war nun auf allen Vieren, beugte sich weit vor über die Kante und schlug nach Kellen. Der Häuptling spürte einen dumpfen Schmerz am Hinterkopf. Warme Flüssigkeit rann seinen Nacken hinab.
In Panik ließ er die eine Hand los und griff nach der Pranke des Bären. Er bekam ein Büschel Fell zu packen und zerrte daran mit aller Kraft. Und der Bär kippte tatsächlich nach vorn und stürzte noch immer brüllend in die Tiefe. Kellen spürte den Pelz des Tieres über seinen Rücken streifen. Dann hörte er ein Geräusch, das so klang, als wäre ein großer Sack Holz von einem Wagen gefallen. Kellen sah nach unten: Die Bestie regte sich nicht mehr. In ihrem Rücken steckte tief das reich verzierte Schwert eines Fürsten. Zwei kräftige Hände packten Kellen und zogen ihn nach oben.
„Das ist ein Opfer an die Götter nach meinem Geschmack“, lachte Murddin und biss ein weiteres Mal in seine Keule. Ardric sah ihn strafend an, verzichtete aber zum Glück auf eine Bemerkung. Vermutlich nur deshalb, weil auch er viel zu sehr mit Kauen beschäftigt war, dachte Kellen.
Nach zwölf Tagen war Bärenfleisch eine willkommene Abwechslung zu hartem Brot, Hirsebrei und getrockneten Früchten.
„Das ist ein Mahl, wie es Kriegern gefällt“, ergänzte Murddin mit vollem Mund. Niemand widersprach. Mal abgesehen von Kellen waren wohl alle glücklich darüber, dass sich der neugierige Bär in ihr Lager geschlichen hatte. Das verschaffte ihnen nicht nur frisches Fleisch, sondern als Dreingabe auch eine willkommene Pause. Kellens Verletzungen mussten versorgt werden, auch wenn es nur ein paar Schrammen und Blutergüsse waren. Ardric hatte Pflanzen gesammelt und daraus einen Sud gekocht, den er ihm auf die Wunden strich. Unter den Verbänden tat er nun seine heilende Arbeit, während die Männer am Feuer saßen und Fleisch, Ruhe und die warme Nachmittagssonne genossen.
Domhnall ging ein wenig abseits die Ränder des Plateaus ab und blickte wachsam in die Ebene hinab. Auf Befehl des Fürsten passte er auf, dass an diesem Tag weitere Überraschungen ausblieben.
„Den Bären haben uns die Götter geschickt“, rief Murddin zwischen zwei Bissen. Fleischreste hatten sich über seinen Schnurrbart verteilt. Den Vorfall vom Abend, die Furcht vor den Feuerfressern hatte er ganz offensichtlich vergessen.
„Dann frage ich mich, was ich Ihnen getan habe“, antwortete Kellen.
Murddin lachte und offenbarte dabei, was er sich kurz davor in den Mund gesteckt hatte.
„Ich wünschte nur, ich wäre schneller gewesen als Fürst Morcant“, sagte der Krieger wieder etwas ernster.
„Warum?“ Ardric sah ihn fragend an.
„Weil ich noch niemals einen Bären erlegt habe. Darum. Ein Krieger sollte das in seinem Leben mindestens einmal getan haben. Aber Morcant ...“
Er machte eine Pause. Seine Miene wurde ernst und er sah zu dem Fürsten hinüber, der sich abermals auf dem Felsen auf der anderen Seite des Plateaus niedergelassen hatte. Dort saß er nahezu regungslos. Sein Helm lag neben ihm. Aber er trug das Kettenhemd, das er nur zum Schlafen und Waschen ablegte. Matt glänzten tausende eiserne Ringe in der Sonne. Kellen wusste, dass es weit mehr war für den Fürsten als bloßes Rüstzeug. Das Hemd sollten etruskische Schmiede für ihn gefertigt haben. Das Volk auf der anderen Seite der Großen Berge konnte mit Eisen umgehen wie kein anderes. Von den Etruskern hatte Morcant wohl auch die Sitte übernommen, sich Kinn und Wangen vollständig zu rasieren, vermutete Kellen. Hätte er nicht den goldenen Halsreif und die bunt karierte Hose - niemand hätte Morcant wohl als Keltenfürst erkennen können.
„Morcant war schneller“, fuhr Murddin fort. Seine Augen funkelten vor Missgunst. „Er war unglaublich schnell. Und dabei so leise, dass ihn das Biest erst bemerkte, als es schon zu spät war.“ Er zuckte dabei bedauernd mit den Schultern.
„Fürst Morcant ist ein großer Fürst. Er ist weit gereist und hat mehr grauenvolle, aber auch schöne Dinge gesehen, als wir uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können“. Ardric sagte das mit so viel Bedeutung in der Stimme, als rufe er die Götter an.
Murddin warf ihm einen missmutigen Blick zu.
„Mag sein. Aber sieh ihn dir an! Morcant sitzt auf seinem Felsen, als bestünde das Leben aus einer schönen Aussicht. Manche sagen, er sei nur zur Hälfte Mensch und zur anderen einer aus dem dunklen Volk. Das würde einiges erklären.“
„Genug jetzt, Murddin!“ Kellen setzte sich auf. Seine Schulter und seine Knie schmerzten. Aber dennoch ging es ihm deutlich besser als noch vor wenigen Stunden. Der Druidenschüler verstand sein Handwerk. Wenigstens das musste man ihm lassen.
„Zügle dein Mundwerk! Du solltest den Fürsten weit mehr fürchten als die Feuerfresser, die über uns hinweggezogen sind. Glaub nicht, dass ihm deine Vorstellung gestern entgangen ist!“
Murddin sah betreten zu Boden. Ein unangenehmer Gedanke, den der Krieger offensichtlich gerne für immer aus seinem Kopf verbannt hätte.
„Verzeih, Häuptling!“, murmelte er leise.
Die Männer schwiegen einen Moment. Allerdings war die Stille nicht von langer Dauer. Ardric hatte den Mund gerade leergegessen und nutzte die Pause, um einmal mehr mit seinem Wissen über die Feuerfresser zu prahlen.
„Mein Meister hat die Germanen aufgesucht, als die Feuerfresser zum ersten Mal bei uns gesehen wurden. Er hat viel über sie erfahren. Wusstet ihr, dass sie aus dem Norden kommen und nun auch bei uns Jagd machen? Aber - ich sagte es bereits - weder auf Menschen noch auf Tiere. Oh nein. Sie haben es auf ...“
Kellen brachte ihn abermals mit einem seiner stechenden Blicke zum Schweigen. Was musste eigentlich noch passieren, damit der Junge lernte, wann er besser die Klappe hielt? Der Häuptling kam sich schon vor, als wäre er einer dieser strengen Druidenmeister, die ihre Schüler mit harten Worten und beizeiten auch dem Stock züchtigten. Dabei war es Murddin, der noch viel mehr zu lernen hatte als der junge Ardric. Der Druidenschüler hatte wenigstens Verstand.
„Ardric, ich habe Schmerzen“, sagte Kellen dann im versöhnlichen Ton. „Warum machst du mir nicht noch einen Topf von diesem großartigen Sud?“
„Aber ...“ Der Druidenschüler stutzte einen Moment. Dann erhob er sich aber wortlos und machte sich wieder auf die Suche nach Kräutern und Farnen.
Als er außer Hörweite war, seufzte Murddin.
„Morcant ist ganz gewiss ein großer Fürst. Daran zweifele ich nicht“, sagte der Krieger eindringlich. „Aber warum sagt er uns nicht, was er vorhat? Was machen wir hier in dieser Wildnis, Häuptling Kellen? Und warum sind wir nur zu fünft? Morcant hätte hunderte Krieger mitnehmen können.“
Kellen runzelte die Stirn. Die Fragen waren natürlich berechtigt. Auch er hatte sie sich bereits gestellt. Allerdings standen sie weder ihm noch einem einfachen Krieger wie Murddin zu. Er hatte nicht das Recht, die Befehle eines Fürsten zu hinterfragen. Der Krieger lief offenbar abermals Gefahr, zu weit zu gehen. Die Grenze zwischen Mut und Dummheit hatte bei ihm keine Konturen. Er kam Kellen wie ein freches Kind vor, das man vor sich selbst schützen musste.
„Die Götter haben jeden von uns mit Aufgaben bedacht, Murddin.“ Der Häuptling sprach langsam und ruhig. „Du bist ein Krieger, der kämpfen soll. Der Fürst muss führen, denken, Entscheidungen treffen. Er glaubt, es ist besser, dieses Land in Frieden zu betreten, statt mit einem Heer einzufallen. Die Götter kennen seine Gründe. Aber eines ist gewiss: Seine Aufgaben sind weit schwieriger als deine. Und du tust gut daran, ihm zu folgen, statt ihm im Wege zu stehen. Das würde er nicht zulassen.“
Wieder eine Warnung. Murddins Miene nahm sehr ernste Züge an. Der Krieger strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und streichelte seinen Schnurrbart. Ein paar der Essensreste segelten gemächlich zu Boden.
„Aber so weit wirst du es nicht kommen lassen, Reiterkrieger Murddin. Habe ich recht?“
Kellen lächelte und legte die Hand auf die Schulter des Kriegers. „Schließlich hat uns Fürst Morcant mitgenommen, weil er glaubt, dass wir die Besten für diese Reise sind - wohin auch immer sie uns führen wird.“
„Hat er das gesagt?“ Murddins Gesicht gewann wieder an Farbe.
„Das nicht. Aber denk darüber nach! Er hätte andere als uns auswählen können. Das hat er aber nicht. Warum sonst sind wir hier?“
Murddin nickte zögernd.
„Aber was will er dann mit diesem rotzigen Druidenjungen?“
Kellen zuckte mit den Schultern.
„Du weißt, dass Morcant immer gerne einen Gelehrten um sich hat. Nun sind aber die Druiden alle zu alt für eine solche Reise. Mit ihnen würden wir nicht weit kommen. Ardric dagegen ist jung und trotz seines Mundwerks ist er der Beste unter den Schülern.“
Murddin schüttelte missmutig den Kopf und stopfte sich ein weiteres Stück Bärenfleisch in den Mund.
Er verschluckte sich daran, als Domhnall lautstark Alarm gab.
„Wir bekommen Besuch!“, rief er. „Zwei Männer sind es. In Begleitung von Ardric.“
Kellen und Murddin sprangen auf und schnallten sich ihre Schwerter um.
Und auch in die Statue am Felsen kam endlich etwas Bewegung. Kellen sah, dass sich der Fürst langsam erhob, dann aber einen Moment lang verharrte - so, als wusste er, wie sehr seine erhabene Erscheinung wirkte. Morcants Umrisse zeichneten sich schwarz vor einem Gemenge an grauen und weißen Farben am Himmel ab. Das etruskische Kettenhemd spielte dazu eine helle, monotone Melodie. Dann lief der Fürst ohne Hast auf die Stelle zu, an der der schmale Pfad auf dem Felsplateau endete. Kellen und die beiden Krieger stellten sich hinter ihm nebeneinander auf - die Hände am Schwertknauf. Dann warteten sie.
Der ältere der beiden Ankömmlinge war ein Druide, vermutete der Häuptling. Langes, graues Haar wallte unter seiner speckigen Kappe hervor. Der Übergang zu seinem mächtigen Bart war fließend. Sein Gewand reichte bis zum Boden herab, wo es vor Dreck nur so strotzte. Der Rest des Kleidungsstücks war nur unwesentlich sauberer. Unmöglich zu sagen, ob es einmal eine Farbe gehabt hatte. Die heruntergerissene Gestalt hätte erbärmlich wirken können. Aber ein langer, knorriger Stock, an dessen Spitze allerlei Medaillons und die Schwänze verschiedener Tiere baumelten, verlieh dem Mann eine gewisse Würde. Aufrecht und furchtlos stand er vor dem Fürsten und seinen Männern. Zwei wache, braune Augen funkelten trotzig aus dem Gemenge an grauem Haar heraus. Nur, wer genau hinsah, konnte eine wie ein Halbmond geformte Narbe auf der Stirn erkennen. Sie reichte ihm vom Scheitel bis zum Nasenansatz. Vielleicht die Folge eines Kampfes?, dachte Kellen. Oder aber die Spur eines blutigen, kultischen Rituals?
Der zweite Mann war offensichtlich ein Krieger von niedrigem Rang. Er trug schmucklose, einfarbige Hosen und ein an den Ärmeln zerrissenes Leinenhemd, dessen beste Zeiten lange zurücklagen. Mann und Kleidung hatten fast ebenso lange kein Wasser mehr gesehen. Anders als der Druide wirkte der junge Krieger nervös. Seine Augen wanderten rastlos umher. Und auch die beiden Zöpfe, die das schmutzverkrustete Gesicht flankierten, kamen nicht zur Ruhe. Den Rest der blonden Haare trug er offen, was seinem Aussehen Wildheit verlieh.
Er stieß Ardric grob von sich. Rasch suchte der Druidenschüler Schutz hinter Domhnall. Er zitterte am ganzen Körper.
Fürst Morcant sagte kein Wort. Seine Miene verriet nichts - keinen Zorn, keine Neugier. Wer ihn nicht kannte, musste glauben, ihm seien die beiden Neuankömmlinge gleichgültig. Aber Kellen wusste auch diesmal, dass es nicht so war. Die Männer wurden gemustert, eingeschätzt. Die Möglichkeiten des eigenen Handelns wurden durchgespielt. Und wie das Ergebnis ausfiel, konnte niemand vorhersagen. Kellen hätte es nicht im Mindesten überrascht, würde der Fürst im nächsten Moment sein Schwert ziehen und die beiden erschlagen. Bei den Ahnen! Dieser Druide zeigte schließlich nicht den geringsten Respekt vor Morcants hohem Rang, der auch für ihn offensichtlich sein musste.
„Ihr durchstreift den Wald der Freien. Seit Tagen zieht ihr in ihm umher, als würde er euch gehören. Und nun habt ihr einen heiligen Bären erlegt“. Der Druide hielt inne, um vorwurfsvoll den Kopf zu schütteln. Dann fuhr er fort. „Unsere Ahnen und die Götter erzürnt das. Sie haben die Feuerfresser in unser Land geschickt, um euch zur Umkehr zu bewegen. Doch was macht ihr? Ihr spuckt auf ihren Willen.“
Morcant zog die Augenbrauen hoch. War da Zorn? Aber er schwieg weiter und auch die Hand auf dem Knauf seines Schwertes blieb regungslos.
Unbeeindruckt fuhr der Druide fort.
„Ihr bringt Unheil über dieses Land. Bram, der Häuptling der Freien, wird das nicht hinnehmen. Das kann er nun nicht mehr länger. Es ist seine heilige Pflicht, euch zu verjagen. Oder zu töten.“
Morcant ließ noch einen Augenblick verstreichen. Dann antwortete er mit starker, aber leiser Stimme.
„Unsere Absichten sind friedlich. Wir wollen niemanden erzürnen. Wir wollen reden, Freunde gewinnen, nicht kämpfen. Taranis selbst hat uns diese Reise befohlen. Er sprach zu unseren Druiden. Sie sagen, er will, dass sein Land, das du das Land der Freien nennst, wieder zu einem freien Land wird.“
Der Blick des Druiden gefror. Sein halb offener Mund verriet Erstaunen. Offenbar hatte er mit Vielem gerechnet, nicht aber mit einem Streit über den Willen der Götter. Er war Druide und wohl nicht an Widerspruch in diesen Dingen gewohnt.
Morcant sah den Mann kurz prüfend an und fuhr dann fort:
„Dein Volk verehrt doch Taranis, den allmächtigen Himmelsgott? Oder haltet ihr es lieber mit den Dämonen der Finsternis? Das jedenfalls würde erklären, warum uns deine Götter zürnen, nicht aber unsere.“ Sein Gesicht zeigte Neugier.
Das seines Gegenübers blanke Wut.
„Du maßt dir an, so mit einem Druiden zu sprechen? Du, ein Fürst, der die Gebote der Götter unter Schutzwällen begräbt, mit den Hufen deiner Pferde zermalmt und mit den Waren gottloser Völker verhöhnt. Bei Lug! Was für ein Frevel!“
Er schnaufte verächtlich. Seine geweiteten Augen streiften über das Waldland.
„Einst waren alle unseres Volkes frei“, rief er und streckte die Arme zum Himmel. „Frei zu tun, was den Göttern gefällt. Unsere Festungen waren die Wälder, unsere Waffen die blanken Fäuste, unser Wille, allein den Göttern zu dienen. Das ist das Leben, das uns zu führen aufgegeben ist.“
Sein Begleiter nickte voller Eifer. In seinen Augen brannte das Feuer der Überzeugung.
Kellen packte den Griff seiner Waffe ein wenig fester. Den beiden Männern schien das, woran sie glaubten, wichtiger zu sein als ihr Leben.
Morcant blieb zu Kellens Erstaunen aber noch immer regungslos. Falls er sich tatsächlich beleidigt fühlte, dann merkte man ihm das nicht an, als er wieder mit ruhiger Stimme sprach.
„Dein Spiel ist gefährlich, Druide. Ich bin ein Fürst, der über viele Dörfer und Höfe gebietet. Vor dir stehen fünf Männer, die den Frieden suchen. Das ist es, was wir anbieten. Wählst du aber den Krieg, dann solltest du wissen, dass ich die Macht habe, dieses Land zu unterwerfen und seine Bewohner zu töten. Ist es das, was du möchtest?“
Hass loderte in den Augen des Druiden. Trotziger Hass. Morcants Drohung schien ihn nicht zu beeindrucken.
Der Fürst fuhr fort:
„Du siehst, es geht hier nicht darum, wer von uns den Weg der Götter besser verstanden hat und wer nicht. Lebt, wie ihr wollt! Bleibt im Morast der Vergangenheit stecken, wenn es euch glücklich macht!“
Der junge, dreckige Krieger sah den Druiden hilfesuchend an. Morcants Worte schienen ihm Angst zu machen.
„Richte Bram aus, dass Fürst Morcant mit ihm zu reden hat. Über Freiheit? Sehr gerne. Und über die Händler, die er in seinem Land der Freien zu massakrieren pflegt. Und deren Waren er wie ein dreckiger Dieb an sich genommen hat. Und dann möchte ich mit ihm darüber reden, was ihm lieber ist: Will er mit uns kämpfen? Oder entscheidet er sich für einen Frieden, der unser Volk einen und zur Blüte bringen könnte. Das ist mein Angebot. Sag ihm das, Druide!“
Brams Druide hob drohend seinen Stab und setzte zu einer Erwiderung an. Aber dazu kam er nicht. Morcants Geduld war erschöpft.
„Genug jetzt!“, rief der Fürst mit lauter Stimme. Metall schliff über Metall und einen Wimpernschlag später hielten er, Kellen, Domhnall und Murddin ihre Schwerter kampfbereit in den Händen. „Sag ihm das!“, wiederholte Morcant.
Erschrocken wich der Druide zurück und rempelte dabei seinen nicht weniger entsetzten Begleiter um. Erstaunlich schnell rappelte der sich wieder auf und rannte davon.
Der Druide dagegen blieb wie erstarrt stehen. Er atmete schwer. Angst und Zorn schienen in seinem Inneren zu toben. Aber dann siegte auch bei ihm die Erkenntnis, dass er diese Situation nicht für sich entscheiden konnte. Mit einer ruckartigen Bewegung drehte er sich um und folgte dem jungen Krieger mit großen, energischen Schritten.
„Domhnall“, sagte Morcant leise. „Ich will wissen, welchen Weg sie nehmen. Beobachte sie eine Weile!“
Der große Krieger nickte.
Kellen glaubte, die schneebedeckten Gipfel riechen zu können. So rein und frisch war die Luft an diesem Morgen. Seit Tagen waren die Zacken der Großen Berge ihre Begleiter, standen am Horizont, ohne sich - so schien es - auch nur im Mindesten zu bewegen. Gerne hätte er sie einmal aus der Nähe gesehen, so wie Morcant, der die Berge sogar schon zweimal überquert haben sollte. Aber ihr Weg hatte ein anderes Ziel. Sie wollten ins Dorf des Bram. Der Druide und sein Begleiter hatten eine deutliche Spur hinterlassen. Vielleicht aus Unachtsamkeit, vielleicht aber auch mit Absicht. Das war nicht wichtig. Der Fürst war fest entschlossen, mit dem wilden Häuptling zu verhandeln. Ein riskanter Weg, denn Bram und seine Leute schienen nicht zu den Menschen zu gehören, die Verträge schlossen. Kellen stellte sich ein ganzes Dorf vor, das nur aus Breacs und Murddins bestand - mit sehr vielen Schädeln über den Hüttentüren. Aber Morcant schien nun mal an die Vernunft der Menschen zu glauben. Kellen bewunderte ihn dafür und wünschte, er könnte das auch. Der Auftritt des Druiden auf dem Plateau machte ihm das allerdings unmöglich.
Sie ritten in gewohnter Formation: Vorneweg der Fürst auf seinem großen, schwarzen Hengst, etwas versetzt folgte ihm der Druidenschüler auf einem deutlich kleineren Grauen. Der Junge wich kaum von der Seite des Fürsten. Und es schien ihn dabei nicht im Mindesten zu stören, dass Morcant auch mit ihm nicht mehr Worte wechselte als mit den anderen.
Dahinter, in einigem Abstand, ritten Kellen und die beiden Krieger. Murddin hatte zu seiner gewohnt sorgenfreien Beredsamkeit zurückgefunden. Er erzählte von den unschlagbaren Qualitäten seiner Frau - wobei er nicht das Kochen, Weben oder Töpfern meinte. Er erzählte davon, welche großartig schmeckenden Pflanzen er zu Hause erntete und von seinen Besuchen in der Pferdezucht des Fürsten. Selbstverständlich war es in seinen Geschichten stets er, der heldenhaft widerspenstige Pferde zuritt und bändigte.
Domhnall und Kellen ertrugen es geduldig. Es gab hier im Waldland nichts anderes - außer dem Gezwitscher der Vögel, dem Schnauben der Pferde und dem Klappern der schweren eisernen Schilde, die an der Sattelseite hingen und gelegentlich gegen das Schwert schlugen.
Die grauweiße Wand der Berge war nun doch größer geworden und hatte an Konturen gewonnen. Kellen sah es immer dann, wenn der Wald gnädigerweise einen Blick in die Ferne zuließ, was nicht oft geschah.
„Ist es wahr, dass die Etrusker in Frauenkleidern kämpfen?“, wollte Murddin wissen, nachdem ihm die Heldengeschichten über sich selbst ausgegangen waren.
„Das sagt man jedenfalls“, antwortete Domhnall schmunzelnd - wohl darauf bedacht, dass ihn der Fürst nicht hören konnte. „Angeblich tragen sie Röcke.“
Murddin lachte. „Das erklärt, warum sie sich nicht über die Berge trauen. Hier würden alle über sie lachen.“
„Seid froh, dass sie bleiben, wo sie sind!“, sagte Kellen leise. „Im Gegensatz zu unseren Leuten halten sie zusammen und kämpfen lieber gegen ihre Feinde als gegen sich selbst.“
„Vor jemandem, der Frauenkleider trägt, fürchte ich mich nicht“, antwortete Murddin mit lauter Stimme. Mit zu lauter Stimme.
Der Fürst stoppte sein Pferd und blickte Murddin streng an. Das Lächeln des Kriegers gefror.
„Verzeih, Fürst!“, stammelte er hastig.
Morcant funkelte ihn noch einen Augenblick an. Dann setzte er seine schweigsame Reise fort.
„Er muss dich für einen wirklich guten Krieger halten, du Narr. Andernfalls wärst du lange schon tot“, sagte Kellen leise zu Murddin. Der Krieger nickte und schwieg bemerkenswerterweise für die folgenden Stunden. Er würde es wohl niemals lernen, dachte Kellen und wunderte sich dabei einmal mehr über die Geduld des Fürsten. Als wäre er der Fels, auf dem er gesessen hatte, ließ er Murddins unpassendes Verhalten wie Regentropfen an sich abprallen.
Etwas schien ihm wichtiger zu sein, dachte Kellen. Er bemerkte, dass Morcant immer wieder seinen Wollmantel an der linken Seite zurückschlug - dort, wo er sein Schwert trug. Als rechnete er jeden Augenblick damit, angegriffen zu werden.
Sie folgten einem schmalen Pfad, der durch dichten Nadelwald führte und den großen Vorteil hatte, dass es außer ihm keinen anderen gab. Der Druide und sein Begleiter mussten hier gegangen sein. Dieser Weg musste also in Brams Dorf führen, glaubte Kellen. Wohin sonst? Sie ritten viele Stunden lang, bis der Pfad eine steile Linksdrehung machte und zu einem schmalen Bach hinabführte.
Domhnall drückte seinem Pferd die Fersen in die Flanke und überholte Morcant und Ardric. Unten am Wasser stieg er ab und ging in die Hocke. Er gab den anderen das Zeichen, stehen zu bleiben. Kellen machte sich bereit, für was auch immer nun geschehen würde.
Domhnall untersuchte etwas, das auf dem Boden lag. Er nahm es und ging damit auf Morcant zu.
„Kellen!“, rief der Fürst und stieg ab. Der Häuptling folgte ihm.
„Das ist merkwürdig“, sagte Domhnall und zeigte den beiden etwas, das wie ein abgeschnittener Eichhörnchenschwanz aussah.
Kellen strich über das schmutzige, buschige Fell.
„Der Druide hatte so etwas an seinem Stab.“
„Er muss es verloren haben“, stimmte ihm Domhnall zu. „Vermutlich war er in Eile.“
Kellen runzelte die Stirn und folgte mit seinem Blick dem Lauf des Bachs. Nichts deutete darauf hin, dass hier in der Nähe Menschen lebten. Und doch war das Bachufer erstaunlich licht. Der Pfad dort war breit genug, um zwei Reitern nebeneinander Platz zu bieten. Abseits des Pfades war es dafür umso dichter und undurchdringlicher.
„Ja, vielleicht hat er es verloren“, sagte er.
Kellen lauschte. Außer dem Gezwitscher von ein paar Vögeln war nichts zu hören. Aber wieder hatte er das Gefühl, dass etwas oder jemand sie belauerte.
„Fürst Morcant, ich rate dazu, kehrtzumachen“, sagte er dann.
Murddin, der noch immer auf seinem Pferd saß, stöhnte verächtlich auf. Morcant sah Kellen prüfend an. Der Häuptling wusste, dass der Fürst ihn nicht für einen Feigling hielt. Und auch nicht für jemanden, der unbedacht sprach.
Morcant überlegte einen Moment. Dann sagte er mit leiser Stimme: „Du hast recht, Kellen. Der Druide legt eine Spur zum Dorf des Bram. Er will, dass wir kommen. Er will, dass wir mit seinem Häuptling verhandeln.“
„Oder er will, dass uns seine Krieger abschlachten“, entgegnete Kellen. „Vielleicht ist das eine Falle.“ Domhnall nickte zustimmend.
Morcant atmete tief ein. Sein Blick ging von Kellen zu Domhnall, dann dreht er sich um.
„Ardric?“
Der Druidenschüler räusperte sich und war gerade sichtlich bemüht, sein Pferd ruhig zu halten.
„Nun ...“, er dachte einen Moment angestrengt nach. „Der Mann war dreckig und dreist. Aber er war ein Druide, ein weiser Mann. Kein Krieger. Er sagte uns das, was er sagen musste. Aber ich glaube ...“ Sein Pferd schnaubte. „Ich glaube, er ist aufrichtig und denkt an das Wohl seiner Leute. Ihm ist klar, dass ein Angriff auf uns einen Krieg auslösen würde, den er nicht gewinnen kann. Ja, er will verhandeln.“
Fürst Morcant sah auch ihn einen Augenblick prüfend an. Dann gab er den Befehl zum Aufsitzen.
„Ihr bringt Unheil über dieses Land. Bram, der Häuptling der Freien, wird das nicht hinnehmen.“
Kellen hatte dem Druiden geglaubt. Seine Augen hatten bei diesen Worten geblitzt wie blanke Messer. Ein Fanatiker, kein „weiser Mann“. Kellen hatte kein gutes Gefühl. Er spürte die Feindseligkeit dieses Landes - in jedem Strauch, in jedem Baum, an dem sie vorbeiritten. Sogar das Geplätscher des Bachs kam ihm nun bedrohlich vor.
Keiner sprach ein Wort. Alle spähten angestrengt ins Dickicht. Kellen glaubte, in Murddins Gesicht so etwas wie freudige Erwartung zu erkennen. Der Mann wollte kämpfen. Die Breacs, Brams und Murddins dieser Welt kümmerten sich nicht um die Visionen eines Fürsten, scherten sich nicht um Ordnung und Wohlstand. Sie wollten töten, ihre Kraft beweisen. Vielleicht war Morcant zu lange bei den Leuten südlich der großen Berge gewesen und hatte das vergessen. Kellens Gedanken reisten weit zurück, in die Nacht, in der Morcant zum Fürsten geworden war, vor so vielen Jahren.
„Die Etrusker treiben regen Handel mit einem großen Volk, das weit im Süden lebt - dort, wo es niemals Winter wird.“
Morcants Häuptlinge hatten sich am Feuer in dem großen Haus versammelt und gehört, was ihr neuer Herr ihnen zu sagen hatte. Dieser seltsame Mann mit dem eisernen Kettenhemd und dem glattrasierten Gesicht. Statt von Ruhm und großen Taten berichtete er von fremden Völkern.
„Ein Volk, das gewaltige Schiffe baut und kunstvolle Dinge fertigt. Und das Wissen und Weisheit über alles andere stellt.“
Zweifel und Misstrauen standen damals in den Gesichtern der Häuptlinge.
„Ein großes Volk, das weit weg lebt. Und doch ...“ Er ließ eine kurze Pause. „Und doch kennt man uns dort.“
Neugierige Blicke.
„Man hat dort sogar einen Namen für uns: Keltoi, die Erhabenen.“
Jubel brandete auf. Morcant aber hob die Hände.
„Ja, sie bewundern unsere Tapferkeit. Aber gleichzeitig lachen sie über uns.“
Allgemeines Raunen. Einer der Häuptlinge rief empört zum Kampf gegen dieses fremde Volk auf. Aber der neue Fürst winkte ab und sagte mit lauter Stimme:
„Sie lachen über uns, weil Tapferkeit ohne Ordnung und ohne Weisheit nichts ist. Und außerdem glauben sie, dass wir öfter betrunken als nüchtern sind.“
Die Häuptlinge hatten Jahre gebraucht, um nach dieser Nacht ihren Frieden mit dem schweigsamen, seltsamen Fürsten zu machen. Aber mit den Siegen, dem Wohlstand und der Ordnung waren die Zweifel weniger geworden.
An diesem Tag aber zweifelte Kellen an Morcants Entscheidung. Nein, er wusste, dass sie falsch war. Sie war falsch und tödlich.
Wieder waren zwei Stunden verstrichen. Das Dickicht am Rande des Pfads war noch undurchdringlicher geworden. Regen hatte eingesetzt. Zweimal mussten sie anhalten und absteigen, weil der Boden zu weich und zu matschig für die Hufe ihrer Pferde geworden war. Die Feuchtigkeit drang durch Kellens Umhang. Er fröstelte.
Dann plötzlich stoppte Fürst Morcant das Pferd. Unruhig sah er in den Wald hinein, dann zurück zu seinen Männern. Sein Hengst wieherte. Morcants Blick traf den von Kellen. Bedauern und Enttäuschung standen ihm im Gesicht - so, als würde er sich bei ihm entschuldigen wollen.
Wieder starrte er wie gebannt ins dunkle Geäst.
„Manchmal muss man etwas wagen, wenn es viel zu gewinnen gibt.“ Der Fürst machte eine Pause.
Domhnall nutzte sie, um laut vernehmlich zu fluchen. Murddin war der Erste, der sein Schwert zog.
„Verzeiht mir!“, rief der Fürst und zog ebenfalls. Kellen und Domhnall taten es ihm nach.
Und dann kam der Angriff, so plötzlich und heftig wie ein Platzregen.
Der Fürst wehrte mit dem Schwert einen Wurfspeer ab, der ihn sonst unweigerlich getroffen hätte.
Kellen riss seine Stute herum. Keine Sekunde zu früh, denn auch ihn verfehlte ein Speer nur knapp.
Murddin hatte weniger Glück. Kellen sah, dass ein langes Stück Holz aus seiner Brust ragte. Die metallene Spitze der Waffe war vollständig durch den Körper des Kriegers gedrungen und ragte nun tiefrot gefärbt aus seinem Rücken. Mit einem seltsam verblüfften Gesichtsausdruck glitt Murddin seitwärts aus dem Sattel in den Staub.
„Weg hier!“, schrie Domhnall und rammte seinem Pferd die Stiefel in die Seite.
Aber er kam nicht weit. Drei Schwertkämpfer versperrten ihm den Weg. Mindestens ein Dutzend weitere sprangen wild schreiend aus dem Unterholz. Unmöglich zu sagen, wie viele genau es waren. Ihre nackten Oberkörper waren bunt mit Fratzen und kriegerischen Symbolen bemalt. Die Haare hatten sie in Kalkwasser getaucht und zu wilden Skulpturen geformt. Sie sahen aus wie Dämonen.
Kellen versuchte verzweifelt, das Geschehen zu überblicken und zu sortieren. Aber es gelang ihm nicht. Er spürte einen festen Ruck unter sich. Die Stute war getroffen. Kellen drückte beide Füße in den Sattel und stieß sich mit aller Kraft ab, als sein Pferd stürzte. Er traf mit beiden Beinen auf den Boden und rollte sich ab, um dem Aufprall die Wucht zu nehmen.
Noch bevor er vollständig wieder oben war, trieb er einem Angreifer das Schwert in die Eingeweide.
Kein Zögern! Kein Nachdenken. Der Krieger hatte nun auch in Kellen die Macht übernommen. Ohne ein Ziel zu haben, schwang er sein Schwert und drehte sich um die eigene Achse.
Er traf einen weiteren Mann am Arm. Blut spritzte ihm in die Augen. Er taumelte, wischte mit dem Ärmel über das Gesicht, suchte ein weiteres Mal nach Ordnung in dem Durcheinander.
Domhnall und Morcant kämpften verbissen. Ein paar Männer lagen auf dem Boden. Einer von ihnen war Ardric, der Druidenschüler mit dem großen Wissen und der großen Klappe. Seine Augen waren offen, aus einer klaffenden Kopfwunde sickerte Blut. Wie sinnlos, ging es Kellen durch den Kopf.
Nicht denken! Drei von Brams Männern stürmten auf Kellen zu. Er parierte den wuchtigen Hieb des ersten Kriegers, machte einen Ausfallschritt und schlug ihm den Kopf ab. Die beiden anderen waren vorsichtiger. Sie blieben auf Abstand und griffen ihn nun von zwei Seiten gleichzeitig an.
Noch einmal drehte er sich um die eigene Achse. Diesmal traf er nicht.
Ein Hieb verfehlte nur knapp seinen Kopf. Kellen blockte einen weiteren mit dem Schwert ab und rammte seinem Gegner gleichzeitig den Fuß in den Oberschenkel. Der schrie vor Schmerzen auf, taumelte zwei Schritte zurück. Kellen setzte mit dem Schwert nach und verpasste dem Krieger eine klaffende Schnittwunde quer über den Bauch.
Einen Moment später drang etwas tief in Kellens Rücken ein. Der Häuptling spürte Kälte und Hitze zugleich. Der zweite Krieger! Er war hinter ihm, Kellen hörte sein Schnaufen. Dann setzte der Schmerz ein - betäubend, rasend, erbarmungslos. Der Krieger zog sein Schwert aus Kellens Körper. Die Kälte ließ augenblicklich nach. Aber nun war da noch mehr Hitze, noch mehr Schmerz und ein metallischer Geschmack, der sich in seinem Mund breitmachte. Kellens Schwert fiel, seine Beine knickten ein wie dünne Äste. Er ging auf die Knie und sah nun seinen Mörder. Der Krieger keuchte, aber seine Augen funkelten triumphierend. Dann holte er mit dem Schwert aus, um sein Werk zu vollenden. Schmuck für die Hütte eines Helden! Wie sinnlos, dachte Kellen.
Der silberne Pfeil lag ruhig in der Kerbe zwischen Daumen und Zeigefinger. Ohne auch nur im Mindesten zu zittern, zog die andere Hand des Schützen die Sehne mit dem Pfeilende weit zurück und ließ sie einen Augenblick später nach vorne schnellen. Der silberne Pfeil war auf dem Weg. Er verfehlte zwei dicke Äste um Haaresbreite und flog sirrend seinem Ziel entgegen. Die Flugbahn war leicht gekrümmt, nicht stark genug, als dass es einem der kämpfenden Männer am Bach hätte auffallen können. Sie bemerkten sie ebenso wenig wie den Pfeil selbst, dessen rasende Geschwindigkeit die Augen der Menschen überforderte.
Der Pfeil traf Brams Krieger in den Hals - mit solcher Wucht, dass er wie von einem heftigen Schlag getroffen zur Seite geworfen wurde. Doch keine Trophäe, fuhr es Kellen durch den Kopf. Benommen ließ er sich vollständig zu Boden sinken. Er verstand nicht, was da eben passiert war, und es war ihm seltsamerweise auch nicht so wichtig. Sein Schicksal war besiegelt - so oder so.
Weiße Wolken drängelten die schwarzen beiseite. Der Häuptling sah geradewegs in den Himmel. Auch dort hatte so etwas wie ein Kampf stattgefunden. Der Regen war nun besiegt. Das Licht hatte das Dunkel bezwungen. Wie tröstlich. Wie friedlich.
Etwas Buntes wehte über ihn hinweg, forderte den Rest Aufmerksamkeit, zu dem er noch imstande war. Kellen drehte den Kopf zur Seite. Brams Krieger stürzten - einer nach dem anderen - besiegt von einer …
Kellen kniff die Augen zusammen. Er sah sie wie durch einen Schleier aus Wasser. War sie echt? Oder das Trugbild eines Sterbenden? Eine Göttin, gehüllt in wehende, farbige Tücher. Zwei Schwerter trug sie, in jeder Hand eines und sie bewegte sich mit der Geschwindigkeit eines Raubtiers und mit der Anmut einer Tänzerin. Zwei Krieger wurden von ihr nahezu gleichzeitig getroffen. Blut spritzte. Ein dritter rannte ins Dickicht. Noch ein silberner Pfeil sirrte aus dem Nichts und beendete seine Flucht. Der Krieger prallte mit Wucht gegen einen Baumstamm und sank zu Boden.
Eine Göttin! Kam sie, um ihn zu holen? War es das, was geschah, wenn man starb? Kellen wurde schwindelig. Er schloss die Augen. Eine weiche Hand legte sich auf seine Brust. Wärme, Trost, Frieden strömten in seinen Körper wie Wasser in einen leeren Krug.
„Livan has nerviyen.“ Wie sanft, wie melodiös! Die Stimme einer Göttin. Zwei hellblaue Augen, schön wie das Licht der Sterne. Dann wurde es dunkel um Kellen.
Verfolgt
Vier Scheinwerfer tauchten den eleganten, stattlichen Mann auf der Bühne in grelles Licht. Er trug einen modischen, anthrazitfarbenen Anzug über einem legeren, weißen Hemd. Der sorgfältig gestutzte schwarze Vollbart nahm den markanten Konturen seines Gesichtes die Härte und unterstrich seine zu hundert Prozent seriöse Aura.
Beängstigend, schoss es Ben Hartzberg durch den Kopf. Er saß im Zuschauerraum und beobachtete den Mann auf der Bühne, seine ruhigen ausladenden Gesten, lauschte seiner sonoren Stimme und fragte sich, ob es wohl überhaupt etwas auf dieser Welt gab, das dieser Mann nicht hätte verkaufen können. Das war kein billiger Betrüger und kein Spinner. Dieser Kerl war ein Vollprofi. Und das machte ihn so gefährlich.
Da! Ben erkannte ein kurzes Zucken am Mundwinkel des Mannes. Nur für den Bruchteil einer Sekunde zeigte er ein abschätziges Lächeln. Triumph und Freude über eine erfolgreich aufgetischte Lügengeschichte ließen sich nie vollständig verbergen. Und der Triumph an diesem Abend hätte für den Mann auf der Bühne größer nicht sein können. Im Zuschauerraum saßen Leute, die schon mit dem festen Vorsatz gekommen waren, ihm zu glauben. Und das taten sie nur allzu gerne. Wie Zombies hingen sie an seinen Lippen, aufnahmebereit mit geöffneten Augen und Mündern. Und der Saal war voll!
Scheiße, das konnte hässlich werden, dachte Ben. Vorsichtig sah er hinüber zu seinem Kumpel Maus, der auf der anderen Seite des Saals ein paar Reihen hinter ihm saß. Sein Blick wurde von einem breiten selbstzufriedenen Lächeln quittiert. Entweder hatte Maus die fanatische Stimmung im Saal noch nicht bemerkt, oder er wollte sie nicht bemerken. Er fläzte respektlos in seinem Klappsessel und verfolgte das Geschehen auf der Bühne mit unverhohlener Verachtung und einer Spur Belustigung. Ben fragte sich, ob er dem eleganten Mann auf der Bühne schon aufgefallen war. Nicht nur wegen seiner legeren Sitzhaltung. Auch sonst war Maus nicht wirklich unauffällig. Ihn als Mix aus Computer-Nerd und Kleinstadt-Rapper zu bezeichnen traf es am besten. Seine viel zu große Jeans hing unter der Basketball-großen Wampe. Dazu trug er ein Bushido-T-Shirt mit Ketchup-Flecken, eine Trainingsjacke und - ausgerechnet heute - eine klischeehaft-große, goldene Kette. Sein Gesicht hätte man für das eines 16-Jährigen halten können, jedenfalls wenn sich Maus gelegentlich rasiert hätte. Nicht einmal die Basecap hatte er abgenommen. Maus lebte das Bild, das er selbst von sich hatte. Hin und wieder war das liebenswert, manchmal aber auch nur peinlich.
„Und ich bitte Sie eindringlich, verehrte Damen und Herren. Nein, ich flehe Sie an: Machen sie nicht den Fehler, den so viele andere Menschen auf diesem Planeten machen. Schließen Sie nicht Ihre Augen! Sehen Sie das Unvermeidbare, das bald geschehen wird! Erkennen Sie den einzig wahren Weg, der sich Ihnen öffnet!“
Markus Zöllner - der elegante Mann auf der Bühne - stellte plötzlich jede Bewegung ein und blickte mit weit geöffneten, durchdringenden Augen in die Menge. Erst als Zöllner sich sicher war, dass er die Aufmerksamkeit aller Zombies im Saal hatte, fuhr er fort.
„Sie werden kommen“, sagte er leise und öffnete dabei betont lässig den Knopf seines Jacketts. „Machen Sie sich bitte nichts vor. Die Zeichen sprechen eine klare Sprache. Sie werden bald kommen. Und dann werden sie wissen wollen, wer auf ihrer Seite steht und wer gegen sie ist.“
Einige Zuschauer nickten eifrig, andere hielten sich angstvoll die Hand vor den Mund.
„Sie werden fragen, wem sie vertrauen können und wem nicht. Denken Sie nicht, dass sie das wissen wollen? Ich an ihrer Stelle würde das wissen wollen.“
Ein paar mehr Zombies nickten. Maus schüttelte grinsend den Kopf. Idiot! Mach nicht alles kaputt. Das hier ist nicht Klingelmännchen. Das hier ist eine Nummer größer. Und gefährlicher.
Zöllner wurde jetzt lauter. Dazu zeigte er mit seinem ausgestreckten Finger wahllos auf seine Zombies.
„Aber was ist mit Ihnen? Stehen Sie auf der Seite der Ankömmlinge? Werden Sie Ihnen helfen? Oder wollen Sie lieber zu denen gehören, die von ihnen vernichtet werden? Wie Würmer im Dreck, die dem Bau einer Schnellstraße im Wege sind?“
Die letzten Worte spie er aus. Auf einer Großleinwand hinter ihm wuchs das Bild eines kohlrabenschwarzen Raumschiffs zu gewaltiger Größe heran. Es wurde unruhig im Stadtteilzentrum. Angst, Unsicherheit, Fragen vermischten sich. Die Zuschauer verlangten nach einer Lösung des Rätsels. Zöllner hatte sie da, wo er sie haben wollte. In den nächsten Minuten würden sie alles tun, was er von ihnen verlangte. Ben wusste, dass es am Ende darauf hinauslief, dass Zöllner ordentlich Geld von ihnen einsacken würde. Es war offensichtlich und es wäre nicht das erste Mal.
Markus Zöllner war ein begnadeter Lügner, ein Demagoge und in direkter Folge ein steinreicher Mann. Seine Geschichte: Eine außerirdische Zivilisation, die der Ochdoi, plante, schon bald auf der Erde zu landen und dort sesshaft zu werden. Die Menschheit wurde dabei - wohlwollend formuliert - als lästiges Geschmeiß empfunden. Trotzdem gab es Hoffnung, nämlich für die Menschen, die die Ochdoi als nützliche Lakaien anerkannten. Und da kam Zöllner ins Spiel. Denn er war einer von ganz wenigen Kontaktpersonen der Außerirdischen auf der Erde - mit dem Auftrag, die Ankunft vorzubereiten und Verbündete unter den Menschen zu finden. Letztere konnten sich auf ein paradiesisches Leben freuen, denn die Ochdoi würden zum Dank schwere Krankheiten ebenso gründlich ausmerzen wie Gewalt, Umweltprobleme, inkompetente Politiker und nervige Chefs.
Diese furchtbar abenteuerliche Geschichte würzte Zöllner mit UFO-Videos, Entführungserlebnissen, Tonaufnahmen von außerirdischen Stimmen und vielen anderen fantasiereichen Details. Natürlich wurde er von den Allermeisten trotzdem für einen Spinner gehalten. Andere aber glaubten ihm. Und es wurden immer mehr. 10.000 sollten es alleine schon in Deutschland sein, ein anderer „Kontaktmann“ in den USA brachte es bereits auf 60.000 bestens vernetzte Ochdoi-Fanatiker.
Maus war vor einem Jahr im Web auf Zöllner gestoßen und hatte seinen Siegeszug seitdem verfolgt. Erst waren es nur ein paar spektakuläre Videos bei YouTube und eine Seite bei Facebook. Dann kamen die ersten Auftritte auf Bühnen und in Talkshows. Schließlich veranstaltete Zöllner Seminare und verkaufte Bücher und DVDs in großen Mengen. Übrigens auch an viele, die sich für schlau und aufgeklärt hielten, aber trotzdem beim Thema „Zöllner“ mitreden wollten.
Markus Zöllner spielte als skrupelloser Hochstapler in der allerersten Liga. Und damit passte er hervorragend ins Beuteschema von Maus, Ben und Viktoria. Jemand musste ihn bloßstellen, musste den Menschen zeigen, was Zöllner wirklich im Schilde führte. Der Zeitpunkt für „Operation Rosswell“ war gekommen.
Ben sah zurück zu Maus. Der amüsierte sich noch immer über Zöllners Riesen-Raumschiff. Herschauen, Idiot! Maus sah ihn an. Sein Lächeln wich schlagartig einem ernsthaften und entschlossenen Gesichtsausdruck. Ben nickte ihm langsam zu. Maus verstand und schickte im Rekordtempo eine SMS los: „R&R“ - die Abkürzung für „Rock 'n Roll“. Das war das Startsignal für Viktoria.
Unglaublich! Es funktionierte von Mal zu Mal besser. Markus Zöllner war zufrieden. Und dabei war ihm völlig egal, ob es an seinem Talent als Redner lag oder daran, dass immer mehr von sich aus bereitwillig diesen Ochdoi-Unsinn schluckten. Dummes Volk! Wohlhabendes Volk! Zöllner hatte keinerlei Skrupel, diese Leute nach Strich und Faden auszunehmen. Er zwang sie ja nicht dazu. Wenn sie zahlten - und sie würden auch an diesem Abend zahlen - dann doch freiwillig. Aus Dummheit, aber freiwillig. Früher hatte er sich immer gefragt, wie so viele Deutsche so naiv sein konnten, auf einen cholerischen Zwerg wie Hitler hereinzufallen - damals vor mehr als 70 Jahren. Und er war sich sicher gewesen, dass so etwas heute in dieser aufgeklärten Zeit nicht mehr passieren konnte. Inzwischen war ihm klar, dass die gleichen Mechanismen immer noch funktionierten und immer funktionieren würden: Unmut, Angst, Zorn und schließlich das Angebot einer einfachen Lösung. Ein passabler Teil der Menschheit war damit zu packen. Er war groß genug, um ihn, Markus Zöllner, zu einem reichen Mann zu machen.
Und damit begann der beste Teil des Abends.
„Wenn das so ist, dann kommen Sie! Treten Sie in den Kreis derer, auf die die Ankömmlinge nicht verzichten können und wollen. Heißen Sie die Ochdoi willkommen! Geben Sie ihnen, was sie wollen! Dann werden sie es Ihnen hundertfach vergelten. Helfen Sie Ihnen! Und helfen Sie mir, damit ich ihnen einen angemessenen Empfang bereiten kann. Sie zählen auf mich.“ Eine kurze Pause. „Und ich zähle auf jeden Einzelnen von Ihnen!“
Tosender Jubel. Zöllner sah, dass ein paar von Ihnen bereits den Geldbeutel gezückt hatten, obwohl er von Spenden noch gar nichts gesagt hatte. Großartig!