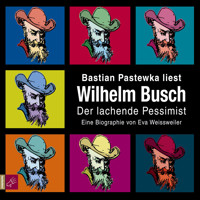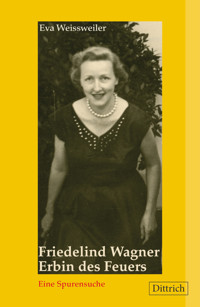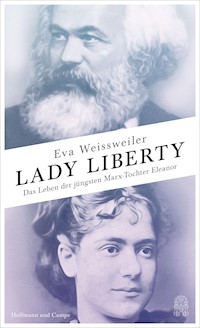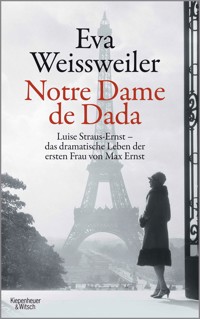19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Sie war nicht nur die Fluchthelferin des großen Philosophen Walter Benjamin, auch ihr Wirken im frühen antifaschistischen Widerstand, ihr politisches Exil zwischen Prag und Paris, ihr Engagement in der amerikanischen Friedensbewegung sowie ihre Freundschaft zu Barack Obama prägten maßgeblich Lisa Fittkos Leben. Bis ins hohe Alter setzte sie sich unermüdlich ein für den Traum von Frieden und Freiheit. Eva Weissweiler legt nun die erste vollständige Biographie dieser bemerkenswerten Frau vor und wirft den Blick auf eine Zeit, in der Lebensläufe zum Spielball der Weltgeschichte wurden, in einer Weise, die die Betroffenen oft zwang, bis an ihr Lebensende ganze Kapitel ihrer politischen Biographie zu verschweigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Ähnliche
Eva Weissweiler
Lisa Fittko
Biographie einer Fluchthelferin
Sachbuch
Meinen Enkeln Anna und Anton B.
Vorwort
»Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen.«
William Faulkner, Requiem für eine Nonne, 1951
Als ich anfing, im Kollegenkreis über dieses Projekt zu sprechen, waren die Reaktionen geteilt. Die einen sagten: »Lisa Fittko? Wer ist das denn?« Die anderen: »Ach, das war ja die Fluchthelferin von Walter Benjamin!« Das sind die beiden Pole, zwischen denen sie sich in der öffentlichen Wahrnehmung bewegt: zwischen völliger Unbekanntheit und zwei Tagen im Leben eines berühmten Philosophen, den sie auf seinem Weg bis zur spanischen Grenze begleitet hat, bevor er sich in einem kleinen Hotel in Portbou umbrachte.
Diese Reduktion fand ich frauenfeindlich und falsch. Ich wollte mehr von ihr hören, lesen und wissen, nicht nur das Kapitel »Der alte Benjamin« aus ihrem Buch Mein Weg über die Pyrenäen, das seit seinem Erscheinen im Jahr 1985 unzählige Male zitiert, nacherzählt und reinszeniert worden ist, kritisch und unkritisch, verherrlichend und mit pfadfinderischem Ehrgeiz. Sie selbst hat oft ärgerlich reagiert, wenn sie immer wieder auf Walter Benjamin und seine schwarze Aktentasche angesprochen wurde, die sein angeblich wichtigstes Manuskript enthalten haben soll, nach dem bis heute vergeblich gesucht wird. Nach dem Philosophen ist der Weg, den sie damals gegangen sind, benannt worden, »Le Chemin Benjamin«, er zieht Jahr für Jahr Tausende von Reisenden an, während von all den anderen Flüchtlingen, die Lisa Fittko geführt hat, nicht mehr die Rede ist: Juden und Nicht-Juden, Kommunisten und Sozialisten, Ärzte, Juristen, Politiker, Schriftsteller, Soldaten, Kriegsgefangene, ganze Familien, Schwerkranke, sogar Kinder. Für sie alle gilt, was Walter Benjamin in seinen Notizen über den Begriff der Geschichte einmal gesagt hat: »Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten.«
Bei meinem Versuch, Lisa Fittkos Lebensweg nachzugehen, bin ich auf Lücken und Widersprüche gestoßen, die in der Geschichte des 20. Jahrhunderts begründet sind. Sie stammte aus einer Familie, die traditionell »links« eingestellt war. Ihr Vater war Gründungsmitglied der KPÖ und Herausgeber einer sozialistischen Zeitschrift, ihre Mutter Mitglied der Roten Hilfe. Sie selbst trat mit fünfzehn in den Kommunistischen Jugendverband und mit Neunzehn in die KPD ein, wo sie wichtige Funktionen ausübte, auch im Exil. Das alles musste sie streng geheim halten, als sie 1955 amerikanische Staatsbürgerin wurde, nach Jahrzehnten der Heimatlosigkeit endlich irgendwo angekommen. Es war mitten in der McCarthy-Ära, auf dem Höhepunkt der Verfolgung von Kommunisten und »kommunistischen Umtrieben«. Man hätte sie bei dem geringsten Verdacht sofort ausgewiesen oder wegen Meineids vor Gericht gestellt, obwohl sie einen schwerkranken Mann und zwei alte Eltern zu versorgen hatte, die ohne sie völlig hilflos gewesen wären.
Als ihr erstes Buch Mein Weg über die Pyrenäen1985, während der Amtszeit von Ronald Reagan, erschien, war der Kalte Krieg immer noch nicht vorbei. Sie war also weiter zum Verschweigen wichtiger Kapitel ihres Lebens gezwungen, wenn sie auch niemals geleugnet hat, wer sie war: Antifaschistin, Widerstandskämpferin und politische Emigrantin. Erst in ihrem zweiten Buch, Solidarität unerwünscht, Erinnerungen 1933–1940, das nach der »Wende«, 1992, erschien, wagte sie es, etwas genauer zu werden, wenn auch das Wort »Kommunismus« nirgendwo auftaucht. Ihr Bruder, Hans Ekstein, ein bekannter Physiker, hatte sie als Erster auf diesen Widerspruch hingewiesen:
Ich glaube, der politisch aufmerksame Leser wird sich fragen müssen: Was für eine Art von politischer Emigrantin ist die Autorin? Für welche politischen Gruppen steht sie? Als sie diese antifaschistischen Flugblätter verteilte – für welche Partei arbeitete sie? Das Wort »antifaschistisch« scheint mir als Schlagwort zu dienen, das den Leser im Dunkeln lässt. […] Es wäre am besten, Dir eine Ausrede einfallen zu lassen, wenn jemand unangenehme Fragen stellt.[1]
Doch die kamen, wie es scheint, niemals auf, jedenfalls nicht in Deutschland, wo das zweite Buch kaum noch beachtet wurde, da es nicht von einer Kultfigur wie Walter Benjamin handelte, sondern vom schmerzlichen Alltag einer jungen politischen Emigrantin, die einerseits um das schiere Überleben kämpfte, während sie sich andererseits immer wieder fragte und fragen lassen musste, wie es nur möglich gewesen sei, dass Hitler überhaupt an die Macht kam? Ob die deutsche Linke wirklich alles getan hätte, um seinen Sieg zu verhindern oder ihn mit ihrer chronischen Zerstrittenheit sogar noch befördert hätte?
Dieses Buch, das ich aufgrund der schwierigen Quellenlage eher als »Annäherung« denn als »Biographie« verstehe, ist nicht der Versuch einer Heiligenverehrung. Es handelt auch nicht von Lisa Fittko und Walter Benjamin allein, sondern von vielen anderen, die sich dem Nazi-Regime unter Einsatz ihres Lebens widersetzt haben, von den sogenannten stillen Heldinnen und Helden, deren Geschichte erst noch geschrieben werden muss.
1Die Heimatlose
(Uschhorod, Budapest, Wien, 1909–1921)
Uschhorod
Forscht man in amerikanischen Archiven über Lisa Fittko,[2] wird man feststellen, dass fast in jedem Dokument ein anderes Geburtsland angegeben ist: Österreich, Österreich-Ungarn, Tschechoslowakei,[3] Ukraine. Nur der Ort, Ungvar oder Uschhorod, bleibt derselbe, eine kleine Stadt in Transkarpatien, die seit Lisa Fittkos Geburtsjahr 1909 immer wieder den Namen und die »Nationalität« wechselte: Ursprünglich zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörend, wurde sie 1919 tschechisch, 1938 ungarisch, 1944 sowjetisch und 1991 ukrainisch. Sie ist geprägt von österreichischer Barockarchitektur, sowjetischen Plattenbauten, russischen Gasleitungen und japanischen Kirschbäumen. Es gibt viel Industrie dort, aber auch schöne Lindenalleen, die sich am Ufer des Usch, zu Deutsch: Schlange, entlangziehen. Von Wien nach Uschhorod, wie die Stadt heute heißt, braucht man mit dem Zug etwa zehn Stunden, mit dem Flugzeug fünf Stunden weniger. Bis vor wenigen Jahren war es ein Ort, den kaum jemand kannte. Doch durch den Krieg in der Ukraine ist er plötzlich in die Schlagzeilen geraten. Da er im äußersten Südwesten des Landes liegt und bisher von Bombenangriffen verschont geblieben ist, kommen viele Flüchtlinge hierher, die in Schulen, Turnhallen und anderen Notunterkünften untergebracht werden. Vor dem Krieg lebten ungefähr 120000 Menschen hier. Heute sollen es fast 50000mehr sein. Die Solidarität unter den Einheimischen ist enorm. Viele haben Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Aber auch Menschen aus anderen Teilen der Ukraine kommen und helfen, versorgen Kranke, kümmern sich um Kinder oder verteilen Essen im ehemaligen Weinkeller »Delfin«: Spaghetti bolognese, Eintopf mit Hähnchen, Gemüsesuppe, Buletten, ungefähr zwei bis drei Tonnen täglich. Im Sommer sieht es manchmal aus wie im Frieden: volle Caféhausterrassen, Betrieb auf der Uferpromenade, lachende Kinder, die Tauben füttern, ja sogar der Plastikmüll auf der Usch fehlt nicht. Aber da ist auch die Angst. Fast bei jedem. Sogar die Kinder haben eine Luftalarm-App auf dem Handy.
Lisa Fittko hat das alles nicht mehr erlebt. Müßig zu fragen, was sie wohl dazu gesagt hätte. In den vielen Interviews, die sie im Laufe ihres Lebens gegeben hat, sagte sie, dass sie über ihren Geburtsort kaum etwas wisse, weil sie vier Wochen nach ihrer Geburt weggezogen seien. Es sei der Arbeitsort ihres Vaters gewesen, weiter nichts. Der pure Zufall habe die Eltern in diese Gegend verschlagen, in diese Stadt mit dem unaussprechlichen Namen, in der ihr Bruder Hans und sie selbst geboren wurden. Danach seien sie nach Budapest, Wien und Berlin gezogen. Mit Uschhorod habe sie, außer auf dem Papier, nie etwas zu tun gehabt.[4]
Vielsprachig
Ihr Vater Ignaz (eigentlich »Ignaz Isak«) Ekstein, geboren 1873 in Pilsen, leitete in Uschhorod eine Möbelfabrik, die Mundus AG, die zum selben Konzern wie die örtlichen Elektrizitätswerke gehörten. Die Firma war bekannt dafür, besonders exklusive Modelle herzustellen, Stühle aus edlen Hölzern in modernen Formen, aber auch noble Hoteleinrichtungen, Kinosessel und Büromobiliar nach Entwürfen von Adolf Loos, Otto Wagner und Gustav Siegel.[5] In ihren Filialen beschäftigte sie über 4000 Arbeiter, die sonst kein Auskommen gehabt hätten, denn »Transkarpatien«, die Gegend um Uschhorod, war arm und unterentwickelt. Es gab viele Tagelöhner, Arbeitslose und Bauern, die unter den unhygienischsten Verhältnissen lebten. Ihre erbärmlichen Katen brannten oft ab oder wurden von Sturm und Regen verwüstet.[6] Viele Menschen aus dieser Region sahen keinen anderen Ausweg als die Emigration. Zwischen 1890 und 1913 sollen etwa 800000 Menschen Transkarpatien verlassen haben und nach Amerika gegangen sein. Andere fuhren als schlecht bezahlte Saisonarbeiter nach Deutschland.
In Uschhorod wurden viele Sprachen gesprochen: Ukrainisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Jiddisch, Slowakisch und Deutsch. Es war ein extrem buntes Völkergemisch. Ignaz Ekstein konnte sich in den meisten dieser Idiome verständigen. Später würde er einmal behaupten, 24 Sprachen zu sprechen.[7] Das war vielleicht etwas übertrieben, aber auch nicht ganz falsch. Er war sehr polyglott, seine Frau ebenfalls. Meistens sprachen sie Deutsch miteinander, aber auch Tschechisch, denn beide stammten aus Böhmen. Kein Wunder, dass auch Lisa ein Sprachgenie wurde. Ob in Holland, Frankreich, Kuba oder Amerika, in welchem Exilland auch immer, sie lernte die Sprache erstaunlich schnell und fast völlig akzentfrei, was sie, um einen Buchtitel von Irmgard Keun zu zitieren, zu einem echten Kind aller Länder machte.
Keine Kindheit?
In ihren beiden autobiographischen Büchern Mein Weg über die Pyrenäen[8] und Solidarität unerwünscht[9] verrät sie kaum etwas aus ihren Kinderjahren. Das erste beginnt mit einem Brief, den ihr Vater nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Kollegen namens Oskar Maurus Fontana erhalten hat, das zweite setzt am 30. Januar 1933 in Berlin ein, dem Tag der sogenannten Machtergreifung, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Über ihre Zeit in Budapest, Wien und dem Berlin der zwanziger Jahre erfährt man fast nichts. Nur in einigen ihrer zahlreichen Interviews äußerte sie sich auf direktes Befragen dazu, fast etwas unwillig, wie es scheint. Unwillig und mit großen Erinnerungslücken, sodass alles aus Sekundärquellen rekonstruiert werden muss, mühsam und hypothetisch natürlich.
Ignaz Ekstein hatte Uschhorod schon ein paar Wochen vor Lisas Geburt verlassen, um eine Stelle in Budapest anzutreten, wieder bei der Mundus AG, wahrscheinlich zu besseren Konditionen. Das Unternehmen erlebte damals gerade eine Blütezeit, lieferte Möbel in die ganze Welt und war eng mit der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank verbunden, deren Palais es vollständig ausgestattet hatte. Es stand für Fortschritt und Sachlichkeit, Abkehr vom Biedermeier, edles Material, Förderung der einheimischen Holzwirtschaft und faire Behandlung der Arbeiter. Die Presse hat jedenfalls nie über größere Streiks berichtet, obwohl die Jahre seit 1909 eine Zeit heftiger arbeitspolitischer Unruhen waren: unter Fuhrwerkskutschern, Kaffeesiedern, Bergarbeitern, Stallburschen, Zigarettendrehern, Goldgrubenarbeitern, ja sogar unter Choristen, die sich plötzlich weigerten zu singen und den Betrieb ganzer Opernhäuser stillstehen ließen. Es war kein Häuflein von Extremisten, das da protestierte. Es war ein Strom, den man nicht mehr aufhalten konnte, nicht einmal mit brutaler Gewalt. Polizisten schossen auf Streikende, Streikende auf Streikbrecher. Es gab Tote in allen Teilen der Monarchie. Durch den Streik der Fuhrwerkskutscher in Budapest kam nicht nur die gesamte Bautätigkeit zum Erliegen, auch Kohle und Lebensmittel konnten nicht mehr ausgeliefert werden, sodass eine echte Notlage entstand.[10]
Wie wohnten die Eksteins in Budapest? Wahrscheinlich weder besonders luxuriös noch besonders bescheiden. In Interviews berichtet Lisa von einer riesigen Wohnung mit weißen Möbeln, großen Kinderzimmern und einer Gräfin als Nachbarin, die zunächst ganz freundlich gewesen sei, bis sie sich plötzlich als Antisemitin entpuppt habe. Sie habe niemanden direkt beschimpft oder beleidigt, sondern einfach nur »Hallo, Isaak« zu Lisas Bruder gesagt, der doch in Wirklichkeit Hans hieß und gar nicht wusste, wie er das verstehen sollte.[11] Wann das war, konnte Lisa später nicht mehr genau rekonstruieren. Vielleicht zu Beginn ihrer Schulzeit im Ersten Weltkrieg? Sie sei in Budapest eingeschult worden, habe dort Ungarisch lesen, schreiben, zählen, singen und fluchen gelernt. Fast alle, die nicht selbst jüdischer Herkunft waren, seien Antisemiten gewesen, sogar die Lehrer. »Es war wirklich unglaublich«, sagte sie noch 1994.[12] Sprach sie deshalb so ungern über Budapest?
Und die Eltern? Wie haben sie darauf reagiert? In ihren Büchern sagt sie nur wenig dazu, aber in Interviews ist sie manchmal danach gefragt worden. »Meine Eltern haben mir beigebracht, dass das dumme Leute seien, die ihre Hassgefühle gegenüber einer bestimmten Gruppe ausleben.« Antisemiten seien im Grunde zu bedauern, da niemand ihnen erklärt habe, was Toleranz und was »Menschsein« bedeuteten.[13] In einem Brief an ihren Cousin Fritz hat sie noch einmal präzisiert, ihr Vater habe wörtlich gesagt: »Antisemitismus ist der Sozialismus der Dummen.«[14]
Damals, noch in Budapest, waren die Eksteins Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die sie erst 1919 in Wien verließen. In die Synagoge gingen sie aber trotzdem nicht, geschweige denn dass sie sich an die religiösen Gebote gehalten, den Sabbat gefeiert oder gar koscher gegessen hätten. Als die kleine Lisa ihre Eltern einmal fragte, ob sie an Gott glaubten, sagten sie, nein, jedenfalls nicht an den, von dem die Rabbiner sprächen. Sie seien in erster Linie Menschen, nicht Juden. Wie sie, Lisa, es später einmal halten wolle, müsse sie selbst entscheiden.[15]
E.K. Stein
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges liefen die Geschäfte der Mundus AG immer schlechter, denn der Export exklusiver Möbel war kaum noch möglich, sodass die Produktion massiv eingeschränkt werden musste. Der Vater beschloss, sich ein neues Standbein im Journalismus zu suchen, zumal er sich ohnehin mehr als Literat denn als Kaufmann fühlte. Er war sehr belesen, wie seinen Briefen und Manuskripten zu entnehmen ist, in denen er Shakespeare, Sigmund Freud, Moses Mendelssohn und Karl Marx zitiert. Vielleicht verband ihn das mit Julie, seiner Frau, geborene Schalek, die aus einer angesehen Prager Buchhändler- und Verlegerfamilie stammte?
In Wien gab es seit 1898 eine Wochenschrift für Volkswirtschaft, Politik, Literatur und Kunst, Die Wage.[16] Sie vertrat ausgesprochen fortschrittliche Positionen, weshalb sie von der Zensur streng überwacht wurde. Der spätere österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky erzählte einmal, dass sein Vater zu ihren regelmäßigen Lesern gehört habe.[17] Schon in der ersten Zeit ihres Bestehens gelang es der Redaktion, Unterschriften von 16000 Lesern von Wien bis Czernowitz zu sammeln, die sich solidarisch mit dem französischen Schriftsteller Émile Zola erklärten, als er wegen der »Affäre Dreyfus« vor Gericht stand.[18]
Unter dem Pseudonym E.K. Stein begann Ignaz Ekstein seit 1916 regelmäßig für Die Wage zu schreiben, über Shakespeare, August Strindberg, die politische Situation in Ungarn, städtische Schulerziehung, Menschen im Krieg, über französische Kriegsbücher, Volksverhetzung, Beethoven, den Pazifismus, Kindsmörderinnen, Trotzki und vieles mehr. Inhaltlich gab es gewisse Ähnlichkeiten mit der Fackel des berühmten Karl Kraus, der zu den Autoren der ersten Stunde gehört hatte. Ekstein hoffte eines Tages Herausgeber der Wage zu werden, auch wenn er dafür sein ganzes Vermögen hergeben müsste.
Die Familie führte von nun an ein sehr unruhiges Leben, in dem von beschaulicher Kindheit keine Rede sein konnte. Zeitweise hatten sie mindestens zwei Wohnungen, eine in Wien und eine in Budapest. Sie lebten mal getrennt, mal zusammen, mal hier, mal dort, Hans mehr beim Vater, Lisa mehr bei der Mutter. Sie pendelten zwischen zwei Ländern, zwei Sprachen, zwei Kulturen. Ekstein war sehr gebildet und korrespondierte mit führenden Intellektuellen seiner Zeit, Arthur Schnitzler zum Beispiel,[19] aber sein Einkommen als Journalist war sehr unregelmäßig, was zu mancher Krise in dieser Ehe geführt haben muss. Doch eine Köchin und ein Kindermädchen gab es immer. Denn bei aller Sympathie für den Sozialismus wollte man doch comme il faut leben, wie gehobene Bildungsbürger eben, auch wenn es oft genug nur wenig zu essen gab.[20] Seltsamerweise wurde Ekstein nicht eingezogen, obwohl er bei Kriegsbeginn erst 41 Jahre alt war. Das war ungewöhnlich. Denn es galt die allgemeine Wehrpflicht, die, so wie der Krieg insgesamt, fast überall laut bejubelt wurde, auch unter Juden, Demokraten und Sozialisten.
»Dieser Krieg«, schrieb der Pester Lloyd am 31. Juli 1914, »hat nicht nur die nationalen, er hat auch die sozialen Gegensätze in beiden Ländern zum Schwinden gebracht. Es ist etwas Wundersames um die ausgleichende Gerechtigkeit der allgemeinen Wehrpflicht. Alle […] Menschenkraft hat für den Ruhm und die Ehre des Vaterlands einzustehen. […] Hohe Aristokraten Österreichs und Ungarns eilen unter die Fahne, und auch das arbeitende Proletariat erklärt sich mit den Zielen dieses Krieges solidarisch. […] Mit Serbien werden wir fertig werden. Daran hat die Welt keinen Moment gezweifelt.«[21]
War Ekstein vielleicht krank, sodass er für untauglich erklärt wurde? Oder gelang es ihm, Beschwerden, etwa psychischer Art, vorzutäuschen? Dann muss er ein Meister der Verstellungskunst gewesen sein und sich sehr gut ausgekannt haben. Nicht einmal Sigmund Freud schaffte es, seine drei Söhne vor dem Dienst an der Front zu bewahren, obwohl er den Krieg aus ganzem Herzen verabscheute und in seinem Aufsatz »Zeitgemäßes über Krieg und Tod« schreiben würde, noch nie habe ein Ereignis »so viel kostbares Gemeingut der Menschheit zerstört, so viele der klarsten Intelligenzen verwirrt [und] so gründlich das Hohe erniedrigt«.[22]
Tante Malva
Wenn Lisa in diesen Jahren in Wien war, wohnte sie meistens bei Malva Schalek, der jüngeren Schwester ihrer Mutter, die, ihrerseits kinderlos, Kinder sehr liebte.[23] Sie war damals noch eine junge Frau, gerade erst Mitte 30, und schon sehr berühmt, vor allem in Wiener Gesellschaftskreisen. Von der Familie nach Kräften gefördert, hatte sie ein Studium an der Münchner »Damenakademie« absolviert, da Frauen der Zutritt zu den regulären Kunsthochschulen verwehrt war. Zurück in Wien, wurde sie von einem Onkel unterstützt, dem ein Teil des Theaters an der Wien gehörte. Dort hatte sie ein romantisches Atelier unterm Dach, vollgepackt mit Bildern, Requisiten und Staffeleien, in dem sich die Reichen und Schönen einfanden, um sich porträtieren zu lassen. Neben Schauspielern, Geschäftsleuten und Gesellschaftsdamen kamen aber auch Malerinnen, Ärztinnen, Anwältinnen und Schriftstellerinnen zu ihr. Denn wenn sie auch die Honorare der Prominenten brauchte, um überleben zu können, war ihr doch wohler unter ihresgleichen, unter anderen starken, autonomen Frauen, die gegen den Widerstand der Gesellschaft ihren Weg gingen.
Nur wenige ihrer Porträts haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, darunter eins von der kleinen Lisa. Es heißt »La Poupée à la mode« (»Die Modepuppe«), zeigt aber ein durch und durch uneitel wirkendes Kind im roten Russenkittel, dem die dicken schwarzen Zöpfe fast bis zur Taille hängen. Es scheint ganz in sich gekehrt, ganz mit einer Handarbeit oder Bastelei beschäftigt zu sein, scheint die Malerin oder Fotografin gar nicht wahrzunehmen.[24] Die langen Beine baumeln bis knapp über den Boden, auf dem Nähutensilien liegen: ein Maßband, ein Karton mit Stoffresten. »Modisch« wirkt eigentlich nur die Puppe, die klein und fremd neben ihr sitzt, platinblond, die Augen weit aufgerissen, das Kinn erhoben. Doch Lisa beachtet sie gar nicht. Sie ist einfach nur bei sich selbst und ihren Gedanken, die dem Betrachter verborgen bleiben.
Grippe und Revolution
Für Lisa war es besser, nicht zu oft nach draußen zu gehen, sondern bei Tante Malva im Atelier zu bleiben, unter dem Dach des Theaters an der Wien, wo schon Beethoven kurze Zeit gewohnt hatte, wo alles nach Leim, Farbe, Puder und Kolophonium roch, wo man phantastisch kostümierte Menschen sah, wo dauernd Musikfetzen durch die Gänge schwebten und wo man mit etwas Glück Franz Léhar oder Emmerich Kálmán begegnen konnte, den Begründern der »Silbernen Operettenära«. Draußen auf den Straßen sah es schauerlich aus. Überall Bettler und Kriegsversehrte, Ganoven, Obdachlose und Kinder, die nach ihren Eltern suchten. Im Winter 1916/17 gab es außer Steckrüben kaum noch etwas zu essen. Tausende Menschen verhungerten und erfroren, zum Teil auf offener Straße. Und in den Gasthäusern durfte kein Brot mehr auf den Tisch gebracht werden, von Kuchen oder anderen Mehlspeisen ganz zu schweigen.
Weil es an Kriegsmaterial fehlte, wurden Kerzenleuchter, Mörser, Bügeleisen, Kupferkessel und Badeöfen requiriert, ja sogar Türklinken aus Privatwohnungen. Trotzdem herrschte immer noch große Kriegsbegeisterung, sogar während der Schlachten im Isonzo-Tal, als Phosphorgranaten und die verschiedensten Giftgase eingesetzt wurden, sodass Tausende von Italienern tot oder betäubt in den Felsen lagen, die meisten erst 16 oder 17 Jahre alt, nur zehn Jahre älter als Lisa.
Im November 1918, als die meisten ehemaligen Kronländer der Monarchie sich von Österreich lösten, wurde auch in Ungarn eine unabhängige Republik ausgerufen. Friedlich, wie es zunächst aussah. Die alten Kasernen und Kanzleigebäude aus der Habsburgerzeit konnten fast ohne Widerstände besetzt werden. Das Volk feierte seinen Sieg mit weißen Herbstrosen. Doch im Umland, besonders in der Gegend von Bratislava, damals noch Pressburg, tobten heftige Kämpfe zwischen Tschechen, Ungarn und Österreichern, alliierten Truppen und versprengten Deutschen. Für Julie Ekstein stand fest: Sie wollte weg aus dem Chaos, wollte nach Wien zu ihrem Mann. Es wurde keine Post mehr befördert, es gab keinen Schulunterricht mehr, man musste um »Mehlkarten« anstehen, Militärpolizei wurde eingesetzt, Soldatenräte übernahmen die Macht. Auch das Wetter war trostlos, ein ungewöhnlich stürmischer Herbst mit Regen und Schnee. Es fehlte an Heizmaterial für die riesige Wohnung, in der die Kinder wie besessen herumtollten, um sich aufzuwärmen. Sie waren völlig außer Rand und Band, nicht mehr zu zügeln oder gar zu »erziehen«. Julie Ekstein wusste sich keinen Respekt mehr zu verschaffen, zumal noch ein drittes Kind in ihre Obhut gekommen war, Mita Eisner, die Tochter ihrer früh verstorbenen Schwester Olga.[25]
Ekstein telegraphierte ihnen, dass sie versuchen sollten, mit dem Zug zu kommen und vor allem die Gegend um Pressburg zu meiden. Die Stadt sei mit Flüchtlingen überfüllt. Heimkehrende slowakische Soldaten brächen in jüdische Geschäfte ein, um Lebensmittel und Spirituosen zu stehlen.[26] Auf der Donau seien sogar schon Schiffe überfallen worden. Doch die Mutter erklärte, sie hätten keine andere Wahl. Sie müssten ein Schiff nehmen, da die Bahnstrecken fast völlig zerstört seien.
Reguläre Fahrkarten waren allerdings nicht zu bekommen. Sie mussten mit einem Militärschiff fahren, als blinde Passagiere sozusagen. »Merkwürdige Gestalten« halfen ihnen, sich unter Deck zu verstecken. Das war das erste Mal, dass Lisa Bekanntschaft mit »Fluchthelfern« machte. Man hatte sie schon vorher in bestimmten Hafenkneipen getroffen, wo sie ab und zu auftauchten, finstere Männer, die so aussahen, als seien sie gerade einem Märchen oder einem Abenteuerbuch entstiegen. »Jetzt ist es wieder so weit, jetzt geht wieder ein Schiff«, raunten sie den ungeduldig Wartenden zu. Lisa fand das sehr aufregend.[27]
Die Mutter wagte sich auf der ganzen Fahrt nicht ins Freie, sondern versteckte sich irgendwo in einer Kajüte. Aber die Kinder konnten nicht immer stillhalten, auch wenn man sie mit Malbüchern abzulenken versuchte. So liefen sie manchmal doch auf dem Deck herum und kamen mit der beruhigenden Nachricht zurück, dass sich außer Soldaten und Matrosen auch einige »Zivilisierte« da oben befänden, was sich als geflügeltes Wort in der Familie einbürgern würde.[28]
Weil der Vater dringend vor Gefahren aller Art gewarnt hatte, hoffte Lisa inständig, dass etwas richtig Aufregendes passieren würde. Ein Bombenangriff? Ein Beschuss? Eine Plünderung? Eine Meuterei? Aber es geschah nichts. Das Schiff fuhr ganz ruhig und gelassen über die Donau, fast wie in Friedenszeiten. Sie war beinahe enttäuscht, als sie unbehelligt in Wien ankamen, wo sie von einem erleichterten Vater empfangen wurden.[29]
Krieg und Frieden
Wieder ein neues Quartier, wieder ein Neuanfang, in einem riesigen Haus Ecke Franzensgasse/Margaretenstraße im fünften Bezirk. Die Wohnung war viel zu groß für sie, zehn bis zwölf Zimmer, je nachdem, ob man alle Durchgangsräume mitzählte. Eins davon war ein richtiger Tanzsaal, weinrot gestrichen, ideal zum Herumtollen. Lisas Mutter war gar nicht begeistert, wenn sie daran dachte, wie hoch die Heizkosten sein würden. Und das bei dem herrschenden Kohlenmangel, der so dramatisch war, dass der Verkehr der Wiener Stadtbahn nahezu vollständig eingestellt und der Verbrauch von Gas streng limitiert wurde, sodass der Betrieb in den meisten Fabriken stillstand? Doch der Vater beruhigte sie: Es würden nach und nach viele Verwandte kommen, die im Krieg ihre Wohnung verloren hätten. Sie alle würden etwas zum Familienunterhalt beitragen.
Er hatte recht. Es kamen tatsächlich sehr viele Verwandte, allerdings ohne Geld beizusteuern. Die meisten wollten nur für ein paar Tage oder Wochen bleiben, aus denen am Ende drei Jahre wurden. Auch Onkel Julius, ein Bruder von Ekstein, zählte dazu, ein charismatischer Pechvogel, der sich mal als Kinobesitzer, mal als Erfinder versuchte, meist ohne großen Erfolg. Jetzt war auch noch seine Ehe in die Brüche gegangen.
In Wien ging es kaum weniger chaotisch zu als in Budapest. Zwar hieß es, dass Österreich bald eine Republik werden sollte, ein Land ohne Kaiser, Könige, Grafen, Fürsten. Aber niemand wusste so recht, wie das gehen würde. Neue Gesetze, neue Beamte mussten her, Tausende Invaliden und »Kriegskrüppel« mussten versorgt werden, allein in Wien gab es 20000 jüdische Flüchtlinge aus den ehemaligen östlichen Kronländern, wo ihre Häuser und Geschäfte niedergebrannt worden waren. Jetzt sah man sie in Scharen vor den Spitälern stehen oder vor Notasylen auf einen Teller Suppe warten. In seiner ersten Rede fasste der neue sozialdemokratische Staatskanzler Karl Renner zusammen:
Der neue Staat hat ein Trümmerfeld übernommen. Alle wirtschaftlichen Zusammenhänge sind aufgelöst, die Erzeugung steht beinahe still, der Güterverkehr stockt, ein Viertel der männlichen Bevölkerung wandert noch fern von der Heimat. Die Vorsorge für das tägliche Brot, die Zufuhr von Kohle, die Bereitstellung der notdürftigsten Bekleidung, die Wiederaufnahme des Ackerbaues, die Aufnahme der Friedensarbeit in den Fabriken […] ist unmöglich, wenn nicht sofort alle Bürger […] geordnet zur Tagesarbeit zurückkehren.[30]
In diesem Moment, es war am 12. November 1918 nachmittags gegen vier, ertönten Schüsse. Die Menschen, die sich vor dem Parlamentsgebäude versammelt hatten, um die Ausrufung der neuen Republik mitzuerleben, hielten es zunächst für eine Täuschung, glaubten, Ziegelsteine seien vom Dach eines Neubaus heruntergefallen. Doch als das Rattern und Krachen nicht aufhörte, wurde schnell klar: Es waren Maschinengewehre. Man kannte das Geräusch noch zu gut aus dem Krieg. Irgendwo wurden rote Fahnen gehisst mit der Aufschrift: »Hoch die sozialistische Republik«. Soldaten der Roten Garde marschierten auf und schlugen mit ihren Gewehren Fenster und Türen ein, während die Masse in Panik die Flucht ergriff, »keuchend, atemlos, in gestrecktem Galopp von der Ringstraße weg, das Volksgartengatter entlang. […] Jeder glaubte, nur durch die Schnelligkeit seiner Beine dem sicheren Tode entgehen zu können.«[31] Am Ende gab es zwei Tote und mindestens 40 Verletzte. War das der Frieden, den man sich nach vier Jahren Krieg so sehr wünschte?
Die Wage
Erst nach und nach wurde klar, dass hinter dem Wiener Aufstand vom 12. November 1918 die KPÖ, die neugegründete Kommunistische Partei Österreichs stand, der Ekstein gleich zu Anfang beigetreten war.[32] Zu ihren Mitgliedern und Sympathisanten gehörten so prominente Zeitgenossen wie Egon Erwin Kisch, Leo Lania oder Hanns Eisler, sodass Ekstein sich in guter Gesellschaft befand. Was genau ihn zu diesem Parteieintritt bewog, ist nicht bekannt, zumal Lisa sich nie dazu geäußert hat. Auf einem Meldezettel vom Dezember 1918 ist vermerkt, dass er sich in »Isaak Eckstein« umbenannt habe, von Beruf Schriftsteller, verheiratet und mosaischen Glaubens sei.[33] Da seine Kinder weiterhin »Ekstein« hießen, wird diese Schreibweise im Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit beibehalten. Für Die Wage schrieb er weiterhin unter dem Pseudonym E.K. Stein.
Er hatte sich inzwischen seinen Wunschtraum erfüllen können und das Blatt als Herausgeber übernommen, wahrscheinlich zu günstigen Bedingungen, denn sein Vorgänger, Ernst Viktor Zenker, Ostasienforscher, Historiker und Politologe, hatte durch Kriegszensur, Papiermangel und persönliche Schicksalsschläge solche Einbußen erlitten, dass die Zeitschrift nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch einmal im Monat erscheinen konnte. In seinen Erinnerungen bezeichnet Zenker Ekstein als »jüdischen Spekulanten«, der das Blatt in kurzer Zeit vollkommen heruntergewirtschaftet habe, indem er es der »kommunistischen Sache« zur Verfügung stellte,[34] eine seltsame Diktion für jemanden, der einem »Verein zur Abwehr des Antisemitismus« angehörte und sich im Nationalrat für die Rechte der Juden einsetzte.[35]
In einem Punkt hatte er allerdings recht. Ekstein hatte keine glückliche Hand mit der Redaktion der Wage, die er am liebsten sofort in Wage! umbenennen wollte, um seiner Leserschaft deutlich zu machen, dass sie künftig ein Kampfblatt kommunistischer Prägung sein sollte. Im November 1918, unmittelbar nach der Gründung der neuen Republik Deutschösterreich, schrieb er:
Frisch gewagt – ist kaum halb gewonnen; wagen – verpflichtet! Nichts Halbes; besser: Alles verloren – denn halb gewonnen. Wir müssen die Völker der Entente mit uns reißen; weiter nach links, dass auch sie ihre »Le Kaiser« rechts liegen lassen. Wagen – verpflichtet; zur zähen Arbeit. Einst – gab es Arbeiter und andere; wir wollen Arbeiter sein, Alle! Die Arbeit allein, sie adelt. Edelmenschen, diese Pflicht ruft: waget![36]
Im Prolog zu ihrem ersten Buch, Mein Weg über die Pyrenäen, schreibt Lisa, dass sie, damals zehn Jahre alt, den Unterschied zwischen Wage und Wage! zunächst nicht verstanden habe. »›Die Wage soll jetzt Wage! heißen – warum denn?‹ ›Man muss wissen, wann es Zeit ist zum Wagen‹« sagte mein Vater. Sie selbst aber habe manchmal darüber nachdenken müssen, woher man denn wissen sollte, wann es Zeit ist.[37]
Wieso sie ausgerechnet diese Episode an den Anfang ihres Buches setzt und zum Leitmotiv für ihr ganzes Leben und Handeln macht, ist allerdings irritierend. Denn tatsächlich erschien nur eine einzige Nummer unter der Überschrift Wage!, nämlich am 11. Juli 1919. Sie trug den Untertitel Revolutionäre Zeitschrift und begann mit einem Artikel E.K. Steins über die »Weltrevolution, die von Millionen und Abermillionen werklustiger Hände« betrieben werden solle, im »heiligen Glauben an das neue Reich allmenschlicher Harmonie und Solidarität«. Schon ab der nächsten Nummer hieß die Zeitschrift wieder Die Wage, weil sich zu viele Leser beschwert hatten. Die finanzielle Lage des Blattes verschlechterte sich so dramatisch, dass die Redaktion in die Privatwohnung der Eksteins verlegt werden musste.
In den folgenden Ausgaben wurde das neue »Manifest der Kommunistischen Internationale[n]« abgedruckt, Akademiker wurden zum Eintritt in die Föderation Revolutionärer Sozialisten aufgerufen, Marx und die Russische Revolution wurden beschworen, die Republik Österreich als »Republik Sauerkraut« abgetan.[38] Dafür verschwand Kultur fast vollständig aus dem Programm. Aber auch die Auseinandersetzung mit dringenden sozialen Fragen: der dramatischen Teuerung, dem Hunger, der Kohlen- und Wohnungsnot, der Arbeitslosigkeit, der Lage der jüdischen Flüchtlinge, der rasenden Verbreitung der Spanischen Grippe. Alles das fand in der Wage nicht statt. Es ging immer nur um die Weltrevolution, und das fast nur aus dem Blickwinkel Eksteins und seiner Genossen. Nur ganz selten kamen Frauen zu Wort, die Pazifistin Elsa Beer-Angerer zum Beispiel mit einem kurzen Artikel über das Frauenstimmrecht.[39]
Im Juni 1919 trat das Ehepaar Ekstein aus der jüdischen Gemeinde aus.[40] Über die Gründe lässt sich nur spekulieren, zumal Ekstein doch eben erst seinen aus dem Lateinischen stammenden Vornamen Ignaz gegen den jüdischen Isak ausgetauscht hatte. Waren es die ewigen Streitereien in der Gemeinde, der neben assimilierten Juden aus Wien auch strenggläubige Chassiden aus Osteuropa angehörten, außerdem kämpferische Zionisten und Nationalisten, die mit einer eigenen Partei in den Nationalrat drängten? Auffallend ist, dass Ekstein plötzlich so tat, als sei er selbst gar kein Jude mehr, indem er antisemitische Stereotypen benutzte, wie sie sonst nur in den schlimmsten völkischen Hetzblättern vorkamen: »jüdische Kapitalistenpresse«, »Raben-Rabbis«, »jüdische Lügner«, »jüdisches Großkapital«.[41] Immer wieder wird der vermeintliche Erzfeind, der ebenfalls jüdische Vorsitzende der SDAP, Friedrich Adler, attackiert und als Sprachrohr der »jüdischen Kapitalistenpresse« bezeichnet. Damit folgte Ekstein zwar dem Vorbild von Marx, der sich ähnlich abfällig über »die« Juden geäußert hat, nicht nur in seiner programmatischen Schrift »Zur Judenfrage«, sondern auch in vielen Briefen an Friedrich Engels; es war aber trotzdem der Anfang vom Ende der Wage, jedenfalls unter Eksteins Herausgeberschaft. Als die Autoren und Leser, viele davon jüdisch, ihm davonliefen, gab er das Blatt wieder auf, um sich ganz der kommunistischen Agitation zuzuwenden. In Grassauers Gasthaus in der Mollardgasse 43 hielt er regelmäßig Vorträge vor Mitgliedern der KPÖ. Der antisemitische Jargon hatte ihm übrigens so wenig genützt wie sein Austritt aus der jüdischen Kultusgemeinde. Denn als er mit Paul Friedländer, Franz Koritschoner und Gerhart Eisler in die Exekutive der kommunistischen Obmännerkonferenz gewählt wurde, spotteten die Wiener Neuesten Nachrichten: »Mit Ausnahme von einem, höchstens zwei Leuten lauter Juden! Und von einer solchen Mischpoche lassen sich Arbeiter führen, als ob sie jüdischer Vormundschaft bedürftig wären!«[42]
Kindertransporte
Seit dem Krieg, in dem Österreich seine klassischen Kornkammern verloren hatte, waren die Lebensmittel immer knapper und teurer geworden. Der Wiener Schriftstellerverband, dem Ekstein angehörte, betrieb deshalb eine Tafel, wo die Kinder manchmal eine warme Mahlzeit oder ein Stück Brot mit Marmelade aus Rüben und Süßstoff bekamen. Sie mussten dafür einen weiten Weg bis ans andere Ende der Stadt zurücklegen. Lieber fuhren sie mit der Bahn hinaus aufs Land, um zu »hamstern«, Milch, Eier, Mehl, Butter oder etwas Fleisch. Auf der Rückfahrt mussten sie alles gut verstecken, denn Hamstern war streng verboten. Onkel Julius, der ehemaliger Kinobesitzer, half ihnen dabei. Er band sich die Beute in Tüchern um den Bauch und ließ sie unter seinem Mantel oder seinem Hemd verschwinden, was niemandem auffiel, da er sowieso viel zu dünn war. Die Kinder mochten ihn gern. Er war ein Witzbold. Allerdings kam es manchmal vor, dass die Mitreisenden die Nase rümpften, weil das Fleisch etwas unangenehm roch, besonders im Sommer.
Wien hatte damals etwa zwei Millionen Einwohner, von denen gut die Hälfte Kinder und Jugendliche waren. Ihre Not war besonders groß, da sie fast alle unter Skorbut, Rachitis, Herzschwäche, Knochenödemen und dramatischem Untergewicht litten. An Schulbesuch war kaum zu denken, umso weniger, als in den überfüllten, schlecht beheizten Klassenzimmern die Gefahr bestand, sich mit Tuberkulose oder Spanischer Grippe zu infizieren. Schon während des Krieges waren deshalb Sammeltransporte ins neutrale Ausland organisiert worden, vor allem in die Schweiz, wo man Kinder in Hotels oder Kurhäusern unterbrachte, um sie notdürftig wieder aufzupäppeln.
Inzwischen waren sich aber fast alle europäischen Länder einig geworden, dass noch viel mehr Hilfe notwendig war, unabhängig von der »Kriegsschuld« oder nationalen Ressentiments. In Schweden, Dänemark, Norwegen, England, Holland und Italien entstanden immer mehr Komitees kirchlicher, politischer oder gemeinnütziger Natur, sogar in Bayern und dem Rheinland, wo doch ebenfalls bittere Not herrschte. Auch die inzwischen unabhängig gewordenen Kronländer der alten Monarchie nahmen bereitwillig Kinder aus Österreich auf: Ungarn, Jugoslawien, die Tschechoslowakei usw. Es war ein Akt internationaler Solidarität, wie es ihn noch nie gegeben hatte. Es wurde nicht lange diskutiert und gefeilscht, sondern einfach geholfen, auch von Privatleuten, die die Kinder kostenlos oder gegen ein geringes Entgelt in Pflege nahmen. Im August 1920 schrieb die Wiener Arbeiter-Zeitung, dass schon 85000 Kinder verschickt worden seien und täglich neue Anfragen beim Jugendamt eingingen, wobei leider nur den Kindern geholfen werden könne, die frei von Läusen und ansteckenden Krankheiten seien, nachts nicht ins Bett machten, alle erforderlichen Impfungen erhalten hätten und nicht als renitent oder bösartig gälten.[43]
Zu diesen Glücklichen gehörten auch Lisa, ihr Bruder Hans und ihre Cousine Mita, die noch immer bei den Eksteins lebte. Sie waren alle drei halb verhungert. Keine Chance, sie gesund durch diese Zeiten zu bringen, wenn sie bei den Eltern in Wien bleiben würden. Lisa wurde für einen Transport nach Holland bestimmt, ihr Bruder nach Dänemark, ihre Cousine nach Schweden. Warum man sie nicht zusammen »verschickt« habe, wurde sie später von einem Verwandten gefragt.[44] Das sei gar nicht erst diskutiert worden. Ein zentrales Amt habe alles geregelt. Auf 500 Plätze seien etwa 10000 Anfragen gekommen. Sonderwünsche seien nicht möglich gewesen. Man habe ihr ein Schild mit der Aufschrift »Apeldoorn« umgehängt und sie zu einem der Wiener Bahnhöfe gebracht, wo schon Hunderte anderer Kinder und Eltern warteten.[45]
In der Nacht zuvor sei ihr das Haar gewaschen worden, ihr schönes, langes, dichtes, krauses Haar, immer und immer wieder. Das Waschmittel stank nach Petroleum und reizte die Kopfhaut, aber egal, es durfte nur ja keine Laus gefunden werden, denn verlausten Kindern wurde entweder das Haar abgeschnitten, oder sie wurden sofort wieder nach Hause geschickt. Am Bahnhof gab es eine »Läusekommission«, die jeden Kinderkopf genau untersuchte. Zu ihrer großen Erleichterung war Lisa läusefrei. Sie war zwar nicht eitel, aber ihr schönes Haar hätte sie doch nur sehr ungern verloren.
Apeldoorn
Wien und Apeldoorn liegen über 1000 Kilometer weit voneinander entfernt. Noch heute braucht man mit dem Zug bis zu 18 Stunden für die Strecke. Zu Lisas Zeit waren es drei Tage und Nächte. Eine der Hauptstrecken führte mitten durchs Ruhrgebiet. Dort muss Lisa etwas gesehen haben, was sie furchtbar erschreckte: Hochöfen, die wie feuerspeiende Ungeheuer aussahen, besonders bei Nacht, wenn sie das Land gespenstisch erhellten. Niemand erklärte ihr, was das war, sodass sie glaubte zu träumen, zu halluzinieren.
Einmal wachte ich auf und sah durch das Fenster, ganz weit weg, einen glühenden Schornstein. Er war riesig lang und schien noch zu wachsen, bis die Spitze den Himmel berührte. Er glühte immer mehr, gelb und rot und so leuchtend, wie ich es noch nie gesehen hatte, es kam mir vor, als würde unser Zug im Kreis um den Schornstein herumfahren. Dann begann er zu schwanken, ich war froh, dass er weit weg von uns war. Schließlich geschah es: der glühende Schornstein knickte um und fiel der Länge nach hin. Es war sehr aufregend und mir fiel ein: Meine Eltern sind in Wien geblieben und ich fahre nach Holland, immer weiter weg. Wem kann ich erzählen, was ich gerade gesehen habe? Und ich fing an zu weinen. Ein paar Erwachsene kamen und trösteten mich und sagten: Sie ist sicher eingeschlafen und hat einen bösen Traum gehabt, und einer sagte: Sie hat Heimweh.[46]
Unter den Erwachsenen, die die Kinder begleiteten, waren Lehrer, Krankenschwestern und Ärzte. Es war schwer, ihnen das Richtige zu essen zu geben, denn Fettes und Süßes brachen sie sofort wieder aus. Als sie in Apeldoorn ankamen, standen die meisten Pflegeeltern schon auf dem Bahnsteig, um auf »ihre« Kinder zu warten. Lisas Pflegemutter war nicht dabei. Das war enttäuschend. Sie war Krankenschwester und hatte an dem Tag vielleicht gerade Dienst. Doch sie hatte einen Jungen von den Nederlandse Padvinders geschickt, der Lisa abholen sollte. Da stand er nun blond und breitbeinig neben seinem Fahrrad, in seiner etwas seltsamen Uniform, die aus einem breitkrempigen Hut, kurzen Hosen und Kniestrümpfen bestand. Er sprach und verstand zwar kein Wort Deutsch, machte Lisa aber irgendwie klar, dass sie sich auf die Stange seines Fahrrads setzen solle, mitsamt ihrem schweren Gepäck, was nicht sehr angenehm war. Die Fahrt kam ihr endlos lang vor, denn das Haus ihrer Pflegemutter lag weit draußen am Waldrand. Dort war es sehr schön, aber auch etwas unheimlich. Ob in Budapest oder Wien: Sie hatte immer mitten in der Stadt gewohnt. Und jetzt plötzlich im finsteren Wald, wie im Märchen?
Nun lernte sie endlich Elisabeth Bosscha kennen, ihre künftige Ziehmutter, die man nur mit »Zuster«, dem niederländischen Wort für Schwester, ansprechen durfte. Sie erklärte ihr, dass sie noch andere Kinder in Pflege habe, denen es gesundheitlich nicht sehr gut gehe. Da habe sie dann noch ein Kind aus Wien dazu genommen, sodass eine Art Kinderheim, ein kleines Kollektiv entstand, in dem es viel lustiger zuging als zu Hause. In den ersten Tagen gab es nur Brühe zu essen, denn mehr vertrug Lisas Magen noch nicht. Erst nach und nach durfte sie wieder etwas Fett und Fleisch zu sich nehmen.
Den Vorschriften nach hätte sie eigentlich nur ein paar Wochen bleiben dürfen, aber die Zuster schloss sie so ins Herz, dass sie sie gar nicht mehr fortlassen wollte. Sie sei immer noch viel zu schwach und zu dünn, habe sich noch gar nicht richtig erholt. Es flossen Tränen, als sie wieder abfuhr, auf beiden Seiten. Kaum war Lisa wieder in Wien, kam auch schon ein Brief von Elisabeth Bosscha, in dem sie die Eksteins anflehte, dass sie sie doch bitte wieder zurückschicken sollten. Die Kosten und die Bestimmungen seien ihr egal. Sie würde auf eigene Verantwortung handeln.
Lisa war hin- und hergerissen. Wenn sie ja sagte, würden die Eltern gekränkt sein. Ein Nein hätte wiederum die Zuster verletzt. Am Ende fuhr sie doch und blieb ein volles Jahr. Das müsse von 1919 bis 1920 gewesen sein, sagte sie später, ohne sich dessen ganz sicher zu sein. Sie war gerne in Apeldoorn, aber sie fühlte sich auch irgendwie abgeschoben und fand die Entscheidung ihrer Eltern verletzend. War sie ihnen denn ganz egal? Wollten sie ihr eigenes Kind nicht mehr bei sich haben? Alles in allem sei es aber eine »phantastische« Zeit gewesen, an die sie immer wieder gerne zurückgedacht habe.
Phantastisch war es wohl wirklich in dem Haus im Wald »mit dem Rosengarten vorne und dem Kieselweg rundherum«, mit dem »Gemüse- und Obstgarten«, in dem sie im Sommer dicke reife Erdbeeren pflückte und später die aromatischen Blaubeeren.[47] Apeldoorn war eine kleine, beschauliche Stadt in der Provinz Gelderland, verglichen mit Wien fast ein Dorf, Sommersitz der niederländischen Königsfamilie, umgeben von weiten Heidelandschaften, in denen Lisa stundenlang herumwandern konnte, ohne dass jemand nach ihr rief oder ihr Vorschriften machte. Mit den anderen Kindern verstand sie sich gut. Sie ging auch zur Schule und sang lauthals mit, wenn die niederländische Nationalhymne geübt wurde: Wilhelmus van Nassouwe / Ben ik van Duitsen bloed / Den vaterland getrouwe / Blijf ik tot in den dood …
Das Problem war nur: Sie verlernte ihr Deutsch. Als sie ihren Eltern einen Brief schreiben sollte, konnte sie es plötzlich nicht mehr. Wieder in Wien, wusste sie erst gar nicht, was sie sagen sollte, als man sie auf dem Bahnhof abholte. Goedendag? Grüß Gott? Ik heb je gemist? Das ging eine ganze Weile lang so, dass sie beide Sprachen miteinander vermischte. Hans, ihr älterer Bruder, machte sich lustig über sie. Ihm ging alles leicht von der Hand. Die Schule, der Umgang mit Menschen, das Wiederankommen. Es war schon jetzt klar, dass er einmal etwas ganz Besonderes werden würde. Ein Gelehrter, ein Professor, Mathematiker oder Physiker vielleicht? Die Eltern waren sehr stolz auf ihn. Sie lobten ihn dauernd und priesen ihn als ihr großes Vorbild. Mit demselben Stolz sprachen sie immer wieder von den vielen »tüchtigen« Frauen in der Familie, von Tante Malva, der Malerin. Das muss eine schwere Last für Lisa gewesen sein, manchmal kaum zu ertragen. Irgendwann wurde ihr das Wort »tüchtig« regelrecht zuwider, besonders weil da etwas wie ein Vorwurf mitzuschwingen schien: Und du? Was hast du bisher geleistet? Wofür bist du eigentlich begabt? Was soll aus dir bloß einmal werden?
Es fällt auf, dass ihre Zeit in Apeldoorn fast das Einzige ist, was sie aus ihrer Kindheit preisgibt. Fast alles andere wird weggelassen. Die Freundinnen, die Lehrer, das Familienleben, ihre Lieblingsplätze, ihre Lieblingsspeisen, die Aufenthalte in Malvas Atelier, die doch sehr prägend gewesen müssen. Kann man daraus vielleicht schließen, dass das Jahr in Holland ein Höhepunkt ihrer Kindheit war, die einzige Zeit, in der sie sich geliebt, gut behandelt und akzeptiert fühlte, gut ernährt und nicht immer im Schatten des großen Bruders oder der vielen »tüchtigen« Frauen stehend, auf die alle so stolz waren?
2Blutmai
(1921–1932)
»Abgeschafft«
Zu Beginn der zwanziger Jahre wurde die Lage in Wien immer dramatischer: Es gab Revolten und Straßenschlachten, wütende Proteste gegen den Mangel an Nahrungsmitteln, die Wohnungsnot und die rasende Inflation. Die Juden, hieß es nun immer öfter und lauter, seien schuld, vor allem die, die als Flüchtlinge in die Stadt gekommen seien. Von etwa 20000 war die Rede, die nun zusätzlich ernährt, untergebracht und versorgt werden müssten und durch ihre schiere Anwesenheit dazu beitrügen, die Not der Einheimischen zu vergrößern. Das fand auch der neue Bundeskanzler, Ignaz Seipel, ein Mann der Großdeutschen Volkspartei, der als eine seiner ersten Amtshandlungen die Verfügung erließ, alle Fremden, die nach 1914 in die Stadt gekommen seien, auszuweisen oder »abzuschaffen«, wie es im Amtsdeutsch hieß. Zurück in die »Heimat«, wo auch immer die war: Polen, Ungarn, Russland oder die Tschechoslowakei?
Auch die Eltern von Lisa waren davon betroffen. Obwohl sie sich immer als Österreicher gesehen hatten, galten sie plötzlich als »fremd«, denn sie waren in Prag beziehungsweise Pilsen geboren und erst nach Kriegsbeginn in die Hauptstadt gekommen. Ähnlich wie der junge Journalist Joseph Roth, der aus dem galizischen Brody stammte und verzweifelt an die Behörden appellierte:
Meine ganze Existenz beruht auf der durch die deutschösterreichische Staatszugehörigkeit bedingten persönlichen Freiheit, innerhalb meines Kulturkreises zu wirken und wäre durch eine Verurteilung zur Heimatlosigkeit erschüttert. Ich bitte daher um die formale Zuerkennung jener Staatsbürgerschaft, die ich mir […] durch mein Wesen und Wirken längst erworben zu haben glaube.[48]
Es dauerte Jahre, bis er das gewünschte Papier endlich erhielt. Bei den Eksteins ging es wesentlich schneller. Sie bekamen es schon 1921, eigentlich erstaunlich, denn Ekstein hatte weder – wie Joseph Roth – in der österreichischen Armee gedient, noch nahm er eine wichtige Stellung im öffentlichen Leben ein. Ganz im Gegenteil, er war KPÖ-Funktionär, für die Gesellschaft eher lästig als nützlich. Vielleicht spielte die Prominenz seiner Schwägerin Malva Schalek eine Rolle? Oder die von Alice Schalek, einer weiteren Verwandten seiner Frau, die als Kriegsreporterin berühmt geworden war und der man sogar das Goldene Verdienstkreuz mit Krone verliehen hatte? Dass Karl Kraus sich lautstark über diese »kriegsgeile Hyäne« empörte und immer wieder hasserfüllt auf sie einhieb, ob in seiner Zeitschrift Die Fackel oder dem Drama Die letzten Tage der Menschheit, hatte ihrer Beliebtheit nichts anhaben können, sondern machte sie nur noch populärer.[49]
Nicht gemeldet
Mit der im November 1918 gegründeten KPÖ ging es schnell bergab, da sie sich in innerparteilichen Kämpfen verzehrte: zwischen Ultralinken, Anarchosyndikalisten und Vertretern der Arbeiterschaft, dazu noch tschechischen und zionistischen Splittergruppen, die jeweils eigene Interessen verfolgten.[50] Einig waren sie sich nur in ihrem Hass auf die Sozialdemokraten, mit dem sie aber niemanden so recht überzeugen konnten, da sie seit der Gründung der Republik doch sehr viel durchgesetzt hatten: das Frauenwahlrecht, den Achtstundentag, besseren Kündigungsschutz und den Neubau von Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Wohnungen. Ihre Reformarbeit in Wien war beispielhaft und verlieh der Stadt den Ruf, eine der fortschrittlichsten Metropolen Europas zu sein.[51]
Die KPÖ hatte dagegen fast nichts erreicht, nicht einmal einen Sitz im Nationalrat. 1921 hatte sie landesweit 4500 Mitglieder, davon 60 Prozent Arbeitslose.[52] Sie wurde kaum als Opposition wahrgenommen, nur als Grüppchen von Querulanten, was dazu führte, dass sogar ihre Gründer, Karl Steinhardt und Elfriede Friedländer, enttäuscht das Land verließen und nach Deutschland gingen, wo die KPD eine Massenpartei, eine echte politische Kraft war.[53] Elfriede Friedländer nannte sich nunmehr »Ruth Fischer« und übernahm die Leitung der Berliner Gruppe, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Arkadi Maslow, einem ukrainischen Kommunisten, der wie sie zum ultralinken Flügel der Partei zählte. Obwohl sie selbst jüdischer Herkunft war, bediente sie in ihren Reden antisemitische Klischees, die das Zerrbild vom jüdischen Kapitalisten bedienten und fast genauso wie Eksteins Artikel in der Wage klangen: »Sie rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren? Wer gegen das Judenkapital aufruft, […] ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. […] Tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Aber, meine Herren, wie stehen Sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes, den Klöckner?«[54]
Bald nach dem Krieg war in Wien eine Sowjetische Handelsvertretung eröffnet worden, die wenig später nach Berlin zog, wo sie effektiver arbeiten konnte. Sie verdankte ihre Existenz verschiedenen Dekreten, mit denen die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland normalisiert werden sollten, in wirtschaftlicher, militärischer und auch kultureller Hinsicht. Kaum etabliert und in ein riesiges Gebäude eingezogen – in das Haus der ehemaligen Viktoria-Versicherung an der Lindenstraße in Kreuzberg –, hatte sie schon mehr als 600 Mitarbeiter, darunter den legendären Graphiker und Fotografen John Heartfield. Es gab Kunstausstellungen mit Werken von Malewitsch und El Lissitzky, Zeitungsneugründungen, Konzerte, Vorträge, vor allem aber binationale Handelsabkommen, an denen die gesamte deutsche Großindustrie beteiligt war: Otto Wolff, Krupp, Siemens, Orenstein und Koppel, die Rheinmetall usw. Hier floss viel Geld, zum Teil mit Hilfe der Deutschen Bank. Es wurde über den Im- und Export von Getreide, Erdöl, Gas, Flugzeugen, Waffen und Panzern verhandelt, über die Gründung binationaler Gesellschaften wie der Deutsch-russischen Luft-AG (Deruluft) und der Deutsch-russischen Transport-Aktiengesellschaft (Derutra), die alsbald ihren Betrieb aufnahmen. Schon ab dem 1. Mai 1922 konnte man bequem von Königsberg nach Moskau fliegen. Es war ein Riesengeschäft, an dem alle blendend verdienten, Kriegsgewinnler und Kriegsgegner, Juden und Antisemiten, Bolschewisten, Aristokraten und Deutschnationale, nicht zuletzt aber die KPD, die von der Handelsvertretung großzügig alimentiert wurde.[55]
Hier fand auch Lisas Vater ein reiches Betätigungsfeld, als er sich im Herbst 1920 entschloss, nach Berlin zu ziehen, denn aufgrund seiner Vielsprachigkeit und kaufmännischen Erfahrung konnte man ihn als Dolmetscher und Verhandler gut gebrauchen. Außerdem waren die Arbeitsbedingungen recht komfortabel. Ein Siebenstundentag, mehr Urlaub als in irgendeiner deutschen Firma und ein Lohn, der deutlich über dem Durchschnitt lag. Angestellte der Handelsvertretung konnten »Motorräder, Pelzjacken und ähnlichen Luxus mit beträchtlichem Rabatt kaufen und […] mit ihren Familien billige Ferien in Russland verbringen oder in russische Sanatorien gehen.«[56] Das war eine Wohltat nach den harten Jahren in Wien. Damit ließ sich die Inflation gut überleben.
Die Vertretung genoss zwar diplomatische Immunität, trotzdem fanden manchmal Razzien statt, wenn etwa der Verdacht aufkam, dass sich polizeilich gesuchte Kommunisten dort versteckt hielten. Als Ausländer musste man besonders vorsichtig sein, um nicht als unerwünscht abgeschoben zu werden. Es war besser, sich nicht offiziell anzumelden, sondern wechselnde Deckadressen zu benutzen. Ekstein zog es wohl vor, bis etwa 1925 in Wien gemeldet zu bleiben, obwohl er dort längst nicht mehr lebte.
Wo aber dann? In der Ganghoferstraße in Steglitz, wie Julie, seine Frau, später angeben würde, sicher nicht, denn diese Straße war 1922 noch eine Art Brachland, auf dem sich lediglich einige Baustellen befanden.[57] Erst 1926 erscheint er namentlich im Adressbuch von Berlin, und zwar auf der Lietzenburger Str. Nr. 11, in einem Haus, das seinem Arbeitgeber, der Sowjetischen Handelsvertretung, gehörte. Hier wohnten ausschließlich leitende Mitarbeiter: Ingenieure, Professoren, Verlagsleiter. Man blieb also unter sich, vermutlich ständig unter strenger Überwachung stehend. Denn der Direktor der Handelsvertretung, ein Bulgare namens Boris Spiridonowitsch Stomonjakow, führte ein ultraautoritäres Regiment im Geiste Stalins, dem er später allerdings selbst zum Opfer fallen sollte.[58]
Lisa hat diesen Abschnitt ihrer Kindheit und Jugend nie erwähnt, weder in ihren Interviews noch in ihren Büchern. Ihr Vater sei erst Kaufmann, dann Journalist, dann wieder Kaufmann gewesen. Einzelheiten seien ihr unbekannt und hätten sie auch nicht interessiert.
Preußischer Drill?
In der ersten Zeit war sie sehr unglücklich in Berlin, kein Wunder, nachdem sie sich gerade erst in Wien wieder eingelebt hatte. Sie hatte die Grundschule abgeschlossen, ihre Sprachschwierigkeiten überwunden, ein paar Kilo zugenommen und auf dem Lyzeum des Frauenerwerbvereins mehrere Freundinnen gefunden, mit denen sie ins Kino, ins Schwimmbad oder in die Urania ging. Dieses große Volksbildungshaus war bei der Bevölkerung sehr beliebt, weil es für wenig Geld Konzerte, Dichterlesungen und Vorträge auf höchstem Niveau bot, die vom Professor bis zum einfachen Arbeiter besucht wurden.
Nun also Berlin, die Stadt der Mietskasernen, Armenküchen und der Hyperinflation, eine Stadt aus Asphalt, Ziegeln und Mauern mitten im Flachland, durchzogen von Untergrundbahnen, bewohnt von abweisend wirkenden Menschen, deren Dialekt sie nicht richtig verstand. Das Schlimmste aber sei die Schule gewesen, das städtische Viktoria-Lyzeum in Kreuzberg. Alles so schroff, so militärisch, so preußisch, so deutschnational, Lehrerinnen und Lehrer, die im Geschichtsunterricht ständig über die Schlacht im Teutoburger Wald gesprochen hätten, ein Thema, das sie nicht im Mindesten interessiert habe.[59]
Sie persönlich mag es so empfunden haben. Aber aus noch erhaltenen Lehrplänen der Schule geht hervor, dass es sich um eine sehr progressive Einrichtung gehandelt haben muss, in der Aufsätze über hochaktuelle Themen geschrieben wurden: »Die Elektrizität im Dienste der Menschheit«, »Vor- und Nachteile des Großstadtlebens«, »Der deutsche Rundfunk«, »Warum gehe ich gern ins Kino?«, »Ist Armut ein Unglück?«, »Meine Meinung über die verschiedenen Frauenberufe« usw.[60] Direktor war, wie damals noch üblich, ein Mann. Aber das Kollegium bestand überwiegend aus Frauen, darunter Lilli Auerbach, eine feministisch orientierte Germanistin, die ihre Dissertation über das Frauenbild Wilhelm Raabes geschrieben hatte.[61] Es gab eine Schüler- und Elternvertretung, freien Mittagstisch und Schulgeldbefreiung für immerhin 14 Prozent aller Schülerinnen, Wandertage, Fahrten ins Landschulheim und natürlich auch jüdischen Religionsunterricht, der von einem Rabbiner, Dr. Sally Gans, erteilt wurde. Dieses Lyzeum war sicher keine Reformschule. Aber eine preußische Zucht- und Drillanstalt war es auch nicht.
Sie habe Heimweh, beklagte sich Lisa bei ihren Eltern, furchtbares Heimweh. Sie könne es in Berlin nicht mehr aushalten und wolle unbedingt wieder zurück nach Wien. Im Winter 1922 kam sie dort wieder an. Allein. Sie war 13 Jahre alt. Man hatte sie einfach in einen Zug gesetzt, der über 700 Kilometer weit fahren würde, über Cottbus, Dresden, Prag und Brünn bis nach Wien, wo sie bei einer Schwester ihres Vaters wohnen sollte.
Diese Schwester, Lisas Tante also, sie hieß Hedwig, war mit einem aus Budapest stammenden Kaufmann namens Ladislaus Csató verheiratet, der eine Gemischtwarenhandlung in der Kleinen Sperlgasse betrieb. Sie hatten drei Söhne, András, Tibor und Gyury, der sich später Georges nennen würde. András, der Älteste, war wahrscheinlich schon aus dem Haus. Aber Tibor und Gyury waren noch da, sodass es nie langweilig für Lisa wurde, zumal sie ihre Cousins sehr gut leiden konnte. Die Csatós waren bestimmt nicht mit Gütern gesegnet, denn die Sperlgasse lag mitten in der Leopoldstadt, nicht weit vom Tandelmarkt und der Taborstraße, wo vorwiegend jüdisches Kleinbürgertum wohnte. Doch auch wenn man selbst in bescheidenen Verhältnissen lebte: Es war ganz normal, dass man sich half, wenn es um die Kinder ging, dass man sie »austauschte«, wenn es irgendeinen Grund dafür gab. Auch Tibor und Gyury würden später längere Zeit bei den Eksteins wohnen, der eine, um Medizin, der andere, um Kunst zu studieren. Man habe damals ein ganz anderes Verständnis von »Familie« gehabt, sagte Lisa später in einem Interview, nicht so eng, nicht so kleingeistig, nicht so hermetisch nach außen abgeschirmt wie seit dem Wirtschaftswunder. Es sei eben eine andere Art der Solidarität und der »menschlichen Verbindung« gewesen. [62]
Da in Lisas alter Schule, dem Lyzeum des Frauenerwerbsvereins, kein Platz mehr war, musste sie auf eines der zahlreichen Mädchenpensionate gehen, die in Wien wie Pilze aus dem Boden schossen, teuer und von unterschiedlicher Ausrichtung und Qualität, ob reformpädagogisch, konservativ, jüdisch, staatlich anerkannt oder nicht. Lisa, die sich später an den Namen nicht mehr erinnern konnte, scheint es ganz gut getroffen zu haben. In verschiedenen Interviews schwärmt sie geradezu von den jungen Lehrerinnen, bei denen ihr das Lernen zum ersten Mal richtig Spaß gemacht habe.
»Die Neese voll!«
Die Eltern hatten ihr für diesen Aufenthalt eine Frist gesetzt. Nicht länger als eine Saison, maximal ein Jahr. Schließlich konnte sie nicht für immer bei den Csatós bleiben, die doch ihre eigenen Sorgen hatten, drei Söhne, den Laden und dann noch Lisa, die auf dem Höhepunkt ihrer Pubertät angekommen war!
Was für ein Glück, dass ihr Vater so gut verdiente, denn die Inflation schritt in dieser Zeit so rasend voran, dass man glaubte zu träumen. Im März 1923 kosteten drei Pfund Feinbrot noch 760 Mark, im November schon 769 Milliarden. Fast die gesamte Arbeiterschaft war verarmt, das Volk über alle Parteigrenzen hinweg in großer Erregung, denn im Januar war das Ruhrgebiet von 60000 französischen und belgischen Soldaten besetzt worden, weil Deutschland mit Reparationsleistungen in Rückstand geraten war, die im Friedensvertrag von Versailles vereinbart worden waren. Die Bevölkerung leistete passiven Widerstand. Die Arbeit in den Kohlebergwerken ruhte.
»Über 100000 deutsche Männer, Frauen, Greise und Kinder sind von Haus und Hof vertrieben worden«, empörte sich der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert. »Für Millionen Deutsche gibt es den Begriff der persönlichen Freiheit nicht mehr.«[63] Es gab Straßenkämpfe, Streiks, Sabotageakte und beängstigende Koalitionen zwischen Rechts und Links. Die Regierung wechselte alle paar Wochen. Eine neue Partei, die NSDAP, war gegründet worden und hatte in kürzester Zeit über 50000 Mitglieder gewonnen, die allesamt gegen die »Judenrepublik« und den »Schandvertrag« von Versailles waren. Der Traum von Frieden und Freiheit hatte sich nicht erfüllt. Nur fünf Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges stand Deutschland in jeder Hinsicht am Abgrund. Wer mochte da noch optimistisch in die Zukunft sehen und große berufliche Ambitionen entwickeln?
Es begann damit, dass Lisas Zeugnisse aus Wien in Berlin nicht anerkannt wurden, sodass sie eine »Presse«, ein privates Nachhilfeinstitut, besuchen musste, um das Nötigste nachzuholen. Was dann geschah, bleibt unklar. Zuerst sei sie auf einem Privatgymnasium für Knaben gewesen, das in Ausnahmefällen auch Mädchen aufnahm. Dann wiederum auf einer Mädchenschule, wo man sich aber nur für »Haarfrisuren und künftige Ehemänner« interessiert habe.[64] An anderer Stelle erklärt sie, sie habe die Karl-Marx-Schule in Neukölln besucht,[65] die de facto aber damals noch Kaiser-Friedrich-Realgymnasium hieß und erst 1930 umbenannt wurde. Es muss, kurz gesagt, ein einziges Chaos gewesen sein und viel Streit mit den Eltern gegeben haben. Nachdem sie einen Abschluss in der Tasche hatte, der der heutigen Mittleren Reife entsprach, hatte sie endgültig »die Neese voll« und erklärte den Eltern, dass ihre Schulzeit nunmehr beendet sei. Es sei nichts zu machen. Keine Diskussion. Punkt.[66]
Ihr Vater, der ihr sonst fast jede Freiheit gelassen habe, sei entsetzt gewesen: Ob sie sich wirklich aufgeben wolle, die Chance zu studieren nicht ergreifen? Ob sie Lust habe, in die alte Frauenrolle zurückzufallen und eines Tages von einem Mann abhängig zu sein? Er zwang sie zu nichts. Aber er stellte eine Bedingung: Sie sollte wenigstens auf eine Handelsschule gehen, um die klassischen Büroarbeiten zu erlernen, Maschineschreiben, Buchhaltung, Stenographie usw., damit sie eines Tages die Verantwortung für sich selbst übernehmen könne.
Es war die Zeit, in der sie begann, politisch aktiv zu werden. 1924 trat sie in den Kommunistischen Jugendverband ein und vier Jahre später in die KPD.[67] Außerdem war sie Mitglied im Sozialistischen Schülerbund, wo sie viele ihrer späteren Genossen kennenlernte. Der Sozialistische Schülerbund hatte eine eigene Zeitschrift, Der Schulkampf, in der es hieß:
Unsere Aufgabe im imperialistischen Krieg ist es, ihn umzuwandeln in den Bürgerkrieg gegen die herrschende Klasse. […] Die Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit treiben zum Bürgerkrieg. Eine friedliche Austragung dieser Gegensätze ist unmöglich. Die kapitalistische Herrschaft ist nur mit Gewalt zu stürzen. Die friedliche Eroberung der Macht durch eine Parlamentsmehrheit hilft nichts. Die Eroberung der Macht ist also nur möglich durch die organisierte Gewalt der Revolution.[68]
Der Sozialistische Schülerbund trat bisweilen recht militant auf und regte seine Mitglieder dazu an, Lehrer als »Diktatoren« zu bezeichnen oder mit Blumentöpfen zu bewerfen, selbst wenn es sich um anerkannte Reformpädagogen handelte, die für Arbeiterbildung und das spätere Gesamtschulprinzip eintraten. Doch dazu war es nach Meinung dieser Gruppierung noch zu früh. Eine echte Schulreform sei erst möglich, wenn das Proletariat an die Macht gelangt sei. Bis dahin sei sie abzulehnen und zu bekämpfen. So argumentierte auch Lisa, wenn die Eltern ihr vorwarfen, dass sie die Chance zu studieren vorbeiziehen lasse, um stattdessen zu Versammlungen oder Demonstrationen zu gehen:
»Ihr versteht das eben nicht. Alles kommt jetzt darauf an, den Faschismus zu schlagen, da kann ich keine Zeit verschwenden mit bequemem Leben und Universität. Ihr wisst ja nicht, wie viel ich lerne, oft von Leuten, die nur die Volksschule besucht haben – sie verstehen so viel von Dingen, die in keinem Universitätsseminar vorkommen. Und auch nicht in eurem Romanischen Café.«[69]
Rotsport
Der Kommunistische Jugendverband Deutschlands (KJVD), dem Lisa seit 1924 angehörte, war nach dem Ersten Weltkrieg aus der Freien Sozialistischen Jugend hervorgegangen. Als Kaderschmiede für künftige KPD-Funktionäre vertrat er eins zu eins die politischen Grundsätze der Partei, der er sich in einer Art »Waffenbrüderschaft« verbunden fühlte.[70] Viele Kinder und Jugendliche fanden hier eine zweite Heimat, besonders wenn sie aus schlechten sozialen Verhältnissen kamen. Niemand musste hungern oder Heimarbeit machen. Wer krank war, wurde zum Arzt geschickt. Es wurde nicht geprügelt und nicht getrunken. Für Kleidung war ohnehin gesorgt, denn alle trugen die gleiche Uniform, in der sie wie sowjetische Bäuerinnen und Bauern aussahen.[71] Auch die Freizeitgestaltung war gut strukturiert. Mit strammen Wanderungen, Fahrten aufs Land, Singen, Tanzen, Gruppenabenden, Schwimmen und Mannschaftssport. Bei Lisa spielte aber sicher noch etwas anderes eine Rolle: Das Gefühl, endlich so akzeptiert zu werden, wie sie war, unabhängig von ihren Schulleistungen und ihrem Geschlecht. Es entfiel auch die ständige Frage, was sie später einmal werden wolle und warum sie die Chance zu studieren nicht ergreife, denn hier gab es nur drei Dinge, die wirklich zählten: die Solidarität, der politische Kampf und der Sport.
In diesem Punkt war sie ihrem Bruder Hans klar überlegen. Er war zwar gut gewachsen und sehr attraktiv, aber leicht gehbehindert. Seit einer Kinderlähmung zog er ein Bein etwas nach. Er würde nie ein guter Läufer oder Bergsteiger werden, würde nie Medaillen gewinnen. Das übernahm jetzt Lisa, indem sie in eine der vielen Rotsport-Bewegungen eintrat,[72] die von der KPD frenetisch gefeiert wurden, als rote Heerschau, Demonstration der Brüderlichkeit und proletarische Wehrhaftmachung, wie Parteichef Ernst Thälmann immer wieder erklärte.
Lisa war Teil dieser Bewegung. Es war ihr sehr ernst damit. Bis 1933, als die Rotsport-Bewegungen verboten wurden, muss sie beinahe täglich intensiv trainiert haben, Leichtathletik und Tennis vor allem. Ihr Mitgliedsbuch war ihr so wichtig, dass sie es selbst in Augenblicken größter Gefahr nicht aus der Hand gab. Nur diesem Training und ihrer guten Kondition war es zu verdanken, dass sie ihren Verfolgern später immer wieder davonlaufen konnte, ob in den Straßen von Berlin oder auf steilen Pfaden in den Pyrenäen.
»Gegnermann« Lisa
Welche Aufgaben hatte sie im Kommunistischen Jugendverband? Schwer zu sagen, da sie sich selbst nie dazu geäußert hat. In einem Dossier, das die Amsterdamer Exil-KPD1937 über sie anlegte, heißt es allerdings:
Die Freundin trat 1924 in den KJVD ein und 1928 in die Partei. Im KJVD war sie Unter-Kassiererin und Organisationsleiterin der Zelle im Unterbezirk 15 (Berlin-Wilmersdorf) bis 1925. Von 1925–26 bearbeitete sie die Schülerfraktion und machte Gegnerarbeit und Politleitung in der Gruppe 16