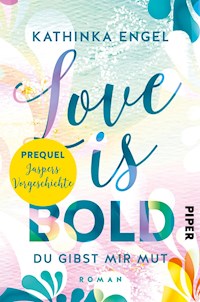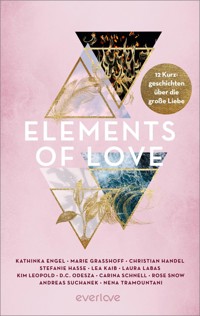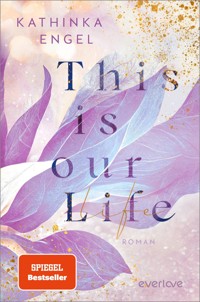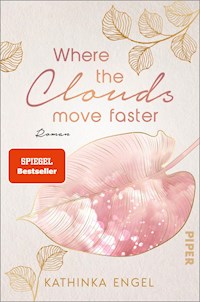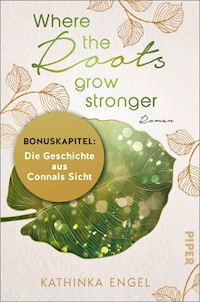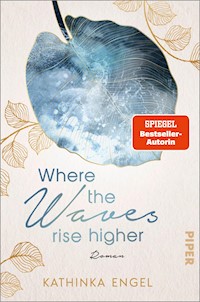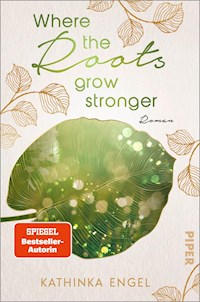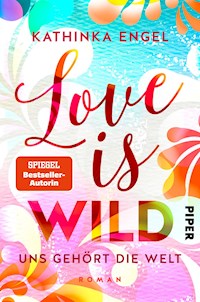
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Sie ist alles, was er will. Doch um sie für sich zu gewinnen, muss er sich selbst unter Kontrolle bekommen. Curtis hat seit dem Tod seiner Eltern Probleme, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Erst als seine Mitbewohnerin Amory ihre lockere Sex-Beziehung beendet, merkt er, dass er mehr von ihr will. Doch dafür muss er seine Aggressionen in den Griff bekommen … Eine bunte, ungewöhnliche Stadt, eine junge Band und die große Liebe: Der dritte Band der neuen Reihe der Spiegel-Bestsellerautorin Kathinka Engel, in der sie uns ins bunte und lebensfrohe New Orleans entführt – und mitten hinein in das turbulente Leben einer Band. Zwischen berauschenden Auftritten und dem harten Alltag als Berufsmusiker suchen sie alle nach ihrem persönlichen Happy End. Als leidenschaftliche Leserin studierte Kathinka Engel allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, arbeitete für eine Literaturagentur, ein Magazin sowie als Übersetzerin und Lektorin. Mit ihrem Debüt »Finde mich. Jetzt« schaffte Kathinka Engel es aus dem Stand auf die Bestsellerliste. Wenn sie nicht gerade schreibt oder liest, trifft man sie im Fußballstadion oder als Backpackerin auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Love is Wild – Uns gehört die Welt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Von Kathinka Engel liegen im Piper Verlag vor:
Finde-mich-Reihe:
Band 1: Finde mich. Jetzt
Band 2: Halte mich. Hier
Band 3: Liebe mich. Für immer
Love-is-Reihe:
Band 1: Love is Loud – Ich höre nur dich
Band 2: Love is Bold – Du gibst mir Mut
Band 3: Love is Wild – Uns gehört die Welt
© Piper Verlag GmbH, München 2020
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Für all die Wilden, für all die Braven.Und für Linus und Quentin.
Inhalt
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Danksagung
1
Amory
Meiner Meinung nach ist das Konzept des richtigen Moments, des perfekten Zeitpunkts, nichts als eine Illusion. Es gibt das Gestern, das Heute und das Morgen. Irgendwann dazwischen bringen wir die Dinge unter, die untergebracht werden müssen. Meistens sind gestern, heute und morgen ziemlich okay. Ich für meinen Teil mag sie alle drei. Das Gestern vielleicht am wenigsten, weil es schon vorbei ist. Das Heute vielleicht am meisten, weil ich mittendrin bin. Und das Mittendrin liebe ich. Das ist genau mein Ding.
Gerade bin ich mittendrin, Blueberry Pancakes zu backen. Ich stehe in unserer Küche, die ich mit meiner ehemaligen besten Freundin Esmé damals rot gestrichen habe. Wir dachten, das wäre eine gute Idee, um die bräunlichen Flecken an der Wand zu überdecken. Doch die Flecken sieht man bis heute. Denn die Wand hat die Farbe an diesen Stellen nicht so recht annehmen wollen. Aus meiner kleinen Bluetooth-Box singt Skeeter Davis, meine liebste Country-Sängerin und Heldin meiner Jugend, He called me Baby. Den Refrain schmettere ich lautstark mit.
Blueberry Pancakes, das habe ich von meiner Mutter gelernt, sind ein guter Begleiter von schlechten Nachrichten. Bei uns zu Hause gab es Blueberry Pancakes, als meine Kaninchen allesamt von einem Fuchs gefressen wurden, als mein liebster Farmmitarbeiter uns verließ, und seltsamerweise auch, als meine Eltern mir verkündeten, dass meine Mom mit meinem kleinen Bruder schwanger war. Am Tag seiner Geburt – ich war gerade zwölf Jahre alt – machte ich Blueberry Pancakes, weil ich mir sicher war, Nicky würde absolut hässlich werden. So hässlich wie all die anderen Babys, die ich bislang gesehen hatte. Ich sah die Enttäuschung meiner Eltern schon vor mir. Wie sie versuchten, dieses knallrote, verknautschte Ding zu lieben. Aber es stellte sich heraus, die Pancakes waren völlig unbegründet, denn Nicky sah überhaupt nicht aus wie die anderen hässlichen Babys. Er war wunderschön. Wenn ich mir heute Fotos vom Tag seiner Geburt ansehe, weiß ich, dass er genauso rot und verknautscht war wie jeder andere auch, der sich gerade mit dem Kopf voraus stundenlang durch einen extrem engen Gang gequetscht hat. Da sieht man mal, was Liebe mit der Wahrnehmung macht.
Heute habe ich schlechte Nachrichten für meinen Mitbewohner Curtis. Wobei ich mir nicht einmal sicher bin, ob es wirklich schlechte Nachrichten sind. Vielleicht sind es einfach nur Nachrichten. Trotzdem will ich mit den Pancakes auf Nummer sicher gehen.
»Morgen«, sagt eine vom Schlaf noch ganz kratzige Stimme in meinem Rücken. »Kannst du das ausmachen?«
Ich drehe mich um. Da steht er, meinen rot getigerten Kater Hilbert auf dem Arm. Er runzelt die Stirn und zeigt auf die Bluetooth-Box. Niemand in meiner näheren Umgebung teilt meine Begeisterung für Skeeter Davis, aber das ist okay. So habe ich sie ganz für mich allein.
Curtis trägt ein schlabbriges weißes T-Shirt über seinen Boxershorts. Seine hellbraunen Haare stehen in alle Richtungen ab. Er sieht ganz und gar bezaubernd aus, finde ich. Morgens ist er immer am schönsten, wenn die Last seiner Gedanken noch keine Zeit hatte, seine Laune zu drücken. Wenn der Tag noch frisch und alles voller Verheißung ist.
Er räuspert sich, und Hilbert macht sich lang, legt seine Pfoten auf Curtis’ Schultern und reibt den Kopf an seinem Kinn.
»Morgen«, erwidere ich und wünsche mir im Stillen, Hilbert möge mit seinen Liebesbekundungen aufhören. Denn es gibt kaum etwas Heißeres als einen Mann mit Katze. In meinen Augen schlägt es sogar einen Mann mit Baby um Längen.
»Was machst du da?«, fragt Curtis und lässt Hilbert auf den Boden plumpsen. Er tritt zu mir an die Anrichte und linst in die Pfanne.
»Blueberry Pancakes.«
»Ist jemand gestorben?« Er runzelt die Stirn.
»Nein«, sage ich lachend, merke aber, dass ich ein bisschen nervös werde. »Kaffee?«
Curtis setzt sich an den Tisch und gießt sich Kaffee aus unserer French Press ein. Ich gebe den letzten Rest Teig in die Pfanne und stelle einen Teller mit Pancakes vor Curtis. Dann nehme ich ihm gegenüber Platz.
»Ich muss mit dir reden«, sage ich, nachdem ich ebenfalls einen Happen gegessen habe. Hilbert streicht um meine Beine und maunzt leise. Er will auf meinen Schoß, aber meine Konzentration gilt dem kommenden Gespräch.
»Okay?« Curtis legt seine Gabel auf den Teller und verschränkt die Arme vor der Brust. »Was habe ich angestellt?«
»Nichts. Du hast nichts angestellt«, beeile ich mich zu sagen. »Es ist vielmehr …«
Der von mir abgewiesene Hilbert versucht es jetzt bei Curtis. Natürlich hat er dort mehr Erfolg. Er springt auf Curtis’ Schoß und beginnt gleich zu schnurren. Auf einmal habe ich das Gefühl, in der Unterzahl zu sein.
»Es geht um Richard«, beginne ich, während ich beobachte, wie Curtis’ Finger Hilberts Kopf massieren. Das ist nicht fair.
»Um diesen Langweiler?«, fragt Curtis desinteressiert.
Ich könnte Richard verteidigen. Könnte sagen, dass er alles andere als ein Langweiler ist, sondern ein fähiger Mathematiker mit vielen Hobbys. Dass er leidenschaftlich gerne bouldert, sich für gesunde Ernährung interessiert. Dass er im Gegensatz zu anderen in der Lage ist, eine normale Beziehung zu führen. Aber ich schlucke es als meinen persönlichen metaphorischen Blueberry Pancake hinunter.
»Das mit Richard und mir könnte was Ernstes werden«, sage ich stattdessen. Die nüchterne Wahrheit. »Er hat mich letzte Woche gefragt, ob wir offiziell zusammen sein wollen.« Jetzt ist es raus. Ich sehe Curtis erwartungsvoll an. Ist er enttäuscht? Eifersüchtig? Gleichgültig?
»Offiziell zusammen, hm?«, fragt er, und sein Gesicht bleibt vollkommen ausdruckslos. »Das klingt so richtig nach Romantik und Leidenschaft.«
Okay, anscheinend ist es ihm doch nicht gleichgültig. »Sei kein Arsch«, erwidere ich. »Ich mag ihn eben. Und ich will es mit ihm versuchen.«
»Ja, klar, versteh schon. Er ist Heiratsmaterial. Wird bestimmt ein ganz wundervoller Daddy. Und wenn er dann seinen schlaffen Schwanz einmal im Monat in dich steckt und du deinen Fake-Orgasmus herausstöhnst …«
»Curtis! Er hat keinen –« Doch er lässt mich nicht ausreden.
»Und so ganz allgemein, nur damit ich das richtig verstehe, ist das meine Angelegenheit, weil …?« Curtis kaut demonstrativ gelangweilt auf seinen Pancakes herum.
»Es ist nicht deine Angelegenheit«, sage ich, »sondern Richards und meine. Aber du bist mein Freund und Mitbewohner. Du wirst ihn jetzt öfter zu Gesicht bekommen. Ich will, dass du nett zu ihm bist. Und vielleicht musst du ihm nicht gleich auf die Nase binden, dass wir eine Affäre hatten.«
»Eure Beziehung fängt ja toll an. Mit richtig viel Vertrauen und so.«
»Ich werde es ihm erzählen«, sage ich. »Wenn ich weiß, dass … er mich nicht dafür verurteilt.« Es wird Blueberry Pancakes geben, so viel steht fest.
»Dass er dich nicht verurteilt? Wow.« Curtis schnaubt verächtlich. »Hätte ich gewusst, dass die Sache mit uns etwas ist, das andere verurteilen, hätte ich mich nie auf dich eingelassen.« Sein Tonfall verändert sich. Er äfft mich nach.
»Gibst du mir dein Wort?«, frage ich und übergehe seine Aussage.
»Dass wir nichts mehr machen, das Saint Richard verurteilen könnte? Oder dass ich ihm nichts sage?«
»Offensichtlich beides.«
»Du hast mein Wort«, antwortet er. »Wurde mir, ehrlich gesagt, eh ein bisschen langweilig mit dir. Ist also eine Win-win-Situation. Und wer weiß, vielleicht würde Saint Richard mich auch dafür verurteilen, dass ich mich von dir habe sexuell ausbeuten lassen. Das ist das Letzte, was ich will. Wie stehe ich dann da! Vor ihm!« Seine Stimme trieft vor Sarkasmus.
Ich weiß, dass er das sagt, um mich zu verletzen. Aber damit macht er es mir nur leichter.
»Das zwischen uns war von Anfang an nichts weiter als Spaß«, erinnere ich ihn. »Das waren sogar deine Worte, wenn ich mich richtig erinnere.«
»Also ist doch alles gut, oder?« Er klingt giftig.
Ich hatte absolut erwartet, dass es so läuft. Deshalb die Pancakes. Dennoch geht es mir jetzt auf die Nerven.
»Kannst du bitte ein bisschen weniger Wichser und ein bisschen mehr Freund sein?«, frage ich. »Du bist mir wichtig, Curtis.« Und das meine ich vollkommen ernst. Curtis ist eigentlich einer der besten Freunde, die ich habe. Er ist ein toller Mensch, wenn er es zulässt. Viel zu oft versteckt er sich hinter seiner Wut.
Er schnaubt. »Dein Freund, hm? Na, klar kann ich das. Und als dein Freund sage ich dir, dass ich deinen festen Freund für einen langweiligen Lackaffen halte. Trotzdem wünsche ich dir viel Erfolg bei diesem …« Er hält inne und tut so, als würde er nachdenken. »… Abenteuer. Halt mich auf dem Laufenden. Erzähl mir alles. Welche Farbe haben seine Augen? Was hatte er heute zum Frühstück? Wie groß ist sein Penis?« Er fängt an, mit den Fingern abzumessen. Langsam vergrößert er den Abstand zwischen ihnen. »Echt jetzt?«, fragt er, weil ich nichts sage. »Größer?« Als seine Finger ungefähr sechzig Zentimeter auseinander sind, lässt er sie wieder sinken. »Dann eben nicht«, mault er.
»Ich meine es ernst, Curtis«, sage ich. »Wir wohnen zusammen. Wir sind Freunde. Und du benimmst dich ein bisschen blöd.«
»Hör zu, Amory. Du bist diejenige, die Blueberry Pancakes gemacht hat. Offenbar dachtest du, mich würde diese Sache interessieren oder treffen oder sonst irgend so einen Scheiß. Glaub mir, es könnte mir nicht egaler sein, mit wem du wann vögelst oder Händchen hältst. Also alles gut.«
Es tut mir weh, dass er so mit mir spricht. Denn er hat mir immer etwas bedeutet. Aber seltsamerweise tut es mir noch weher, zu wissen, dass ihn diese Sache eben doch nicht so kaltlässt, wie er behauptet. Curtis’ Seele ist nicht von Natur aus ein schwarzes Loch. Er ist lediglich das Produkt seiner Umwelt. Und nicht einmal die kann wirklich etwas dafür, dass er so verkorkst ist. Wenn eine große Katastrophe das eigene Leben von einem Tag auf den anderen aus den Angeln hebt, wenn man danach nie wieder die Chance bekommt, unbeschwert zu sein, dann ist unterdrückte Wut vielleicht noch das Beste, worauf man hoffen kann.
»Wenn die Pancakes überflüssig waren, wäre es nur fair, du würdest dich um den Abwasch kümmern«, sage ich und gehe einfach über seine Unverschämtheiten hinweg.
»Darf ich vielleicht noch aufessen?«, fragt er etwas pampig, scheucht Hilbert von seinem Schoß und widmet sich den inzwischen kalten Pancakes. Immerhin ist der feindselige Tonfall aus seiner Stimme verschwunden.
»Ich bitte darum«, antworte ich.
Als er wenig später den Tisch abräumt, nutze ich die Gelegenheit und ziehe ihn in eine Umarmung. Auch wenn er denkt, er würde es nicht brauchen. Auch wenn er mich vermutlich dafür verachtet, dass ich mehr Gefühle zeige als er, nachdem ich unsere Affäre beendet habe.
»Äh«, macht er, lässt mich aber gewähren.
Ich spüre seinen warmen Körper an meinem dünnen Spaghettiträgertop, seine Brust, die sich hebt und senkt. Seine Arme hängen schlaff an der Seite herunter, als wüsste er nicht, wie so eine Umarmung funktioniert.
»Ich hab dich lieb, Curtis«, sage ich und drücke ihn noch ein bisschen fester.
»Halt die Klappe«, sagt er, aber ich höre das leichte Lächeln in seiner Stimme.
»Ich dich auch, wäre eine passende Antwort«, sage ich grinsend, um ihm auf die Sprünge zu helfen.
»Du mich auch«, sagt er und tätschelt etwas unbeholfen meinen Rücken.
Das Gefühl seines Körpers an meinem ist viel zu vertraut. Bevor Erinnerungen wach werden, löse ich mich von ihm.
»Eine Sache sollten wir vielleicht festhalten«, sagt er und dreht den Wasserhahn auf. »Wenn du dich an mich presst, als würdest du mich gleich bespringen wollen …«
»Ich hab mich nicht –«, setze ich an, doch er hört mir gar nicht zu.
»… wenn du deine Brüste in so einem Oberteil, noch dazu ohne BH, an mir reibst …«
»Ich hab meine Brüste nicht –«
»… mir zuckersüße Versprechungen in mein Ohr raunst …«
»Ich hab dir keine –«
»… werde ich an dich denken, wenn ich mir gleich einen runterholen gehe.« Er zuckt mit den Schultern. »Und in meiner Vorstellung stöhnst du dann andere Sachen als ›Ich hab dich lieb‹.«
»Du mich auch, Curtis«, sage ich und verlasse die Küche.
»Sag Richard liebe Grüße, wenn du ihn siehst«, ruft Curtis mir nach. »Bin ein großer Fan. Wirklich wahr. Vielleicht sein größter. Denkst du, er würde mal mit mir was trinken gehen? Trinkt er überhaupt? Vielleicht auf einen Smoothie? …«
Den Rest höre ich nicht mehr, weil ich meine Zimmertür schließe. Auf meinem Handy leuchtet eine Nachricht von Richard auf, und ich muss unwillkürlich lächeln. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Mit einem Mann an meiner Seite. Viel zu lange habe ich mich nicht getraut, wieder Nähe zuzulassen. Und mit Curtis wäre diese Art von Beziehung, diese Art von Intimität ohnehin nie möglich gewesen. Er weiß das, ich weiß das. Ich bin nicht so naiv, dass ich glauben würde, die richtige Frau könnte Curtis’ seelische Narben heilen. Entweder er macht es selbst, oder er lebt damit.
Guten Morgen, schöne Frau, lese ich, und mein Lächeln wird breiter. Ich habe von dir geträumt.
Das ist es, was ich will. Ein Mann, der keine Angst hat vor seinen Gefühlen. Jemand, auf den ich mich verlassen kann. Ein Mann, der ehrlich ist, mich nicht hintergeht. Jemand, dem ich vertrauen kann. Ich brauche kein Feuer und keine Atemlosigkeit. Ich möchte Liebe, die über Selbstliebe hinausgeht. Statt wild will ich es wunderbar.
2
Curtis
»… am Schlagzeug: Curtis Sullivan, Ladies and Gentlemen«, ruft Link, unser Gitarrist und Leadsänger, ins Mikrofon.
Die Menge johlt, und zum ersten Mal an diesem Abend muss ich mich nicht zurückhalten. Ich kann fucking alles rauslassen. Dresche auf mein Schlagzeug ein, wirble die Sticks über die Toms und Becken. Eigentlich soll mein Solo nur vier Takte lang sein, doch ich bin gerade so im Flow, dass ich einfach weitermache. Aus dem Augenwinkel nehme ich wahr, wie Bonnie, unsere Bassistin, weiterspielen will, aber noch bin ich nicht fertig. Der ohrenbetäubende Lärm, das ungezügelte Wüten ist genau das, was ich brauche. Deswegen ist das Schlagzeug mein Instrument. Weil es alles vergibt. Weil es mich lässt.
Schweiß rinnt mir die Schläfen hinunter, meine Arme brennen, und so komme ich langsam zum Ende. Nach acht statt vier Takten. Dem Publikum gefällt es trotzdem. Sie klatschen und kreischen. Besoffene Touristen, die uns heute hoffentlich genug Kohle für den ein oder anderen Schnaps in den Hut werfen.
Als Link jedem von uns ein Bündel Scheine hinhält, weiß ich, dass es reicht. Zwei Zehner wandern gleich in die Tasche meiner ausgewaschenen Jeans, der Rest verschwindet in meinem Geldbeutel.
»Okay, wer hat Bock auf ’ne Runde Feiern?«, frage ich. »Jasper, du bist entschuldigt.«
»Ich fühle mich seltsam befreit und gleichzeitig beleidigt«, sagt Jasper grinsend. Er ist unser Pianist und Vater von zwei kleinen Kindern. Aus diesem Grund habe ich ihn schon lange abgeschrieben. Auf freundschaftliche Art.
»Bye, Leute«, sagt unser Trompeter Sal. Auch mit ihm ist nichts anzufangen. Er verschwindet nach jedem Gig und jeder Probe sofort. Sagt, er brauche keine Freunde, sondern eine Band. Also geben wir ihm Letzteres und lassen ihn in Ruhe.
»Link? Bonnie?«
Ich habe keine Lust, allein weiterzuziehen, aber zur Not mache ich auch das. Wäre nicht das erste Mal. Denn in die Wohnung zu gehen, um leise lovey-dovey-Gespräche aus Amorys Zimmer zu hören, ist so ungefähr das Letzte, was ich tun möchte. Nicht, weil Amory nicht mit Richard zusammen sein soll. Sie kann es treiben, mit wem sie will. Ich wünschte nur, der Vollpfosten würde es ihr endlich richtig besorgen. Diese Laber-Nummer macht mich sauer.
»Geh ruhig«, sagt Jasper gerade zu Bonnie. Die beiden sind seit ein paar Wochen zusammen und schauderhaft süß dabei. Fast könnte es einem hochkommen, würde man sich nicht für sie freuen.
»Braucht sie jetzt deine Erlaubnis?«, frage ich, was dumm ist, weil ich meinen Freunden nicht ans Bein pissen sollte, wenn ich Gesellschaft will.
Doch Bonnie grinst nur. »Ein Drink, Curtis. Dann geh ich nach Hause.«
»Lieblingsmensch«, sage ich und nehme sie in einen sanften Schwitzkasten.
Link ist auch am Start, und zu dritt gehen wir Richtung Bourbon Street. Link hat die Gitarre auf dem Rücken und schiebt sein altes, klappriges Fahrrad. Jasper hat netterweise Bonnies Kontrabass mitgenommen. Das Schlagzeug gehört ohnehin dem Cat’s Cradle.
Es ist Montagabend, aber trotzdem ist das French Quarter voller angetrunkener Leute. In die Frenchmen Street, in der wir spielen, kommen sie vor allem wegen der Musik. In der Bourbon Street suchen sie Zerstreuung, Rausch und nackte Brüste. Deswegen machen Menschen wie Link und Bonnie meistens einen Bogen darum. Heute steuern sie mit mir eine der Bars an. Zwischen all den Besoffenen, der lauten Musik, die aus den Läden schallt, und den Neonschildern fällt es leicht, sich selbst zu vergessen. Ich liebe es. Liebe die kaputten Leute, den Lärm, die Zügellosigkeit.
Das Lou’s ist meine Stammkneipe auf der Bourbon Street, eine ehrliche Bar ohne großen Schnickschnack. Hinter der Bar steht Lous Frau, eine dralle Blondine, die hier so etwas wie die gute Seele ist.
»Curtis, Darling«, sagt sie, als sie mich erblickt. Ihre stark geschminkten Augen hellen sich merklich auf.
»Wanda, mein Engel, krieg ich drei Wodka und drei Bier?«, frage ich und klopfe auf den Tresen.
»Für mich keinen Wodka«, ruft Bonnie aus der Sitznische, die sie und Link besetzt haben, doch ich ignoriere sie.
Wir stoßen an, ich kippe den Wodka hinunter und nehme einen tiefen Schluck von meinem Bier. Ich fühle mich großartig und nur ein bisschen beschissen.
»Was für ein geiler Abend, oder?«, sage ich in die Runde.
»Haben wir lange nicht gemacht«, erwidert Link.
»Ja, weil ihr auf einmal langweilig geworden seid.«
»Oder glücklich«, schlägt Bonnie vor.
»Darauf trinke ich«, sagt Link.
Mir entgeht nicht, dass auch er seinen Wodka nicht angerührt hat. Also ziehe ich sowohl Bonnies als auch sein Shotglas zu mir. Umso besser.
»Dann erzählt mal, wie läuft’s in euren monogamen Beziehungen?«, frage ich und kippe Bonnies Wodka hinunter.
»Eigentlich ist alles perfekt«, sagt Link. »Franzis Visum wurde verlängert. Aber eine feste Stelle hat sie immer noch nicht gefunden. Sie hat ein paar kleinere Aufträge für Bekannte von Faye gemacht, sodass sie über die Runden kommt. Nur die Sache mit der Aufenthaltserlaubnis …«
Er spricht nicht zu Ende. Ich weiß, dass die Situation für ihn und seine Freundin Franzi, die aus Deutschland kommt, schwierig ist. Und ich weiß auch, dass es eine Lüge wäre, zu sagen, dass alles gut wird. So funktioniert es nun mal nicht. Für manche wird es gut. Andere bleiben auf der Strecke. Deswegen schweige ich und wünsche den beiden im Stillen alles Gute.
»Ich sage meiner Mom, sie soll sich in der Gemeinde umhören. Vielleicht hat jemand eine Idee«, sagt Bonnie. Sie ist eine echt gute Freundin. So gut, dass es fast albern ist. Wahrscheinlich ist sie der Mensch, dem ich am allermeisten vertraue.
»Genug von uns«, sagt Link. »Wie läuft’s bei dir und Jasper? Honeymoon-Phase und rosarote Brille?« Er grinst Bonnie an.
»Das haben wir übersprungen, glaube ich«, antwortet sie. »Bei uns ist von Anfang an Alltag gewesen. Aber …« Kurz zögert sie. »Der Alltag fühlt sich an wie Honeymoon.«
Ich stürze Links Wodka in einem Zug hinunter. »Da kriegt man ja fast Lust auf eine Pyjamaparty und gegenseitiges Nägellackieren, wenn man euch so zuhört«, sage ich. »Wanda? Kriegen wir noch drei Kurze?«
»Willst du vielleicht ein bisschen langsam machen?«, fragt Link.
Ich schnaube. »Da haben wir nach Monaten einmal Zeit, zu dritt ein bisschen zu feiern, so wie früher. Und ausgerechnet dann soll ich langsam machen?«
»Ich meine ja nur, du hast vermutlich mehr davon, wenn du dich morgen noch daran erinnerst.«
»Aber darum geht es doch«, sage ich und lege ihm meinen Arm um die Schultern. »Einmal nicht daran denken, was morgen ist.«
Wanda bringt drei neue Shotgläser.
»Trink einen mit, Wanda!«, rufe ich begeistert. Meine Zunge wird schon etwas schwer, mein Kopf ist allerdings vollkommen wach. Das hier ist ein guter Moment!
Wanda quetscht sich zwischen Link und mich. »Worauf trinken wir?«, fragt sie mit ihrer rauchigen Stimme.
»Auf das Leben. Auf uns!«, sage ich überschwänglich. »Darauf, dass wir uns genug sind.«
Bonnie und Link heben ihre Biergläser, doch mir entgeht der Blick nicht, den sie sich zuwerfen. Und auf einmal wünschte ich, ich wäre allein unterwegs. Ohne Leute, die auf mich aufpassen wollen. Die über mich urteilen. Die wollen, dass ich langsam mache, während sie vor ein paar Monaten noch genauso drauf waren wie ich.
Wanda versteht mich. Sie lacht und lebt einfach. Obwohl sie es sicher auch nicht leicht hat. Und in meiner euphorischen Stimmung gebe ich ihr einen Kuss auf ihre klebrige alte Wange.
»Ach, du«, sagt sie und wird unter der dicken Schicht Make-up tatsächlich etwas rot. »Wäre ich ein paar Jahre jünger …«
Der Alkohol macht alles besser. Alles ein bisschen wärmer. Alles ein bisschen lebendiger. Mich eingeschlossen. Ich werde richtig hungrig aufs Leben, hungrig auf Abenteuer. Hungrig auf neue Leute, fremden Sex. Ich spüre, wie etwas aus mir herausbrechen möchte, und bestelle noch eine Runde Bier und einen weiteren Shot.
Eine Horde junger Männer betritt johlend die Bar. Sie tragen einheitliche T-Shirts. Seine letzte Stunde hat geschlagen steht darauf. Der Bräutigam bahnt sich seinen Weg durch die Bar. Sein T-Shirt verrät, dass er heute noch ledig und ab morgen erledigt ist.
»Wir brauchen Bier«, grölt er, und seine Entourage antwortet mit wolfsartigem Geheul.
»Hey, du!«, rufe ich. »Wenn du deine Frau so scheiße findest, warum heiratest du sie dann?« Ich merke, dass ich etwas lalle.
»Curtis, lass ihn doch!«, sagt Bonnie.
»Würde mich aber echt mal interessieren.« Ich verschränke die Arme vor der Brust und sehe ihn spöttisch an. »Hat sie auch so ein megacooles T-Shirt?«
»Trink was mit uns«, sagt der Junggeselle und bedeutet Wanda, mir noch ein Bier zu zapfen. »Ist doch alles nur Spaß.«
»Nee, Leute, echt nicht.« Ich versuche, jede Silbe ganz genau auszusprechen, um nicht so dicht zu wirken, wie ich bin. »Lasst uns woanders hingehen.«
Das Bier, das der zukünftige Bräutigam vor mich stellt, exe ich, während ich aufstehe. Ich merke, dass ich etwas schwanke. Das ist das Problem am Alkohol. Während man im Kopf noch voll da ist, versagen die Muskeln langsam.
»Wollen wir vielleicht nach Hause gehen?«, schlägt Bonnie vor.
»Wollen wir vielleicht deine Schwester besuchen?«, frage ich. Bonnies Zwillingsschwester Lula tanzt in einem Nachtclub ein paar Blocks weiter.
»Da bin ich raus«, sagt Link.
»Bei dir hat das mit dem Erledigtsein schon vor der Ehe angefangen, oder?«, frage ich und fühle mich wie ein komplettes Arschloch dabei. Ich mag Franzi. Und eigentlich ist es wohl nett, dass Link sich keine anderen Brüste anschauen will. Aber es frustriert mich trotzdem.
»Geh nach Hause, Curtis«, sagt er nun, und ich kann es ihm nicht mal verdenken.
»Sorry, Mann, war nicht so gemeint. Ein Drink bei Lula, dann gehen wir nach Hause.« Ich vermutlich nicht, allerdings muss ich ihm das ja nicht auf die Nase binden.
Bei meinen ersten Schritten Richtung Ausgang schwanke ich noch ein bisschen, doch dann pendelt sich mein Körper wie von selbst wieder ein. Ich klatsche Wanda ein paar Scheine auf den Tresen und werfe ihr eine Kusshand zu.
Draußen fische ich etwas unkoordiniert meine Zigarettenschachtel aus der Hosentasche und schnippe zweimal dagegen, bis eine Kippe herausfällt. Meine Bewegungen sind zu langsam, und im nächsten Moment muss ich mich nach ihr bücken. Das Feuerzeug reagiert erst auf den dritten Versuch.
Inzwischen sind Bonnie und Link neben mir aufgetaucht. »Also, was is’?«, frage ich und inhaliere tief. Ein bisschen zu tief, denn sofort kippt die Welt. »Whoa«, mache ich und suche mein Gleichgewicht. Ich lehne mich an die Wand der Bar und fange an zu lachen. »Was für Trottel, oder?« Ich zeige durchs Fenster auf den Junggesellenabschied. »Besuchen wir jetzt Lula?«
»Ein Drink, Curtis«, sagt Bonnie. »Und Link lassen wir nach Hause gehen.«
»Abgemacht. Du bist eh mein Lieblingsmensch«, flüstere ich so laut, dass Link es auf jeden Fall hört. Ich fühle mich ziemlich witzig. Beschwingt. Link kann machen, was er will. Ich habe Bonnie.
Der Eingang zu dem Nachtclub, in dem Lula arbeitet, ist mit dem Neonschriftzug »Girls, Girls, Girls« verziert. Vor der Tür steht ein bulliger Typ und lässt sich Ausweise zeigen.
»Weißt du, ob Lula tanzt?«, fragt Bonnie.
»Sie müsste schon angefangen haben«, sagt der Bullige und winkt Bonnie herein. Ich klatsche mit Link ab und will hinter Bonnie in den Club gehen, doch der Türsteher bremst mich mit seiner Hand.
»Was, Mann?«, frage ich. »Ich gehöre zu Bonnie.«
»Du bist jenseits, Alter«, sagt er.
»Jenseits von was?«
»Jenseits von ›nüchtern genug, um hier reinzukommen‹.«
Bonnie ist inzwischen wieder neben mich getreten. »Er ist cool, er gehört zu mir«, sagt sie.
»Sorry, Bonnie, aber das kann ich nicht machen.«
»Was kannst du nicht machen, du Clown?«, frage ich.
»Besoffene Vollidioten wie dich in den Club lassen.«
»Alter, wie hast du mich gerade genannt?« Ich hasse diesen Typen. Vielleicht schwanke ich etwas, doch ich bin ein fucking zahlender Kunde.
»Anweisung vom Chef«, sagt er gerade zu Bonnie. »Ich kann da echt nichts machen. Die Sicherheit der Mädels geht vor.«
Ich fange an, laut zu lachen. »Was ist dein verfluchtes Problem, Mann? Glaubst du, ich würde Lula anfassen? Wir wollen einfach nur was trinken.«
»Das habt ihr sehr erfolgreich schon woanders gemacht«, erwidert er und wendet sich den nächsten beiden Kerlen zu, die ihm ihre Ausweise hinhalten.
»Komm, Curtis, das ist ein Zeichen. Wir gehen einfach bald wieder zusammen was trinken.« Es ist Link, der nach wie vor hinter mir steht, bereit loszufahren.
»Ich scheiß auf den Kerl und seine verfickten Regeln«, sage ich, und während er mit der Taschenlampe auf den einen Ausweis leuchtet, mache ich einen Satz an ihm vorbei und in den Club hinein.
Drinnen ist es dunkel und nicht so voll, wie man erwarten würde. Auf einer Bühne rekeln sich zwei Frauen in aufreizender Unterwäsche zu irgendwelchen Beats. Eine große Blonde und die tätowierte, zierliche Lula. Ich sehe mich hastig um, suche eine Möglichkeit, um mich vor dem Türsteher zu verstecken. Das Adrenalin bewirkt, dass ich mich auf einmal wieder ganz nüchtern fühle.
»Was habe ich dir gerade gesagt, Bürschchen?«, höre ich eine Stimme hinter mir. Der Türsteher hat mich sofort ausgemacht. Bonnie steht hinter ihm, auf dem Gesicht ein müdes Grinsen.
Ich bin stark, aber der bullige Kerl ist stärker als ich. In null Komma nichts hat er mich am Arm gepackt und schleift mich wieder nach draußen. Ein paar Köpfe wenden sich um.
»Ich will dich hier heute Abend nicht mehr sehen«, sagt der Türsteher. »Sonst gibt’s Hausverbot.« Vor dem Eingang lässt er mich los, jedoch nicht ohne mir einen kräftigen Schubs zu geben, sodass ich beinahe nach hinten umfalle. So behandelt mich keiner. Schon gar nicht so ein dahergelaufener Möchtegern-Hulk. In mir regt sich die Wut. Wut auf ihn, Wut auf seine beschissenen Regeln, die der Grund sind, warum ich nicht noch einen Drink mit Bonnie nehmen kann. Wut auf die ganze verfluchte Welt, in der nie irgendwas so läuft, wie ich es mir vorstelle.
»Finger weg!«, knurre ich und schubse ihn zurück, so fest ich kann. Ich will, dass er sich wehrt. Will, dass er mit seinem fetten Arm ausholt. Doch er hält einfach nur meine Hände fest und lacht. Lacht mich aus.
»Geh nach Hause, Junge«, sagt er und schenkt mir einen mitleidigen Blick.
Ich will sein verficktes Mitleid nicht. Ich will ihm seine hässliche Nase brechen. In dem Moment, als er mich loslässt, bin ich bereit. Ich hole aus, doch wieder fängt er meine Hand ab und hält sie fest.
»Mach dich nicht lächerlich«, sagt er. »Ich bin genau für so was ausgebildet.«
»Curtis?«, fragt Bonnie hinter mir. »Hast du jetzt genug?«
Und ja, ich schätze, das habe ich. Ich spucke auf den Boden und laufe mit großen Schritten die Bourbon Street zurück. Von ferne höre ich noch, wie Bonnie Link versichert, dass sie sich um mich kümmert. Als bräuchte ich einen Babysitter.
»Hey, Curtis«, ruft sie wenig später. »Warte auf mich.« Sie rennt hinter mir her und hat mich gleich darauf eingeholt. »Das war uncool«, sagt sie. »Ich hasse es, wenn du so bist.«
»Ich hasse es, wenn die Welt so ist.«
»Ich weiß«, sagt sie und legt mir eine Hand auf den Arm. »Aber die anderen können nichts dafür.«
Vielleicht hat sie sogar recht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade gar nichts so richtig. Außer dass die Welt sich wieder dreht und ich auf einmal sehr müde werde.
»Tut mir leid, Bonnie.«
»Ist schon okay.«
»Nein, das ist es nicht. Ich wollte, dass wir einen geilen Abend haben. Einfach nur noch ein Drink. Deine Brüste an deiner Schwester sehen.«
»Du bist so ein Arsch«, sagt sie und boxt mich fest in die Seite.
»Aua!«
»Du bist ein Arsch, aber es liegt daran, dass Amory mit dir geredet hat, oder?«
Ich gebe einen knurrenden Laut von mir. »Komm mir bloß nicht so.«
»Es ist nicht schlimm, wenn man traurig ist.«
»Traurig? Dass ich nicht lache!«
»Du kannst vor mir du selbst sein, weißt du? Dass sie jetzt mit Richard –«
»Lass den Scheiß, Bonnie«, unterbreche ich sie. Denn den Namen dieses Langweilers kann ich im Moment echt nicht ertragen. »Er hat mich provoziert, und ich habe keinen Bock, mir alles gefallen zu lassen. Mehr ist da nicht.«
»Okay«, sagt sie, aber ich merke ganz genau, dass sie mir nicht glaubt. Das ist der Scheiß mit Freunden. Sie verstehen dich immer besser als du dich selbst.
3
Amory
Richard winkt mir von einem Tisch ganz hinten am Fenster zu. Das Restaurant ist eines dieser neuen hippen Lokale, die überall aus dem Boden sprießen. Moderne Küche, modernes Ambiente. Das Cochon befindet sich in einer ehemaligen Lagerhalle, in die man eine Galerie eingezogen hat. Die Fenster sind meterhoch, der enorme Hall verstärkt jedes Geräusch. Aber das Essen soll fantastisch sein, deswegen hat Richard es vorgeschlagen.
Ich schlängle mich an den Tischen vorbei, und wie automatisch verzieht sich mein Mund zu einem Lächeln. Richards Blick ist auf mich geheftet, und er sieht gut aus. Ein bisschen wie eines dieser Brillenmodels. Dunkle Haare, Seitenscheitel, Undercut, Dreitagebart. Unter einem hellblauen Hemd zeichnet sich sein schlanker Körper ab. Sobald ich nah genug bin, erhebt er sich, kommt mir entgegen. Er legt seine rechte Hand in meinen Nacken und zieht mich sanft zu sich, um mir einen Kuss auf die Lippen zu drücken.
»Du siehst toll aus«, sagt er und lässt seinen Blick einmal von oben nach unten über mich wandern. Mit einiger Genugtuung nehme ich wahr, dass er etwas länger an meinem Ausschnitt hängen bleibt.
Eigentlich mache ich mir nicht viel aus dem Urteil anderer. Ich habe gelernt, dass Makel augenblicklich aufhören, welche zu sein, wenn man sie an sich selbst akzeptiert. Oft werden sie dann zu einer Stärke. Doch nach all den Monaten, in denen ich single war, in denen ich mich geweigert habe, irgendwen wirklich in mein Leben zu lassen, ist es schön zu wissen, dass ich es bringe.
»Danke«, erwidere ich und setze mich auf den Stuhl ihm gegenüber.
»Die sind hier berühmt für ihren Aperitif. Portwein mit hauseigenem Tonic Water«, sagt Richard und studiert die Getränkekarte.
»Klingt gut«, erwidere ich. »Aber ich freue mich schon den ganzen Tag auf ein Glas Weißwein.«
»Wollen wir uns ein paar von den Appetizern teilen?«, fragt er dann und zeigt mir auf der Speisekarte, was er meint. Ich nicke, denn es klingt alles ziemlich fantastisch. Shrimps mit Knoblauchbutter, gebratener Alligator mit Chili-Mayonnaise, Krebs-Pie, Schweinebäckchen mit Kürbispüree …
»Hey.« Richard greift über den Tisch und nimmt meine Hand. »Es ist schön, dich zu sehen.«
Mit Richard ist es so einfach. Kein Minenfeld, auf dem man aufpassen muss, wo man hintritt, wenn man vermeiden will, dass etwas (oder jemand) in die Luft geht. Er schwankt nicht ständig zwischen himmelhochjauchzend und brüllender Wut auf alles und jeden. Es ist entspannt. Und ich bin es überraschenderweise auch. Obwohl so etwas auch immer Risiken birgt. Obwohl man sich verletzlich macht. Aber ich habe es mir ausgesucht. Ich wollte es. Wollte es wieder wagen. Zu zweit.
Wenig später stoßen wir mit unseren Getränken an. Richard lässt mich seinen Aperitif kosten, der wirklich gut schmeckt.
Wir unterhalten uns kurz über die Arbeit. Wir sind Kollegen an der mathematischen Fakultät der Tulane University, schreiben beide an unserer Doktorarbeit. Richard promoviert über numerische Optimierung, während meine Forschung in der Chaostheorie deutlich weniger anwendungsorientiert ist. Das Schöne ist, dass wir dennoch darüber reden können, etwas, das mit niemandem außerhalb der Mathematik so richtig möglich ist.
Das Essen kommt und schmeckt hervorragend. Richard ist glücklich, und ich bin es auch. Und in diesem Moment weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Dass ich endlich wieder bereit bin, mich auf jemanden einzulassen, nachdem ich vor ein paar Jahren so fies hintergangen wurde. Auch wenn ich Curtis damit wehgetan habe. Aber es war von Anfang an klar, dass wir beide den Status der Unverbindlichkeit nicht aufgeben würden. Es war das, was wir beide brauchten. Ich nach einem Vertrauensmissbrauch, er, weil er zu mehr nicht fähig ist. Und wir wussten, dass dieser Status ein Ablaufdatum hatte. Ich mag ihn. So, so gern. Doch ich kann nicht mit ihm zusammen sein. Niemand kann das. Er kann es ja nicht einmal selbst.
Richard ist schön. Er sieht klug aus, reflektiert. Andere würden ihn vielleicht langweilig oder zu glatt finden. Ich sehe ihn einfach gerne an. Und er duftet. So gut!
»Was?«, fragt er grinsend, als ihm auffällt, dass ich ihn anstarre.
»Ich mag dein Gesicht«, sage ich.
»Ich mag dein Gesicht«, erwidert er, streckt erneut seine Hand aus. Doch diesmal lässt er seine Finger an meiner Wange entlangwandern.
Ich schließe die Augen, genieße die Berührung. Wünschte, wir wären nicht an einem öffentlichen Ort, sondern in meinem Schlafzimmer. Seit zwei Monaten gehen wir auf zwanglose Dates. Seit einer Woche sind wir richtig zusammen. Und dennoch haben wir noch nicht miteinander geschlafen. Wir haben andere Sachen gemacht. So ziemlich alles, was man tun kann, ohne dass sich die Genitalien berühren. Und langsam wird es Zeit.
»Hast du Lust, nach dem Essen mit zu mir zu kommen?«, frage ich und beiße mir auf die Unterlippe.
»Gern«, sagt er, und in seinen Augen blitzt etwas auf.
»Ich will mit dir schlafen«, flüstere ich und sehe ihn erwartungsvoll an.
»Ich auch mit dir«, sagt er leise und beugt sich über den Tisch, um mich zu küssen. »Aber ich bin noch nicht so weit.«
Es kostet mich einiges an Anstrengung, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
»Sex ist für mich etwas sehr Intimes. Etwas sehr Persönliches«, sagt er. »Ich mag dich. Sehr. Aber wenn ich mit dir schlafe, soll es etwas heißen. Eine schnelle Nummer, triebgesteuertes, bedeutungsloses Herumbumsen – das bin ich nicht. Das sind wir nicht.«
Ich schlucke. Es ist das, was ich mit Curtis hatte. Der Plan, ihm davon zu erzählen, ist erst mal in weite Ferne gerückt. Ich fühle mich nicht gut damit, etwas vor Richard geheim zu halten, doch ich will, dass wir eine Chance haben. Die Blueberry Pancakes müssen noch ein bisschen warten. Kurz habe ich ein elend schlechtes Gewissen. Aber dann fällt mir ein Artikel ein, den ich neulich gelesen habe, in dem es darum ging, dass man in den ersten Monaten einer Beziehung nie so richtig man selbst ist. Dass man die Marotten und schlechten Angewohnheiten versteckt. So lange, bis das Vertrauen groß genug ist, bis die Partnerschaft stabil genug ist, um den Murks zu verkraften. Curtis ist mein Murks, und ich beschließe hier und jetzt, Richard den seinen sofort zu verzeihen, wenn es so weit ist.
»Aber wir können andere Dinge machen«, sagt er.
»Ja«, erwidere ich lächelnd.
Vom Cochon ist es ein knapp dreißigminütiger Fußweg zu meiner Wohnung in der Burgundy Street am Rand des French Quarter. Der Weg führt uns vom Warehouse District mit seinen verlassenen oder wiederbelebten großen Hallen, den die Gentrifizierung in den letzten Jahren langsam für sich entdeckt hat, Richtung Canal Street. Wir schlendern in gemächlichem Tempo auf die Wolkenkratzer des touristischen Zentrums zu, die Gehwege sind gesäumt von kleinen Magnolienbäumen.
»Erzähl mir von deiner Familie«, sagt Richard.
»Was willst du denn wissen?«
»Ich will wissen, wo du herkommst. Dich noch besser kennenlernen. Wie war es, auf einer Farm aufzuwachsen?« Er verwebt seine Finger mit meinen, und ich grinse in mich hinein.
»Ich mochte die Tiere«, sage ich. »Ich mochte es, dass die Familie immer beisammen war. Aber irgendwie, also, es war nicht mein Ding. Und meine Eltern haben das auch irgendwann mitbekommen.«
»Wie war das für sie?«
»Seltsam, glaube ich. Meine Lehrer hatten schon ein paarmal mit ihnen darüber gesprochen, dass ich massiv unterfordert war. Und dann kam dieser Mathematik-Wettbewerb für die neunten Klassen. Da war ich elf und gerade in der sechsten. Als ich den ersten Platz im gesamten Bundesstaat Mississippi belegte, wurde uns allen klar, dass meine Zukunft wohl nicht die Farm sein kann.«
»Glaubst du, es war ein Schock für sie?«, fragt Richard.
»Ein Schock nicht wirklich. Ich glaube, ich habe es einfach immer wieder geschafft, ihre Erwartungen zu unterwandern. Seit dem Tag meiner Geburt. Sie hatten mit einem Jungen gerechnet. Meine Mom war sich hundertprozentig sicher. Sie wollten ihren Sohn Amory nennen, nach meinem Großvater mütterlicherseits. Na ja, dann kam ich auf die Welt, aber der Name ist geblieben.«
»Waren sie enttäuscht?«
»Nein. Enttäuscht waren sie nie. Immer wieder überrascht, das ja. Und dann haben sie ihre Pläne einfach angepasst. Beispielsweise noch ein Kind gemacht, als sie eingesehen haben, dass das mit mir und der Farm nichts wird. So bin ich zu meinem kleinen Bruder gekommen.«
Wir erreichen die Canal Street, die auch an einem Wochentag voller flanierender Menschen ist. Die hochgewachsenen Palmen wiegen sich leicht im Wind. Teure Hotels, Touristenläden und Restaurantketten locken zu jeder Tages- und Nachtzeit Besucher an.
»Und? Wird er die Farm übernehmen?«, fragt Richard.
»Bislang hat er zumindest noch keine anderen Ambitionen«, sage ich und denke daran, dass Nicky sich zu Weihnachten vor zwei Jahren einen Lego-Bauernhof gewünscht hat. Weihnachten. Aus dem Augenwinkel sehe ich Richard an, und auf einmal wird mir ganz warm. Vielleicht habe ich dieses Jahr zu Weihnachten das erste Mal seit Langem einen Freund. Das erste Mal seit Leo, dem Fremdgänger. Ich sehne mich danach, die romantischste Zeit des Jahres zu zweit verbringen zu können.
Wir machen einen Bogen um die Bourbon Street, biegen rechts in die Dauphine ab. Hier, eine Querstraße weiter, ist es deutlich ruhiger. Es gibt nur vereinzelte Bars, vor denen Leute herumlungern und rauchen.
»Erzähl mir irgendwas Lustiges über dich«, sage ich. »Irgendwas Besonderes.«
»Was Besonderes? Oh wow, das ist schwierig.« Er denkt kurz nach. »Was ist denn mit dir?«
»Okay, pass auf«, sage ich, »ich bin besessen von Tierdokumentationen. Besonders liebe ich die von David Attenborough. Planet Earth und so.« Das war früher Nickys und mein Ding. Dann wurde es zu Esmés und meinem Ding. Und vielleicht kann es jetzt zu Richards und meinem Ding werden. Denn ich will das mit uns beiden so sehr. Will, dass es funktioniert. Weil ich das Single-Dasein einfach satthabe.
Eine Pferdekutsche kreuzt unseren Weg. Das Klingeln der Glöckchen am Halfter, das Klappern der Hufe ist ein allgegenwärtiges Geräusch im French Quarter. Ebenso wie grölende Betrunkene und laute Brass Bands, die durch die Straßen ziehen. Ich liebe die Lebendigkeit. Die Sorglosigkeit, die das Viertel ausstrahlt. Mach das Beste aus dieser Nacht, denn wer weiß, ob wir morgen nicht von einem Hurrikan weggefegt werden, scheint es zu sagen.
Manchmal kommt es mir so vor, als hätte die Stadt selbst Narben von all den Katastrophen, die sie schon überlebt hat. Dabei sind es nur die Menschen, die mit Dämonen aus der Vergangenheit zu kämpfen haben. Menschen wie Curtis. Doch im French Quarter, in der Musik, in der Kunst finden sie alle zu einem Kollektiv zusammen. Zu einer Menge, die sich bei der Heilung unterstützt, bis ein neues Unglück sie wieder auseinanderreißt. Die Stadt selbst ist eine tickende Zeitbombe. Genauso wie manche ihrer Bewohner.
»Richard! Kumpel!«, sagt Curtis mit übertriebener Begeisterung und klopft ihm dreimal fest auf den Rücken. Richards gequältem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, etwas zu fest. »Schön, dich endlich mal wiederzusehen.«
Ich werfe ihm einen warnenden Blick zu, doch Curtis zuckt nur mit den Schultern.
»Da ist ein Brief für dich gekommen«, sage ich und reiche ihn Curtis in der Hoffnung, dass er damit abgelenkt ist. Aber er faltet ihn zusammen und stopft ihn in seine hintere Hosentasche.
»Na? Was habt ihr Turteltauben heute Schönes angestellt?«
Ich seufze innerlich. Denn natürlich weiß ich, was er hier tut. Er zieht uns auf, ohne dass Richard es merkt, ohne dass er sich wirklich etwas zuschulden kommen lässt.
»Willst du nicht wissen, was in dem Brief steht? Sieht wichtig aus«, versuche ich es noch mal.
»Wir waren im Cochon«, sagt Richard und folgt blöderweise Curtis’ einladender Geste ins Wohnzimmer. Er ahnt wohl nicht, dass er in sein eigenes Verderben rennt.
»Das klingt ja mega«, sagt Curtis. »Erzähl mir mehr davon.«
Wenn Blicke Schmerzen verursachen könnten, würde Curtis sich jetzt jaulend auf dem Boden winden.
»Irgendwas Offizielles aus Marigny«, nehme ich einen letzten Anlauf, doch Curtis ignoriert mich.
Stattdessen erzählt Richard von seinem Aperitif und unserem Essen. Er ist ganz euphorisch, während er darüber spricht, und ich hasse es, dass Curtis sich über ihn lustig macht.
»Hast du heute keine Bandprobe?«, frage ich von meinem Platz neben der Tür aus. Im Gegensatz zu Curtis und Richard habe ich es mir nicht auf einem der Sofas gemütlich gemacht, weil ich eigentlich so schnell wie möglich in mein Zimmer verschwinden will. Mit Richard. Tickende Zeitbombe.
»Ausgefallen«, sagt Curtis. »Habt ihr Lust auf einen Gute-Nacht-Drink?«
»Lass den Scheiß«, forme ich mit den Lippen an Curtis gewandt. Richard sitzt mit dem Rücken zu mir, sodass er es nicht sehen kann. »Denk an den Brief«, sage ich laut.
Curtis wirft mir einen vollkommen unschuldigen Blick zu, macht aber tatsächlich Anstalten, sich das Schreiben noch mal anzusehen. Sein Verhalten nervt mich. Deswegen lehne ich mich über das Sofa, auf dem Richard sitzt, und lege von hinten meine Arme um seinen Hals. Ich beginne ihm sanfte Küsse auf seine Schläfe, seine Wange, seinen Mundwinkel zu hauchen.
»Süße«, sagt er leise lachend und versucht sich zu mir umzuwenden.
»Ach, da fällt mir ein, ich habe leider noch was Wichtiges vor«, sagt Curtis. Der Schalk ist aus seinem Blick gewichen, und an dessen Stelle blitzt so etwas wie Wut auf.
»Okay«, sagt Richard, »dann beim nächsten Mal.«
Curtis erhebt sich mit dem Brief in der Hand vom Sofa, und kurz darauf hört man, wie die Wohnungstür zugeknallt wird.
»Dein Mitbewohner ist ein bisschen seltsam«, sagt Richard.
»Ich weiß. Er … hatte eine blöde Woche.«
»Glaubst du, er mag mich nicht?«
»Curtis mag niemanden. Außerdem ist es doch völlig egal. Ich mag dich, darauf kommt es an.« Ich beiße ihn sanft in sein Ohrläppchen. »Gehen wir in mein Zimmer?«
Richard nickt. Und auch wenn wir immer noch nicht miteinander schlafen, freue ich mich auf seinen Körper. Auf seine Berührung. Denn mit jedem Mal, das wir uns näherkommen, überschreiben wir gemeinsam eine Erinnerung an Curtis’ Berührungen. Schaffen unsere eigene Vergangenheit, unsere eigene Gegenwart und damit auch eine Chance auf eine wundervolle, dramafreie, bombenentschärfte Zukunft zu zweit.
4
Curtis
Sehr geehrter Herr Sullivan,
einige Bewohner der Nachbarschaft in Marigny haben sich über den Zustand Ihrer Immobilie 704 Mandelville Street beschwert, der nicht nur die Ästhetik und das Ansehen des Viertels in Verruf bringt, sondern auch die Maßnahmen zur Stadthygiene und Schädlingsprävention konterkariert. Hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Häuser in einer derart beliebten Lage auf dem Immobilienmarkt hoch im Kurs stehen, sollten Sie sich mit dem Gedanken tragen, zu verkaufen. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, den offiziellen Weg einzuschlagen und unsere Anwälte einzuschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Guy Livingston
Faubourg Marigny Improvement Association
Ich liege auf Jaspers Couch, auf der ich die letzten Nächte verbracht habe, weil ich keine Lust hatte, nach Hause zu gehen, und lese den Brief zum ungefähr siebzehnten Mal. Und mit jedem weiteren Lesen wächst die Wut in mir. Mit freundlichen Grüßen, dass ich nicht lache! Mit beschissenen Grüßen wohl eher. Wer sind diese Menschen? Warum interessiert es sie, was ich mit meinem Haus mache? Mit meinem verdammten Haus?
Ich bin seit Jahren nicht dort gewesen. Jahre, in denen ich beinahe verdrängt habe, dass es existiert. Dass das, was ich dort hatte, existierte. Damit bin ich eindeutig besser gefahren.
Verkaufen. Das hätten sie wohl gerne. Dass ich mein Haus verkaufe. Damit ein Investor sich das Grundstück unter den Nagel reißt? Luxussaniert? Und dann ein Yuppie-Pärchen sein New-Orleans-Partyhaus daraus machen kann, das es für den Großteil des Jahres über Airbnb vermietet? Sicher nicht, Guy Livingston, du hässliche Made. Vielleicht sollte man die Schädlingsprävention mal auf dich loslassen.
Warum müssen verwöhnte, gelangweilte Menschen ständig fremder Leute Angelegenheiten zu ihren eigenen machen? Was ist das für eine Sucht, anderen zu sagen, was sie falsch machen? Was sie optimieren können? Wie sie sich besser verhalten? Was für ein Aufwand, wenn man bedenkt, wie einfach es ist, sich um seinen eigenen Scheiß zu kümmern.
Doch während ich darauf warte, dass Weston und Maya ins Wohnzimmer gestürmt kommen, um wie jeden Morgen auf meiner Brust herumzuspringen, finde ich auf einmal die Idee reizvoll, einen Ausweichort für mich zu schaffen. Selbst wenn es mein Elternhaus ist. Denn immerhin laufe ich dort nicht Gefahr, mir eine Rippenprellung zuzuziehen oder einem Weichei à la Richard zu begegnen.
Das Wellblech quietscht, als ich es zur Seite schiebe. Dahinter ist es. Mein Haus. Mein einstiges Zuhause. Oder besser gesagt: meine Ruine. In den ersten Jahren nach Hurrikan Katrina bin ich überhaupt nicht hergekommen. Meine Großmutter hatte es mir verboten, und ich war ein zu großer Schisser, als dass ich mich ihr in diesem Punkt widersetzt hätte. Sie kümmerte sich außerdem darum, dass das Haus leer geräumt wurde. Alles, was an uns als Familie erinnerte, wanderte in den Müll. Nicht, dass noch viel intakt gewesen wäre. Nicht, dass man irgendwas davon noch hätte brauchen können. Aber an manchem hingen Erinnerungen. Das war vermutlich genau der Grund, warum sie es loswerden wollte. Der Schmerz war zu groß. Am liebsten hätte sie das komplette Haus einfach abgerissen und das Grundstück verkauft. Doch das konnte sie vergessen. Ich sagte Nein, und dabei blieb es.
Ich habe keine Ahnung, was ich damit eigentlich soll. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt, das Dach ist an einer Stelle löchrig und nur mit einer Plane notdürftig abgedeckt. Die Tür, die früher leuchtend gelb war, hängt seit Katrina windschief in den Angeln. Jetzt in einer Farbe, die nach Klärwerk aussieht. Marigny wurde vom Wasser weitgehend verschont, der Sturm war es, der die alten Irish Channel Houses verheerte. Aber die Substanz ist gut. Und deswegen steht mein Elternhaus noch. Versteckt hinter Wellblech. Für niemanden sichtbar außer für mich.
Die Veranda ist noch intakt. Wenn ich früher hierherkam, setzte ich mich meistens auf die oberste Stufe, trank ein Bier und vergrub den Kopf in meinen Händen, bis es mir zu blöd wurde. Selten wagte ich mich ins Innere des Hauses.
Früher. Früher schreckte mich der Gedanke ab, dass das Haus nie wieder so werden würde, wie es mal war. Derart kitschigen Gefühlskram habe ich allerdings hinter mir gelassen. Es bringt einen ja doch nicht weiter. Heute ist es einfach nur der Schandfleck von Marigny, schätze ich. Mein Schandfleck.
Auf der Tür prangt das große rote X, das die FEMA, die Federal Emergency Management Agency, auf jedes Haus sprayte. Oben die Zahl 912. Das Datum. Der zwölfte September. An diesem Tag waren sie hier, fanden niemanden. Keine Toten, keine Überlebenden, wie die zwei großen Nullen unten verkünden. Dabei habe ich überlebt. Ein paar Meilen weiter westlich in Metairie bei meiner Großmutter. Im Gegensatz zu meinen Eltern. Links befindet sich das Kürzel der Taskforce »CaTF«. Die rechte Ecke ist leer. Keine Risiken entdeckt.
Ich schiebe die Tür auf, sie macht ein scheußlich schleifendes Geräusch auf dem nackten Boden. Drinnen ist es dunkel. Durch die brettervernagelten Fenster fällt nur hier und da ein feiner Lichtstrahl. Das hier war unser Wohnzimmer. Ich erinnere mich noch daran, wo das Sofa stand, wo der Fernseher. Abgesehen von einem Geröllhaufen aus undefinierbarem Schrott, ist der Raum leer. Es riecht etwas modrig. Mit der Handytaschenlampe leuchte ich die gelbliche Wand hinauf an die Decke. Spinn- und Staubweben hängen herab.
Durch einen schmalen Flur gelange ich ins Schlafzimmer meiner Eltern. Es ist so lange her, dass es mir vorkommt wie eine andere Welt. Auch dieser Raum ist leer, abgesehen von einem zerbrochenen Bilderrahmen in der hinteren Ecke. Der Regen, der auf den Sturm folgte und durch die kaputten Fenster in alle Ritzen drang, hat das Foto unkenntlich gemacht. Vermutlich zeigte es meine Eltern. Vielleicht war sogar ich mit darauf.
Die Küche ist der unversehrteste Raum. Einige Schränke hängen noch an der Wand, der Herd steht nach wie vor an seinem Ort. Daneben die Spüle. Ich spiele am Wasserhahn, aber natürlich haben sie dem Haus das Wasser abgedreht. Durch die Hintertür blicke ich nach draußen in den Garten. Dort stand mein Trampolin.
Mit langsamen, hallenden Schritten gehe ich in den Flur zurück und zu der schmalen Treppe, die nach oben führt. In mein Zimmer. Schmutz knirscht unter meinen Schuhen, das Geländer ist staubig. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich in mein altes Zimmer vorwage. Wenn überhaupt, ist das der einfachste Teil. Erinnerungen an unser Familienleben sind unangenehm. Erinnerungen an mich selbst als kleines Kind jucken mich nicht. Hier oben ist jedoch das Dach an einer Stelle eingestürzt. Es hängt einfach so bis auf den Boden herunter, als hätte es eine Pause gebraucht. Als hätte es das Gewicht einfach nicht mehr ausgehalten. Verständlich, finde ich.
»Curtis?«, ruft eine Stimme von unten. Es ist Link. Ich habe ihn gebeten, herzukommen.
»Ich bin hier oben«, gebe ich zurück.
»Alter, das ist nie und nimmer bewohnbar.«
»Noch nicht«, erwidere ich, als ich wieder unten bin.
»Schau dir das an! Es ist feucht, es ist dunkel, es ist eine absolute Katastrophe.«
Ich habe Link angerufen, weil er nicht sonderlich anspruchsvoll ist, wenn es um Wohnraum geht.
»Hast du nicht vor Kurzem noch in leeren Lagerhallen gehaust?«, frage ich wenig beeindruckt von seinen Bedenken.
»Aber die waren wenigstens …« Er hält kurz inne. »Okay, berechtigter Einwand.«
Aus meiner Tasche hole ich zwei Flaschen Bier, schraube sie auf und reiche Link eine davon.
»Bevor du noch irgendwas sagst«, beginne ich, »dieses Haus wird nicht abgerissen.«
»Okay«, sagt Link.
»Es ist meins, und ich will es behalten.« Die Vehemenz, mit der ich es sage, erstaunt selbst mich.
»Okay.«
»Ich will retten, was zu retten ist.«
»Alles klar, wir retten, was zu retten ist.«
Ein paar Sommer lang habe ich mit Link auf Baustellen gearbeitet. Ein Freund seines Vaters hatte einen kleinen Baubetrieb, bei dem wir aushalfen. Auch Jahre nach Katrina mussten immer noch Häuser wiederaufgebaut werden. Jeder, der kräftig genug war, wurde gebraucht. Ein bisschen was weiß ich also über Häuser.
»Wollen wir draußen weitersprechen? Die Luft hier drin …«, sagt Link, und ich kann es ihm nicht verübeln.
Wir setzen uns auf die oberste Stufe der Veranda und lassen die Flaschen aneinanderklirren.
»Soll ich mal Hugo fragen, ob er eine Idee hat?«, fragt Link. »Er hatte früher einen kleinen Baubetrieb.« Hugo ist der alte Mann, auf den Franzi in ihrem ersten Jahr in New Orleans aufgepasst hat. Und Jaspers Großvater.
»Das wäre cool.«
Wir schweigen eine Weile. Ich, weil ich darüber nachdenke, was alles zu tun ist. Link grübelt vermutlich über den Irrsinn der Aufgabe.
»Du willst das Haus behalten?«, fragt er dann.
»Ja, Mann.«
»Ich helfe dir. Aber ich muss wissen, dass du weißt, was du tust.«
»Wann weiß ich bitte nicht …«
»Curtis!«, sagt er streng.
»Okay, ja, Punkt für dich.« Ich kann nicht anders, als zu grinsen.
»Erstens: das Dach«, sagt Link.
»Ich brauche eins«, erwidere ich. »Offensichtlich.«
»Fenster. Trocknung. Sanitäranlagen.«
»Es soll doch kein Luxushotel werden«, sage ich und lache.
Das Wellblech, das mein Grundstück von der Straße abtrennt, biegt sich leicht im Wind und ächzt unter der Bewegung.
»Warum schläfst du auf Jaspers Couch?«, fragt Link.
»Ich brauche Abwechslung.«
»Abwechslung von Amory?«
»Auch«, sage ich, spüre bei der Erwähnung ihres Namens aber diesen festen Klumpen in meinem Magen. Es ist der gleiche Klumpen, den ich hatte, als meine Eltern nicht wieder ins Apartment meiner Großmutter zurückkamen. Und dann noch mal, als meine Großmutter mich rauswarf. Der Klumpen, der macht, dass ich meine Hände zu Fäusten balle und Lust habe, die beschissene Veranda kurz und klein zu schlagen.
»Hey«, sagt Link und boxt mir leicht in die Seite, »entspann dich.«
»Ich bin entspannt«, gebe ich durch meine zusammengebissenen Zähne zurück.
»Ich hör’s. So entspannt wie neulich Abend. So entspannt wie auf der Hochzeit von Amorys Cousine. So entspannt wie …«
»Halt’s Maul«, sage ich, und Link lacht. Vermutlich über mich, aber das ist okay. Das habe ich verdient.
»Weißt du, Mann, egal, was du machst, du bist einer von uns. Wir lieben dich. Wir halten dir den Rücken frei, stehen zu dir. Aber manchmal, ich schwöre, gehst du mir so hart auf die Eier.«
Nun ist es an mir, zu lachen. »Danke«, sage ich.
Doch Link hat anscheinend noch nicht genug von diesem Gefühlskram. »Wie geht’s dir?«
»Passt schon«, erwidere ich.
»Das sagst du jedes verdammte Mal.«
»Es stimmt ja auch jedes verdammte Mal.« Ich klinge genervt.
»Alter, hältst du jetzt mal die Luft an?« Links Tonfall ist auf einmal seltsam wütend. »Ich weiß, welchen Scheiß du durchgemacht hast. Ich war von Anfang an dabei. Ich habe gesehen, wie du aus einem ganz normalen Jungen innerhalb von ein paar Wochen zu diesem wütenden Kerl wurdest.«
Ich schnaube, aber ich weiß, dass er recht hat.
»Und jeder von uns, jeder, der dabei war, jeder, der nach Katrina zurückkam, war ein anderer. Deswegen sind wir zusammen. Deswegen funktionieren wir.«
»Fängst du gleich an zu heulen?«, frage ich.
»Du fängst gleich an zu heulen«, sagt Link.
»In deinen feuchten Träumen.«
»Glaub mir, mit meinen feuchten Träumen hast du so wenig zu tun wie Hygienestandards mit deinem Haus.«
Link lässt mir Hugos Telefonnummer da und verabschiedet sich kurz darauf. Ich bleibe noch. Gehe wieder ins Haus und setze mich auf den schmutzigen Boden unseres ehemaligen Wohnzimmers. Aus meiner Hosentasche ziehe ich meine Schachtel Zigaretten und stecke mir eine an. Im dämmrigen Licht, das durch die offene Tür fällt, vermischt sich der Rauch mit feinen Staubwirbeln.
Ich denke an meine Eltern. An meine Großmutter, die jedes Mal einen halben Herzinfarkt kriegte, wenn ich wieder mit einem blauen Auge nach Hause kam, weil ich mich auf dem Schulhof geprügelt hatte. Und die mich bat, aus ihrem Leben zu verschwinden, als ich achtzehn wurde. Und ich denke an Amory. Natürlich hat sie jedes Glück der Welt verdient. Dass ich kein Glück bin, ist jedem auf den ersten Blick klar. Ich nehme ihr nicht übel, dass sie mit Richard bumst. Dass sie mich nicht mehr will. Aber es ist kein schönes Gefühl. Hier zu sitzen ist kein schönes Gefühl. Kein Ventil zu haben ist kein schönes Gefühl. Ich nehme einen tiefen Zug von meiner Zigarette und stoße laut die Luft aus. Mein Herz beginnt zu rasen. Ich habe Lust, etwas kaputt zu schlagen. Und dann erhebe ich mich und trete mit einer Wucht, über die ich selbst im ersten Moment erschrecke, die Bretter vor einem der Fenster ein. Wieder und wieder kicke ich dagegen und stoße dabei laute Wutschreie aus, bis das Fenster frei ist. Dann widme ich mich einem weiteren. Auch hier trete ich die Bretter kaputt. Mein Fuß schmerzt inzwischen, aber ich höre nicht auf. Im Gegenteil: Beim nächsten Fenster nehme ich meinen gesamten Körper zu Hilfe. Werfe mich gegen das Holz, schlage mit den Fäusten dagegen. Der Schmerz hilft. Der Schmerz ist gut. Er entspannt mein Inneres, beruhigt meine Nerven.
Als ich merke, dass meine Fingerknöchel aufplatzen, halte ich einen Augenblick inne. Denn ich brauche meine Hände. Darf es nicht übertreiben. Doch es ist ohnehin nur noch ein Brett übrig. Ich werfe mich mit der Schulter dagegen, aber es gibt nicht nach. Also trete ich mit meinem schmerzenden Fuß dagegen. Das Holz knackt und knarzt. Ich trete noch einmal und noch einmal, und endlich zerbirst auch dieses Brett und landet scheppernd auf der Veranda.
Ich atme. Das Haus atmet. Endlich wieder. Die feucht-warme Abendluft strömt in den Raum und verdrängt den modrigen Geruch. Augenblicklich wird es freundlicher. Als würde das Leben von draußen nach drinnen wandern. Auf einmal ist alles ganz ruhig. Beinahe friedlich.
Ausgelaugt von meinem Rausch, meiner Raserei lasse ich mich wieder in der Mitte des Raums nieder, stecke mir eine weitere Zigarette an. Ich blicke durch die Löcher in der Wand nach draußen und – denke an nichts.
5
Amory
»Hi, Am«, ruft mein kleiner Bruder und winkt in die Kamera. Er sitzt am Schreibtisch in seinem Zimmer. Im Hintergrund sehe ich das Poster seines Lieblingsbaseballclubs, der Mississippi Braves.
»Hi, Nicky.«
»Ich werde jetzt Nick genannt«, korrigiert er mich. Sein rundes Kindergesicht ist auf einmal ganz ernst.
»Haha, was?«
»Meine Freunde in der Schule nennen mich Nick. Und du solltest das auch tun. Ich bin kein kleines Kind mehr.«
»Ja, sicher«, sage ich grinsend. »Ich hab dir deine Windeln gewechselt, du Pimpf. Ich nenne dich auch noch Nicky, wenn du vierzig bist, einen Bierbauch und Geheimratsecken hast.«
Er will ansetzen, etwas zu sagen, schluckt es dann jedoch hinunter. Er weiß, dass er gegen mich keine Chance hat. Stattdessen streicht er sich seine dunklen Locken aus der Stirn. Während ich meine blonden Haare von unserer Mom geerbt habe, kommt er nach unserem Dad. Nur die Statur haben wir beide von unserer Verwandtschaft mütterlicherseits. Wobei es natürlich sein kann, dass sich Nickys Babyspeck noch verwächst.
»Wie geht’s Curtis?«, erkundigt er sich. Nicky ist ein großer Fan von Curtis. In den letzten zwei Jahren habe ich ihn zu Weihnachten mit nach Hause gebracht. Und zwischen meinem Bruder und meinem Mitbewohner machte es sofort klick. Beinahe hörbar.
»Ähm, ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht. Er war nicht viel zu Hause in letzter Zeit.«
»Warum? Wo war er?« Sofort tritt Sorge in Nickys Blick.
»Keine Ahnung«, erwidere ich auf die zweite Frage. Die erste ignoriere ich.
»Habt ihr euch gestritten?«, fragt er weiter.
»Du bist zu neugierig«, sage ich.
»Also, habt ihr?«
Nicht nur neugierig, sondern auch schnell im Kopf. »Nicht wirklich.« Ich versuche mich elegant um die Wahrheit herumzulavieren. Aber ich weiß, dass er es früher oder später aus mir herausquetschen wird.
»Muss man dir alles aus der Nase ziehen?«, fragt er und äfft offensichtlich unsere Mom nach.
»Du kleine Kröte«, sage ich scherzhaft.
»Ich hab gestern einen Frosch gefangen!«, ruft er ganz aufgeregt. »Beim Weiher hinterm Haus. Da sind jetzt jede Menge. Die sind ganz kalt in der Hand. Wenn du das nächste Mal kommst …« Er unterbricht sich selbst. »Wann kommst du das nächste Mal?«