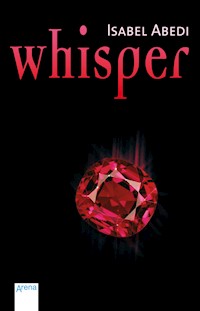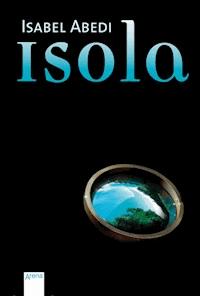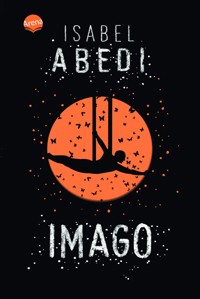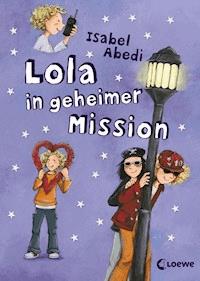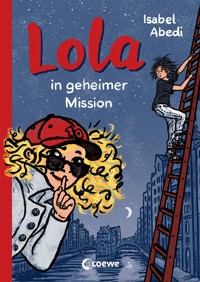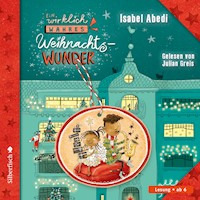7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Es fühlt sich an wie ein Riss. Ein hauchfeiner Riss, tief in Rebeccas Innerem. Als ob ihr jemand mit der Pinzette ein Härchen ausgerupft hätte. Was bleibt: ein sonderbares Gefühl von Leere und der Angst. Doch dann taucht Lucian auf, wie aus dem Nichts. Ein Junge ohne Vergangenheit, jemand, der sich nicht erinnern kann, wer er ist oder wo er herkommt. Aber Lucian gibt Rebecca mit einem Mal das Gefühl, dass sie nicht mehr allein ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Ähnliche
Isabel Abedi
Lucian
Weitere Romane von Isabel Abediim Arena Verlag:
IsolaWhisperImago
Isabel Abedi
Lucian
Roman
Veröffentlichung als E-Book 2010 © 2009 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Arena Verlag Quellenverweis: S. 277 – S. 279 zitiert nach: Jean-Paul Sartre, Das Spiel ist aus, Rowohlt Verlag 1952, S. 26 – S.28 ISBN 978-3-401-80005-9
www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
INHALT
Für Alex Loyek
ERSTER TEIL
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWEITER TEIL
ZWANZIG
DRITTER TEIL
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
DANKE!
Für Alex Loyek
( 1965 – 2001 )
ERSTER TEIL
EINS
Der Mittwochabend gehörte uns, Janne, Spatz und mir.
Seit ich ein kleines Mädchen war, verbrachten wir drei diesen Abend in der Woche gemeinsam und abgesehen von den Ferien auch immer am selben Ort: zu Hause, in der Hamburger Rainvilleterrasse 9.
Die Idee kam von Spatz, Jannes Lebensgefährtin. Kurz nachdem sie bei uns einzog, ernannte Spatz den Mittwochabend zur Ladys Night in und besorgte für diesen Anlass sogar eine Krone. Es war eine Plastikkrone mit bunten Strasssteinchen aus der Spielzeugabteilung des Kaufhauses, in dem Spatz damals jobbte.
Spatz war es auch, die die Regeln für unsere Ladys Nights festlegte: Immer der Reihe nach durfte eine von uns die Mittwochskrone tragen und bestimmen, wie wir den Abend verbringen würden. Die einzigen Bedingungen waren: Es musste etwas sein, was wir zusammen machten, und es durfte nichts kosten.
Ich war vier Jahre alt, als wir unsere erste Ladys Night in veranstalteten und ich auch als Erste die Krone aufsetzen durfte. Ich fühlte mich tatsächlich wie eine Königin und ernannte Spatz und Janne zu meinen Zofen. Janne musste mein Lieblingsessen, Crêpes mit heißer Schokoladensauce, zubereiten. Spatz wies ich an, Fabeltiere zu zeichnen, Drachen, Einhörner und Greifen, die wir anschließend gemeinsam ausmalten.
Irgendwann kam die Krone abhanden oder wurde einfach nicht mehr aufgesetzt. Aber die Ladys Night blieb und wurde mit den Jahren zu einem Ritual, auf das wir nur verzichteten, wenn etwas Ernsthaftes dazwischenkam.
Inzwischen war ich sechzehn und diesen Mittwoch war meine Mutter Janne an der Reihe, über die Ladys Night zu bestimmen. Das Motto des Abends lautete: ausmisten.
Zuerst hatten Spatz und ich laut aufgestöhnt, als Janne den riesigen Schrank auf unserem Dachboden öffnete, aber Janne hatte auf ihre imaginäre Krone getippt und verkündet: »Ein bisschen Vergangenheit loswerden kann nie schaden. Also keine Widerrede, Ladys! Ran an die Klamotten.«
Draußen tobte ein Herbststurm. Wie mit Eisfingern trommelte er an die Scheiben, doch hier oben unter dem Dach war es warm und mittlerweile saugemütlich. Janne hatte Kerzen angezündet, aus den Lautsprechern ertönte die Mondscheinsonate von Beethoven, Jannes Lieblingskomponisten, und der Duft von frischem Apfelstrudel zog aus der Küche bis zu uns hinauf.
Der Dachboden nahm die gesamte obere Hälfte unserer Wohnung ein, eine geschwungene Wendeltreppe trennte ihn von den unteren Zimmern. Die alten Holzdielen hatte Dad damals noch abgeschliffen.
Wir alle liebten diesen Raum. Er war unser Familienzimmer, das offizielle Wohnzimmer nutzten wir eigentlich nur, wenn Besuch kam. Hier oben steckte etwas von jedem von uns. Ich hatte mir das große Tagesbett mit den vielen Kissen gewünscht, auf dem wir schon unzählige Mittwochabende mit unseren Lieblingsfilmen verbracht hatten. Die Zimmerlinde, die mittlerweile bis zur Dachschräge hochgewachsen war, hatte Janne bei meiner Geburt als winziges Pflänzchen gekauft und die große Glasvase vor dem Fenster bestückte sie jede Woche neu mit Blumen. Von Spatz waren der alte Plattenspieler und das Regal mit der riesigen Plattensammlung. Unsere Möbel, die zum großen Teil von Antikflohmärkten stammten, hatten Spatz und Janne gemeinsam aufgestöbert, wobei Janne das Herunterhandeln der Preise und Spatz die anschließende Aufarbeitung übernahm.
Das einzige Erbstück war der Sekretär von meiner Urgroßmutter Moma, an dem Janne früher ihre Gutachten geschrieben hatte.
Neben dem Sekretär hing ein Vogelbauer an einer schweren Messingkette herab. Hier wohnten John Boy und Jim Bob. Meine Mutter hatte die beiden Wellensittiche von einem ehemaligen Klienten geschenkt bekommen. Mit ihren dreizehn Jahren waren sie mittlerweile reife Herren und Janne sorgte rührend für sie. Spatz dagegen hasste es, wenn Tiere hinter Gittern eingesperrt wurden. Sie nannte unsere Vögel deshalb die Knastbrüder, was ihr jedes Mal einen bösen Seitenblick von meiner Mutter bescherte.
Jim Bob hatte seinen Schnabel unter den Flügel gesteckt und die Federn aufgeplustert, während John Boy neugierig auf uns herabsah, wie wir vor dem Berg aus altem Kram hockten und uns darum stritten, was wir entbehren – oder besser gesagt nicht entbehren – konnten.
»Nicht!«, kreischte Spatz aus vollem Hals. Sie machte einen Hechtsprung und versuchte, Janne einen grinsenden Gummizwerg mit einer blauen Mütze aus der Hand zu reißen, den meine Mutter gerade in der Kiste mit der Aufschrift »Goodbye Ladys« versenken wollte.
»Wieso nicht?« Janne starrte verblüfft von Spatz auf den Gummizwerg.
»Weil der nimmersatte Anton das Glück meiner Kindheit war«, rief Spatz empört. »Nur über meine Leiche kommt der auf den Flohmarkt.« Sie packte Janne am Handgelenk und fing an, sie durchzukitzeln, bis meine Mutter lachend aufgab und den Plastikzwerg fallen ließ.
»Komm her, Anton.« Spatz hob ihn auf und nahm ihn schützend in den Arm. »Weg von der kaltherzigen Mittwochskönigin. Ab heute . . .«, sie grinste den Zwerg an, » . . . thronst du auf unserem Fernseher.«
»Auf dem Fernseher? Was soll das Teil denn auf dem Fernseher?«, fragte ich entgeistert.
»Das Teil?« Spatz pustete sich eine Staubflocke von der Nase und funkelte mich an, als hätte ich mich gerade selbst in einen Gummizwerg verwandelt, und zwar in einen bösen. »Was deine Mutter auf dem Flohmarkt verschachern will, ist kein Teil, sondern ein Meilenstein der deutschen Fernsehgeschichte!«
Sie hielt mir den Gummizwerg vor die Nase. »Darf ich bekannt machen?«, fragte sie und ließ den Zwergenkopf hin- und herwackeln. »Rebecca, das ist der nimmersatte Anton, Genosse der Mainzelmännchen und Star des Werbefernsehens aus den Siebzigerjahren. Anton, das ist Rebecca, Ersttochter von Janne und Zweittochter von mir. Sag Guten Abend.«
»Gut’n Aaaaaaaaaaaabend«, quiekte der Gummizwerg mit Spatz’ verstellter Stimme und ich musste lachen.
Janne strich sich stöhnend das blonde Haar aus der Stirn. Ein schwarzer Streifen zog sich quer über ihr Gesicht und passte so gar nicht zu ihr. Meine schöne Mutter mit dem Körper einer Marathonläuferin konnte man morgens um drei Uhr aus dem Tiefschlaf wecken und sie sah immer noch perfekt aus.
»Also gut. Solange Antons Genossen nicht irgendwo im Hinterhalt lauern, kann er bleiben«, sagte sie und beugte sich wieder über ihre Kiste. »Was ist hiermit?«
Janne hielt eine rote Plastiktrompete hoch und ich kreischte: »Ohhh, die hat Daddy mir geschenkt, weißt du noch? Nach dem Kindergartenfest, wo mir Sören seine halbe Bratwurst aufs Kleid gekotzt hat. Ich hab gestunken wie Sau und mich total geschämt und abends hat Dad mir zum Trost die Trompete mitgebracht. Soll ich euch was vorspielen?«
»Törööö«, machte Spatz und zwinkerte mir zu.
»Leute, so kommen wir nie weiter«, nörgelte Janne. »Die Aktion des Abends heißt nicht Spielen, sondern Ausmisten. Also, weg damit oder nicht?«
»Nicht.« Ich legte die Trompete zur Seite und öffnete die große Bücherkiste. Zwischen Jannes Fachbüchern, Spatz’ Kunstbänden und ein paar speckigen Kochbüchern fischte ich einige alte Bilderbücher heraus.
Meine Mutter rutschte zu mir herüber und schlug Wo die wilden Kerle wohnen von Maurice Sendak auf. »Das war dein Lieblingsbuch«, sagte sie. »Du hast dich wahnsinnig vor den Monstern gefürchtet, die Max in seiner Traumreise besuchte. Aber du wolltest die Geschichte immer wieder hören.« Janne lächelte mich an. »Du hast die Augen geschlossen und bist in deiner Fantasie mit Max auf dem Segelschiff davongereist. Ich sollte dir die wilden Kerle vormachen. Du wolltest ihr fürchterliches Brüllen hören und sehen, wie sie ihre fürchterlichen Zähne fletschten, ihre fürchterlichen Augen rollten und ihre fürchterlichen Krallen zeigten – bis Max Seid still sagte und sie mit seinem Zaubertrick zähmte. Weißt du noch, Wölfchen? Du kanntest den Text auswendig.«
Ich legte meinen Kopf auf Jannes Schulter und sah auf das Segelschiff, in dem der kleine Max mit seinem Wolfspelz saß. Das Papier war schon ganz vergilbt und strömte diesen undefinierbaren Geruch alter Bücher aus.
»Ja, das weiß ich noch«, sagte ich und warf Spatz einen Blick zu. »Und du hast mir ein Bild von dem Schiff gemalt. Aber es stand nicht Max, sondern Rebecca darauf.«
Und so ging es weiter. Jedes Teil, das wir aus den Kisten zogen, brachte eine Geschichte mit sich. Da war das Mörderdirndl mit der roten Schürze, das meine Großmutter mir zur Einschulung aus München mitgebracht hatte. Im Stoff, direkt über dem linken Schulterblatt, steckte eine vergessene Sicherheitsnadel. Das erste und einzige Mal, dass ich das blöde Ding trug, öffnete sich die Nadel, und als ich auf dem Schulhof beim Spielen geschubst wurde, rammte sich die Spitze tief in meine Haut.
Da war die winkende Glückskatze aus goldlackiertem Plastik, ein Mitbringsel aus Asien von Spatz für Janne. Am selben Tag kaufte Janne ein Rubbellos und gewann dreißig Euro. »Wisst ihr noch? Wir sind mit Rebecca auf den Hamburger Dom gegangen und haben uns im Spiegelkabinett verirrt . . .«
Und da war Sharky, meine alte Luftmatratze. Spatz hatte sie mir geschenkt, als ich vier war und noch nicht schwimmen konnte. Die Luftmatratze hatte einen Haifischkopf mit aufgerissenem Maul und riesigen Gummizähnen. Eine alte Dame hatte vor Schreck fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich im Freibad mit Sharky auf sie zupaddelte.
In einer Kiste – auf die Spatz einen Totenkopf gemalt hatte – stapelten sich die Weihnachtsgeschenke ihrer Mutter, in einer anderen bewahrte sie ihre Insektenkästen auf. Ich nahm den obersten heraus und betrachtete sein Innenleben. Das hinter Glas gebannte Etwas war eins von Spatz’ ersten Kunstobjekten: ein gehäkelter Glockenpolyp aus rosafarbenem und grünem Baumwollgarn.
Ich war gerade in die zweite Klasse gekommen, als Spatz an dieser Serie zu arbeiten begonnen hatte. Sie nannte sie Seemannsgarn und häkelte monatelang an den Seeanemonen, Sternkorallen und Glockenpolypen, die ich anschließend in die würfelförmigen Insektenbehälter legen und mit dem gläsernen Deckel verschließen durfte.
Spatz hatte sich inzwischen eine Kiste mit der Aufschrift Schnickschnack vorgenommen. Sie legte ein Duschradio in U-Bahn-Optik, einen silbernen Handspiegel und ein pinkfarbenes Vampirgebiss zur Seite, dann zog sie einen Bilderrahmen hervor. »Schaut mal, die kleine Seejungfrau aus Kalifornien«, sagte sie und lächelte, als sie mir den Rahmen hinhielt.
Auf dem Foto musste ich ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein. Zwei Hände hielten meinen ausgestreckten Körper über die Wasseroberfläche eines Sees. Ich hatte die Arme ausgebreitet wie im Flug und sah aus, als würde ich vor Glück platzen.
»Das war am Lake Nacimiento«, sagte Janne. Ihre Stimme klang weich. Sie nahm mir das Bild aus der Hand und wischte den Staub von der Glasfläche. »In dem Sommer hast du schwimmen gelernt. Dad musste dich immer wieder in die Luft werfen, damit du von seinen Armen ins Wasser springen konntest.«
Ich musterte mein lachendes Kindergesicht und musste daran denken, dass das mein einziger Besuch in Dads Heimat gewesen war. Ich konnte mich tatsächlich noch daran erinnern, wenn auch nur vage. Ich hatte den See immer Drachensee genannt. »Und?« Ich stupste meine Mutter an und zeigte auf das Foto. »Verscherbelst du mich jetzt auf dem Flohmarkt?«
»Nein, ich denke, dieses Stück Vergangenheit bleibt bei uns«, sagte Janne entschlossen und legte das Bild zur Seite.
Aus der Küche ertönte ein schrilles Klingeln.
»Ding, dong«, rief Spatz. »Hier eine wichtige Durchsage: Der kleine Apfel Strudel möchte von seiner Mami aus dem Backparadies abgeholt werden.« Sie warf Janne einen unschuldigen Blick zu. Ich prustete los, aber Spatz’ Gelächter übertönte mich mühelos. Jannes Lebensgefährtin war sehr klein und ausgesprochen zierlich, sie hatte kurzes mausbraunes Haar, das ständig zerzaust war, und große goldbraune Augen. Nur ihre Lache stand im exakten Gegensatz zu ihrem Aussehen. Sie schepperte wie ein Sack voll leerer Blechbüchsen, die man über einer Kellertreppe auskippte – und ob man wollte oder nicht, sie riss einen mit sich.
»Na, dann will die liebe Mami mal«, sagte Janne schließlich. Sie klopfte den Staub von ihrer Jeans und sah sich in dem Tohuwabohu um, das wir in der letzten Stunde um uns herum verbreitet hatten.
Spatz brauchte ihr persönliches Chaos, das vor allem in ihrem Arbeitszimmer herrschte. Alltägliche Dinge wie Steuererklärungen oder der Umgang mit einem Computer überforderten sie komplett, während Janne das Organisationstalent schlechthin war und sich durch kaum etwas aus der Ruhe bringen ließ.
Einzige Ausnahme: häusliche Unordnung. Herumliegende Sachen, nicht eingeräumtes Geschirr oder eine verkrümelte Arbeitsfläche in der Küche verwandelten meine gelassene Mutter in ein nervliches Wrack.
»Keine Panik«, sagte ich, als ich den entsetzten Ausdruck bemerkte, der in ihr Gesicht getreten war. »Wenn du den Apfelstrudel holst, räumen wir nachher auf. Versprochen!«
Janne nickte dankbar und bahnte sich durch die Kisten einen Weg nach unten.
Wenig später kehrte sie mit einem beladenen Tablett zurück.
»Lasst es euch schmecken, Ladys«, sagte sie und verteilte die Teller auf dem großen Bambustisch. »Aber danach gibt es keine Ausrede mehr. Wir werden diesen ganzen Müllhaufen aussortieren, so wahr ich Janne Wolff heiße.« Sie fuchtelte mit ihrem Messer durch die Luft. »In einer Stunde ist die Kiste für den Flohmarkt gefüllt!«
Wir aßen den gesamten Apfelstrudel mit Vanillesauce auf, wobei ich die eine Hälfte übernahm, während Janne und Spatz sich die andere teilten. Dann krönten wir Janne zur Strudelkönigin der Ladys Night – und scheiterten schließlich jämmerlich, was das Ausmisten betraf.
Während sich in der Flohmarktkiste ein bescheidenes Häufchen aus Jannes Fachbüchern, Brettspielen und CDs ansammelte, wurden die Berge mit den Dingen, die wir behalten wollten, höher und höher.
Spatz stapelte selig ihre alten Videoaufzeichnungen von Godard–und Hitchcockfilmen (»Wir müssen unbedingt noch einen Videorekorder kaufen, bevor es zu spät ist«), ich hatte mir die alten Bilderbücher wie einen Hocker unter das Gesäß geschoben und Janne zog gerade etwas Kleines, Weißes aus der letzten Kiste, als ich plötzlich etwas spürte. Es fühlte sich an wie ein hauchfeiner Riss tief in meinem Inneren. Er war kaum wahrnehmbar, als ob mir jemand mit der Pinzette ein Härchen ausgerupft hätte, das nach innen gewachsen war. Ein kurzer Ruck, dann war es vorbei. Was blieb, war ein sonderbares Gefühl von Leere, das ich nicht deuten konnte. Ich schob es auf die späte Uhrzeit – mittlerweile war es nach Mitternacht – und verdrängte es, als Janne mir einen kleinen Teddybären in den Schoß legte.
»Das war dein allererstes Geburtstagsgeschenk«, sagte sie. Er war aus Schafwolle, ziemlich schmuddelig und kaum größer als Jannes Hand. Dunkelbraune Filzkreise bildeten die Augen, die winzige Nase war ein schwarzes Garnbällchen und auf seinen wollweißen Wangen prangte ein Schokoladenfleck.
»Daran wirst du dich bestimmt nicht mehr erinnern«, fuhr Janne fort. »Moma hat ihn dir geschenkt, als wir dich nach der Geburt nach Hause brachten. Er sollte über deine Träume wachen, aber du hast ihn auch am Tag nicht aus der Hand gelassen. Überallhin hast du ihn mitgeschleppt, und als wir ihn einmal beim Griechen liegen ließen, hast du so lange gebrüllt, bis ich Herrn Papatrechas aus dem Schlaf geklingelt habe und er dein Bärchen mit dem Taxi zurückschickte. Du hattest sogar einen Namen für ihn. Wie war er noch . . . Li oder La . . .?« Janne legte die Stirn in Falten.
»Lu«, murmelte ich. Ich hatte keine Ahnung, wieso mir der Name über die Lippen kam. Ich erinnerte mich gar nicht mehr an den kleinen Bären.
Aus dem Vogelbauer war ein schnarrendes Geräusch zu hören. Es kam von John Boy. Eifrig wetzte er seinen Schnabel an der kleinen Sepiaschale. Ich starrte den grünen Wellensittich an, ohne ihn wirklich wahrzunehmen, und als er mit den Flügeln schlug, zuckte ich aus irgendeinem Grund zusammen.
»Hey.« Janne musterte mich besorgt. »Du bist ja ganz blass. Ist alles in Ordnung, Wölfchen?«
Ich nickte, aber es stimmte nicht. Mit einem Mal fühlte ich mich total erschöpft.
»Ich glaub, ich muss ins Bett«, murmelte ich. »Ich hab morgen in der ersten Stunde Englisch.«
Spatz warf mir einen mitleidigen Blick zu. »Dann richte deinem Mister Tyger aus, wenn er dich das nächste Mal auf dem Kieker hat, erscheine ich persönlich in seiner Sprechstunde und töröte ihm mit deiner alten Trompete den Marsch.«
»Gute Idee«, knurrte Janne. »Hätten wir eigentlich schon längst mal tun sollen.«
Mein Englischlehrer gehörte nicht zu unseren Lieblingsthemen. Janne und Spatz verabscheuten es, wenn mir jemand das Leben schwer machte, insbesondere wenn es gar keinen Grund dafür gab.
Ich rappelte mich vom Boden auf und warf Janne einen zerknirschten Blick zu. »Kann ich . . . vielleicht doch meinen Kram bis morgen hier liegen lassen?«
Es war eine rhetorische Frage. Mir war klar, dass morgen keine Spuren mehr von unserer Aktion zu finden sein würden. Egal, wie spät der Abend wurde, egal, wie früh der Morgen anbrach, Janne würde nie ins Bett gehen, ohne vorher klar Schiff gemacht zu haben, und wenn wir unseren Teil zur Hausarbeit nicht beitrugen, konnte meine Mutter ziemlich ungemütlich werden. Heute überraschte sie mich.
»Ich mach das schon«, sagte sie. »Ich leg dir die Sachen vor die Tür, okay?«
»Danke.« Ich gab Janne einen Kuss und nickte Spatz zu, die sich wieder dem Studium ihrer Videokassetten gewidmet hatte. Gerade hielt sie ein Video mit der Aufschrift Orfeo Negro in der Hand. »Ein wunderbarer Film«, murmelte sie. »Wir müssen wirklich einen Rekorder anschaffen. Videos haben so etwas Romantisches.«
»Nacht, Spatz«, sagte ich. Ich drehte mich zu dem Vogelbauer um. Mittlerweile hatte auch John Boy seinen Schnabel unter den Flügel gesteckt. Seine weichen Federn waren aufgeplustert und sein Brustkorb hob und senkte sich in einem wiegenden Rhythmus. »Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Jim Bob.«
Spatz winkte abwesend und Janne lächelte mich an.
»Gute Nacht, Wölfchen. Träum was Schönes.«
Als ich mir in meinem Zimmer die Kleider abstreifte, merkte ich, dass ich noch immer den kleinen Bären in der Hand hielt. Ich nahm ihn mit ins Bett und löschte das Licht. Das seltsame Gefühl in meiner Brust war immer noch da. Ich konnte es nicht richtig zuordnen, ich wusste nur, dass es von einer Minute auf die andere gekommen war.
Mein Zimmer lag im ersten Stock. Ich hörte Schritte über mir, die lauten von Janne, die trippelnden von Spatz, und auch der Regen hatte nicht nachgelassen. Er trommelte gegen die Scheibe. Dieses Geräusch liebte ich, genauso wie den Augenblick des Einschlafens. Die magischen Sekunden, in denen wir in die andere Wirklichkeit wechseln, hatte ich schon immer als etwas Besonderes empfunden. Manchmal fühlte es sich an wie ein Fallen, manchmal wie ein Sinken, aber heute kam es mir vor, als zerrte der Schlaf mit groben, ungeduldigen Fingern an mir. Irgendwo in der Ferne dröhnte eine Schiffssirene, dann war ich weg.
Der Traum überfiel mich wie die Wirkung einer zu starken Droge. Ich lag in einem Raum, auf einem plüschigen dunkelgrünen Teppich. Die Wände waren mit Holz verkleidet, da war ein Bett mit einer geblümten Tagesdecke, darüber hing ein Bild von einer grauenhaft kitschigen Berglandschaft. Über meinem Kopf waberte ein Kronleuchter und neben mir lagen Scherben. Sie waren überall, auf meinem Bauch, meinen Händen. Es roch metallisch süß und ich stellte entsetzt fest, dass es Blut war.
Mein Blut? Ich rang nach Atem, aber in dem Raum war keine Luft oder vielleicht war in mir keine Luft, ich japste, stöhnte, wollte mich bewegen, konnte mich aber nicht rühren, nicht mal meine Finger gehorchten mir.
Wo war ich? Ich kannte diesen Raum nicht. Was machte ich hier? War ich allein? Nein, da war jemand, ich fühlte es, aber ich konnte kein Gesicht erkennen. Bitte. Bitte nicht . . . bitte . . . lass mich nicht . . .
Selbst die Worte fühlten sich an wie Scherben, kalt und scharf und Angst einflößend. Jetzt erst merkte ich, dass ich um mein Leben bettelte. Der Raum, fremd, hässlich und unpersönlich, dehnte sich aus und dann schrumpfte er zusammen, immer dichter rückten mir die Wände auf den Leib. Mir wurde kalt und es stank nach Schweiß.
Ich wachte von meinem eigenen Schrei auf.
Vor mir saß meine Mutter, sie hielt mich im Arm und strich mir das Haar aus der Stirn. Ich war nass geschwitzt, wie durch eine Nebelwand hörte ich Jannes Murmeln: »Wölfchen, du hast geträumt. Hey. Alles ist gut. Es ist vorbei.«
Ich rang nach Luft. Nein. Nein! Es war nicht vorbei. Ich sah mich im Zimmer um, in meinem Zimmer, das so vertraut war. Wie um sicherzugehen, tasteten meine Augen alles ab. Den schwarzen Sitzsack. Die Trophäen meiner Schwimmwettkämpfe auf den Regalflächen. Den knallroten Bonbonspender, den Sebastian für mich mit Smarties bestückt hatte. Mein Schreibtisch mit Dads altem Apple, an der Wand das große Blechschild, auf dem eine Frau aus den Fünfzigern die Ärmel ihres blauen Overalls umkrempelte. We Can Do It stand in großen Lettern darüber.
Okay, das hier war wirklich mein Zimmer und neben mir saß meine Mutter, die beruhigend auf mich einsprach, als wäre ich ein kleines Kind. Ich roch ihr Parfüm, es mischte sich mit der Wärme ihrer Haut. Aber warum hörte mein Herz nicht auf zu rasen? Mir wurde fast schlecht von dem Geruch meines eigenen Schweißes. Etwas hatte sich in meine Brust gekrallt. Wie eine eiserne Hand fühlte es sich an und es schnürte mir die Luft ab. Die Angst, nicht atmen zu können, wurde so übermächtig, dass ich immer hektischer nach Luft rang. Ich fühlte meine Hände nicht mehr und Jannes Gesicht war so bizarr weit weg, obwohl sie doch direkt vor mir saß.
»Rebecca? Rebecca . . .«
Ich versuchte, mich auf Jannes Stimme zu konzentrieren, aber auch ihre Worte klangen wie aus der Ferne an mein Ohr.
» . . . Schatz, hör mir zu . . .«
Ich bemühte mich krampfhaft, ich öffnete den Mund, aber ich konnte nicht antworten.
»Okay, Rebecca.« Jannes Stimme war lauter geworden, professioneller, aber immer noch ruhig. »Ich möchte, dass du ausatmest.« Sie legte ihre Hand auf meine Brust. »Spürst du das? Lass deinen Atem hierhin fließen, gut so, noch ein Stück, atme aus, schieb die Luft nach unten. Es geht, siehst du? Gleich noch einmal. Ja, so ist es richtig.«
»Ich . . .« Endlich fand ich meine Stimme wieder. Sie war ein klägliches Krächzen. »Ich . . . hab . . . geträumt, ich sterbe. Da war ein
Raum, Mam. Mit einem grünen Teppich. Da war ein Bett. Ein Kronleuchter. Es war alles . . . so scharf.«
Wieder rang ich nach Luft, ich fixierte Jannes Gesicht. »Da waren lauter Scherben. Und bei mir war . . . jemand, direkt neben mir. Er . . . es . . . ich konnte nicht . . .«
Ich hielt inne. Das Sprechen half nicht. Im Gegenteil, mein Atem spielte nur noch mehr verrückt.
Janne drückte meine Hand, dann machte sie Anstalten aufzustehen, ich hörte sie sagen, dass sie das Fenster öffnen würde, aber ich schüttelte den Kopf und krallte mich an ihrem Arm fest.
Jannes Hand legte sich wieder auf meine Brust, aber es fühlte sich nicht mehr gut an. Ihre Hand war zu schwer. »Mein Schatz, es war nur ein Traum, hörst du?«
Ich hörte, was sie sagte, aber ich fühlte es nicht.
»Rebecca.« Jannes Stimme klang jetzt zärtlich und eindringlich. »Bedrückt dich etwas? Die Sache mit Sebastian? Oder war was mit Dad und Michelle? Träume stehen für etwas, Wölfchen, und manchmal hilft es, wenn man herausfindet, wofür.«
Nein, schrie es in mir. Da ist nichts. Die Sache mit Sebastian war jetzt fast sechs Wochen her und mit Dad war alles bestens. Verdammt, mir ging es bestens.
Janne musterte mich. Ihr forschender Blick war jetzt voller Sorge und plötzlich wünschte ich mir, dass sie aufhörte, mich so anzusehen.
Meine Mutter war Psychologin und was Träume anging, die Spezialistin schlechthin. Obwohl mich ihre Angewohnheit, allem auf den Grund zu gehen, manchmal nervte, wusste ich, dass sie in jeder Hinsicht für mich da war – nicht auf diese »Ich–bin–deine–beste–Freundin–Tour«, sondern auf eine im besten Sinne mütterliche Art. Ich wollte sie fragen, ob es normal war, von seinem eigenen Sterben zu träumen, und ob ein Traum wirklich so echt wirken konnte. Aber ich sprach es nicht aus, denn irgendetwas gab mir plötzlich die Gewissheit, dass meine Mutter mir nicht helfen konnte.
Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich allein.
»Ist schon gut, Mam«, brachte ich mühsam hervor. »Es geht wieder . . . danke. Ich glaub, ich sollte einfach versuchen weiterzuschlafen.«
Mit aller Kraft konzentrierte ich mich darauf, ruhiger zu atmen, und ganz langsam gelang es mir auch. »Ich bin okay«, sagte ich schließlich mit festerer Stimme. »Wirklich.«
»Also gut«, sagte Janne zögernd. »Ich lass meine Zimmertür offen. Wenn was ist, brauchst du nur zu rufen, in Ordnung?«
»Danke, Mam. Schlaf gut.«
»Du auch.« Janne blieb noch ein paar Sekunden in der Tür stehen, dann fiel leise die Klinke ins Schloss.
Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Von wegen okay. Die Panik lauerte noch immer ganz dicht unter der Oberfläche, wie ein Tier, bereit zum Angriff. Ich überlegte verzweifelt, was ich jetzt machen sollte. Janne hatte das Licht im Zimmer brennen lassen. Ich hatte noch nie im Hellen schlafen können, aber allein der Gedanke daran, das Licht zu löschen, ließ die Angst ihre Krallen ausfahren.
Mit einem Ruck schlug ich die Decke zurück, um jetzt doch das Fenster zu öffnen. Wenigstens würde die Nachtluft diesen widerlichen Schweißgeruch vertreiben. Als ich aus dem Bett stieg, trat ich auf etwas Weiches. Es war der kleine Bär. Er musste im Schlaf aus dem Bett gefallen sein. Ich hob ihn auf, presste ihn an meine Brust und taumelte zum Fenster.
Der Sturm hatte sich gelegt. Kein Windhauch regte sich. Stattdessen war Nebel aufgestiegen, die Luft war blass und feucht. Unser Haus lag am Ende der Straße, von meinem Fenster aus konnte ich direkt auf die Elbe schauen.
In der Ferne sah ich die Lichter der Queen Mary, des großen Kreuzfahrtschiffs, das gestern im Hamburger Hafen eingelaufen war. Ich war dort gewesen, mit Suse und ungefähr tausend anderen Schaulustigen. Wir hatten Fischbrötchen gegessen, heiße Schokolade getrunken und ich hatte mich halb totgelacht über Suses blöde Witze. Am liebsten würde ich meine beste Freundin jetzt anrufen. Oder Sebastian. Plötzlich sehnte ich mich nach ihm.
Die Straße unter mir war wie ausgestorben. Es musste schon spät sein. Alle Fenster der Häuser waren dunkel und selbst unter den parkenden Autos kroch der Nebel hervor. Nur die Straßenlaterne vor unserem Haus sonderte ein trübes Licht ab. Es flackerte.
Dann sah ich ihn.
Er lehnte an der Laterne, eine schattenhafte Gestalt, und für eine absurde Sekunde dachte ich, er wäre Sebastian. Aber das stimmte nicht. Es war ein Fremder – ob Mann oder Junge, konnte ich nicht erkennen, doch ich war mir sicher, dass es ein männliches Wesen war.
Schmal und dunkel lehnte er an der Laterne und sah zu mir hinauf. Sein Gesicht war kaum mehr als ein blasser Fleck und sein Haar schwärzer als die Nacht. Der lange Mantel wirkte zu groß über den schmalen Schultern.
Er stand da wie festgefroren. Das Einzige, was sich bewegte, war das flackernde Licht der Laterne, die an und wieder ausging, an und aus. Selbst als mein Blick ihn traf, rührte der Fremde sich nicht, er schaute nur weiter unvermittelt zu meinem Fenster auf, als ob er auf mich gewartet hätte.
Es war ein zutiefst unheimliches Bild, aber ich hatte merkwürdigerweise überhaupt keine Angst. Im Gegenteil, ich sah auf die fremde Gestalt unter der Laterne und fühlte, wie etwas in mir zur Ruhe kam. Die Panik fuhr die Krallen ein und zog sich zurück und mit einem Mal wurde ich sehr müde.
Regungslos stand ich da, tat nichts, dachte nichts, schaute nur den Fremden an. Und dann ging ich zurück ins Bett, kuschelte mich unter die Decke und schloss die Augen.
Diesmal kam der Schlaf ganz sanft. Er hüllte mich mit weichen Schattenfingern ein. Das Fenster war weit geöffnet und das Letzte, was ich wahrnahm, war der Regen, der wieder einsetzte, flüsternd und rauschend wie ein Gutenachtlied.
ZWEI
Aus weiter Ferne drang das Piepsen des Weckers an mein Ohr. Es kam näher, wurde fordernder, schriller, bis es sich wie eine Spirale in meinen Kopf bohrte. Als ich die Bettdecke zurückschlug, fühlte ich mich wie gerädert. In meinem Zimmer herrschten arktische Temperaturen, den kleinen Bären hielt ich noch immer in der Hand. Fröstelnd ging ich zum Fenster, das weit offen stand. Als ich auf die Straße sah, fiel mein Blick als Erstes auf die Laterne. Der Platz darunter war leer. Einer unserer Nachbarn verließ gerade das Haus, stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Auf dem Bürgersteig kreischte Lasse, der kleine Junge aus der Wohnung im Erdgeschoss, weil ihm sein Brötchen aus der Hand gefallen war, und vor einem der Bäume hob ein wuscheliger Mischlingshund sein Bein.
Die Straße sah aus wie an jedem anderen Morgen. Aber warum machte mir der gewohnte Anblick mehr zu schaffen als der von letzter Nacht? Der Fremde hatte direkt in mein Fenster gestarrt, was im Tageslicht betrachtet wirklich eine gruselige Vorstellung war. Die Tatsache, dass der Platz unter der Laterne jetzt leer war, sollte mich also eigentlich beruhigen, aber das tat er nicht – im Gegenteil.
Ich schüttelte meinen Kopf, um das wattige Gefühl loszuwerden.
Was war nur mit mir los?
Vermutlich hatte mich mein Albtraum so aus der Bahn geworfen. Die Träumerin in unserer Familie war eigentlich Spatz, die ich manchmal sogar um ihre nächtlichen Abenteuerreisen beneidete, während ich mich morgens fast nie daran erinnern konnte, dass ich überhaupt geträumt hatte.
Musste es ausgerechnet dieser Traum sein, der mir in allen Einzelheiten im Gedächtnis geblieben war? Seltsamerweise hatten sich besonders die Farben dieses Raumes in irgendeinem Winkel meines Hirns eingebrannt. Dieser plüschige grüne Teppich, die Tagesdecke mit den bunten Blümchen – rot, gelb und violett. Gequält grinste ich auf. Du meine Güte, ich würde in einem holzgetäfelten Zimmer mit geblümter Tagesdecke und einem grünen Plüschteppich sterben, das war wirklich ein Albtraum.
Was wohl Suse dazu sagen würde?
Ich riss mich vom Fenster los, ging unter die Dusche und drehte den Warmwasserhahn bis zum Anschlag auf. Das heiße Wasser half tatsächlich. Als ich aus dem Bad kam, fühlte ich mich – na ja, wie neugeboren wäre eine Wunschvorstellung gewesen – aber zumindest etwas besser.
Ich schlüpfte in die Jeans von gestern, zog ein Shirt und einen Kapuzenpulli über und ging in die Küche. Spatz saß in ihrem schwarzen Kimono am Frühstückstisch. Ihre Haare standen in alle Richtungen ab und ihre kleinen Hände legten sich um die Suppentasse mit heißer Milch. Über den Rand ihrer Tasse hinweg warf sie mir einen ihrer typischen Spatz-Blicke zu, mit denen sie ganze Romane erzählen konnte. Vor allem morgens, wenn sie zu verschlafen war, um einen vollständigen Satz herauszubringen. Heute sagte ihr Blick: Janne hat erzählt, was letzte Nacht mit dir war. Ich hoffe, es geht dir besser.
Mein Platz am Frühstückstisch war schon gedeckt. Janne war ein Morgenmensch. Wenn um halb sechs ihr Wecker klingelte, sprang sie in ihre Joggingsachen, lief ihre Runde an der Elbe und war bereit für den Tag. Ihre ersten Klienten empfing sie meist um halb acht, so wie heute Morgen auch.
Ich zog den Zahnstocher aus meinem Sesambrötchen. An seinem oberen Ende klebte ein Zettel mit einem zähnefletschenden Strichmännchen. Zeig Tyger den Tiger, tausend Küsse, Mam, stand darunter. Ich musste grinsen, vor allem über die Zeichnung. Jannes Malkenntnisse waren auf dem Stand einer Fünfjährigen.
Mach dich nicht über deine arme Mutter lustig, sie hat den halben Morgen an diesem Kunstwerk gearbeitet, sagte Spatz’ Blick.
Ich biss versuchsweise in das Brötchen, und als mein Magen nicht rebellierte, schob ich eine Scheibe Salami und ein Schälchen Krabbensalat hinterher, weniger aus Hunger als in der vagen Hoffnung, damit das leere Gefühl in meiner Brust zu bekämpfen, das ich immer noch nicht losgeworden war.
Mein Unterricht begann erst um acht, aber ich verließ das Haus ein wenig früher als sonst und überquerte die Straße. Ich lehnte mich mit dem Rücken an die Laterne vor unserem Haus und blickte zu meinem Fenster hinauf. Es lag im vierten Stock. Ich versuchte, mir vorzustellen, was der Fremde gesehen oder vielmehr: gesucht hatte. Mich?
Meine Augen wanderten ein Stockwerk weiter runter. »Oder Frau Dunkhorst«, sagte ich laut und versuchte, meine nervtötende Stimmung wegzualbern, was auch prompt klappte.
Frau Dunkhorst war eine Hypochonderin, vor der alle Mitbewohner im Treppenhaus die Flucht ergriffen. Letzten Monat hatte es Spatz nicht mehr rechtzeitig geschafft und musste sich eine halbe Stunde lang die gefährlichen Symptome einer höchst seltenen Augenkrankheit anhören, die Frau Dunkhorst angeblich befallen hatte. Unter geschlossenen Lidern sah sie tanzende Mücken und ging davon aus, dass sich ihre Netzhaut jede Minute ablösen konnte. Mehrmals pro Woche rief Frau Dunkhorst den Notarzt, einmal hatte sie bei sich selbst einen Milzriss diagnostiziert.
Ich grinste und drehte mich entschlossen um. Okay, die Sache lag auf der Hand. Der Typ von gestern Nacht war vermutlich ein entnervter Sanitäter gewesen, der im Schutz der Dunkelheit ausgekundschaftet hatte, wie er Frau Dunkhorst am besten um die Ecke bringen konnte.
Ich ging in die Garage, schloss mein Fahrrad auf und war ein paar Minuten später unterwegs.
Mein Englischlehrer saß schon am Pult, als ich das Klassenzimmer betrat. Sein Name war Morton Tyger. Mit seinem grau melierten Haar, der hohen Stirn und den blitzblauen, beunruhigend wachen Augen hatte er etwas von einem englischen Aristokraten, der ins falsche Zeitalter gerutscht war. Wie immer hatte er ein Buch vor der Nase, eine Tasse dampfenden Tee in der Hand und trug einen altmodischen Anzug, dunkelgrau mit einer hellblauen Seidenfliege. Aus seiner Jacketttasche lugte die goldene Kette von Tygers Taschenuhr, ohne die ich meinen Englischlehrer noch nie gesehen hatte.
Dass er mein gemurmeltes »Good Morning« mit einer hochgezogenen Augenbraue quittierte, war ich ebenfalls gewohnt. Trotzdem versetzte mir sein Verhalten immer wieder aufs Neue einen Stich. Es ist eine Sache, von einem Lehrer nicht gemocht zu werden, in dessen Fach man eine Niete ist. Aber bei mir war das Gegenteil der Fall. Englisch hätte schon allein deshalb mein bestes Fach sein können, weil ich dank Dad zweisprachig aufgewachsen war und mich nicht wie die anderen mit dem Lernen von Vokabeln abquälen musste.
In Tygers Unterricht gab es jede Menge davon. Dabei hielt er sich weder an Lehrpläne noch an die Inhalte unserer Englischbücher. Stattdessen lasen wir Kurzgeschichten oder Romane, hauptsächlich klassische Science-Fiction oder Schauergeschichten britischer Schriftsteller. Wie Tyger damit durchkam, war uns allen ein Rätsel, aber offensichtlich wagte es nicht mal unsere strenge Direktorin, sich diesem eigenwilligen Lehrer zu widersetzen.
Als ich mich auf meinem Platz neben Suse niederließ, musterte Tyger mich noch einmal über den Rand seines Buches hinweg. Doch diesmal blieb sein Blick länger an mir hängen und auf seiner hohen Stirn bildete sich eine winzige Falte.
»Hilfe«, sagte Suse, die mich ebenfalls von der Seite anstarrte. »Hast du Drogen gefrühstückt? Du siehst aus wie ausgekotzt.«
»Danke, ich liebe dich auch.«
Ich kramte mein Schreibzeug aus der Schultasche. Das Klassenzimmer füllte sich. Als Sebastian an meinem Tisch vorbeikam, klingelte es.
»Hi Zombie, schöne Ladys Night gehabt?«, fragte mein Exfreund im Vorbeigehen. Die spöttische Art, mit der mich Sebastian in den letzten Wochen behandelte, löste normalerweise ein schlechtes Gewissen bei mir aus. Aber heute machte sie mich wütend.
»Leck mich«, knurrte ich mit zusammengebissenen Zähnen.
»What an interesting remark, Miss Wolf.« Tyger schlug das Klassenbuch auf. »Ich muss diesen Ausdruck unbedingt festhalten, damit er für die Nachwelt erhalten bleibt.« Er zückte seinen silbernen Stift. »Rebecca Wolff leitet die heutige Englischstunde mit den Worten Leck mich ein.« Tygers helle Augen fixierten mich. »Was heißt Leck mich auf Englisch, Rebecca?«
Kiss my ass, dachte ich und bemühte mich um einen gleichgültigen Gesichtsausdruck.
»Eat my shorts«, kam es von hinten. Sebastians Stimme. Er hatte fünf Jahre bei seiner Mutter in London gelebt, bevor er zu seinem deutschen Vater nach Hamburg gezogen war. »Oder auch sod you oder bugger me . . .«
»Lovely, Sebastian, that should be enough for now«, entgegnete Tyger mit seinem perfekten oxfordenglischen Akzent und nickte Sebastian wohlwollend zu.
»Amerikanisches Englisch«, fuhr er mit einem gehässigen Seitenblick auf mich fort, »unterscheidet sich vom echten britischen Englisch hauptsächlich in der Aussprache und im Wortschatz. Diese feine Differenz zieht sich bis in die Vulgärsprache hinein. So bevorzugen die Amerikaner auch hier die simple Ausdrucksweise oder haben verschiedene Redensarten des britischen Englisch erst gar nicht in ihr Vokabular aufgenommen – wie etwa das literarisch fantasievolle eat my shorts im Gegensatz zu einem banalen kiss my ass.«
In meinem Rücken hörte ich Sebastians leises Lachen.
Tygers Blick blieb an mir hängen, während Suse ihre Hand in meinen Oberschenkel krallte. Der Schmerz lenkte mich von meiner Wut ab. Ich überlegte, ob ich Tyger darüber aufklären sollte, dass Sebastian die Redewendung eat my shorts unter Garantie nicht aus England, sondern aus der US-amerikanischen Serie Die Simpsons kannte, aber ich ließ es bleiben.
»Wenden wir uns dem eigentlichen Thema der Stunde zu.«
Tyger zog an der goldenen Kette und ließ seine Taschenuhr aufschnappen. Wie jedes Mal wenn er sie ansah, zuckte es um sein linkes Auge.
»Ich habe eine neue Kurzgeschichte von Ambrose Lovell für euch ausgewählt«, verkündete er. »Eins seiner frühsten Werke. Sheila, wenn du mir freundlicherweise zur Hand gehen würdest – vorausgesetzt, du kannst in deinen Stiefeln laufen?« Tyger hielt Sheila einen Stapel Papier entgegen. Diesmal zuckte es um seine Mundwinkel.
Neben mir unterdrückte Suse ein Prusten und ich entspannte mich. Neues Opfer, neues Glück, schoss es mir durch den Kopf. Aber im Fall von Sheila Hameni hatte Tyger mein vollstes Verständnis. Als Sheila auf den Pfennigabsätzen ihrer weißen Stiefel durch das Klassenzimmer stakste, um die Blätter zu verteilen, sah sie aus wie ein misshandeltes Huhn auf Stelzen, aber das hielt sie nicht davon ab, mit ihrem winzigen Hintern zu wackeln.
Suse hielt sich die Kurzgeschichte vors Gesicht. »Erinnere mich bitte daran, dass ich der neuen Gruppe in Schüler-VZ beitrete: »Ich habe keine Vorurteile. Aber die hat weiße Stiefel an.«
Ich presste die Lippen zusammen, um nicht loszulachen, und fixierte mein Blatt. The Bell in the Fog, von Ambrose Lovell. Suffolk, England 1889–1950.
Bevor Tyger unsere Klasse in Englisch übernahm, hatte ich noch nie von diesem Schriftsteller gehört, aber mittlerweile kannte ich viel von ihm. Tyger schien sein gesamtes Werk zu besitzen, inklusive des Manuskripts von Lovells einzigem unvollendetem Roman, aus dem er uns irgendwann einmal eine winzige Kostprobe gegeben hatte. Meistens allerdings las er uns aus den Kurzgeschichten des Schriftstellers vor.
Wenn ich ehrlich war, gehörten diese Stunden zu meinen liebsten. Tyger hatte eine wundervolle Erzählerstimme, rau, tief und von einer genüsslichen Langsamkeit. Heute bat er jedoch Sebastian vorzulesen und forderte uns auf, alle unbekannten Vokabeln zu markieren und für die nächste Stunde auswendig zu lernen.
Lovells Erzählung handelte von einem englischen Lord, der sich bei Nacht und Nebel in einem einsamen Moor verlief und plötzlich ein seltsames Klingeln hörte. Sebastian beherrschte die englische Sprache fast so gut wie unser Lehrer und war ein geübter Vorleser, aber trotzdem hatte ich Mühe, mich zu konzentrieren. Was Schlaf betraf, gehörte ich eindeutig in die Kategorie Murmeltier. Acht Stunden waren normalerweise mein Minimum, alles, was darunter lag, schlug sich nicht nur auf mein Nervensystem nieder. Und heute spürte ich das ganz besonders. Meine Gedanken fingen an zu wandern, und ehe es mir bewusst wurde, standen mir wieder dieser grottenhässliche grüne Plüschteppich aus meinem Traum vor Augen, die geblümte Tagesdecke, die Glasscherben und das viele Blut; dazu dieses Gefühl, dass sich jemand über mich beugte, den ich anbettelte, mich am Leben zu lassen.
Hinter meinen Schläfen pochte es schmerzhaft. Versuchsweise schloss ich die Augen und dann sah ich das nächste Bild: die dunkle Gestalt, die an der Laterne lehnte und unverwandt zu mir hochblickte.
Ich riss die Augen wieder auf, weil mir der Schweiß ausbrach.
Dass Tyger mich erneut im Blick hatte, machte es nicht besser. Ich versuchte, ihm auszuweichen, aber etwas in seinem Ausdruck war anders als sonst. Wenn ich meinen Englischlehrer nicht so gut gekannt hätte, hätte ich geglaubt, dass er sich Sorgen um mich machte.
»Was ist mit dir los, Becky?«, fragte Suse in der Mittagspause. Wir standen wie jeden Tag bei Doris’ Diner an der Theke und warteten auf unser Essen.
»Ist es wegen Tyger? Dieser Arsch. Warum hasst er dich so? Nur weil dein Vater Ami ist? Was sagt dein Dad eigentlich dazu? Hast du mit ihm darüber gesprochen? Wie wär’s, wenn du ihn mal zu Tyger in die Sprechstunde schickst? Wollte er nicht vor Weihnachten noch einmal nach Deutschland kommen?«
Ich musste gleichzeitig gähnen und grinsen. Meine beste Freundin konnte mühelos drei Dutzend Fragen aneinanderreihen, ohne die Antwort abzuwarten. Aber diesmal kam sie zurück auf den Ursprung. »Jetzt mal im Ernst. Warum bist du so blass wie Lovells Lord aus dem Nebelmoor?«
»Bist du sicher . . .«, setzte ich an.
»Willst du einen Spiegel?« Suse nahm unsere Chickenburger mit Pommes frites entgegen. »Frag Sheila, die leiht dir vielleicht einen aus ihrer Sammlung.«
»Danke, Suse, ich weiß, wie ich aussehe. Ich wollte sagen: ›Bist du sicher, dass du das hören willst?‹«
»Spinnst du? Schieß los. Ist es . . . wegen ihm? Bereust du es?«
Suse nickte zum Tisch neben der Tür. Dort saß Sebastian, umringt von der gesamten Tussenfraktion, und pustete sich gerade eine Haarsträhne aus dem Auge. Sebastian hatte dichte, geschwungene Wimpern und den sinnlichsten Mund, den ich je gesehen hatte. Letzten Sommer hatte ich ihn beim Eisdealer im Schanzenviertel gefragt, wie Zabaione-Eis auf seiner Zunge schmecken würde. Keine Ahnung, was damals in mich gefahren war. Gleich darauf war ich jedenfalls in hysterisches Gekicher ausgebrochen und hätte mich am liebsten in Luft aufgelöst. Aber Sebastian hatte eine Augenbraue hochgezogen und einen Schritt auf mich zugemacht. Dann hatte er meine Frage beantwortet.
Als ich jetzt auf meinen Burger wartete und seinen spöttischen Blick erwiderte, wurde die Erinnerung in mir plötzlich wieder sehr lebendig. Nicht nur die Küsse, sondern all die Monate, die auf meine Frage gefolgt waren, hatten sich richtig angefühlt. Gut.
Aber etwas hatte doch gefehlt. Als ich vor fünfeinhalb Wochen Sebastians Hand festhielt, die unter meiner Bettdecke auf Wanderschaft ging, sah er mir in die Augen und sagte: »Du hast nicht Angst, dass ich dich fallen lasse. Du hast Angst, dass du mich fallen lässt. Deshalb willst du nicht mit mir schlafen. Stimmt’s?«
Als ich meinen Kopf an Sebastians Schulter vergrub, stieß er mich sanft von sich. Dann stand er auf und ging.
Seitdem hatten die Möchtegernjulias ihn wieder. Sie klebten an ihm wie die Fliegen und mittlerweile hatte Sebastian aufgegeben, sich dagegen zu wehren.
»Hier, dein Burger.« Suse schob mir mein Tablett zu und wir gingen zu unserem Tisch. Als wir an der Gruppe um Sebastian vorbeikamen, stierte Sheila mich an, als ob sie mich am liebsten zum Mond schießen wollte. Sie hockte Sebastian fast auf dem Schoß.
»Hey Becks, tut mir leid wegen heute Morgen«, murmelte Sebastian. Es war das erste Mal seit unserer Trennung, dass er mich Becks nannte. »Ich wollte nicht . . .«
»Hast du aber«, zischte Suse. »Friss das nächste Mal deine Calvinunterhose, dann hältst du wenigstens die Klappe.«
Sheila schnappte nach Luft. An ihrem pinkfarbenen Lipgloss klebte ein Fleischkrümel.
Sebastian grinste Suse an. Auch als wir noch ein Paar gewesen waren, hatten die zwei sich ständig Wortgefechte geliefert, aber im Grunde mochten sie sich.
»Also.« Suse setzte sich gegenüber von mir an einen der hinteren Tische und leckte sich einen Spritzer Ketchup von den Fingern. »Jetzt erzähl schon, was ist passiert?«
An der Wand tickte eine Uhr. Das Gehäuse hatte die Form eines Burgers, der Sekundenzeiger war eine Pommes. Ich folgte ihm mit den Augen, zur Drei, zur Sechs, zur Neun . . .
»Wenn du nicht in zwei Sekunden den Mund aufmachst, fang ich an zu schreien!«, drohte Suse und zog eine Gurkenscheibe aus ihrem Chickenburger.
Ich tunkte meine Pommes in den Ketchup und begann zu erzählen, was mir letzte Nacht passiert war. Als ich fertig war, lag mein Chickenburger noch unberührt auf meinem Teller. Er war kalt geworden und sah so eklig aus, dass mir bei seinem Anblick übel wurde.
»Da unten an der Laterne hat er gestanden? Er hat direkt in dein Zimmer gestarrt? Und du bist sicher, dass es nicht Sebastian war?«
Suse hockte auf meiner Fensterbank und sah hinüber auf die andere Straßenseite. Sebastian saß jetzt mit den anderen im Biounterricht, wo Frau Donner, eine winzige Lehrerin mit Hamsterbacken und grauem Dutt, sich vermutlich gerade ihrem Lieblingsthema Legale und illegale Drogen widmete.
Suse hatte mich überredet, die letzten Stunden zu schwänzen. Gerade hatte sie mit verstellter Stimme im Sekretariat angerufen, um uns zu entschuldigen.
»Todsicher«, hörte ich mich sagen.
»Becky, das ist so gruselig. Wer steht denn nachts vor fremden Fenstern und beobachtet die Bewohner?« Suse schauderte.
Meinen Albtraum hatte sie kurzerhand als Folge einer Überdosis Apfelstrudel in den Wind geschossen, aber der fremde Laternenmensch brachte ihre Fantasie auf volle Touren.
»Vielleicht war es dieser Streichler, der neulich aus der Klapse entlaufen ist«, hauchte sie mit weit aufgerissenen Augen.
»Der bitte wer?«
»Na, du weißt schon«, sagte Suse und kaute aufgeregt auf einer ihrer Haarsträhnen herum. »Dieser Gestörte mit der pinkfarbenen Strumpfmaske, über den sie letzte Woche in der Mopo berichtet haben. Er steigt nachts bei alleinstehenden Frauen ein und setzt sich auf ihre Bettkante. Während sie schlafen, streichelt er ihnen über die Wange, und wenn sie verträumt ihre Augen aufschlagen, dann . . .«
»Suse!«, kreischte ich entsetzt. »Kannst du bitte mit diesem Scheiß aufhören? Das lässt mich heute Nacht nicht wirklich ruhiger schlafen, hörst du?«
Ich zerrte meine Freundin vom Fensterbrett weg. Es war merkwürdig, den ganzen Tag über hatte ich entweder an meinen Albtraum denken müssen oder an diese seltsame Gestalt vor meinem Fenster. Aber darüber zu reden, machte es nicht besser. Ganz im Gegenteil irgendwie kam es mir vor, als wäre es ein großer Fehler. Laut ausgesprochen wirkte das Ganze wie eine Verkettung von seltsamen Zufällen. Aber das war es nicht, nicht für mich – nicht mit diesem Gefühl in meiner Brust, dieser Leere, die ich ja nicht einmal mir selbst erklären konnte.
»Erzähl doch mal lieber, wie war die Bandprobe gestern?«, fragte ich Suse.
Meine Freundin ließ sich mit einem tiefen Seufzer in meinen Sitzsack fallen und das Thema der nächsten Stunde war Dimo Jamal, Leadsänger der Schulband Dr. No und die kranken Schwestern und Suses Traum schlafloser Nächte. Für meine Begriffe war Dimo ein ziemlich arrogantes Arschloch, aber das behielt ich wohlweislich für mich – Suse hätte eh nicht auf mich gehört.
Vor drei Monaten hatte Dimo meine Freundin in den erlesenen Kreis der Back-Vocals aufgenommen. Seitdem nahm Suse Gesangsunterricht und spielte ernsthaft mit dem Gedanken, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Mir war es ein Rätsel, warum Menschen sich ausgerechnet an dem, wofür sie am wenigsten können, am stärksten messen ließen. Dabei hatte das Schicksal Suse mindestens ebenso reich bedacht wie Sebastian, als es um die Verteilung von gutem Aussehen ging.
Optisch war Suse so ziemlich das Gegenteil von mir. Was nicht heißen soll, dass ich mich neben ihr wie ein hässliches Entlein fühlte, aber mit meinen runden Hüften, den stämmigen Beinen und dem großen Busen war ich wahrscheinlich der leibhaftige Albtraum aller Magersüchtigen. Und während ich wie mein Dad schwarzhaarig und braunäugig war, hatte Suse weißblonde – polange – Korkenzieherlocken, hellgrüne Augen und den Körper einer Elfe.
Suses einzigen Makel kannten nur vier Menschen auf der Welt. Suses Frauenärztin, ihre Mutter, Janne und ich. Suse hatte zwei unterschiedlich große Brüste. Rechts so ungefähr B/C und links ein A–Körbchen.
Um den Unterschied zu kaschieren, hatte sie sich spezielle BHs anfertigen lassen, deren eine Seite mit einem gummiartigen Material gepolstert war. Dadurch konnte Suse auch enge T-Shirts tragen, ohne dass man den Unterschied bemerkte. Trotzdem litt sie natürlich entsetzlich darunter. Beim Sportunterricht verließ sie die Kabine –mit mir als Bodyguard – immer als Letzte und wie viele Stunden wir schon in Internetforen verbracht hatten, konnte ich nicht mehr nachrechnen. Mittlerweile kannte ich sämtliche Pros für eine Brustoperation auswendig. Für die Kontras sorgten Janne und ich.
Nachdem Suse mir also ausgiebig von Dimos Songs, Dimos Stimme, Dimos Hintern und dem Muttermal auf Dimos Stirn vorgeschwärmt hatte, landeten wir auch heute zwangsläufig bei ihrem Komplex und ich versuchte mein Glück wieder einmal mit einem Verweis auf Mädchen, die es schlimmer getroffen hatte. Ein aussichtsloses Unterfangen.
»Lilith Hopf ist mit ihrem Schweinchenrüssel geboren worden«, konterte Suse wie aus der Pistole geschossen, »die hatte ein Leben lang Zeit, sich daran zu gewöhnen. Meine Brüste dagegen waren spiegelgleich, warum in aller Welt konnte sich die rechte nicht zufriedengeben und musste weiterwachsen?«
»Sieh es doch mal so«, versuchte ich es mit einem Scherz, »wenn Dimo auf einen kleinen Busen steht, kannst du ihn glücklich machen, und wenn er auf einen großen Busen steht, kannst du ihn ebenfalls glücklich machen. Du bist sozusagen two in one.«
»Sehr witzig.« Suse verschränkte die Arme vor ihren ungeliebten Körperteilen. »Lieber sterbe ich als vertrocknete Jungfrau, als mich vor Dimo als Krüppel zu outen. Wenn ich wenigstens Krebs hätte, dann hätte ich zumindest eine Entschuldigung, aber so . . .«
»Suse! Das meinst du nicht ernst!«
»Doch!« Wenn es um ihre Brüste ging, kannte Suse keine Grenzen. Aber man konnte es ihr nicht übel nehmen, niemand schaffte es, Suse länger als fünf Minuten böse zu sein.
Nachdem sie sich beruhigt hatte, surften wir auf YouTube, hörten Coolios neue CD Steal Hear und schrieben auf dem Handy von Suses Mutter einen Hilferuf an deren Steuerberater. Die beiden hatten seit einem halben Jahr ein Verhältnis miteinander. Vor ein paar Wochen war Suses Vater deshalb ausgezogen und Suse hasste den Neuen ihrer Mutter wie die Pest.
»Liebling, mein Auto hat eine Panne«, diktierte sie mir, weil ich schneller tippen konnte. »Ich stehe an der Raststätte, erste Ausfahrt nach Hannover. Der ADAC kommt erst in drei Stunden. Kannst du mich retten? Ich verzehre mich nach dir. Dein Schneckchen.«
»Schneckchen?« Ich prustete los. Suses Mutter war eine gertenschlanke Frau und gab in Hannover Zeitmanagementseminare für Führungskräfte.
»Sie nennt sich Schneckchen? Und wo steckt sie in Wirklichkeit?«
»Krank im Bett«, sagte Suse mit einem triumphierenden Grinsen. Sie riss mir das Handy aus der Hand und drückte auf Senden. »Jede Wette, dass in den nächsten zehn Sekunden eine Antwort kommt?« Suse legte das Handy auf ihre Handflächen – und da war sie auch schon.
Bin unterwegs. Rühr dich nicht vom Fleck, die Rettung naht. Dein Zahlenhengst.
Ich glotzte auf das Display. Er hatte wirklich Zahlenhengst geschrieben. »Mir wird schlecht«, sagte ich und schickte einen stummen Dank in den Himmel, dass ich von solchen Familienproblemen verschont geblieben war. Suse hatte wirklich ernstere Sorgen als zwei unterschiedlich große Brüste, aber ich war froh, dass sie es in diesem Fall mit Humor nahm.
Bei der Vorstellung, wie Schneckchens Zahlenhengst jetzt in seinen Sportwagen stieg und mit zweihundert Sachen gen Hannover brauste, kreischten wir vor Lachen. Coolio rappte Keep it Gangsta, und als Janne von der Arbeit kam und ihren Kopf in mein Zimmer steckte, erzählten wir ihr von der SMS.
Sie musste ebenfalls lachen. »Wenn dir deine liebeskranke Mutter auf den Geist geht, findest du bei uns immer Asyl, das weißt du, Suse, oder?«
Suse nickte. Schon oft hatte ich vermutet, dass Janne für sie die Mutter war, die sie sich immer gewünscht hatte. Suse und ich kannten uns seit der Grundschule und unsere Wohnung war ihr zweites Zuhause.
Ich holte uns gerade zwei Teller mit Quiche aus der Küche, als mein Handy klingelte. Am anderen Ende war Sebastians Vater. Er leitete einen Cateringservice und Sebastian hatte mir Anfang des Jahres einen Job bei ihm verschafft. Ich half bei Nachmittags- oder Wochenendevents aus, aber für heute stand keine Veranstaltung in meinem Kalender.
»Oh mein Gott, wie gut, dass du da bist!«, keuchte Sebastians Vater. Seine Stimme klang so atemlos, als stünde er kurz vor einem Herzinfarkt. »Wir haben eine Eröffnungsfeier, superwichtiger Kunde! Eine der Kellnerinnen ist krank geworden, kannst du einspringen? Der Laden heißt Lights on. Große Elbstraße im Stilwerk. Um neunzehn Uhr geht’s los. Ich zahle doppelten Stundensatz, ein Nein wird nicht akzeptiert, also was sagst du?«
Ich sagte Ja, obwohl mir die letzte Nacht noch immer in den Knochen steckte und ich am liebsten früh ins Bett gegangen wäre. Aber Sebastians Vater klang so verzweifelt, dass ich es nicht übers Herz brachte, ihm einen Korb zu geben.
Nachdem Suse gegangen war, nahm ich noch eine Dusche – dies mal eiskalt –, sagte Janne Bescheid, dass ich um elf zurück sein würde, und machte mich auf den Weg.
Lights on war, wie der Name schon sagte, ein Lampenladen im Stilwerk, einem ziemlich hippen Einkaufszentrum am Fischmarkt. Die Gäste waren schon da, als ich ankam. Sebastians Vater warf mir die Garderobe zu, die sich der Kunde gewünscht hatte, und ich zog mich hastig in der Toilette um. Schwarzes, kurzes Kleid mit tiefem Ausschnitt und einer weißen Schürze, dazu hohe Pumps. Hallo? Ging es noch nuttiger?
Aber ich war zu müde, um mich zu ärgern. Als ich einen Blick in den Spiegel warf, erschrak ich vor mir selbst. Meine Augen waren gerötet und brannten, meine Haut war käsebleich und mein sonst eher rundes Gesicht wirkte wie eingefallen. Ich kniff mir in die Wangen und machte mich an die Arbeit.
Die Gäste waren Männer und Frauen in den Vierzigern, die Spatz die Schublade neureiche Schnösel gesteckt hätte. Sie standen herum, saßen auf roten Samtsofas oder verchromten Barhockern und warteten auf ihr Fingerfood, das ich ihnen zusammen mit den beiden Service-Kolleginnen servieren sollte.
Neben dem Verkaufstresen begann die Liveband zu spielen. Ein aufgebrezeltes Sängerinnen-Duo stimmte als kleine Revivaleinlage den Abba-Song Lovelight an und die Lichter im Laden, die bis eben noch angenehm heruntergedimmt gewesen waren, wurden jetzt voll aufgedreht: Hunderte von Designerlampen stahlen sich gegenseitig die Show. Wandleuchten, Stehleuchten, Tisch-und Pendelleuchten in allen Größen und Formen. Die grellen Lichter schraubten sich in meine Nervenbahnen und die vielen Menschen machten es auch nicht besser. Der Laden, ein riesiges Loft mit Steinboden und hohen Decken, war mittlerweile gerammelt voll.
Mit zusammengebissenen Zähnen schlängelte ich mich durch die Menge. Allein für das Outfit hätte ich die dreifache Gage verdient. Die Schuhe drückten, das Kleid kratzte und ein glatzköpfiger Mann im Nadelstreifenanzug stierte mir unverhohlen in den Ausschnitt, während er sich marmorierte Eier, chinesische Hackbällchen und Garnelenspieße von meinem Tablett pflückte. Am liebsten hätte ich ihm das Tablett vor die Glatze gepfeffert. Wenn es eine Vorhölle gäbe, dann säßen Typen wie dieser in der ersten Reihe, dachte ich angewidert.
»Was glotzt der so? Gehört der zu dir?«, raunte mir die kleine rothaarige Kellnerin ins Ohr, als sich unsere Wege kreuzten.
Ich wollte gerade empört mit dem Kopf schütteln, als ich bemerkte, dass die Kellnerin nicht auf den Glatzkopf, sondern in die andere Richtung deutete.
Und da war es wieder. Dieses seltsame Gefühl von Ruhe, tief in meinem Inneren. Ich fühlte es, bevor ich ihn sah.
Er lehnte an einer Wand ganz hinten in der Ecke des Ladens. Ich erkannte das blasse Gesicht mit dem schwarzen Haar sofort wieder. Jetzt sah ich auch, dass es ein Junge war, vielleicht ein wenig älter als Sebastian, aber nicht viel. Niemand war in seiner Nähe. Die große Stehlampe links von ihm hatte die Form eines Baumes und die Lichter, Dutzende winziger Blätter aus weißem Glas, hingen an metallenen Ästen und Zweigen auf ihn herab. Und während die anderen Gäste im Raum umhergingen, gestikulierend beieinanderstanden oder sich Häppchen in den Mund schoben, war seine Haltung so ruhig, als stünde er einem unsichtbaren Maler Porträt. Auch sein Blick war bewegungslos. Er richtete sich einzig und allein auf mich, als wäre außer mir niemand in diesem Laden.
»Wer ist das?«, flüsterte meine Kollegin. »Wie ein Gast sieht er jedenfalls nicht aus. Gott, ist der abgewrackt.« Sie kicherte. »Aber irgendwie auch sexy. Wie ist der bloß hier reingekommen?«
Ich wollte etwas sagen, aber die Worte blieben mir in der Kehle stecken.
Er war schmal, fast dünn, aber auf eine katzenhafte Art und Weise. Seine tiefschwarzen Haare waren leicht zerzaust, seine Züge scharfkantig. Er trug einen schwarzen Pullover, der am linken Ellenbogen einen Riss hatte, und die zerschlissene Jeans saß knapp über den Hüften. Aber abgewrackt – das war das falsche Wort.
Er sah fremd aus. Anders.
Mein Blick glitt zurück zu seinem schmalen Gesicht. Noch immer schaute er mich unverwandt an. Ob seine Augen braun oder blau waren, konnte ich nicht ausmachen, aber die tiefen Schatten darunter sah man von hier aus. Er hatte hohe Wangenknochen und plötzlich schoss mir eine völlig blödsinnige Umfrage durch den Kopf, auf die Suse und ich neulich beim Surfen im Internet gestoßen waren: »Hey Girls, findet ihr hohe Wangenknochen bei Jungs sexy?«
In diesem Fall, ja.
Wobei es nicht sein Aussehen war. Oder doch – das war es auch, aber da war noch etwas anderes – eine seltsame, fast fiebrige Intensität, eine Unruhe, die er ausstrahlte, obwohl er sich nicht von der Stelle rührte. Bis eben war mir kalt gewesen vor Müdigkeit, jetzt wurde mir warm.
Die beiden Mädels aus der Band sangen: Everything around you is lovelight, you’re shining like a star in the night, I won’t let you out of my sight . . . und der Fremde verzog die Mundwinkel zu einem ironischen Lächeln.
»Hey, Kleine, ich hätte zu gerne noch eine Dattel im Speckmantel.«
Ich zuckte zusammen. Der Glatzkopf stand wieder vor mir und versperrte mir die Sicht. Meine Kollegin war mittlerweile in der Menge untergetaucht. Der eklige Kerl grapschte sich die Dattel von meinem Tablett und ließ sie mit purer Absicht in meinen Ausschnitt fallen.
»Hoppla. Das tut mir leid, kann ich Ihnen . . .«
Der Glatzkopf wollte gerade die Wurstfinger ausstrecken, als er in der Bewegung erstarrte. Eine Hand hatte sich in seinen Nacken gekrallt. Sie gehörte zu dem fremden Jungen. Er stand dicht hinter dem Glatzkopf, die schwarzen Haare fielen in seine Stirn, sein Gesicht konnte ich nicht erkennen.
»Lass das Mädchen in Ruhe oder dir passiert was.«
Die Stimme des Jungen war leise, rau, fast heiser, als hätte er sie lange nicht benutzt. Und sie hatte einen gefährlichen Unterton.
Der Glatzkopf schnappte nach Luft und diesmal ließ ich wirklich das Tablett fallen. Scheppernd fiel es zu Boden. Irgendein Gast, ein weiblicher, gab einen schrillen Laut von sich, Sekunden später war Sebastians Vater da.
Plötzlich herrschte überall Tumult, und als ich meine Sinne wieder beisammenhatte, war der Fremde spurlos verschwunden.
Die Band hatte einen neuen Song angestimmt, danach hielt der Geschäftsführer eine Ansprache. »Verehrte Gäste, es ist mir eine Ehre, Sie heute bei uns zu begrüßen, bla, bla, bla . . .«
Irgendwie brachte ich den Abend hinter mich, und als ich um kurz nach zehn an die frische Luft kam, konnte ich mich vor Erschöpfung kaum noch auf den Beinen halten. In meiner Tasche steckte ein Hunderteuroschein von Sebastians Vater – als Wiedergutmachung für den kleinen Zwischenfall mit dem Glatzkopf, der natürlich nicht von der Eröffnungsfeier verwiesen worden war.
»Taxi gefällig?« Eine Hand legte sich auf meine Schulter. Diesmal war ich es, die einen Schrei ausstieß. Neben mir stand Sebastian und strich sich grinsend das helle Haar aus der Stirn. Mein Schreck war immer noch größer als die Überraschung, meinen Exfreund hier zu sehen.
»Du spinnst wohl, dich so anzuschleichen! Willst du mich umbringen?«
Das Grinsen wurde noch breiter. »Im Gegenteil. Ich wurde zu deiner Rettung befohlen. Mein alter Herr hat mich vorhin angerufen. Er hat gesagt, ich soll dich nach Hause bringen, damit dich keine fremden Männer kidnappen. Also komm schon, steig auf.« Sebastian hielt mir den Helm hin und kurz darauf saß ich hinter ihm auf der Vespa.
Ich schlang meine Arme um seinen Bauch und legte meinen Kopf an seinen Rücken. Unter Sebastians Helm lugten seine Haare hervor, sie kitzelten mich in der Nase. Ich hielt mich so fest, wie ich nur konnte, aber das hohle Gefühl war wieder zurückgekehrt, so stark wie gestern Abend. Es war, als hätte sich ein Loch in meine Brust gefressen.
»Hey Becks. Muss ich mir Sorgen machen? Du siehst wirklich nicht gut aus«, sagte Sebastian, als wir vor meiner Haustür standen und ich mich verabschieden wollte. Er legte seine Hände an meine Wangen. Seine Finger fühlten sich eiskalt an, aber die Berührung schien ihn ebenso zu erschrecken wie mich.
»Du glühst ja«, sagte er und musterte mich besorgt. »Hast du Fieber?«