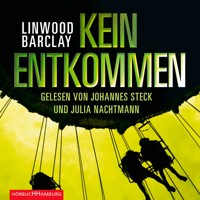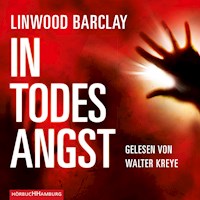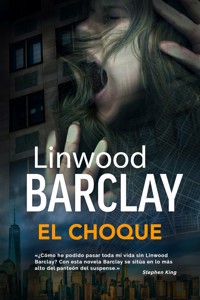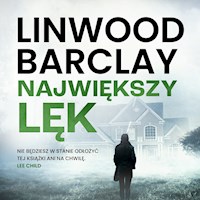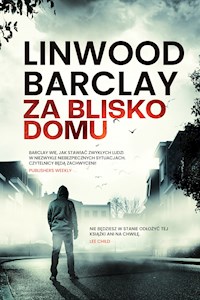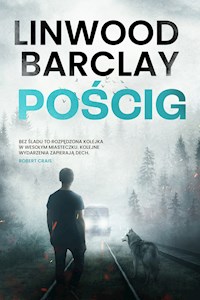9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Promise Falls
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Bestsellerautor Linwood Barclay ("Ohne ein Wort") ist zurück! "Lügennest" bildet den Auftakt seiner neuen "Promise Falls"-Trilogie: Drei Thriller, die sich mit den Abgründen einer amerikanischen Kleinstadt beschäftigen, deren Mitbewohner auch nicht vor Mord zurückschrecken... Für Promise Falls sieht es düster aus. In der Kleinstadt an der US-Ostküste gibt es kaum Perspektiven – und vor allem keine Jobs. Auch die Zeitung von Reporter David Harwood ist pleite, trotzdem steckt er seine Nase weiterhin in Sachen, die ihm merkwürdig vorkommen. Wie zum Beispiel in diese Geschichte mit dem Baby. Seine Cousine Marla schwört, ein Engel habe es ihr gegeben. Aber es sieht eher so aus, als hinge alles mit einem brutalen Mord am anderen Ende der Stadt zusammen. Und das ist nicht der einzige Abgrund, der sich in Promise Falls auftut. Linwood Barclay ist "ein wahrer Spannungsmeister." Stephen King
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Ähnliche
Linwood Barclay
LÜGENNEST
Promise Falls I Thriller
Aus dem Englischen von Silvia Visintini
Knaur e-books
Über dieses Buch
Bestsellerautor Linwood Barclay (»Ohne ein Wort«) ist zurück! »Lügennest« bildet den Auftakt seiner neuen »Promise Falls«-Trilogie: Drei Thriller, die sich mit den Abgründen einer amerikanischen Kleinstadt beschäftigen, deren Mitbewohner auch nicht vor Mord zurückschrecken …
Für Promise Falls sieht es düster aus. In der Kleinstadt an der US-Ostküste gibt es kaum Perspektiven – und vor allem keine Jobs. Auch die Zeitung von Reporter David Harwood ist pleite, trotzdem steckt er seine Nase weiterhin in Sachen, die ihm merkwürdig vorkommen. Wie zum Beispiel in diese Geschichte mit dem Baby. Seine Cousine Marla schwört, ein Engel habe es ihr gegeben. Aber es sieht eher so aus, als hinge alles mit einem brutalen Mord am anderen Ende der Stadt zusammen. Und das ist nicht der einzige Abgrund, der sich in Promise Falls auftut.
Inhaltsübersicht
Für Neetha
1
Ich hasse diese Stadt.
TAG EINS
2
David
Zwei, drei Stunden, bevor das Chaos ausbrach, lag ich im Bett und grübelte. Seit fünf Uhr dachte ich darüber nach, welche Umstände mich im Alter von einundvierzig Jahren in mein Elternhaus zurückgeführt hatten.
Mein Zimmer sah nicht mehr so aus wie damals, vor zwanzig Jahren, als ich auszog. Das Ferrari-Poster hing nicht mehr an der Wand mit der blaugestreiften Tapete, und das Raumschiff-Enterprise-Modell mit den eingetrockneten bernsteinfarbenen Kleberesten am Rumpf – ich hatte es selbst zusammengebaut – stand auch nicht mehr auf der Kommode. Aber die Kommode war noch da. Und die Tapete. Und das Bett war auch noch dasselbe.
Ich hatte im Laufe der Jahre natürlich ein paar Mal hier übernachtet, wenn ich zu Besuch war. Aber wieder hier wohnen? Bei meinen Eltern? Mit meinem Sohn?
Was war das denn für eine Scheiße? Wie hatte es so weit kommen können?
Natürlich gab es eine Antwort auf diese Frage. Und ich kannte sie auch. Es gab keine einfache Antwort, aber es gab eine.
Das Elend hatte vor fünf Jahren begonnen, nach dem Tod meiner Frau Jan. Eine traurige Geschichte; es lohnt sich nicht, sie hier wieder aufzuwärmen. Fünf Jahre waren vergangen, und es war höchste Zeit, mit einigen Dingen in meinem Leben abzuschließen. Ich war in meine Rolle hineingewachsen. Ich war alleinerziehender Vater eines inzwischen neunjährigen Sohnes. Ich will nicht behaupten, dass mich das zum Helden macht. Nur erklären, wie alles gekommen ist.
Ich wollte neu anfangen. Mit Ethan. Ich kündigte meine Stelle als Zeitungsreporter beim Promise Falls Standard – keine allzu schwierige Entscheidung angesichts des mangelnden Interesses der Herausgeber, irgendetwas zu drucken, das auch nur annähernd auf das Zeitgeschehen einging – und fing beim Boston Globe in der Lokalredaktion an. Ich verdiente mehr, und für Ethan gab es in Boston ein viel breiteres Angebot. Das Museum für Kinder, das Aquarium, den Marktplatz um Faneuil Hall, die Red Sox, die Bruins. Etwas Besseres für einen Jungen und seinen Vater kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber …
Es gibt immer ein Aber.
Aber als Redakteur war ich meistens erst abends gefordert, wenn die Reporter ihre Storys abgeliefert hatten. Ich konnte Ethan zwar morgens zur Schule bringen, ihn manchmal sogar zum Mittagessen abholen, weil ich erst gegen drei, vier Uhr nachmittags in der Redaktion sein musste. Das hieß aber, dass ich sehr oft nicht mit meinem Sohn zu Abend essen konnte. Ich war nicht da, um ihn anzuhalten, seinen Hausaufgaben mehr Zeit zu widmen als seinen Videospielen. Ich war nicht da, um ihn daran zu hindern, Stunden vor der Glotze zu verbringen, bei endlosen Folgen von Pseudo-Dokus über chauvinistische Entenjäger oder hohlköpfige Ehefrauen ebenso hohlköpfiger Sportasse; oder – was gerade angesagt war –, um Beschränktheit und/oder Maßlosigkeit made in USA zu demonstrieren. Am schlimmsten aber war, dass ich einfach nicht da war. Vater zu sein heißt doch nicht zuletzt, anwesend zu sein, zur Verfügung zu stehen, und nicht: außer Haus zu sein, um zu arbeiten.
Mit wem sollte Ethan denn um acht Uhr abends reden, wenn er sich verliebt hatte – bei einem Neunjährigen vielleicht noch nicht so wahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Oder wenn Ethan einen Rat brauchte, weil er gemobbt wurde? Mit Mrs. Tanaka vielleicht? Ja, sie war nett, gar keine Frage, und froh, sich jetzt, da ihr Mann tot war, etwas dazuverdienen zu können, indem sie an fünf Abenden die Woche auf einen Jungen aufpasste. Aber wenn es um Mathe ging, war ihm Mrs. Tanaka keine große Hilfe. Sie hüpfte auch nicht mit Ethan durchs Wohnzimmer, wenn die Bruins in der Nachspielzeit einen Treffer erzielten. Und es bedurfte intensiver Überzeugungsarbeit, bis sie sich mit Ethan hinsetzte, einen Joystick in die Hand nahm und am Computer ein paar virtuelle Grand-Prix-Runden drehte.
Wenn die Kollegen sich nach Redaktionsschluss noch einen Absacker gönnten, ging ich schnurstracks nach Hause, weil ich wusste, dass Mrs. Tanaka auch nach Hause wollte. Wenn ich todmüde zur Tür hereinkam – normalerweise zwischen elf und Mitternacht –, schlief Ethan meistens schon. Ich musste mich sehr zurückhalten, ihn nicht zu wecken und zu fragen, wie er den Tag verbracht hatte. Ich hätte gerne gewusst, ob er mit den Hausaufgaben klargekommen war, was er zu Abend gegessen und sich im Fernsehen angeguckt hatte.
Wie oft war ich wie ein Stein ins Bett gefallen und hatte mich mit Selbstvorwürfen gequält? Dass ich ein schlechter Vater war und einen Riesenfehler begangen hatte, als ich aus Promise Falls weggezogen war. Ja, der Globe war eine bessere Zeitung als der Standard, doch alles, was ich mehr verdiente, wanderte auf Mrs. Tanakas Konto und ging für die hohe Miete drauf.
Meine Eltern boten uns an, nach Boston zu ziehen, um mich zu entlasten, doch das kam für mich nicht in Frage. Mein Vater Don war jetzt Anfang siebzig, und meine Mutter Arlene war nur zwei Jahre jünger als er. Ich würde die beiden bestimmt nicht verpflanzen, insbesondere nach dem Schrecken, den Dad uns erst vor kurzem eingejagt hatte. Ein leichter Herzinfarkt. Jetzt war er wieder auf dem Damm, nahm seine Medikamente und kam wieder zu Kräften, aber an einen Umzug war nicht zu denken. Eines Tages, wenn er und Mom sich nicht mehr richtig ums Haus kümmern konnten, würden sie vielleicht in ein Seniorenheim in Promise Falls ziehen, aber in eine über dreihundert Kilometer und bei lebhaftem Verkehr mehr als drei Stunden entfernte Großstadt? Ausgeschlossen.
So kam es, dass ich meinen Stolz hinunterschluckte und zum Telefonhörer griff, als ich hörte, dass der Standard einen Reporter suchte.
Ich rief den Chefredakteur an und sagte: »Ich würde gern zurückkommen.« Die Worte blieben mir beinahe im Hals stecken.
Kaum zu glauben, dass sie überhaupt eine Stelle neu besetzten. Wie die meisten Zeitungen hatte auch der Standard parallel zum Rückgang seiner Einnahmen seine Ausgaben reduziert, wo es nur ging. Scheidende Mitarbeiter wurden nicht ersetzt. Beim Standard war insgesamt nur eine Handvoll übrig geblieben: Reporter, Redakteure und Fotografen zusammengenommen. (Die meisten Reporter fuhren jetzt »zweigleisig«, das heißt, sie schrieben Artikel und lieferten die Fotos gleich mit.) Aber genau genommen fuhren sie »vier-«, wenn nicht sogar »sechsgleisig«, weil sie auch noch die Online-Ausgaben verfassten, Beiträge für Podcasts lieferten, twitterten und auch alles andere machten, was so anfiel. Lange konnte es nicht mehr dauern, bis die Reporter den wenigen Abonnenten, die ihre Zeitung noch gedruckt haben wollten, das Blatt auch noch in den Briefkasten steckten. Zwei Mitarbeiter hatten in einer Woche gekündigt, um ab sofort »nicht-journalistischen« Tätigkeiten nachzugehen. Der eine machte jetzt in PR, war also auf »die dunkle Seite« gewechselt. So hatte ich es zumindest früher gesehen. Der andere arbeitete als Tierarzthelfer. Der Standard konnte also nicht mit der gewohnten unzulänglichen Berichterstattung über die Ereignisse in Promise Falls aufwarten. (Kein Wunder, dass viele Leute ihn schon seit Jahren nur noch den Substandard nannten.)
Es wäre ein Abstieg für mich, das war mir klar. Mit echtem Journalismus hatte die Arbeit dort nichts zu tun. Es wurden nur mehr die Leerzeilen zwischen den wenigen überhaupt noch geschalteten Werbeanzeigen gefüllt. Meine Tätigkeit würde sich darauf beschränken, mir im Affentempo Storys aus dem Kreuz zu leiern und Pressemeldungen umzuformulieren.
Das Positive daran wären die Arbeitszeiten. Ich würde hauptsächlich tagsüber arbeiten und hätte mehr Zeit für Ethan. Und sollte es doch einmal Abendtermine geben, wären Ethans Großeltern, die ihn über alle Maßen liebten, für ihn da.
Der Chefredakteur des Standard bot mir die Stelle an. Ich kündigte beim Globe, gab meine Wohnung auf und kehrte nach Promise Falls zurück. Ich zog wieder bei meinen Eltern ein, aber das war bloß eine vorläufige Notlösung. In Boston hatte ich mir nur eine Mietwohnung leisten können, aber hier in meinem Heimatort würde ich etwas Ordentliches kaufen. Die Immobilienpreise befanden sich im freien Fall.
Doch Montag um Viertel nach eins war alles im Arsch. Montag war mein erster Tag beim Standard.
Ich hatte gerade Eltern interviewt, die eine Unterschriftensammlung für einen Fußgängerübergang an einer vielbefahrenen Straße gestartet hatten, noch bevor eines ihrer Kinder dort totgefahren wurde. Kaum war ich in die Redaktion zurückgekehrt, kam Madeline Plimpton, die Herausgeberin, herein.
»Ich habe eine Mitteilung für Sie«, sagte sie mit erstickter Stimme. »Wir werden morgen nicht erscheinen.«
Das klang merkwürdig. Der nächste Tag war kein Feiertag. Und Wochenende war auch nicht.
»Und übermorgen werden wir auch nicht erscheinen«, sagte Plimpton. »Ich bin zutiefst traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Standard eingestellt wird.«
Sie sagte noch mehr. Über Rentabilität beziehungsweise deren Abhandenkommen. Über den Rückgang von Anzeigen im Allgemeinen und Kleinanzeigen im Besonderen. Über schrumpfende Marktanteile und sinkende Leserzahlen. Über die erfolglose Suche nach einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell.
Und einen Haufen anderen Mist.
Ein paar von uns begannen zu weinen. Auch der Herausgeberin kullerte eine Träne über die Wange, und, das muss man zu Plimptons Ehrenrettung sagen, wahrscheinlich war die sogar echt.
Meine Augen blieben trocken. Ich war stocksauer. Ich hatte beim Boston Globe gekündigt. Ich hatte einen anständigen, gutbezahlten Job sausenlassen, um hierher zurückzukehren. Verdammte Scheiße. Mein Weg aus der Redaktion führte mich am Tisch des Chefredakteurs vorbei, der mich eingestellt hatte. »Gut, wenn einer weiß, wo’s langgeht«, sagte ich.
Draußen auf der Straße zog ich mein Handy heraus und rief meinen Ex-Chef in Boston an. War die Stelle schon neu besetzt? Konnte ich zurückkommen?
»Wir besetzen sie nicht neu, David«, sagte er. »Tut mir leid.«
Jetzt saß ich also hier. Unter einem Dach mit meinen Eltern.
Keine Frau.
Keine Arbeit.
Keine Perspektive.
Loser.
Es war sieben. Zeit, aufzustehen und schnell zu duschen, Ethan zu wecken und ihn für die Schule fertig zu machen.
Ich öffnete die Tür zu seinem Zimmer – früher das Nähstübchen meiner Mutter, das sie geräumt hatte, als wir einzogen – und sagte: »Hey, Kumpel. Es ist schon höchste Eisenbahn.«
Er lag unter der Decke und rührte sich nicht. Außer seinen verstrubbelten blonden Haaren war nichts von ihm zu sehen.
»Raus aus den Federn!«, sagte ich.
Jetzt regte er sich doch. Er drehte sich zu mir und zog sich die Decke vom Kopf, so dass er mich gerade eben sehen konnte. »Mir ist nicht gut«, flüsterte er. »Ich glaub, ich kann nicht in die Schule.«
Ich trat ans Bett, beugte mich vor und legte ihm eine Hand auf die Stirn. »Du fühlst dich gar nicht heiß an.«
»Ich glaub, es ist der Bauch«, sagte er.
»Wie beim letzten Mal?« Mein Sohn nickte. »Das war aber falscher Alarm«, erinnerte ich ihn.
»Heut fühlt sich’s aber irgendwie anders an.« Ethan stöhnte leise.
»Steh auf und zieh dich an. Warten wir ab, wie’s dir dann geht.« Das wurde langsam zur Gewohnheit. Die Wehwehchen, die ihn seit zwei Wochen an Schultagen plagten, waren am Wochenende immer verschwunden. Dann konnte er mühelos vier Hot Dogs in zehn Minuten verdrücken und hatte mehr Energie als alle anderen Hausbewohner zusammen. Ethan wollte nicht zur Schule gehen, aber bis jetzt hatte ich noch nicht aus ihm herausgebracht, warum nicht.
Meine Eltern hatten beide schon gefrühstückt, als ich in die Küche kam. Ich hatte sie aufstehen hören, als ich noch im Bett lag und an die dunkle Decke starrte. Später als halb sechs aufzustehen, galt bei ihnen als »sich ausschlafen«. Dad war schon bei der vierten Tasse Kaffee. Er kämpfte noch immer jeden Morgen mit dem iPad, das Mom ihm gekauft hatte, als der Standard plötzlich nicht mehr vor der Tür lag.
Er attackierte das Gerät so heftig mit dem Zeigefinger, dass es aus der Halterung kippte.
»Herrgott, Don«, sagte meine Mutter. »Du musst ihm nicht die Augen ausstechen. Ein leichtes Antippen genügt.«
»Ich hasse dieses Ding«, sagte mein Vater. »Ständig hüpft alles durcheinander.«
Als Mom mich erblickte, schlug sie den übertrieben fröhlichen Ton an, den sie immer wählte, wenn die Dinge nicht zum Besten standen. »Hallo!«, flötete sie. »Gut geschlafen?«
»Bestens«, log ich.
»Ich hab grad frischen Kaffee gemacht«, sagte sie. »Magst du eine Tasse?«
»Kann nicht schaden.«
»David, hab ich dir schon von der Kassiererin bei Walgreen’s erzählt? Wie heißt sie noch mal? Gleich fällt’s mir wieder ein. Auf jeden Fall sieht sie zum Anbeißen aus, und sie und ihr Mann haben sich getrennt und –«
»Mom, bitte.«
Sie hielt immer Ausschau nach einer Frau für mich. Sie wurde nicht müde, mich daran zu erinnern, dass es langsam Zeit wurde. Dass Ethan eine Mutter brauchte. Dass ich lange genug getrauert hatte.
Dabei trauerte ich gar nicht.
Ich hatte in den vergangenen fünf Jahren sechs Verabredungen gehabt. Mit sechs verschiedenen Frauen. Mit einer hatte ich auch geschlafen. Fertig. Nach Jans Tod, und insbesondere in Anbetracht der Umstände ihres Todes, verspürte ich nicht die geringste Lust, mich wieder zu binden, und meine Mutter hätte das eigentlich wissen müssen.
Doch sie ließ nicht locker. »Ich will damit nur sagen, du würdest bestimmt auf ein geneigtes Ohr stoßen, wenn du sie um ein Treffen bätest. Auch wenn mir grad nicht einfällt, wie sie heißt. Wenn wir nächstes Mal zusammen hinfahren, zeig ich sie dir.«
»Herrgott, Arlene, lass ihn doch in Ruh«, mischte sich mein Vater ein. »Und überleg doch mal: Er hat ein Kind, aber keinen Job. Nicht gerade eine glänzende Partie.«
»Gut zu wissen, dass du an mich glaubst, Dad«, sagte ich.
Er verzog das Gesicht und malträtierte wieder sein Tablet. »Ich versteh nicht, was so kompliziert daran ist, eine richtige Zeitung ins Haus geliefert zu bekommen. Es muss doch noch Leute geben, die eine Zeitung aus Papier lesen wollen.«
»Nur die Alten«, klärte Mom ihn auf.
»Die Alten haben ein Recht auf Neuigkeiten«, gab er zurück.
Ich öffnete den Kühlschrank und stöberte darin herum, bis ich den Joghurt fand, den Ethan so gern mochte, und ein Glas Erdbeermarmelade. Ich stellte beides auf die Arbeitsplatte und holte eine Schachtel Cheerios aus dem Schrank.
»Die verdienen nichts mehr«, sagte Mom. »Die Kleinanzeigen stehen jetzt alle auf Craigslist und Kijiji. Ist doch so, David, oder?«
»Mmm«, sagte ich und füllte eine Schale mit Cheerios für Ethan, der hoffentlich bald herunterkam. Erst dann würde ich ihm die Milch eingießen und einen Klacks Erdbeerjoghurt darüber geben. Ich steckte zwei Scheiben von dem Weißbrot in den Toaster, das meine Eltern seit Jahr und Tag kauften.
»Ich hab grad frischen Kaffee gemacht«, sagte meine Mutter. »Magst du eine Tasse?«
Dad hob den Kopf.
»Das hast du mich doch gerade gefragt«, sagte ich.
»Hat sie nicht«, sagte Dad.
Ich sah ihn an. »Doch, vor fünf Sekunden.«
»Gib halt gleich beim ersten Mal Antwort«, sagte er richtig giftig. »Dann muss sie nicht zweimal fragen.«
Bevor ich etwas sagen konnte, tat Mom das Ganze mit einem Lachen ab. »Ich würde auch meinen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre.«
»Das stimmt nicht«, sagte Dad. »Wer von uns beiden hat seine Brieftasche verloren? Ich. Was für ein Zirkus, bis das alles geklärt war.«
Mom schenkte mir Kaffee ein und reichte mir lächelnd den Becher. »Danke, Mom.« Ich beugte mich zu ihr und küsste sie leicht auf die faltige Wange. Dad ging wieder auf sein Tablet los.
»Ich wollte dich fragen, ob du am Vormittag schon was vorhast«, sagte Mom zu mir.
»Warum? Gibt’s was?«
»Ich meine, wenn du irgendwelche Termine hast, Bewerbungsgespräche oder so, will ich dir natürlich nicht dazwischenfunken, aber –«
»Mom, sag mir doch einfach, was du willst.«
»Ich will mich nicht aufdrängen«, sagte sie. »Nur wenn du Zeit hast.«
»Herrgott, Mom, jetzt spuck’s schon aus.«
»Wie redest du denn mit deiner Mutter«, sagte Dad.
»Ich würd schon selbst hinfahren, aber wenn du eh unterwegs bist, könntest du Marla vielleicht ein paar Sachen vorbeibringen.«
Marla Pickens. Meine Cousine. Zehn Jahre jünger als ich. Die Tochter von Moms Schwester Agnes.
»Klar, kann ich machen.«
»Ich hab Chili gemacht, und da ist noch so viel übrig geblieben. Einen Teil hab ich eingefroren, und ich weiß, dass sie mein Chili wirklich mag. Ich hab ihr ein paar Einzelportionen eingefroren. Und ich hab auch noch ein paar Fertiggerichte für sie gekauft. Die sind zwar nicht so gut wie hausgemacht, aber immerhin. Ich glaube, sie isst nichts Gescheites. Es geht mich eigentlich nichts an, aber ich glaube, Agnes schaut viel zu selten bei ihr rein. Außerdem glaube ich, dass es ihr guttun würde, mal ein jüngeres Gesicht zu sehen, nicht immer nur uns Alte. Sie hat dich immer gerngehabt.«
»Kein Problem.«
»Seit das mit dem Baby passiert ist, ist sie nicht mehr dieselbe.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Ich fahre hin.« Ich öffnete den Kühlschrank. »Hast du vielleicht eine Flasche Wasser, die ich Ethan mitgeben könnte?«
Dad gab ein erbostes »Ha!« von sich. Ich wusste, wohin das führen würde, und hätte mir die Frage eigentlich sparen können. »Der größte Schwindel auf der Welt. In Flaschen abgefülltes Wasser. Was aus dem Wasserhahn kommt, ist gut genug. Unser Wasser ist in Ordnung, und ich sollte es ja wohl wissen. Nur Idioten zahlen dafür. Wenn das so weitergeht, knöpfen sie uns bald auch noch Geld ab für die Luft, die wir atmen. Weißt du noch, als Fernsehen noch gratis war? Man hatte eine Antenne und hat geguckt. Gebührenfrei. Jetzt zahlt man fürs Kabel. So macht man Geld. Man lässt sich was einfallen und kassiert für Sachen, die früher gratis waren.«
Mom nahm keine Notiz von Dads Lamento. »Ich glaube, Marla ist zu viel allein. Sie muss raus, was unternehmen, damit sie auf andere Gedanken kommt. Nicht immer nur –«
»Ich hab doch gesagt, ich fahr hin, Mom.«
»Ich meine ja nur, wir könnten uns alle ein bisschen mehr um sie bemühen.« In ihrem Ton lag eine gewisse Schärfe.
»Das ist jetzt zehn Monate her, Arlene«, sagte Dad, ohne von seinem Bildschirm aufzublicken. »Das Leben geht doch weiter.«
Mom seufzte. »Du bist gut, Don. Als ob man über so was so einfach hinwegkäme. Für dich ist ein strammer Spaziergang das Allheilmittel.«
»Sie ist ein bisschen übergeschnappt, wenn du mich fragst.« Er blickte auf. »Gibt’s noch Kaffee?«
»Ich hab doch gerade gesagt, dass ich frischen gemacht hab. Wer ist hier derjenige, der nicht zuhört?« An mich gewandt, fügte sie hinzu: »Denk dran, dich vorzustellen, wenn du hinkommst. Das hilft ihr.«
»Ich weiß, Mom.«
»Dein Frühstück hast du aber anstandslos runtergekriegt«, sagte ich zu Ethan, als wir im Wagen saßen. Ich hatte angeboten, ihn zur Schule zu fahren, damit er nicht laufen musste. Er war spät dran – hatte wahrscheinlich absichtlich rumgetrödelt in der Hoffnung, ich würde ihm dann abnehmen, dass er krank war.
»Ja, schon«, sagte er.
»Ist irgendwas?«
Er schaute interessiert aus dem Fenster. »Nö.«
»Alles klar mit deinem Lehrer?«
»Japp.«
»Und mit deinen Freunden? Da auch alles klar?«
»Ich hab keine Freunde«, sagte er, noch immer, ohne mich anzusehen.
Darauf wusste ich nichts zu sagen. »Ich weiß, das geht nicht so schnell, wenn man neu ist. Aber ist denn niemand mehr da von denen, die du kanntest, bevor wir nach Boston gezogen sind?«
»Die meisten sind in anderen Klassen«, sagte Ethan. Dann, mit leisem Vorwurf in der Stimme: »Wenn wir nicht nach Boston gezogen wären, wär ich wahrscheinlich noch mit ihnen in einer Klasse.« Endlich sah er mich an. »Können wir nicht wieder zurück?«
Das hatte ich nicht erwartet. Er wollte dahin zurück, wo ich abends so gut wie nie zu Hause gewesen war? Wo er seine Großeltern kaum sah?
»Nein, das halte ich für unwahrscheinlich.«
Wir schwiegen. Sekunden vergingen. »Wann werden wir unser eigenes Haus haben?«
»Erst muss ich einen Job finden, mein Freund.«
»Die haben dich voll angeschissen.«
Ich warf ihm einen Blick zu, und er fing ihn auf. Wahrscheinlich wollte er sehen, ob er mich geschockt hatte.
»Keine solchen Ausdrücke«, sagte ich. »Wenn du mit mir so redest, redest du bald auch mit Nana so.« Seine Großmutter und sein Großvater waren Nana und Poppa für ihn.
»Poppa hat das gesagt. Er hat zu Nana gesagt, dass sie dich angeschissen haben. Weil sie die Zeitung eingestellt haben, als du gekommen bist.«
»Tja, das stimmt wohl. Aber ich war nicht der Einzige. Alle wurden rausgeschmissen. Die Reporter, die Drucker, alle. Aber ich seh mich nach was Neuem um. Irgendwas werd ich schon finden.«
Mit dem neunjährigen Sohn die eigene Beschäftigungssituation erörtern zu müssen. Das ist eine Definition von Blamage, die noch ins Wörterbuch hineingehört.
»Jeden Abend mit Mrs. Tanaka verbringen zu müssen, war auch nicht so toll«, sagte Ethan. »Aber in der Schule in Boston hat wenigstens keiner …«
»Hat wenigstens keiner was?«
»Nix.« Er schwieg wieder eine Weile, dann sagte er: »Kennst du diese Schachtel mit altem Zeugs, die Poppa im Keller hat?«
»Der ganze Keller ist voll mit altem Zeugs.« Beinahe hätte ich hinzugefügt: Besonders, wenn mein Dad da unten ist.
»Ich meine diese Schuhschachtel. Mit dem Zeug von seinem Dad. Meinem Urgroßvater. Mit den ganzen Medaillen und Bändern und alten Uhren und so.«
»Ah, die. Ich weiß, welche du meinst. Was ist mit der?«
»Glaubst du, dass Poppa da jeden Tag reinguckt?«
Ich fuhr an den Straßenrand und hielt an. Wir waren schon fast an der Schule angekommen. »Wie kommst du denn da drauf?«
»Nur so«, sagte er. »Nicht so wichtig.«
Ohne sich zu verabschieden, stieg Ethan widerwillig aus und trottete zur Schule wie ein zum Tode Verurteilter zur Hinrichtungsstätte.
Marla Pickens wohnte in einem kleinen eingeschossigen Haus in der Cherry Street, das, soweit ich wusste, ihren Eltern – Tante Agnes und ihrem Mann Gill – gehörte, die auch die Hypothek bezahlten. Das Geld für die Grundsteuer und die Nebenkosten brachte Marla mit Ach und Krach selbst auf. Womit sie im Augenblick ihr Geld verdiente, dafür hatte ich, der ich mein Leben lang in der Zeitungsbranche gearbeitet und mir dennoch einen gewissen Respekt für Wahrheit und Genauigkeit bewahrt hatte, wenig Verständnis. Sie hatte sich von einem Internetportal anheuern lassen, für andere Firmen im Web Bewertungen zu erfinden. Sah zum Beispiel eine Bausanierungsfirma die Notwendigkeit, ihr Image im Internet aufzupolieren oder einen beschädigten Ruf wiederherzustellen, konnte sie sich an Surf-Rep wenden, wo Hunderte von freiberuflichen Rezensenten nur darauf warteten, online zu gehen und Lobhudeleien zu verfassen.
Marla hat mir einmal eine Bewertung gezeigt, die sie für einen Dachdecker in Austin, Texas, geschrieben hatte. »Ein Baum ist auf unser Haus gefallen und hat ein Riesenloch ins Dach geschlagen. Die Leute von der Dachdeckerei Marchelli waren innerhalb einer Stunde da, haben das Dach repariert und neu gedeckt und das alles zu einem sehr vernünftigen Preis. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen.«
Marla war noch nie in Austin gewesen, kannte die Dachdeckerei Marchelli nicht mal vom Hörensagen und hat ihr Lebtag lang noch keiner Baufirma einen Auftrag erteilt.
»Nicht schlecht, oder?«, hatte sie gesagt. »Ist ein bisschen so, als wenn man eine ganz, ganz kurze Kurzgeschichte schreibt.«
Ich hatte damals nicht die Kraft, mit ihr eine Debatte darüber anzufangen.
Marla wohnte am anderen Ende der Stadt, und ich nahm die Umgehungsstraße, die mich am Wasserturm von Promise Falls vorüberführte. Er ist so hoch wie ein zehnstöckiges Haus und sieht mit seinen Stelzen aus wie das Mutterschiff einer UFO-Flotte.
Bei Marla angekommen, stellte ich meinen Mazda 3 in die Einfahrt neben ihren rostzerfressenen Mustang. Der Wagen stammte aus der Mitte der neunziger Jahre und war einmal rot gewesen. Aus dem Kofferraum holte ich die beiden Einkaufstaschen mit Tiefkühlgerichten, die meine Mutter mir mitgegeben hatte. Das Ganze war mir ein bisschen peinlich. Wie würde Marla reagieren? Vielleicht war sie beleidigt, dass ihre Tante sie anscheinend für unfähig hielt, sich selbst etwas zu essen zu machen. Na, wenn schon. Wenn es Mom glücklich machte …
Auf dem Weg zur Haustür fielen mir das Gras und das Unkraut auf, die aus den Rissen in den Pflastersteinen wucherten.
Ich stieg die drei Stufen zur Tür hinauf und nahm beide Taschen in die linke Hand, um mit der rechten anzuklopfen. Da bemerkte ich einen Schmierfleck am Türrahmen. Er befand sich in Schulterhöhe und sah aus wie ein Handabdruck.
Das ganze Haus hatte einen Neuanstrich oder wenigstens eine gründliche Dusche mit dem Hochdruckreiniger nötig, der Fleck war also durchaus nichts, über das man sich hätte wundern müssen. Aber irgendetwas daran stach mir ins Auge.
Er sah aus wie verschmiertes Blut. Als hätte hier jemand die größte Mücke der Welt erschlagen.
Vorsichtig berührte ich den Abdruck mit der Spitze meines Zeigefingers. Er fühlte sich trocken an.
Zehn Sekunden waren vergangen, aber Marla hatte mir noch nicht geöffnet. Ich klopfte noch einmal. Fünf Sekunden danach drehte ich den Knauf.
Die Tür war nicht versperrt.
Ich stieß sie auf und trat ein. »Marla?«, rief ich. »Ich bin’s. David!«
Keine Antwort.
»Marla? Tante Arlene wollte, dass ich dir ein paar Sachen vorbeibringe. Selbstgemachtes Chili und Zeugs. Wo bist du?«
Ich betrat den L-förmigen Raum, der den vorderen Teil des Hauses einnahm. Es war ein enges Wohnzimmer mit einem abgenutzten Sofa, zwei ausgeblichenen Polstersesseln, einem Flachbildfernseher und einem Couchtisch, auf dem ein aufgeklappter Laptop stand. Der Bildschirm war an. Wahrscheinlich hatte Marla sich gerade ein paar Nettigkeiten über einen Klempner in Poughkeepsie ausgedacht. Im hinteren Teil des Hauses war rechts die Küche und links ein kurzer Flur, von dem zwei Schlafzimmer und ein Bad abgingen.
Als ich die Tür hinter mir schloss, bemerkte ich einen zusammengeklappten Buggy in der Ecke.
»Was zum Teufel?«, murmelte ich.
Da hörte ich ein Geräusch. Oder hatte ich es mir nur eingebildet? Am Ende des Flurs. Eine Art … Maunzen? Ein Glucksen?
Ein Baby. Es klang wie ein Baby. Nichts, was einen besonders schockieren sollte, nachdem man schon einen Buggy hinter der Tür hat stehen sehen. Sollte man annehmen.
Aber in diesem Haus, zu dieser Zeit, war das wohl eine falsche Annahme.
»Marla?«
Ich stellte die Taschen auf den Boden, durchquerte das Wohnzimmer und bog in den Flur ein.
Vor der ersten Tür blieb ich stehen und sah in den Raum. Es sollte wahrscheinlich ein Schlafzimmer sein, aber Marla hatte es in eine Müllhalde verwandelt. Ausrangierte Möbel, leere Kartons, Teppichrollen, alte Zeitschriften, Teile einer vorsintflutlichen Stereoanlage.
Meine Cousine war anscheinend auf dem besten Weg, ein Messie zu werden.
Ich ging zur nächsten Tür. Sie war geschlossen. Ich drehte den Knauf und stieß sie auf. »Marla? Bist du da drin? Alles in Ordnung?«
Das Geräusch, das ich vorhin gehört hatte, war nun wieder zu hören, aber lauter.
Es war tatsächlich ein Baby. Neun Monate, vielleicht ein Jahr alt. Mädchen oder Junge? Keine Ahnung. Allerdings war es in eine blaue Decke gewickelt.
Was ich wahrgenommen hatte, waren Sauggeräusche gewesen. Das Baby nuckelte zufrieden an einem Gummisauger und versuchte, mit seinen winzigen Fingerchen die Plastikflasche festzuhalten.
Marla saß auf einem Polsterstuhl in einer Ecke des Schlafzimmers, hielt den Säugling im Arm und das Fläschchen in der Hand. Auf dem Bett lagen Windelpackungen, Babyklamotten, eine Dose mit Feuchttüchern.
»Marla?«
Sie sah mich prüfend an. »Ich hab dich rufen hören, aber ich konnte nicht an die Tür kommen«, flüsterte sie. »Und schreien wollte ich nicht. Ich glaube, Matthew schläft gleich ein.«
Vorsichtig trat ich ins Zimmer. »Matthew?«
Marla lächelte und nickte. »Ist er nicht wunderhübsch?«
»Ja«, sagte ich gedehnt. Und dann: »Wer ist Matthew, Marla?«
Marla legte den Kopf schief. »Was meinst du damit?«, fragte sie verwundert. »Matthew ist Matthew.«
»Was ich meine, ist: Wem gehört Matthew? Bist du sein Babysitter?«
Marla blinzelte. »Matthew gehört mir, David. Matthew ist mein Baby.«
Ich machte mir Platz auf dem Bett und setzte mich auf die Kante, dicht neben meine Cousine. »Und wann hast du Matthew bekommen, Marla?«
»Vor zehn Monaten«, sagte sie, ohne zu zögern. »Am zwölften Juli.«
»Aber … ich war in den letzten zehn Monaten schon öfter hier und sehe ihn heute zum ersten Mal. Drum wundere ich mich halt ein bisschen.«
»Das lässt sich nicht … so einfach erklären«, sagte Marla. »Ein Engel hat ihn mir gebracht.«
»Das muss ich schon genauer wissen«, sagte ich leise.
»Ich kann dir aber nicht mehr sagen. Es ist wie ein Wunder.«
»Marla, dein Baby –«
»Darüber will ich nicht reden«, flüsterte sie. Sie wandte den Kopf ab und betrachtete das Gesicht des Babys.
Ich tastete mich behutsam vor, wie auf einer wackligen Brücke, die jeden Moment unter mir einstürzen konnte. »Marla, was dir … und deinem Baby … zugestoßen ist … das war eine Tragödie. Es hat uns allen schrecklich leidgetan.«
Zehn Monate war es her. Ein trauriges Ereignis für uns alle, aber für Marla war es verheerend gewesen.
Sie berührte Matthews Stupsnäschen leicht mit einem Finger. »Du bist so unglaublich süß«, sagte sie.
»Marla, du musst mir sagen, wem dieses Baby in Wirklichkeit gehört.« Ich zögerte und fügte dann hinzu: »Und wie Blut an deine Haustür kommt.«
3
Detective Barry Duckworth sah sich der größten Herausforderung seiner an diesem Tag genau zwanzig Jahre währenden Laufbahn bei der Polizei von Promise Falls gegenüber.
Wäre er in der Lage, auf dem Weg zum Revier an dem Donut-Laden vorbeizufahren, ohne sich am Drive-in-Schalter einen Kaffee und einen Donut mit Schokoglasur zu gönnen?
Wenn es überhaupt einen Tag gab, an dem er Anspruch auf ein Leckerli hatte, dann heute. Zwanzig Jahre bei der Polizei, fast vierzehn davon als Ermittler. Wenn das kein Grund zum Feiern war!
Leider war das erst die zweite Woche seines jüngsten Abspeckversuchs. Im vergangenen Monat hatte er fast hundertdreißig Kilo auf die Waage gebracht und daraufhin beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Maureen, die Gute, hatte offensichtlich eingesehen, dass nur er selbst diese Entscheidung treffen konnte, und aufgehört, an ihm herumzukritteln. Und so hatte er vor zwei Wochen beschlossen, dass er als Allererstes den Donut streichen musste, den er sich jeden Morgen reinzog. Nach dem, was auf der Homepage der Donut-Kette stand, hatte sein Lieblingsgebäck dreihundert Kalorien. Menschenskind. Wenn er diesen Donut also an fünf Tagen eliminierte, dann waren das insgesamt fünfzehnhundert Kalorien weniger. Auf ein Jahr gerechnet über zweiundsiebzigtausend Kalorien.
Das wäre ungefähr so viel, wie drei Wochen komplett aufs Essen zu verzichten.
Das war aber noch nicht alles. Er ließ auch den Nachtisch weg. Na gut, das stimmte nicht ganz. Er ließ den zweiten Nachtisch weg. Wenn Maureen einen Kuchen backte – insbesondere einen Zitronenbaiserkuchen –, konnte er sich mit einem Stück nicht begnügen. Er aß ganz normal ein Stück nach dem Essen, versäuberte aber dann die Schnittkante des letzten Stücks. Normalerweise war das nur eine hauchdünne Scheibe, und wie viele Kalorien konnte so ein Scheibchen schon haben? Also gönnte er sich noch ein zweites.
Scheibchenweise widerstand er der Versuchung.
Er war nur mehr einen Häuserblock vom Donut-Laden entfernt.
Ich fahr da nicht rein.
Aber einen Kaffee wollte Duckworth trotzdem. Er konnte doch einfach durchfahren und nur den bestellen, oder? Daran war doch nichts Schlimmes. Er konnte ihn schwarz trinken, ohne Milch und Zucker. Die Frage war nur, wenn er schon wegen dem Kaffee hinfuhr, was würde ihn davon abhalten –
Sein Handy klingelte.
Der Wagen war mit Bluetooth ausgestattet, Duckworth musste also nicht in seine Sakkotasche greifen, um das Handy herauszuziehen. Er musste nur einen Knopf auf dem Armaturenbrett drücken. Außerdem wurde auf dem Bildschirm auch der Name des Anrufers angezeigt.
Randall Finley.
»Scheiße«, murmelte Duckworth.
Der ehemalige Bürgermeister von Promise Falls. Genauer gesagt der ehemalige, in Ungnade gefallene Bürgermeister von Promise Falls. Vor ein paar Jahren, als er für den Senat kandidierte, kam heraus, dass er bei mindestens einer Gelegenheit die Dienste einer minderjährigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte.
Ein Engagement, das bei der Wählerschaft nicht so gut ankam.
Es verhinderte nicht nur sein Vorrücken in der politischen Nahrungskette, sondern kostete ihn auch die Wiederwahl als Bürgermeister. Was wiederum bei ihm nicht so gut ankam. Gedopt mit einer mehr als großzügigen Dosis Whisky, hielt er eine Rede, in der er seine Niederlage anerkannte und gleichzeitig diejenigen, die ihn nicht wiedergewählt hatten, als »intrigante Schwanzlutscher« bezeichnete. Der lokale Fernsehsender konnte diese Einlassung zwar nicht senden, aber YouTube sorgte dafür, dass die unzensierte Version sich wie ein Virus verbreitete.
Eine Zeitlang verschwand Finley aus der Öffentlichkeit und leckte seine Wunden. Dann entdeckte er auf einem Stück Land, das er im Norden von Promise Falls besaß, eine Quelle und errichtete dort eine Wasserabfüllanlage. Der Betrieb – den er mit typisch Finleyscher Bescheidenheit Finley-Quelle nannte – war zwar nicht ganz so groß wie Evian, aber einer der wenigen in der Gegend, der dank der starken Nachfrage Arbeitskräfte einstellte. Die Wirtschaft der Stadt befand sich seit einiger Zeit im freien Fall. Der Standard war eingestellt worden und hatte fünfzig Mitarbeiter arbeitslos gemacht. Der Freizeitpark Five Mountains war pleitegegangen, das Riesenrad und die Achterbahn standen da wie die Relikte einer untergegangenen fremden Zivilisation.
Die Zahl der Studierenden am Thackeray College war dramatisch gesunken, was die Entlassung jüngerer Angehöriger des Kollegiums ohne Festanstellung nach sich zog. Schulabgänger verließen Promise Falls in Scharen, um anderswo Arbeit zu suchen, und die, die dablieben, hingen an den meisten Abenden der Woche in den Kneipen der Stadt herum und vertrieben sich die Zeit mit Schlägereien, dem Besprühen von Briefkästen und dem Umwerfen von Grabsteinen.
Die Besitzer des Autokinos an der Umgehungsstraße, eines Wahrzeichens der Gegend, das sich fünfzig Jahre lang tapfer gegen Videorekorder, DVD-Spieler und Netflix behauptet hatte, schwenkten jetzt die weiße Flagge. Noch ein paar Wochenenden, dann wäre es mit diesem kleinen Kapitel Ortsgeschichte aus und vorbei. Man munkelte, dass der Bauunternehmer Frank Mancini die Leinwand abreißen und eine Wohnsiedlung auf dem Grundstück errichten wollte. Es war Duckworth allerdings schleierhaft, warum jemand in einer Stadt, aus der alle wegwollten, mehr Wohnraum schaffen wollte.
Promise Falls war noch immer die Stadt, in der er aufgewachsen war, aber sie glich einem einst neuen Anzug, der jetzt abgewetzt war und speckig glänzte.
Der Witz bei dem Ganzen war, dass alles sich verschlimmert hatte, seit Finley nicht mehr Bürgermeister war. Trotz aller Peinlichkeiten, die er ihr beschert hatte, war er auch ein großer Förderer der Stadt mit ihren vierzigtausend – nach dem Stand der letzten Volkszählung wohl eher sechsunddreißigtausend – Einwohnern gewesen. Und Finley hätte die gefährdeten Arbeitsplätze mit Klauen und Zähnen verteidigt, als wären sie seine letzte Flasche Whisky.
Deshalb entschied Duckworth sich zähneknirschend doch dafür, den Anruf entgegenzunehmen.
»Hallo«, sagte er.
»Barry!«
»Hey, Randy.«
Wenn er diesen Kaffee wollte, musste er jetzt blinken und abbiegen, und er wusste, wenn er das tat, würde er sich nicht zurückhalten können und gleich noch eines von diesen himmlischen weichen Teigteilchen bestellen. Aber Finley würde es am Telefon mitkriegen, und Barry wollte keinen Zeugen für seinen diätetischen Sündenfall. Dass der Ex-Bürgermeister von seiner FdH-Kur gar nichts wusste, spielte dabei keine Rolle.
Also fuhr er weiter.
»Wo sind Sie?«, fragte Finley. »Sitzen Sie im Auto?«
»Ich bin unterwegs zum Revier.«
»Machen Sie einen Abstecher zum Clampett Park. Südlicher Teil. Gleich neben dem Weg.«
»Was soll ich denn da?«
»Da gibt’s was, das sollten Sie sich ansehen.«
»Randy, wenn Sie noch Bürgermeister wären, würde ich vielleicht springen, und es wäre mir auch egal, dass Sie meine private Handynummer haben, aber Sie sind nicht der Bürgermeister. Und zwar schon ’ne ganze Weile nicht mehr. Also: Wenn Sie was zu melden haben, dann rufen Sie die Polizei, so wie alle anderen das auch tun.«
»Die werden Sie wahrscheinlich sowieso wieder hier rausschicken«, sagte Finley. »So ersparen Sie sich einen Weg.«
Barry Duckworth seufzte. »Na gut.«
»Wir treffen uns am Parkeingang. Ich bin mit meinem Hund unterwegs. Deswegen hab ich es ja überhaupt erst gesehen. Ich war mit ihr Gassi.«
»Es?«
»Kommen Sie her.«
Die Fahrt brachte Duckworth ans andere Ende der Stadt, wo, wie er wusste, Finley und seine leidgeprüfte Frau Jane noch immer wohnten. Randall Finley wartete mit seinem Hund auf ihn. Der kleine graue Schnauzer zog an der Leine und wollte in den Park zurück, der an ein Waldgebiet grenzte. Nördlich davon lag das Gelände des Thackeray College.
»Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen«, sagte Finley, als Barry aus dem nicht gekennzeichneten Polizeiwagen stieg.
»Ich arbeite auch nicht für Sie«, antwortete Barry.
»Und ob Sie für mich arbeiten. Ich zahle schließlich Steuern.« Finley trug bequem geschnittene Jeans, Laufschuhe und eine leichte Jacke, die bis oben hin geschlossen war. Es war ein kühler Maimorgen. Der vierte Mai, um genau zu sein, und am Boden lag noch immer abgefallenes Herbstlaub, das bis vor sechs Wochen noch unter einer Schneedecke verborgen gewesen war.
»Was haben Sie gefunden?«
»Hier entlang. Ich könnte Bipsie von der Leine lassen, und wir gehen ihr einfach nach.«
»Nein«, sagte Duckworth. »Egal, was Sie gefunden haben, ich will nicht, dass Bipsie damit rumspielt.«
»Ah ja, natürlich«, sagte Finley. »Und? Wie geht’s?«
»Gut.«
Finley wartete kurz, ob Duckworth sich nach seinem Befinden erkundigen würde, was dieser nicht tat. »Ist ein gutes Jahr für mich«, sagte er daraufhin. »Wir expandieren. Stellen zwei neue Leute ein.« Er lächelte. »Von dem einen haben Sie vielleicht schon gehört.«
»Hab ich nicht. Wovon reden Sie?«
»Nicht so wichtig«, sagte Finley.
Sie folgten einem Weg, der am Waldrand entlangführte. Ein etwa brusthoher schwarzer Maschendrahtzaun trennte den Wald vom Park.
»Haben Sie abgenommen?«, fragte Finley. »Sie sehen gut aus. Verraten Sie mir Ihr Geheimnis, mir würden ein paar Kilo weniger nämlich auch nicht schaden.« Er klopfte sich mit der freien Hand auf den Bauch.
Duckworth war in den vergangenen vierzehn Tagen gerade mal ein Kilo losgeworden und wusste nur zu genau, dass man ihm das nicht ansah.
»Was haben Sie gefunden, Randy?«
»Das müssen Sie sich selbst ansehen. Es muss in der Nacht passiert sein, weil ich zweimal am Tag mit Bipsie hier langgehe. In der Früh und bevor ich zu Bett gehe. Gestern Abend hat es schon gedämmert, als wir vorbeikamen, wär also möglich, dass es schon da war, und ich hab’s nicht gesehen, aber ich glaub’s eigentlich nicht. Vielleicht hätt ich’s auch jetzt in der Früh übersehen, aber der Hund hat’s gerochen und ist direkt hingelaufen.«
Duckworth verzichtete darauf, Finley noch einmal zu fragen, was er ihm zeigen wolle, aber er bereitete sich auf das Schlimmste vor. In den zwanzig Jahren als Polizist hatte er schon eine Reihe von Leichen zu Gesicht bekommen. Bis zur Pension waren es fast noch mal so viele Jahre, er würde also noch einige Tote mehr sehen. Aber so richtig gewöhnen konnte man sich an den Anblick nie. Zumindest nicht in Promise Falls. Duckworth hatte schon in mehreren Mordfällen ermittelt. Meistens handelte es sich um unkomplizierte Sachen wie häusliche Gewalt oder Kneipenschlägereien. Aber der eine oder andere Fall hatte auch landesweit Aufmerksamkeit erregt.
Ein Vergnügen waren sie alle miteinander nicht gewesen.
»Da sind wir schon«, sagte Finley. Bipsie fing an zu bellen. »Aus! Sitz, dummer Köter!«
Bipsie machte Sitz.
»Da vorn, auf dem Zaun«, sagte Finley und zeigte hin.
Duckworth blieb stehen und betrachtete die Szene, die sich ihm bot.
»Na? Ganz schön abartig, was? Ein richtiges Massaker. Haben Sie so was schon mal gesehen?«
Duckworth sagte nichts. Doch die Antwort war nein.
Randall Finley hörte gar nicht mehr auf zu reden. »Wenn’s nur eins gewesen wär oder zwei, hätt ich bestimmt nicht angerufen. Aber sehen Sie sich das an. Wissen Sie, wie viele das sind? Ich hab sie gezählt. Dreiundzwanzig, Barry. Wie krank muss man sein, um so was zu tun?«
Barry zählte nach. Randy hatte recht. Zwei Dutzend minus eins.
Dreiundzwanzig tote Eichhörnchen. Elf graue, zwölf schwarze. Jedes hatte ein Stück weiße Schnur, wie man sie zum Verschnüren von Paketen verwendete, um den Hals gezurrt. Sie hingen alle zusammen von der Querstange, die den Zaun oben abschloss.
Die Tiere waren auf einer Länge von etwa drei Metern aufgereiht, jedes von ihnen hing an einem etwa dreißig Zentimeter langen Stück Schnur.
»Ich mag sie ja nicht«, sagte Finley. »Für mich sind das Baumratten, obwohl sie wahrscheinlich keinen großen Schaden anrichten. Aber es muss doch ein Gesetz dagegen geben. Auch wenn’s nur Eichhörnchen sind.«
4
David
»Marla, ich mein’s ernst. Du musst mit mir reden«, sagte ich.
»Ich muss ihn hinlegen. Er braucht sein Schläfchen«, sagte sie. Sie hielt ihn noch immer im Arm. Mit dem Sauger des Fläschchens berührte sie leicht seine Lippen. »Ich glaube, jetzt hat er erst mal genug.« Sie stellte das Fläschchen auf den Nachttisch. Das Baby hatte die Augen geschlossen und gluckste zufrieden vor sich hin.
»Am Anfang war er ganz anders«, sagte Marla. »Gestern hat er viel geweint. Richtig gefremdelt hat er.«
Ich wollte sie fragen, warum ein Baby, das, wie sie behauptete, schon monatelang bei ihr war, plötzlich fremdeln sollte, verkniff es mir aber.
»Ich hab ihn die ganze Nacht herumgetragen, und jetzt sind wir ganz eng verbunden«, fuhr sie fort. Dann lachte sie leise. »Ich muss ja zum Fürchten aussehen. Ich hab heute Morgen gar nicht geduscht. Und geschminkt bin ich auch nicht. Als er gestern Abend endlich aufgehört hat zu weinen, bin ich schnell losgelaufen und hab ein paar Sachen eingekauft. Ich weiß, ich hätte ihn nicht allein lassen dürfen, aber es gab niemanden, den ich hätte anrufen können, jetzt noch nicht, und ich hatte ja nichts zu Hause. Der Engel hat nur ein paar Sachen mitgebracht.«
»Wer weiß noch von Matthew?«, fragte ich. »Weiß Tante Agnes – weiß deine Mutter Bescheid?«
»Ich hab ihr noch nichts gesagt. Es ging alles ziemlich schnell.«
Die Ungereimtheiten häuften sich. »Wie schnell?«
Marla ließ das Baby nicht aus den Augen. »Also gut, Matthew ist noch keine zehn Monate bei mir. Gestern hat’s auf einmal geklingelt. Am späten Nachmittag. Ich hab gerade eine Bewertung für einen Klimaanlagenbauer in Illinois geschrieben.«
»Wer hat geklingelt?«
Sie lächelte matt. »Hab ich dir doch gesagt. Der Engel.«
»Was war das für ein Engel?«
»Na ja, sie war kein richtiger Engel. Aber für mich war sie einer.«
»Es war also eine Frau.«
»Genau.«
»Die Mutter?«
Marla sah mich streng an. »Ich bin jetzt die Mutter.«
»Na gut«, sagte ich. »Aber bis zu dem Moment, als sie dir Matthew gegeben hat, war sie die Mutter?«
Marla zögerte. »Vielleicht«, räumte sie dann widerwillig ein.
»Wie sah sie aus? Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht? War sie verletzt? Hat sie geblutet? Hast du gesehen, ob sie Blut an der Hand hatte?«
Marla schüttelte langsam den Kopf. »David, du weißt doch, ich kann mir Gesichter nicht merken. Aber sie war sehr nett, diese Frau. Sie war ganz weiß angezogen. Darum seh ich ja auch einen Engel, wenn ich sie mir vorzustellen versuche.«
»Hat sie gesagt, wer sie ist? Hat sie gesagt, wie sie heißt? Hat sie gesagt, wie du sie erreichen kannst?«
»Nein.«
»Und du hast auch nicht gefragt? Ist dir das nicht merkwürdig vorgekommen? Eine Frau, die einfach so zu dir kommt und dir ein Baby bringt?«
»Sie hatte es eilig«, sagte Marla. »Sie hat gesagt, sie muss weg.« Sie verstummte. Sie legte Matthew mitten aufs Bett und legte Kissen um ihn herum wie eine Art Schutzwall.
»Solange ich kein Gitterbett habe, muss ich das machen. Damit er nicht runterrollt und auf den Boden fällt. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Ein Gitterbett zu kaufen? Gibt es in Albany ein IKEA? Oder vielleicht krieg ich bei Walmart eins. Der ist nicht so weit weg. Ich glaube nicht, dass ich ein Gitterbett in den Mustang kriege, auch wenn es nicht zusammengebaut ist, und ich glaube auch nicht, dass ich es ordentlich zusammenbauen könnte. Ich bin bei so was so ungeschickt. Ich hab noch nicht mal einen Schraubenzieher. Na ja, vielleicht in einer der Schubladen in der Küche, aber wissen tu ich’s nicht. Sind bei IKEA solche Dinger nicht schon dabei? Damit man die Sachen zusammenbauen kann, auch wenn man kein Werkzeug hat? Ich will kein gebrauchtes Gitterbett im Secondhand- oder Antiquitätenladen kaufen, weil sich inzwischen so viel in puncto Sicherheit getan hat. Ich hab da mal eins im Fernsehen gesehen, bei dem konnte man das Seitenteil hoch- und runterschieben, und das ist dem Baby versehentlich auf den Hals gefallen.« Sie zitterte. »Das will ich nicht riskieren.«
»Natürlich nicht.«
»Also könntest du mir da helfen? Ein Gitterbett zu kaufen?«
»Ich denke schon. Aber erst müssen wir noch ein paar Dinge klären.«
Marla hörte mir gar nicht richtig zu. Nahm sie vielleicht irgendwelche Medikamente? War das vielleicht die Erklärung für ihr wirklichkeitsfremdes Verhalten? Sollte sie nach dem Verlust ihres Babys in psychiatrischer Behandlung sein und irgendwas gegen Depressionen oder Angstzustände verschrieben bekommen haben, wusste ich jedenfalls nichts davon. Ging mich auch nichts an. Und ich würde auch nicht in ihrem Medizinschrank rumschnüffeln, weil ich, sollte ich etwas finden, ohnehin keine Ahnung hätte, wozu es gut war.
Vielleicht nahm sie auch gar nichts und war einfach so, seit sie ein totes Kind geboren hatte. Dad hatte auf seine taktlose Art eigentlich schon gesagt, was dazu zu sagen war, als er meinte, sie sei »ein bisschen übergeschnappt«. Ich hatte nur hier und da ein paar Einzelheiten der ganzen Geschichte aufgeschnappt. Dass Tante Agnes, Marlas Mutter, die in jungen Jahren als Hebamme gearbeitet hatte, bevor sie Krankenschwester wurde, ihr die ganze Zeit zur Seite gestanden hatte, ebenso wie der Hausarzt, ein gewisser Dr. Sturgess, wenn ich mich recht erinnerte. Dass Marla das Kind kurz in den Arm nehmen durfte, bevor es weggebracht wurde.
Dass es ein Mädchen gewesen war.
»Eine traurige Geschichte, wirklich traurig«, pflegte meine Mutter zu sagen, wenn sie an ihre Nichte dachte. »Irgendwas ist da mit ihr passiert. Wenn ihr mich fragt, ist da irgendwas bei ihr kaputtgegangen. Und was ist mit dem Vater? Wo war der denn? Hat der ihr irgendwie geholfen? Nein. Kein bisschen.«
Der Vater war ein Student vom Thackeray College. Sieben, acht Jahre jünger als Marla. Viel mehr wusste ich nicht über ihn. Spielte jetzt auch überhaupt keine Rolle.
Wusste man bei der Polizei etwas von einem vermissten Baby? Wenn die Zeitung noch existierte, wenn ich meinen Presseausweis noch bei mir trüge, würde ich einfach dort anrufen und nachfragen. Aber als normaler Bürger war das nicht so einfach. Wollte ich die Behörden auf den Plan rufen, bevor ich wusste, was eigentlich wirklich los war? Es war ja nicht völlig ausgeschlossen, dass Marla nur vorübergehend auf das Kind aufpasste, aber irgendeiner Wunschvorstellung erlegen war.
Ich meine, ein Engel, der an der Tür klingelt?
»Marla, hast du mich gehört? Es gibt da einiges zu klären.«
»Was denn?«, fragte sie.
Ich beschloss, so zu tun, als ob das hier eine ganz alltägliche Situation wäre. »Na, du willst doch bestimmt, dass alles legal ist und seine Ordnung hat. Wenn Matthew dir gehören soll, dann gibt es Dokumente, die du unterschreiben musst. Rechtliche Angelegenheiten, die geklärt werden müssen.«
»Ich glaube nicht, dass das nötig ist«, sagte Marla. »Wenn er größer wird und in die Schule kommt, oder noch später, wenn er den Führerschein macht oder so, dann sage ich einfach, dass ich seine Geburtsurkunde verloren habe, dass ich sie nicht mehr finde. Damit müssen sie sich dann halt abfinden.«
»So läuft das nicht, Marla. Auch die Stadt hat Unterlagen.«
Dieser Einwand beeindruckte sie nicht im Geringsten. »Sie werden akzeptieren müssen, dass er mir gehört. Du machst da ein viel zu großes Ding draus. Heutzutage wird jede Kleinigkeit dokumentiert.«
Ich ließ nicht locker. »Trotzdem müssen wir rauskriegen, wer dieses Kind geboren hat. Schon allein wegen der medizinischen Vorgeschichte. Wir müssen wissen, wer seine richtigen Eltern sind, ob es irgendwelche Krankheiten in der Familie gibt.«
»Warum willst du nicht, dass ich glücklich bin, David? Habe ich nicht ein bisschen Glück verdient, nach allem, was ich durchgemacht habe?«
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Doch ich musste mir auch nichts ausdenken, denn Marla sagte: »Ich mach mich ein bisschen frisch. Jetzt, wo du da bist, kann ich ja duschen und frische Sachen anziehen. Ich hab mir gedacht, ich geh dann mit Matthew einkaufen.«
»Der Buggy. Hinter der Tür«, sagte ich. »Hast du den gestern gekauft?«
»Nein, den hat der Engel mitgebracht«, sagte sie. »Hat dir deine Mom was zum Essen für mich mitgegeben?«
»Ja. Ich räum dir alles in den Gefrierschrank.«
»Danke«, sagte sie. »Ich beeil mich.« Sie ging ins Bad und schloss die Tür.
Ich sah mich kurz nach dem Kind um. Matthew schlief friedlich, und es bestand keine Gefahr, dass er aus seinem Kissengefängnis rollte. Ich verstaute das Essen, das meine Mutter schon eingefroren hatte, in Marlas Gefrierschrank – ich war schließlich ein Praktiker – und ging dann ins Wohnzimmer, um mir den Kinderwagen genauer anzusehen. Er war zusammengeklappt und ließ sich problemlos in einem Kofferraum oder einem Wandschrank unterbringen.
Auf dem rechten Griff gab es noch mehr Schmierflecke wie die, die ich am Türrahmen gesehen hatte.
Ich klappte den Buggy auf und drückte mit dem Fuß auf einen kleinen Hebel, damit er nicht wieder zusammenklappte. Der Kinderwagen war schon lange in Gebrauch. Die einst schwarzen Reifen waren abgefahren. In den Ritzen des Sitzpolsters steckten alte Cheerios. An der Rückenlehne war ein kleiner Beutel mit einem Reißverschluss befestigt. Ich öffnete ihn und fasste hinein. Drei Rasseln, ein kleines Holzauto mit dicken Holzreifen, ein Prospekt von einem Babyausstatter, eine halbvolle Packung Feuchttücher und ein paar Taschentücher kamen zum Vorschein.
Etwas an dem Prospekt erregte meine Aufmerksamkeit. Auf einer Seite waren ein paar Worte gedruckt, eigentlich viel zu klein, um aufzufallen.
Es war eine Adresse. Das war nicht die übliche Postwurfsendung, sondern ein persönlich adressierter Prospekt eines Ladens für Babykleidung in Promise Falls.
Der Name der Empfängerin war Rosemary Gaynor. Sie wohnte am Breckonwood Drive 375. Ich kannte die Straße. Sie lag keine fünf Kilometer von hier in einer vornehmen Wohngegend, deutlich hübscher als die, in der Marla lebte.
Ich zog mein Handy heraus und tippte die Telefonbuch-App an. Doch als die Nummer der Gaynors unter meinem Daumen erschien, kamen mir Zweifel. War dort anzurufen wirklich das Klügste, was ich tun konnte?
Vielleicht war es ja sinnvoller, direkt hinzufahren.
Und zwar sofort.
Vom Bad hörte ich Wasser laufen. Die Dusche. Ich hatte das Handy noch in der Hand. Ich rief zu Hause an.
Gleich beim ersten Klingeln hob jemand ab. »Ja, bitte?«
»Dad, ich muss mit Mom reden.«
»Was ist los?«
»Gib sie mir einfach.«
Ein Knirschen, dann ein gedämpftes »Er will dich sprechen«. Und dann: »Was gibt’s, David?«
»Hier bei Marla ist was passiert.«
»Hast du ihr das Chili gegeben?«
»Nein. Ich meine, ich hab’s gebracht, aber – Mom, hier ist ein Baby.«
»Was?«
»Sie hat ein Baby. Sie sagt, es ist ihres. Sie sagt, eine Frau hat geklingelt und es ihr gegeben. Einfach so. Aber die Geschichte stimmt hinten und vorne nicht. Mom, ich frage mich, ich will das gar nicht aussprechen, aber ich frage mich – oh Gott, das klingt total daneben –, aber ich frage mich, ob sie dieses Kind vielleicht entführt hat.«
»O nein«, sagte Mom. »Nicht schon wieder.«
5
Barry Duckworth forderte Polizisten an, die sich in der Nachbarschaft des Parks umhören sollten, ob jemand vergangene Nacht etwas Verdächtiges gehört oder gesehen hatte. Vielleicht jemanden, der einen schweren Sack trug und lang genug am Zaun herumlungerte, um fast zwei Dutzend Eichhörnchen aufzufädeln.
Der erste Uniformierte am Tatort war ein Hüne namens Angus Carlson. Für ihn war das Ganze offensichtlich eine Herausforderung, sein Talent als Komiker unter Beweis zu stellen.
»Könnte eine harte Nuss werden«, sagte Carlson zu Duckworth. »Aber ich werde die Ohren steif und den Puschelschwanz gereckt halten. Vielleicht finden wir bald einen Zeugen. Könnte aber auch länger dauern. Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.«
Carlson war Duckworth in den letzten Monaten an verschiedenen Tatorten über den Weg gelaufen. Anscheinend sah er sich als eine Art Lennie Briscoe, den Ermittler aus Law & Order, der im Vorspann zu jeder Folge irgendeine geistreiche Bemerkung von sich zu geben wusste. Aus den wenigen Worten, die sie bisher miteinander gewechselt hatten, wusste Duckworth, dass Carlson vor vier Jahren nach Promise Falls gekommen war und davor in einem Vorort von Cleveland Streife gefahren war.
»Verschonen Sie mich«, sagte Duckworth.
Er rief bei der städtischen Tierschutzbehörde an, bekam dort eine Frau namens Stacey an den Apparat und setzte sie ins Bild. »Irgendwas sagt mir, dass das mehr in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt, aber ich habe schon mal ein paar Leute vor Ort, die sich umhören. Wär vielleicht nicht schlecht zu wissen, mit wem wir’s hier zu tun haben, bevor er auch noch anfängt, Hunde und Katzen an Laternenpfähle zu hängen.«
Duckworth machte sich auf den Weg zurück zu seinem Wagen. Ex-Bürgermeister Randall Finley war dageblieben und hatte zugesehen, wie noch mehr Polizisten eintrafen, Fotos machten, das Gelände durchkämmten. Doch als er sah, dass Duckworth aufbrach, folgte er ihm. Bipsie zerrte er an der Leine hinter sich her.
»Wollen Sie wissen, was ich glaube?«, fragte Finley.
»Und ob, Randy.«
»Ich wette, das ist irgend so ein Kult von Perversen. Wahrscheinlich so eine Art Initiationsritual.«
»Schwer zu sagen.«
»Sie halten mich jedenfalls auf dem Laufenden.«
Duckworth öffnete die Tür seines Wagens und warf Finley einen Blick zu. Glaubte der Ex-Politiker allen Ernstes, dass er noch etwas zu sagen hatte?
»Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich«, sagte Duckworth, stieg ein und schlug die Tür zu.
Aber Finley war offensichtlich noch nicht fertig. Er machte keine Anstalten, vom Wagen zurückzutreten. Barry ließ sein Fenster herunter. »Haben Sie noch etwas auf dem Herzen?«
»Eines sollten Sie noch wissen. Ich hänge es nicht an die große Glocke – noch nicht –, aber ich glaube, Sie sollten Bescheid wissen.«
»Worüber?«
»Ich werde wieder kandidieren«, sagte Finley. Er legte eine Kunstpause ein. Als Barrys Miene weder Schock noch Freude verriet, fuhr er fort: »Promise Falls braucht mich. Hier ist alles den Bach runtergegangen, seit ich nicht mehr im Amt bin. Sagen Sie mir, dass ich unrecht habe.«
»Ich kümmere mich nicht um Politik«, sagte Duckworth.
Finley grinste. »Kommen Sie mir nicht damit. Die Politik bestimmt, wie Ihre Arbeit aussieht. Gewählte Beamte bauen Scheiße, vernichten Arbeitsplätze, die Leute wissen nicht mehr ein noch aus, trinken mehr, zetteln mehr Schlägereien an, verüben mehr Einbrüche. Wollen Sie das vielleicht abstreiten?«
»Randy, ich muss jetzt wirklich los.«
»Jaja, ich weiß, Sie müssen einem Eichhörnchenserienmörder auf den Pelz rücken. Ich sage ja nur, sobald ich zurückkomme –«
»Falls.«
»Sobald ich zurückkomme, wird sich einiges ändern. Womöglich auch auf dem Stuhl des Polizeichefs. Sie scheinen mir der richtige Mann für so einen Job zu sein.«
»Ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Und wenn ich Sie darauf hinweisen darf, es könnte sein, dass die Wähler sich noch an Ihre Vorliebe für fünfzehnjährige Prostituierte erinnern.«
Finleys Augen wurden schmal. »Erstens war es nur eine minderjährige Prostituierte, und außerdem hat sie gesagt, sie ist neunzehn.«
»Ach so. Gut, kandidieren Sie. Ihren Wahlspruch haben Sie ja schon: Sie hat gesagt, sie ist neunzehn. Wählen Sie Finley.«
»Das war eine Intrige, Barry, und das wissen Sie auch. Ich war ein guter Bürgermeister. Ich hab was auf die Beine gestellt, hab Arbeitsplätze erhalten. Dieser private Scheiß hatte damit überhaupt nichts zu tun, und die Medien haben wieder mal aus einem Furz einen Donnerschlag gemacht. Jetzt, wo die Plimpton, dieses Luder, den Standard dichtgemacht hat und ich mir keinen Kopf mehr um negative Presse machen muss, habe ich eine echte Chance. Davon bin ich überzeugt. Ich bestimme, worüber berichtet wird. Den Medien in Albany geht’s doch am Arsch vorbei, was hier abgeht. Da müsste ich mich schon erwischen lassen, wie ich’s mit ’ner Ziege treibe oder so was. Was ich damit sagen will: Sie könnten mir heute als Insider bei der Polizei von Nutzen sein, und ich würde mich eines Tages dafür erkenntlich zeigen.«
»Glauben Sie, über einen Eichhörnchen-Killer auf dem Laufenden gehalten zu werden, ist Ihr Schlüssel zum Wahlsieg?«, fragte Barry.
Finley schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Nur ganz allgemein gesprochen: Wenn’s etwas gibt, von dem Sie glauben, dass ich darüber Bescheid wissen sollte, rufen Sie mich an. Mehr nicht. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der die Ohren aufsperrt. Wenn zum Beispiel Ihre königliche Hoheit Amanda Croydon, keine Ahnung, wegen Trunkenheit am Steuer angehalten wird.«
»Ich glaube nicht, dass unsere jetzige Bürgermeisterin dieselben Probleme hat wie Sie, Randy.«
»Schon gut, dann halt nicht Trunkenheit am Steuer, sondern irgendwas anderes. Wenn sie sich von Gemeindearbeitern die Einfahrt freischaufeln lässt.« Er grinste. »Das klingt ja fast dreckig. Egal, wenn Sie was hören, dass sie sich auf Kosten des Steuerzahlers Vorteile verschafft oder irgendwelche Gesetze umgeht, dann könnten Sie mir das stecken. Es muss doch was über sie geben. Unser Bürgermeister ist ’ne Frau, und unser Polizeichef ist ’ne Frau. Das geht doch auf keine Kuhhaut! Man sollte diese Stadt umbenennen. In Muschington.«
»Ich muss los, Randy.«
»Weil, sind wir doch mal ehrlich«, und der ehemalige Bürgermeister beugte sich weiter hinunter, »wir haben doch alle unsere Geheimnisse. Mancher von uns – ich meine, ich bin doch das beste Beispiel – hat zwar nichts mehr, was er verheimlichen könnte. Da wissen eh schon alle Bescheid. Aber andere wären froh, wenn nicht alle Welt erfährt, was sie so im Verborgenen treiben.«
Duckworths Augen wurden schmal. »Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen.«
Finley grinste verschlagen. »Wer sagt denn, dass ich auf irgendwas hinauswill?«
»Mensch, Randy, wollen Sie … Sie wollen mir doch wohl nicht irgendwie drohen?«
Finley wich zurück, als hätte ihm jemand eine Ohrfeige verpasst, doch sein Grinsen blieb. »Wie können Sie nur so was sagen? Ich plaudere doch nur. Soweit ich weiß, haben Sie bei der Polizei von Promise Falls eine blütenreine Weste. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. Eine Laufbahn ohne Fehl und Tadel.« Er beugte sich wieder vor. »Sie sind ein guter Polizist. Und ein guter Familienmensch.«
Er legte den Nachdruck auf Familie.
»Bis zum nächsten Mal, Randy«, sagte Duckworth. Er ließ das Fenster hoch und legte den Gang ein.
Finley winkte freundlich zum Abschied, aber Duckworth nahm keine Notiz von ihm.
Duckworth machte sich auf den Weg zum Thackeray College.
Der Campus lag so nahe am Park, dass die Studenten dort oft spazieren oder joggen gingen, Drogen nahmen oder sich anderweitig verlustierten. Es konnte ein Thackeray-Student gewesen sein, der die Eichhörnchen getötet hatte. Oder gesehen hatte, wer es war.
Vielleicht verschwendete er nur seine Zeit und seine Energie. Im Laufe des Tages würden noch einmal zwei Dutzend Eichhörnchen in Promise Falls ihr Leben lassen, von Autos überfahren, und kein Polizist würde hingehen und die Fahrer der Autos belangen, weil sie sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatten.
Duckworth rechnete ernsthaft damit, bei seiner Ankunft auf dem Revier eine Packung Nüsse auf seinem Schreibtisch vorzufinden. Wenn nicht von Angus Carlson, dann von irgendjemand anderem.