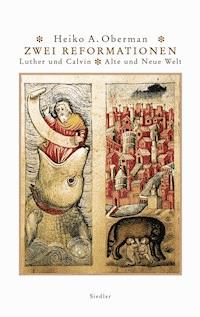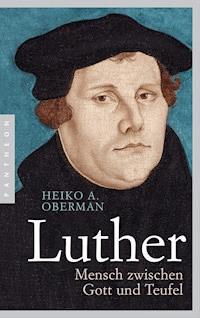
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Standardwerk
Für die Nachwelt ist Luther der Reformator, der Erneurer der Kirche. Er selbst sah sich ganz anders: als von Gott gebrauchtes Werkzeug zur Rettung der Christenheit vor dem noch zu Lebzeiten erwarteten Jüngsten Gericht. Mit einem Bein noch tief im Mittelalter verwurzelt sah Luther sich weniger als Handelnden denn als Getriebenen, als Sprachrohr eines nahen und überwältigenden Gottes. Luther war Mönch aus Angst, Prediger ohne Furcht und Prophet wider den Zeitgeist – ein mittelalterlicher Prophet, der das Mittelalter an sein Ende bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Ähnliche
Heiko A. Oberman
Luther
Mensch zwischen Gott und Teufel
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH.Erste Auflage
Pantheon-Ausgabe Mai 2016 Copyright © 1981 by Quadriga GmbH
Verlagsbuchhandlung KG, Berlin
Severin und Siedler
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18417-9V001www.pantheon-verlag.de
Für Toetie, meine Käthe,
»meiner gnedigen frawenn
zu handen und fussen«
Inhalt
Vorwort
Erster Teil
Prolog: Streit über den Tod hinaus
1. »Der Wagenlenker Israels ist gefallen«
2. Geschichte im Schatten der Endzeit
I. Ein deutsches Ereignis
1. Kurfürst Friedrich, der Rätselhafte
2. Die Lage im Reich
3. Der Wahlsieg König Karls
4. Die spanische Wende
5. Weltmonarchie und Reformation
6. Die Luthersache in Worms
7. »Wach auf, wach auf, du deutsches Land«
II. Ein mittelalterliches Ereignis
1. Reformation und kein Ende
2. Kampf um die Ordensreform
3. Das Ende der Priesterkirche
4. Das Tausendjährige Reich
5. Der fremde Luther
6. Gottesstaat als Utopie
7. Der Antichrist und sein Geschäft
8. »Buße ist besser als Ablaß«
III. Ein Urereignis
1. Was haften blieb: Vater Hans
2. Mutter Hanna: Badehaus und Bürgerheim
3. Pauken und Schläge
4. Schule fürs Leben
5. »Man braucht den Teufel nicht über seine Tür zu malen«25
6. Das göttliche Wort in dreckiger Sprache
Zweiter Teil
IV. Auf dem Weg nach Wittenberg: Entscheidungen vor der Reformation
1. Aufbruch zur Neuzeit
2. Luther wird Nominalist
3. Die Öffnung zum Humanismus
4. Der Magister wird Mönch
5. Kapuze und Kabale
6. Reform oder Einheit: die Grundfrage einer Epoche
7. Bestimmt zum Ratgeber Gottes
8. Der Narr in Rom
V. Der reformatorische Durchbruch
1. Entdeckungen unterwegs
2. Der Teufel und die Kloake
3. Der geborene Reformator
4. Mit Augustin gegen Aristoteles
5. Die erste Wittenberger Vorlesung
6. »Heute habt ihr die Bibel«
VI. Der angefochtene Reformator
1. Christenverfolgung ›heute‹
2. Mystik fürs Leben: Tauler und Staupitz
3. Dreimal exkommuniziert
4. Laß ab vom Ablaß!
5. Schrift oder Papst
6. Gegen Papst und Kaiser
Dritter Teil
VII. Leben zwischen Gott und Teufel
1. Gestoßen und gerissen
2. Luther und der aufgeklärte Humanismus
3. Der Mensch als Reittier
4. Luther und der Fundamentalismus
VIII. Reformatorische Entzweiungen
1. Das Sakrament der ›Blöden‹
2. Streit um das Sakrament der Einheit
IX. Die Christenheit zwischen Gott und Teufel
1. Falsche Alternativen
2. Buch der Psalmen – Buch der Kirche
3. Kirche der Bekenner – Kirche der Märtyrer
4. Verraten und Verkauft
5. Die Zukunft der Kirche: Reformation zwischen Scheitern und Erfolg
X. Ehefreude und Weltfriede: Dem Teufel zum Trotz
1. Lust und Last der Zweisamkeit
2. Kinder, Kirche, Küche
3. Hochzeit: Befriedigung und Freude
4. Scheidung und Doppelehe
5. Chaos und Friede
XI. Person und Tat
1. Der Mensch im Widerspruch
2. Der Sprachkünstler
3. Wein, Weib und Gesang
4. Luther heute: Ein Test
5. Krankheit zum Tode
6. Psychologie am Sterbebett
Epilog: So wie er war
Anhang
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Quellen und Literatur
Anmerkungen
Zeittafel
Vorwort
Den Menschen Luther zu entdecken, verlangt mehr, als Wissenschaft je zu bieten hat. Gefordert ist die Bereitschaft, über die Jahrhunderte des konfessionellen Streits hinweg sein Zeitgenosse zu werden und das eigene Welt- und Lebensbild zurückzulassen. Als die Kirche dem Himmel noch gleich war und der Kaiser die Macht der Welt repräsentierte, da hatte sich dieser Mönch gegen die Mächte von Himmel und Erde erhoben. Ihm blieben Gott und der Teufel, sein allgegenwärtiger Widersacher.
Was er in diesem Kampf, den er nach innen ebenso zu führen hatte wie nach außen, erlebt, erfahren und entdeckt hat, das macht ihn überraschend oft zum Zeitgenossen einer Epoche, die den Teufel übersieht und Gott nur erahnt.
Nicht der ›katholische‹, der ›evangelische‹ und auch nicht der ›neuzeitliche‹ Luther ist gesucht. Diesen werden wir auch begegnen. Vor allem aber geht es um Martin Luther zwischen Gott und Teufel. Aus dieser Perspektive kommt allerdings das Ganze in den Blick: die Reformation, wie sie in seiner Zeit und in seinem Leben angelegt war; wie unerwartet sie dann tatsächlich hereinbrach; und wie gefährdet sie über Luthers Tod hinaus blieb. Seiner Person in ihrer Vielschichtigkeit und der Vielfalt ihrer Bezüge gilt das Augenmerk. Woher er kam, ist aufzuspüren, und wohin er ging, wo er schließlich sich selbst im Wege stand und sich um Teile seiner Wirkung brachte.
Martin Luther zu begegnen, bedeutet nicht nur, ihm auf reformatorische Schauplätze zu folgen – das auch; nicht nur, theologische Höhepunkte zu sammeln – auch das. Entscheidend ist, die Person in ihrer Fülle zu fassen – und sei es nur von Augenblick zu Augenblick.
Das Ziel ist somit zwar wissenschaftlicher, aber ganz und gar nicht akademischer Art. Denn es ist ein Mensch aufzusuchen, dem seine Sache viel zu wichtig war, als daß er sie auf den geschützten Bereich der Universität beschränkt hätte. Er vermochte nicht nur Grenzen zu ziehen, sondern diese auch zu durchstoßen und sich den Zeitgenossen aller Stände nachhaltig einzuprägen.
Am Ende dieses Buches findet sich ein Anmerkungsapparat, nicht um Fachwissen zu belegen, sondern um die Möglichkeit zu bieten, dem Autor ›auf die Finger zu schauen‹. Die Quellenangaben werden ihren Dienst geleistet haben, wenn der Leser von diesem Buch auf Luthers Werke selbst gestoßen ist.
Ein besonderes Wort des Dankes darf hier nicht fehlen. Das Institute for Advanced Studies of the Hebrew University in Jerusalem hat aufs Großzügigste Raum und Zeit gewährt, dieses Buch zu schreiben. Viel mehr als Gastfreundschaft wurde mir geboten: Israel stößt den Erben Luthers auf den fremden, befremdlichen und bisweilen entsetzlichen Reformator. Eben dort kann Lutherliebe sich nicht zu jener Lutherverehrung versteigen, die er selbst als Schwärmerei bezeichnet hätte.
Jerusalem, im Sommer 1982Heiko A. Oberman
Erster Teil
Die ersehnte Reformation
Das christen volck ist so verpeint.
Nyemant sein sundt mit reu beweint,
Ein land das ander ser thüt puken [bedrücken],
Gerechtigkait gett ann zweyen krucken,
Das lacht der teufel heur als fert [jetzt und künftig],
Denn welches reich sich selber stert [zerstört],
Das schafft ym selbs ein großa klag,
Als yetz beschit, dar von ich sag,
Das keyser, konig, fursten, herren
Ein ander günnend nit der ern,
Das sie ein rechte ordnung machten,
Darmit sie die christen welt versachten.
Maria, edle königin,
Nun pit fur uns dein liebes kindt
Und mach uns seinen zorn lind,
Das er nit richt nach strengem rechtem
Fursten, herrn, ritter, knechten,
Geistlich, weltlich alle geschlecht
Denn wurd zu schwer das gotlich recht
Das wendt uns got yn seinem tron.
Dar mit las wir die red beston.
Die großen Krieg und Streit,
so yn aller welt kurtz verschinen
Nürnberg 1515
Prolog: Streit über den Tod hinaus
1. »Der Wagenlenker Israels ist gefallen«
»Verehrter Vater, wollet ihr auf Christum und die Lehre, wie ihr sie gepredigt, beständig sterben?« Ja, heißt es zum letzten Male mit klarer Stimme. Als Martin Luther in der Nacht zum 18. Februar 1546 in Eisleben, fern von zu Haus, im Sterben lag, mußte er sogar im individuellsten und privatesten Akt des Menschen noch einmal öffentlich auftreten. In Anwesenheit eilig herbeigerufener Zeugen rüttelt ihn sein langjähriger Vertrauter, Justus Jonas, jetzt Pfarrer in Halle, am Arm, um den Geist zur letzten Anstrengung zu reizen. Ein ›schönes Stündlein‹ hatte Luther sich schon immer von Gott erbeten: Dem letzten und bittersten Feind, dem Satan, im Vertrauen auf den Herrn über Leben und Tod zu widerstehen, ist gottgeschenkte Befreiung von der Tyrannei der Sünde und verwandelt Agonie in einen kurzen Schlag.
Doch jetzt geht es um weit mehr als um das eigene Schicksal, gottgetrost im Frieden von der Welt zu lassen. Denn gelassene Beständigkeit im Sterben ist seit dem ersten Überlebenskampf während der Verfolgungen durch das antike Rom auch noch im späten Mittelalter das offenbare Merkmal der wahren Gotteskinder, der Bekenner und Märtyrer. Das Sterbebett in der Eislebener Herberge wird zur Bühne – um Luthers Bett stehen nicht nur Freunde, die Gegner lauschen mit.
Bereits im Jahr 1529 hatte sein erster ›Biograph‹, Johannes Cochläus, den verhaßten Luther in aller Öffentlichkeit auf Latein und Deutsch als den siebenköpfigen Drachen, des Teufels Ausgeburt, dargestellt. Schmähschriften hatten wiederholt über sein elend-verzweifeltes Sterben und seinen gottverlassenen Tod berichtet. Jetzt aber wurde das Ende Wirklichkeit, das die Freunde befürchtet und die Gegner ersehnt hatten. Wer wird es sein, der sein Eigentum beansprucht und heimholt, Gott oder der Teufel?
Während die einfachen Gläubigen sich den Teufelszugriff wörtlich ausmalten, war die aufgeklärte akademische Welt überzeugt, daß der Anfang der Höllenfahrt medizinisch diagnostiziert werden kann, und zwar als Herzschlag: Abrupt und ohne Vorwarnung, ohne daß die Kirche noch ihre letzte Hilfe leisten kann, zerschneidet der Teufel den Faden des ihm verfallenen Lebens. In den ersten Berichten betonen deshalb die Freunde Luthers, Melanchthon voran, daß die Todesursache eben keine plötzliche, überraschende Apoplexie gewesen ist, sondern ein allmähliches Nachlassen der Lebenskräfte: Luther verabschiedete sich vom Leben und gab seinen Geist auf in die Hände Gottes.
Beim Streit um den Tod ging es nicht nur um Luther, um Teufelsbrut oder Gottesgut, sondern zugleich um die Legitimität der Reformation. Luther ist nicht nur ihr Auslöser, der in späteren Jahren angeblich hinter den großen Wellen der Bewegung zurückblieb. Er ist auch ihr geehrter oder verfluchter, immer aber gehörter Dirigent, sei es als Prophet, sei es als Drahtzieher, bis in seine letzten Tage und weit über seinen Tod hinaus. Für Freund und Feind war sein Tod mehr als ein Lebensende. Deshalb greift Justus Jonas, kurz nachdem Doctor Martinus am 18. Februar gegen drei Uhr morgens gestorben war, eigenhändig zur Feder, um von den letzten vierundzwanzig Stunden zu berichten, und zwar nicht zuerst der Witwe, sondern dem Landesherrn, Kurfürst Johann Friedrich, und dann den Kollegen in Wittenberg. Wäre Luther, am 10. November 1483 als Sohn des einfachen Bergmanns Hans Luder geboren, in jungen Jahren verstorben, die Geschichte wäre unbewegt über die Trauer der Eltern hinweggegangen. Jetzt aber ist sein Sterben Staatssache. War er am Tag nach seiner Geburt, dem Martinstag, mit aller Selbstverständlichkeit zur Taufe getragen worden und damit ins Leben der Kirche getreten, so scheiden sich jetzt die Geister, ob er angesichts des päpstlichen Bannspruchs noch als Sohn der Kirche entschlafen sei.
Die letzten Tage hatten Luther noch sehr fröhlich gesehen, so wie seine Freunde ihn kannten und schätzten. Er hatte eine schwierige Mission mit Erfolg abgeschlossen; Anlaß seiner Fahrt von Wittenberg nach Eisleben war die Schlichtung eines langwierigen Streits zwischen den beiden Grafen von Mansfeld gewesen, den Brüdern Gebhard und Albrecht. Stundenlang hatte Luther zwischen den Parteien sitzen und sich die schlauen Gründe jener Leute anhören müssen, die er seit seinen Erfurter Tagen als Jurastudent am wenigsten ›riechen‹ konnte: die Verwaltungsjuristen. Schließlich, nach zähen, vierzehn Tage währenden Schlichtungsverhandlungen, war man sich näher gekommen und hatte eine Aussöhnung – auf Zeit – erzielt. Es gab also Grund, fröhlich zu sein. Luther hatte zwar vermutet, daß er in Eisleben sterben werde, wo er auch geboren war. Doch sorgte er sich darum nicht, obwohl ihm ganz sicher war, daß er nicht mehr lange zu leben hätte: »Wenn ich wieder heim gen Wittenberg komme, lege ich mich in meinen Sarg und gebe den Maden einen feisten Doktor zu fressen.« Die spätmittelalterliche Kunst hatte mit ihrer Durchleuchtung des Menschen bis auf sein Skelett jedermann eindringlich daran erinnert, daß Lebenskraft, Schönheit und Reichtum nur einige Atemzüge vom Knochenspiel des Totentanzes entfernt sind. Darum weiß der ›feiste Doktor‹: nicht als moralische Schauergeschichte, sondern als Lebensrealismus auf der Grenze zur Ewigkeit.
Noch am Vorabend des Todes hatte man, wie so oft zuvor am Wittenberger Tisch, gescherzt und damit zugleich Theologie getrieben: Sehen wir unsere Geliebten im Himmel wieder, Herr Doktor?, wurde gefragt. Es ist wohl möglich, lautete die Antwort, daß wir vom Geist so erneuert werden, daß wir wie Adam, der nach seinem Schlaf die neugeschaffene Eva als seine Frau erkannte, einander wiedererkennen. Auch auf der dunklen Gegenseite, in der Hölle, werden Körper und Geist nicht getrennt. Luther erzählt die Geschichte eines Mannes, der von solchem Hunger geplagt wurde, daß er sich dem Teufel verschrieb, um sich endlich einmal satt essen zu können. Als er nun rundum gepraßt hatte, kam der Teufel, um die Schuld einzufordern. Doch der Schuldner erinnerte entrüstet daran, daß der Teufel zu warten habe bis zum Tode, er hätte schließlich nur seine Seele verkauft. Dieser aber hatte seine Antwort parat: Wenn man ein Pferd kauft, erhält man doch die Zügel dazu? Ja, mußte der Mann gestehen. Nun, sagte der Teufel, die Seele ist das Pferd und der Körper die Zügel. Und er packte sich den Mann – mit Leib und Seele.
Luthers Todesahnungen sollten bereits einen Tag später Wirklichkeit werden. Aus seinem Geburtsort ist er nicht mehr lebend in die Stätte seines Wirkens, nach Wittenberg, zurückgekehrt. Noch am Vormittag des 18. Februar fertigte ein Maler jenes Totenbild an, das die entspannten Züge der letzten Stunde bezeugen sollte, um nicht nur dem Familien- und Freundeskreis sondern vor allem der Nachwelt das Angesicht des seligen Todes auch aus der Ferne beweisen zu können.
Der Leichnam wurde von Stadt zu Stadt von einer Ehrengarde zur anderen geleitet und traf so im Trauerzug nach zwei Tagesreisen in Wittenberg ein, der geistigen Hauptstadt Kursachsens. Überall, wo er aufgebahrt wurde, strömten die Menschen herbei. Erste Gedächtnisreden wurden gehalten, voller Erschütterung, noch ohne die spätere Mischung von wissenschaftlicher Pedanterie und protestantischer Heiligenverehrung.
Dem Trauerzug drei Tage voraus erreichte der von Justus Jonas entsandte Eilbote in der Frühe des 19. Februar Wittenberg. Stadt und Universität waren gänzlich unvorbereitet auf eine solche Nachricht. Philipp Melanchthon, Luthers langjähriger Mitstreiter und Kollege, stand frühmorgens wie üblich während des Semesters im Hörsaal und legte seinen Studenten den Römerbrief des Apostels Paulus aus. Mitten während der Vorlesung wird vom Eilboten die Todesmeldung hereingetragen. Melanchthon kämpft um seine Kontrolle, ist nicht imstande zu reden, berichtet schließlich seinen Studenten stockend vom Geschehen und bricht am Ende fassungslos in die Worte aus: »Der Wagenlenker Israels ist gefallen« – »Ach, obiit auriga et currus Israel« (2. Könige 2, 12). Das ist der entsetzte Schrei des Elisa, als er den Propheten Elia im Feuerwagen gen Himmel fahren sah.
2. Geschichte im Schatten der Endzeit
Während Elisa mit dem Prophetenmantel zugleich Elias Amt und Auftrag übernahm, wird die Tiefe der Lücke, die Luthers Tod geschlagen hat, darin offenkundig, daß kein Nachfolger bereitsteht. Die charismatische Größe des Reformers hatte der Reformation Schwung und Stoßkraft verliehen, jetzt aber fällt sie wie ein dunkler Schatten auf die Zukunft der evangelischen Bewegung. Luther selber hatte nicht vorgesorgt, nicht aus Unachtsamkeit, auch nicht aus Selbstgefälligkeit, sondern weil er überzeugt war von der Macht des wiederentdeckten Evangeliums, das stark genug sei, sich seinen Weg selbst zu bahnen, auch in den Wirren, die seinem Tode, wie er oft voraussagte, folgen würden – jene Wirren vor dem Sieg Gottes, von denen Luther fürchtete, daß sie das aufsässige Deutschland durch Entzweiung und Bürgerkrieg tief erschüttern würden. So ist es gekommen.
Nach Luthers Tod wies tatsächlich nichts darauf hin, daß die Reformation eine Überlebenschance hätte. Das Papsttum, aus seinem italienischen Renaissancerausch gerissen, stellte sich endlich der kirchlichen Krise durch Mobilisierung aller Kräfte. Als folgenreich erwies sich die Entscheidung Papst Pauls III., dem Ordensgründer Ignatius von Loyola den Jesuitenorden zu bestätigen, der den Bildungsvorsprung des Protestantismus wettmachen sollte. Dann gelang es seit Jahrhunderten zum ersten Mal – seit Innozenz III. und dem IV. Laterankonzil (1215) –, ein päpstliches Konzil zusammenzurufen (Trient 1545), das im Laufe der Zeit Bischöfe aus weiten Teilen Europas versammeln konnte und sich mit seinen Reformmaßnahmen innerhalb der altgläubigen Christenheit Geltung verschaffte. Drei Wochen nach Luthers Tod wurde in Trient – noch eben auf deutschem Boden – ein erster, bis in die Moderne tragender Grundstein der römisch-katholischen Lehre gelegt mit der Entscheidung, sowohl die Schrift als auch die kirchliche Tradition »mit gleicher Ehrfurcht« zu akzeptieren und »die heilige Mutter Kirche« als einzige Autorität über den Sinn der Schrift bestimmen zu lassen – jene römische Mutterkirche also, die Luthers reformatorische Entdeckung verurteilt hatte.
Nicht nur der Papst, auch der andere mächtige Gegner der Reformation, Kaiser Karl V., stand am Vorabend eines einschneidenden Sieges. Wenige Monate nach Luthers Tod, im Juli 1546, kam es zum Bürgerkrieg im Deutschen Reich, zum Krieg zwischen dem politisch-militärischen Bündnis protestantischer Reichsstände und dem Kaiser mit seinen Verbündeten. Karls vernichtender Schlag gegen den ›Hauptmann‹ des protestantischen Schmalkaldischen Bundes, gegen Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, wurde durch den ›Judas von Meißen‹, den evangelischen Herzog Moritz von Sachsen, ermöglicht. Der ›Verräter‹ schlug sich auf des Kaisers Seite und fiel seinem Vetter, dem Kurfürsten, in den Rücken. Im Dom zu Meißen besang das katholische Stiftskapitel den kaiserlichen Sieg bei Mühlberg mit einem Tedeum. Das Volk verstand es als Gottesurteil, daß am gleichen Tage die Türme des Doms vom Blitz getroffen niederbrannten.
Der Kaiser befand sich auf der Höhe seiner Macht. Auf dem Reichstag zu Augsburg (1548) konnte er den niedergerungenen Protestanten das ›Interim‹ aufzwingen, jenes Religionsdiktat, das für die ›Zwischenzeit‹ (darum Interim) bis zum bindenden Konzilsentscheid Gültigkeit haben sollte und die Reformation abwürgen wollte. Gerade der blühenden Reformation in den Städten wurde der Nacken gebrochen. Widerstand, vor allem in den süddeutschen Reichsstädten, wurde in kürzester Zeit beseitigt und hartnäckige Protestanten vertrieben. Die evangelische Reichsstadt Konstanz wagte, das Interim abzulehnen; sie wurde vom Kaiser zur Kleinstadt rekatholisiert. Fünfzehn Monate nach Luthers Tod, am 19. Mai 1547, mußte Wittenberg kapitulieren. Sein Schutzherr Johann Friedrich verlor die Kurwürde samt eines großen Teils seiner Länder. Ihm verblieben nur die Thüringer Gebiete um Weimar, Eisenach und Gotha.
Zuvor schon war der andere, der kirchenpolitische Weg zur Durchsetzung der Reformation abgeschnitten. Es ging um den Versuch, die Bischöfe für die Sache der Reformation zu gewinnen und so eine deutsche Nationalkirche zu bilden. In diesem Ringen spielte Köln die zentrale Rolle. Alle Augen waren auf Hermann von Wied gerichtet, der als Kurfürst und Erzbischof von Köln evangelisch geworden war. Ein Jahr und eine Woche nach Luthers Tod mußte auch er der Macht des Kaisers weichen und auf sein Bistum und Kurfürstentum verzichten. Sein Nachfolger stellte den alten Glauben in Köln wieder her. Fürstlicher Verrat, kaiserliches Diktat und päpstliches Dekret, wer hätte noch auf eine Zukunft der Reformation in Deutschland gebaut?
Am 22. Februar hielt Melanchthon im Namen der Universität dem Toten auf Latein die Leichenrede. Es war ein Abschied mit offenen Worte: Luther ist ein »scharfer Arzt« gewesen, »das Werkzeug Gottes zur Erneuerung der Kirche«. Keine Spur von jener Verlogenheit, der auch die Ehrlichsten zum Opfer fallen, wenn sie am offenen Grabe unter Vorwegnahme des Endgerichts den Ertrag eines Lebens herbeireden. Melanchthon ließ Luthers aufbrausende Schärfe, die Vehemenz seines Streitens, nicht unerwähnt zu einer Stunde, da tiefe Betroffenheit nur Gutes hören will.
Dennoch hat Melanchthon, menschlich wie wissenschaftlich aus einem Guß und eine der eindrucksvollsten Gestalten der Reformationszeit, ein Bild Luthers in die Welt gesetzt, das bis heute – ob nun bejubelt oder verteufelt – den Zugang zu dem verdeckt, wie Luther sich selbst erfahren und verstanden hat. ›Scharf‹ – ja, das hat Melanchthon am eigenen Leibe erfahren, doch ›Arzt‹ – nein; ›Werkzeug Gottes‹ – so sah Luther sich, aber ›Erneuerung der Kirche‹, die sah er nicht. Bereits ein Jahr nach Melanchthons Nachruf war dem Rückblick als Voraussage schon widersprochen. Allen sichtbar hatte die Durchschlagskraft des Werkzeuges nachgelassen; dem Arzt war zwar die erste Operation gelungen, doch der Patient Kirche quälte sich und stand dem Tode näher als zuvor.
Endlich, im Jahre 1555, scheint ein Ende des Elends in Sicht. Auf dem Augsburger Reichstag war es zu einem Religionsfrieden gekommen, Ergebnis eines abermaligen Verrats des Herzogs Moritz. Hatte er sich im Bund mit dem Kaiser nach dem Schmalkaldischen Krieg Sachsens Kurwürde übertragen lassen, so richtete er sich 1552 gegen den Kaiser, entriß ihm den Sieg und zwang ihn zur Flucht aus seinem Regierungssitz Innsbruck. Weitsichtig oder verschlagen, klug oder ruchlos – unabhängig vom moralischen Urteil bleibt das Ergebnis der doppelten Wende des Moritz bestehen: Er hat den reformatorischen Kirchen im Reich des 16. Jahrhunderts das Überleben gesichert, nachdem er zuvor den protestantischen Ständen die – verführerische – Möglichkeit zerschlagen hatte, sich als irdische Vollstrecker von Gottes Reformation zu etablieren. Auch der in Augsburg zustandegebrachte Friede war kein Sieg für die Protestanten, er war nicht einmal ein Religionsfriede, sondern eher ein Fürstenausgleich.
Für den Bereich des deutschen Reichs wurden die längst im späten Mittelalter angestrebten Schutzrechte der Territorialherren über die Kirche vertraglich festgeschrieben. Der Ausgleich zwischen den streitenden Parteien bestand darin, daß weder Kaiser noch Papst sondern der jeweilige Landesfürst über das Bekenntnis seiner Untertanen entschied: »Cuius regio, eius religio.« Außerhalb des Reiches aber, nicht allein in den habsburgischen Landen, blieben die Evangelischen jenen Verfolgungen ausgeliefert, die allzuoft auf den Galeeren oder auf den Scheiterhaufen endeten. Als zwei Wochen nach diesem ›Religionsfrieden‹ Luthers lebenslanger Freund und Todeszeuge, Justus Jonas, starb – am 9. Oktober 1555 –, war die ›Erneuerung der Kirche‹ in regionale und territoriale Kirchenwesen eingegangen … und eingefangen. Jonas hat noch erleben müssen, wie aus der Reformation Luthers das Luthertum entstanden war.
Erst im Jahre 1648, nach dem Ende des dreißigjährigen Bürgerkrieges, des ersten Weltkriegs der europäischen Geschichte, konnte Papst und Kaiser eine weitergehende Religionslösung abgerungen werden, wenigstens für das Europa nördlich der Alpen und Pyrenäen. Neben Lutheranern und Altgläubigen wurden auch die Calvinisten in den Fürstenausgleich einbezogen. Dieser zu Münster und Osnabrück ausgehandelte Friede war aber im Norden der Politisierung des skandinavischen Luthertums zu verdanken und im Süden und Südwesten einem militanten Calvinismus – zwei von Luther niemals geplante Kinder der Reformation. Die Nachwelt hat sehr verschieden geurteilt. Einerseits wurde die Reformation auf den Nenner ›Kirchenspaltung‹ gebracht und der damit gegebenen Schwächung der Christenheit nachgetrauert, unter anhaltender Verdrängung der Tatsache, daß die Kirche längst (1054) in die griechische des Ostens und lateinische des Westens gespalten war. Andererseits behauptet sich die Deutung, daß 1555 und 1648 Meilensteine auf dem Weg zur religiösen Emanzipation gelegt wurden. Sie ermöglichten es tatsächlich, daß die Stimme Luthers bis heute lebendig geblieben ist und er sich in seinen Werken – den kaiserlichen und päpstlichen Wünschen zum Trotz nicht vernichtet und unverstümmelt – immer wieder neu entdecken läßt. Freund und Feind können sich nur darin einig sein, daß der dreißigjährige Religions- und Mächtekrieg wie eine Geißel über Deutschland gezogen ist und weit gehegte Hoffnungen auf die Belebung von Glaube und Kultur, von Frommheit und Bildung gelähmt wenn nicht zerschlagen hat. Der Anschluß Deutschlands an die europäische Aufklärung hat sich durch diesen Krieg dramatisch verzögert – mit Folgen, die bis heute spürbar sind.
Verfolgung und Verteidigung der Reformation haben in der Neuzeit ihre tiefen, untilgbaren Spuren und Wunden hinterlassen. Doch beides, Jubel um die Erneuerung und Trauer um die Spaltung, verstellt den Zugang zu dem Luther, wie er sich selbst gesehen und seine Aufgabe verstanden hat. Nie hat er sich als Kirchenarzt aufgeworfen und nie die Erneuerung der Kirche als seine Aufgabe begriffen. Der nachhaltige Widerstand gegen die Reformation würde ihn weder überrascht noch beirrt haben. Enttäuscht wäre er jedoch gewesen, wenn er geahnt hätte, daß die letzte Ankunft Gottes, die Wiederkehr Christi am Jüngsten Tag, noch so lange auf sich warten lassen würde, daß es zur Feier seines fünfhundertsten Geburtstags auf Erden kommen muß.
Luthers Zeitdeutung entspringt ganz anderen Maßstäben als denen von Neuzeit und Aufklärung, von Fortschritt und Toleranz. Die Eindämmung der evangelischen Bewegung zu erdulden, hätte ihm keine Mühe gemacht, denn er wußte, daß die Erneuerung der Kirche nur noch von Gott zu erwarten sei, und zwar am Ende der Zeiten. Nach Luthers Voraussage wird der Teufel die Wiederentdeckung des Evangeliums nicht ›tolerant‹ ertragen, sondern sich noch einmal mit Wucht aufbäumen und alle seine Macht gegen das Evangelium sammeln. Der Reformation Gottes wird die Gegenreformation vorausgehen, des Teufels ›Fortschritte‹ kennzeichnen die Endzeit; denn wo Gott am Werke ist, im Menschen und in der Menschengeschichte, da ist der Teufel, der Verneiner, nicht fern.
Luther verstehen zu wollen, macht es nötig, seine Geschichte anders zu lesen, als wir es gewohnt sind: Sie ist Geschichte ›sub specie aeternitatis‹, zwar im Lichte der Ewigkeit, doch nicht im milden Schein eines stetigen Fortschritts gen Himmel, sondern im Schatten der chaotischen Endzeit einer nahe herbeigekommenen Ewigkeit.
I. Ein deutsches Ereignis
1. Kurfürst Friedrich, der Rätselhafte
Unglaublich, diese Deutschen, so urteilt der Botschafter Venedigs auf dem Augsburger Reichstag in seinem Bericht vom Sommer 1518 an die Signorie seiner Republik. Da ringen Fürsten und Diplomaten im Dienste des Gemeinwohls um einen Ausgleich zwischen Kaiser und Landesherren, doch die Gerüchteküche in den Wandelgängen stört diese Bemühungen und sät Mißtrauen nichtiger Angelegenheiten wegen: Anlaß ist ein Theologenkrach um Ablässe. Der Botschafter ist nicht auf unbestimmtes Hörensagen angewiesen, er weiß sogar Namen zu nennen: Die Kontrahenten sind ein Mönch namens Luther und ein Professor aus Ingolstadt, Johannes Eck geheißen. Lächerlich, sich durch Ablässe von der Wirklichkeit ablenken zu lassen; bald wendet sich der Bericht wieder der Politik zu.
Vitale Interessen stehen auf dem Spiel für die stolze Republik Venedig, Finanzmacht, Handelsmacht und Seemacht, die vom freien Zugang zu allen Teilen des Mittelmeers lebt. Auf der Tagesordnung des Reichstags steht der Kreuzzugpfennig, die allgemeine Reichssteuer für den Heiligen Krieg, die von den deutschen Ländern und vor allem von den florierenden Städten aufgebracht werden muß, damit der Westen sich endlich entschieden zur Wehr setzen und der Gefahr aus dem Osten wirksam entgegentreten kann.
Konstantinopel, die alte Vormacht im Kampf gegen die Türken, war ein halbes Jahrhundert zuvor, im Jahre 1453, gefallen, so daß die traditionellen Handelsgebiete Venedigs, Griechenland und die Levante, nur noch unzureichend gegen den Zugriff der osmanischen Macht gesichert sind. Zudem liegt Venedig im Lebensraum des sich aggressiv ausbreitenden Kirchenstaates und ist darum brennend daran interessiert, daß der Papst von Italien abgelenkt und durch einen Krieg im Osten gebunden wird. Ein Kaiser und ein Papst, die sich beide mit dem Kreuzzug gegen die Türken beschäftigen, werden die Unabhängigkeit der Republik am besten schützen.
Am 28. August 1518 unterzeichnete Kaiser Maximilian I. in Augsburg einen Waffenstillstand, der seinem erbitterten Kampf gegen Venedig ein vorläufiges Ende setzen sollte. Damit hätte er den Rücken frei gehabt zum Kreuzzug gegen den Sultan. Entscheidend aber war, ob die Reichsstände die notwendigen Steuern für einen Krieg bewilligen würden, denn Maximilian war bis an den Rand des Staatsbankrotts verschuldet. In Sachen des Türkenpfennigs aber konnte der Kaiser mit der vollen Unterstützung Roms rechnen.
Papst Leo X. hatte als seine Legaten zwei hochgestellte Mitglieder des Kardinalskollegiums zum Reichstag entsandt: Der eine war Matthäus Lang, ein Augsburger Bürgersohn und Vertrauter des habsburgischen Hauses; der andere Legat, Cajetan, nach seinem Geburtsort Gaeta genannt, kam aus Italien angereist und war vor allem damit beauftragt, die sich deutlich abzeichnenden Widerstände gegen die Kreuzzugssteuer überwinden zu helfen. Die Hände des Italieners waren nicht leer. Am 1. August 1518 überreichte er in Augsburg dem jungen Kurfürsten Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz, feierlich – und kostenlos – die Insignien der Kardinalswürde.
Auch Matthäus Lang wurde bedacht. Cajetan bestätigte ihm im Auftrag des Papstes die Anwartschaft auf Salzburg, eines der bedeutendsten deutschen Erzbistümer. Schließlich, am Abend dieses festlichen 1. August, wird auch der Kaiser hoch geehrt – und in die Pflicht genommen. Cajetan überreicht ihm den geweihten Hut und das Schwert, Zeichen christlicher Kreuzritterschaft.
Doch als der Kardinal am 5. August in lateinischer Rede vor dem Reichstag zur Sache kam und für den Türkenkreuzzug warb, war von einer Wirkung dieser päpstlichen Auszeichnungen nichts zu spüren. Die Repräsentanten des Reichs zierten sich nicht einmal höflich, sondern brachten mit Vehemenz alte ›Gravamina‹ vor, führten die Beschwerden der deutschen Nation auf, vor allem gegen die kirchliche Steuerpolitik, gegen die Eingriffe Roms in die Rechtshoheit der Stände und wegen des endlosen Schachers, den die Kurie mit den Pfründen der deutschen Kirche trieb: Keine Karriere, deren Wege nicht nach Rom führten!
Friedrich der Weise, Landesherr von Kursachsen, steht in vorderster Reihe, wenn es darum geht, sich vom Anspruch der geistlichen Macht zu befreien. Dazu gehört nicht nur der Kampf gegen die ständigen Eingriffe in fürstliche Herrschaftsrechte durch die Kurie; auch das mit der Landesherrschaft konkurrierende Regiment örtlicher Bischöfe muß eingedämmt werden. Was vielen freien Reichsstädten schon gelungen war, mußten sich die Fürsten noch erkämpfen: ihre Unabhängigkeit von den weltlichen Herrschaftsrechten der Kirche. Die Luthersache, außerhalb Deutschlands noch kaum beachtet, war auch in Augsburg 1518 lediglich einer von vielen Konfliktpunkten im Rahmen dieser Auseinandersetzungen um das Kirchenregiment in den deutschen Territorien.
Dem römischen Kardinallegaten Cajetan fiel die Aufgabe zu, im Falle ›Luthers‹ eine Lösung zu finden, die im zentralen Punkt der Kirchenherrschaft die Rechte Roms wahrte, ohne den Kurfürsten Sachsens zu provozieren. So kam es zwischen dem 12. und 15. Oktober 1518 – nach dem Abschluß des Reichstages – im Augsburger Fuggerhaus zum ersten und letzten Verhör, dem Martin Luther sich zu unterziehen hatte. ›Väterlich‹ und nicht ›richterlich‹ wolle er vorgehen, so hatte es Cajetan dem Kurfürsten zugesagt. Doch alle Mühe war vergebens, und Überredungskünste verfingen so wenig wie harte Worte. Am Ende blieb dem Legaten nur die Feststellung, daß der Mönch als Ketzer zu betrachten sei, nicht bereit, sich der Kirche zu beugen und zu widerrufen.
Damit war für Cajetan die Sache erledigt. Er hatte, wie versprochen, den Wittenberger Mönch trotz seiner Hartnäckigkeit nicht verhaften lassen, und, wie vom Papst befohlen, ein Urteil gefällt, dessen Exekution er von Friedrich nun nachdrücklich einforderte: Ich ermahne und bitte Eure Durchlaucht, Eure Ehre und Euer Gewissen zu bedenken und den Mönch Martin entweder nach Rom überführen zu lassen oder aus Euren Landen zu jagen. Eure Durchlaucht sollten eine solche Schande nicht über Euren und Eures Geschlechtes Ruhm kommen lassen, nur wegen eines einzelnen Mönchleins – »propter unum fraterculum«.1
Der Botschafter Venedigs und der Legat des Papstes waren beide gleich befremdet, daß ein Reichstag in Deutschland sich durch dergleichen Nebensächlichkeiten beeinflussen und ein Kurfürst sich durch lächerliches Mönchsgeschwätz so ablenken ließ, daß die Notwendigkeiten der Politik aus dem Blick gerieten. Typisch deutsch – woanders nicht denkbar!
Typisch römisch – so machte die Gegenseite ihrem Unmut Luft: Da versuchen die verschlagenen Welschen wieder einmal, uns dumme Deutsche für ihre Interessen auszunutzen. Ein Reichstag als Ganzer war aber ebenso wie ein Kurfürst als Einzelner den politischen Interessen Deutschlands verpflichtet – und nicht denen Roms. Aus der Sicht der Reichsstände gehörte die Emanzipation von der Kurie unverzichtbar zu den nationalen Forderungen, die es endlich durchzusetzen galt.
Die Landesfürsten, allen voran Friedrich, verstanden Politik in einem umfassenderen Sinne als heute. Politik hat es nicht nur mit dem zeitlichen Gemeinwohl, sondern auch mit den Voraussetzungen und Bedingungen für das ewige Heil der Bürger in Stadt und Land zu tun. Eben deswegen konnte sich Luther im August 1520 mit seiner berühmtesten politischen Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation wenden. Die weltliche Obrigkeit fand hier die biblische Begründung für ihre längst praktizierte Verantwortung in der Sorge um Land und Landeskirche: Wer das Wohl der Kirche romtreu den ›Kurtisanen‹, den Höflingen der Kurie, überläßt, verletzt die Pflichten eines christlichen Fürsten.
Daß Cajetan den Ruhm von Friedrichs Vorfahren beschwor, war nicht sonderlich geschickt; denn das Herrscherhaus der Wettiner war bereits vor der sächsischen Landesteilung im Jahre 1485 offen gegen die Rechtsansprüche der Kirchenhierarchie vorgegangen. Längst bevor Luther in seinen Ablaßthesen vom Oktober 1517 auf scheinbar revolutionäre Weise in die Rechte des Papstes eingriff, hatte ein Kurfürst von Sachsen, Friedrich II., dem Papst die Rechte zum Ablaßvertrieb empfindlich eingeschränkt. Als 1458 Papst Calixt III. einen Türkenablaß ausschrieb, griff Friedrich II. ein. Der römische Legat mußte sich damit einverstanden erklären, der kurfürstlichen Kasse die Hälfte der Einnahmen abzutreten. Wie wenig der Landesherr dem Legaten traute, bewiesen die Kontrollmaßnahmen, um eine gerechte Teilung der Einkünfte zwischen Papst und Staat sicherzustellen. Alle Gelder wurden in großen ›Beichtkisten‹ aufbewahrt, die, jeweils mit zwei Schlössern versehen, nur mit dem Schlüssel dafür beauftragter Stadträte geöffnet werden konnten. Damit auch tatsächlich alle Gelder in diese Ablaßkästen gelangten, war dem päpstlichen Legaten vom Fürsten ein Kontrolleur beigegeben, dessen Berichte das fürstliche Mißtrauen rundum bestätigten.2
Am Anfang des Jahrhunderts, als Sachsen bereits seit siebzehn Jahren geteilt war, hatten die Landesherren, Kurfürst Friedrich der Weise auf der einen und Herzog Georg der Bärtige auf der anderen Seite, ihre Interessen in der Ablaßfrage mehrfach zu verteidigen gewußt. 1502 wurde nämlich erneut ein Türkenablaß verkündet, dessen Gelder beide Fürsten umgehend beschlagnahmen ließen, als sich herausstellte, daß aus dem Türkenzug wiederum nichts werden würde. Solche Vorkommnisse erklären bereits, warum ›das Mönchlein‹ nicht sang- und klanglos von der deutschen Bühne verschwand. Doch warum setzte sich der weise Friedrich so für Luthers Sache ein? Sein Nein zu Cajetan verband das Land in den folgenden Jahren auf Gedeih und Verderb mit der Reformation, so daß sein Neffe Johann Friedrich schließlich die Kurwürde verlieren sollte, als er nach seiner vernichtenden Niederlage im Religionskrieg gegen den Kaiser am 19. Mai 1547 die Wittenberger Kapitulation unterschreiben mußte.
Keine Antwort kann an der einen vorbeigehen: Friedrich handelt als christlicher Landesfürst. Religiöse Überzeugungen markieren die Grenzen seiner Kompromißfähigkeit und erweisen sich als staatspolitische Faktoren. Es ist nicht zu übersehen, daß diese Faktoren, die anfangs die Reformation Kursachsens ermöglicht hatten, auch zu den Ursachen der militärischen Katastrophe gehörten. Der Kurfürst wurde am 24. April 1547 deshalb bei Mühlberg von kaiserlichen Truppen überrascht, weil es ihnen gelungen war, unbeobachtet zum Elbufer vorzustoßen, denn Johann Friedrich hatte dem sonntäglichen Gottesdienst den Vorrang vor dem Militärdienst gegeben und alle Wachen einziehen lassen, die ihm den Vormarsch des Kaisers hätten melden können. Das Bild des betenden Fürsten, der sich und sein Heer von Gott geschützt weiß, hat sein Vorbild in der Gelassenheit des weisen Friedrich während des Bauernkriegs: »Will es Gott also haben, so wird es also hinausgehen, daß der gemeine Mann regieren soll. Ist es aber sein göttlicher Wille nicht und daß es zu seinem Lobe nicht vorgenommen, wird es bald anders.«3 – So bescheidet der greise Kurfürst den ungeduldigen Bruder Herzog Johann am 14. April 1525, knapp einen Monat vor seinem Tod am 5. Mai.
Sich in die Vorsehung zu schicken, widerspricht reformatorischem Glauben. Die harten Bauernschriften des Reformators üben neben der Verdammung des Blutvergießens durch die Bauernhaufen zugleich auch scharfe Kritik an den Fürsten, die nicht ›gelassen‹, sondern ›lässig‹ handeln. Denn das Rechnen mit Gottes Geschichtslenkung und mit seinem Strafgericht gehört in den Bereich des Glaubens; es enthebt einen Landesherren nicht von der Pflicht, im fürstlichen Amt seinen Aufgaben nachzukommen und bis zum Ende den kurzfristigen Dienst an der Welt getreu zu leisten.
Wo immer Glaubensüberzeugungen Friedrichs deutlich werden, ist ihre Distanz zur Reformation sichtbar, und Luther ist offen gegen sie zu Felde gezogen. Schon kurz nach dem Ausbruch des Ablaßstreits hat er Front gemacht gegen eine falsche, weil egoistische Art der Heiligenverehrung4 – mit deutlichen Spitzen gegen den ganzen Stolz Friedrichs, seine Reliquiensammlung in der Wittenberger Schloßkirche. Im Jahre 1523 hat Luther dann vor aller Welt seinen Landesherrn bloßgestellt und brüskiert, indem er zum Schluß seines Entwurfs einer neuen Liturgie, der Formula Missae, von den verfluchten Finanzinteressen des Fürsten spricht, der mit Hilfe seiner Reliquiensammlung die Schloßkirche namens »Allerheiligen oder vielmehr Allerteufeln«5 zu einer Geldquelle herabgewürdigt hat. Das wurde Friedrich nicht gerecht.
Erstaunlich, daß der immer wieder so hart angegriffene Friedrich die Wirkungsfreiheit Luthers erhält und sichert, trotz aller Stürme, die sein umkämpfter Universitätsprofessor heraufbeschworen hat und trotz des Unwillens über so manchen radikalen Verfechter der Reformation. Zuletzt, auf seinem Sterbebett, hat er auch öffentlich seine Entfernung vom alten Glauben bezeugt, als er sich entgegen päpstlicher Lehre im Abendmahl Wein und Brot reichen ließ, gemäß der Einsetzung Christi – wie Luther es gelehrt hatte. Es wird nicht gegen den letzten Willen des Verstorbenen verstoßen haben, als der gebannte Ketzer aufgefordert wurde, die Trauerliturgie gemäß den Prinzipien seiner neuen Gottesdienstordnung umzugestalten und die Bestattungspredigt zu halten. So wurde Friedrich der Weise am 11. Mai 1525 mit mehr Neuerungen zu Grabe getragen, als er im Leben gutzuheißen bereit war.
Die Nachwelt hat diesen Fürsten genauso rätselhaft gefunden wie seine eigene Zeit. Zurückhaltend und scheu, in seinen Handlungen zögernd bis zur Entscheidungsunfähigkeit, nicht bereit, sich festzulegen geschweige sich festlegen zu lassen, im Sterben aber ein Zeichen setzend, das nicht mehr rückgängig zu machen war. Wer war dieser Mann? Im Individuellen und Persönlichen verbirgt diese Gestalt ihre Züge; der Historiker ist auf das Bild angewiesen, das der Fürst sorgsam gepflegt und als Mittel in den politischen Auseinandersetzungen verwendet hatte. Ein spätmittelalterlicher deutscher Landesfürst, kein Souverän und schon gar kein absolutistischer Herrscher, aber im Wertgefühl und Pflichtbewußtsein so gefestigt, daß er sich weder von der Kurie in Rom noch vom kaiserlichen Hof und auch nicht von einem Doktor Luther die Verantwortlichkeit für das zeitliche Wohl und ewige Heil seiner Landeskinder streitig machen läßt. Wieder und wieder betont er, daß er als Laie über Luthers Theologie nicht richten kann und macht zugleich doch deutlich, daß der Bann des Papstes ihm die Schuld des Doktors nicht beweist. Im Kampf der Parteien war Friedrich ganz christlicher Fürst im Interesse der Wohlfahrt und Seligkeit seiner Untertanen. Das landesherrliche Kirchenregiment ist nicht erst das Ergebnis der Reformation, es hat schon ihren Anfängen Pate gestanden.
2. Die Lage im Reich
Luther hat Friedrich als großen Zauderer geschildert – allerdings aus späterer Sicht und immer im Vergleich zur Förderung, die er von den Nachfolgern Friedrichs, von Johann dem Beständigen und vor allem von Johann Friedrich dem Großmütigen, erfahren hatte. Kursachsen verdankte aber gerade dem Zögern Friedrichs des Weisen, daß es die schwierigen Jahre seiner drohenden Isolierung im Reich überbrücken und die Reformation auch ohne Unterstützung durch die deutschen Reichsstände überleben konnte.
Bereits das Verhör Luthers vor Kardinal Cajetan hätte ohne die Intervention Friedrichs und seiner Räte nicht auf deutschem Boden, in Augsburg, sondern in Rom stattgefunden. Ohne die Beharrlichkeit des Kurfürsten hätte die evangelische Bewegung schon 1518 ihr Ende gefunden und wäre höchstens als Kapitel der Theologiegeschichte in ferner Erinnerung geblieben. Es hätte keine geniale Gestalt und keinen Reformator Luther gegeben, sondern nur einen Ketzer, der zeitweilig von sich reden gemacht hatte, als er wie der Böhme Johannes Hus und der Florentiner Girolamo Savonarola vor der Verweltlichung der Kirche warnte. Luther wäre so folgenlos geblieben, daß eine selbstbewußte römische Kurie ihm heute getrost die Wiederaufnahme seines Prozesses in Aussicht stellen könnte.
Es kam anders. Der kursächsische Hof traute von Anfang an einer Verurteilung Luthers durch römische Kurtisanen und Bettelmönche nicht; er sah es keineswegs als erwiesen an, daß der Theologieprofessor an der Landesuniversität Wittenberg Ketzerei gelehrt haben sollte. Außerdem galt jeder Versuch, die Lutherfrage außerhalb Deutschlands in Rom ›lösen‹ zu wollen, als Eingriff in das Hoheitsrecht der landesherrlichen Gerichtsbarkeit. Welche Gefahren diese Politik für das Land mit sich brachte, sah auch Luther, und so machte er dem Kurfürsten das zunächst willkommene Angebot, Sachsen zu verlassen, um ihn nicht zu kompromittieren und um seiner Politik die Handlungsfreiheit zurückzugeben. Die Wittenberger Freunde waren am 1. Dezember 1518 bereits zum Lebewohl versammelt, so nahe war die Stunde des Exils gekommen. Da traf, während Luther mit den Gästen zum Abschied ›guter Dinge‹ war, der gegenteilige Bescheid ein: »Wenn der Doktor noch da wäre, solle er in keinem Fall das Land verlassen, der Kurfürst habe Notwendiges mit ihm zu verhandeln.«6 Luther war Gegenstand der Staatspolitik geworden.
Die kurfürstliche Kanzlei konnte sich ohne weitschweifige Grundsatzerklärungen auf den Standpunkt der Neutralität zurückziehen. Der Wittenberger Doktoreid, den am 19. Oktober 1512 auch Martin Luther geschworen hatte, enthielt neben dem Verbot der Verbreitung häretischer Lehren zugleich die Verpflichtung auf die Freiheiten und Privilegien der theologischen Fakultät. Sie schlossen ausdrücklich das Recht ein, als Doktor der Theologie ungehindert und frei über Fragen der Schriftinterpretation zu disputieren. Daß genau dieses auf Luthers fünfundneunzig Thesen zutreffe, hatte die Wittenberger Universität in ihrem Gutachten vom Dezember 1518 bestätigt.7 Als im Sommer 1519 zu Leipzig – nicht mehr im kurfürstlichen, sondern im herzoglichen Gebiet des seit 1485 geteilten Sachsen – über das heikle Problem der Autorität des Papstes disputiert werden sollte, war Luther sich über den Grundsatz der Disputationsfreiheit mit seinem Gegenspieler Johannes Eck, seinem ersten und lebenslangen deutschen Gegner, völlig einig. Mit einmütiger Unterstützung beider Parteien konnte der Landesherr, Herzog Georg, diese Disputation durchsetzen, und zwar sowohl gegen das ablehnende Votum des zuständigen Bischofs wie gegen die Ängstlichkeit der theologischen Fakultät in Leipzig.
Von Anfang an behandelte Kurfürst Friedrich die Angelegenheit Luthers als ›Rechtsfall Luther‹ und vermied alles, was als Begünstigung hätte ausgelegt werden können. Nie ist er Luther persönlich begegnet, nie hat er sich inhaltlich zur neuen Theologie geäußert. Bis zum Zeitpunkt des Wormser Edikts (26. Mai 1521), der Reichsacht des Kaisers über Luther, konnte Friedrich auf diesem Standpunkt der Unparteilichkeit beharren. Eine Parteinahme hätte den Wittenberger Professor nicht wirkungsvoller schützen können.
Genauso wirksam reagierte der ›Zauderer‹ Friedrich auf Luthers Verurteilung durch den Papst. Am 15. Juni 1520 hatte Papst Leo X. die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine unterschrieben. In ihr waren einundvierzig Sätze aus Luthers Werken aufgeführt, die als »ketzerisch, anstößig und falsch« verworfen wurden. Dem Wittenberger blieben sechzig Tage zur Unterwerfung; als diese Frist ohne Widerruf verstrich, wurde er am 3. Januar 1521 endgültig gebannt. Mit dem Erlaß der Bannbulle Decet Romanum Pontificem hatte die Luthersache ihr Ende gefunden – wie jedermann erwarten mußte. Denn nun war der kirchliche Prozeß abgeschlossen und alles weitere nur administratives Nachspiel: die Auslieferung an die weltliche Gewalt und schließlich die Exekution.
Warum kam es nicht zu dem, was gemäß dem Reichs- und Kirchenrecht hätte geschehen müssen? Seit dem Reichstag zu Augsburg 1518 war schließlich mancherlei vorgefallen, was gegen den Erfolg der Luthersache sprach. In seinem Bericht über die ›väterliche Vermahnung‹ hatte Kardinal Cajetan in einem Zwischensatz das entscheidende Argument des freien Disputationsrechts gleichsam nebenbei zur Seite geschoben: »Obwohl Frater Martinus seine Auffassungen in akademischen Disputationsthesen zur Debatte gestellt hat, sind sie von ihm in Predigten dennoch als feste Ergebnisse verkündigt worden, und zwar, wie man mir mitteilt, sogar in deutscher Sprache.«8 – vor aller Ohren, selbst denen des ›dummen Volkes‹! Er hatte das Disputationsrecht mißbraucht und damit verwirkt; in Zukunft entschied allein die inhaltliche Bewertung von Luthers Thesen.
In der Urteilsbegründung ist Cajetan aber zu überstürzt. Eine merkwürdige Verdoppelung schadet seiner Sache: Luthers Thesen »verstoßen zum Teil gegen die Lehre des Heiligen Stuhls, zum Teil sind sie häretisch«.9 Nicht nur aus der Sicht des heutigen Papsttums ist diese doppelte Begründung eigenartig. Offensichtlich hatte sich Cajetan auf die kursächsische Argumentationslinie des Schriftbeweises eingestellt: Luthers Theologie ist schriftwidrig und deshalb als häretisch zu verdammen – ganz unabhängig vom Verstoß gegen die päpstliche Autorität. Der römische Legat schlug damit Wege ein, die für Luther hätten tödlich enden können. Der Kurfürst hielt dem Kardinal auf dieses Schreiben entgegen, daß es in Sachsen viele Gelehrte gäbe, die in das Verdammungsurteil über Luther nicht einstimmen würden. Erst wenn Luther tatsächlich als Häretiker überführt sei, werde er, der Landesfürst, mit Gottes Hilfe auch ohne Drängen von außen nach Ehre und Gewissen zu handeln wissen.10
Was aber geschieht, wenn Luther tatsächlich als Ketzer überführt wird und dann nicht mehr auf das antirömische Ressentiment der Deutschen bauen kann? Das Schreiben des Kurfürsten ist alles andere als die Stellungnahme eines behutsamen Diplomaten, der sich zu nichts verpflichtet und alle seine Schritte offenhält. Aus heutiger Sicht gehört das Jahr 1518 in die Frühphase der Reformationsgeschichte, und eine solche Festlegung, wie sie der Kurfürst gegenüber Cajetan vornimmt, erscheint deshalb übereilt.
Die Zeitgenossen von damals werteten die Ereignisse allerdings anders: Für sie gehörte Luthers Verhör bereits in die Spätzeit der Reformationsbewegung, die schon ein Jahrhundert lang, seit dem Konzil zu Konstanz (1414–1418) die Kirche in Atem hielt und Deutschland in Erregung versetzte.
Man kann Entscheidungen nicht auf ewig hinausschieben; aus der Antwort an Cajetan spricht der selbstbewußte Landesherr, der um die Entscheidungszeit des Ringens um die Reform der Kirche weiß und darum als christlicher Fürst in eigener Zuständigkeit handelt: Ist er als Ketzer entlarvt, wird Martin Luther verurteilt; ist er der Kurie nur der unbequeme Reformer, bleibt er in Amt und Würden.
Luther erfaßte die Bedeutung dieser Antwort sogleich, als er durch seinen Freund und Schüler Georg Spalatin, Geheimer Rat des Fürsten, eine Kopie des Schreibens zu lesen bekam: »Zu guter Letzt wird auch er [Cajetan] lernen müssen, daß weltliche Macht gleichfalls von Gott herrührt … Ich bin beglückt, daß der Kurfürst in dieser Angelegenheit seine geduldige und weise Ungeduld gezeigt hat.«11
3. Der Wahlsieg König Karls
Die Angelegenheit ›Luther‹ wäre nie ein deutsches Ereignis geworden, sondern hätte als bloßes sächsisches Ärgernis spätestens im Sommer 1520 ihr undramatisches Ende genommen, wenn der Einfluß des Kurfürsten über Nacht nicht erheblich gewachsen wäre. Der Tod Kaiser Maximilians I. am frühen Morgen des 12. Januar 1519 im österreichischen Wels, unweit Linz, veränderte die politische Lage im Reich gründlich. Auf dem Reichstag zu Augsburg, seinem letzten, hatte sich Maximilian – bereits schwerkrank – für die Wahl seines Enkels Karl zum Römischen (deutschen) König stark gemacht. Sein Tod und das sofort einsetzende Intrigenspiel, das diplomatische und weniger diplomatische Ringen um die in Augsburg eben doch nicht endgültig festgelegte Nachfolge Maximilians, durchbricht den ›normalen‹ Ablauf der Luthersache. Erst jetzt, im Zuge des entbrennenden Wahlkampfes, wird der römische Ketzerfall zur deutschen Sache.
Friedrichs gescheite, selbstbewußte, aber durchaus nicht herausfordernde Antwort, die zusammen mit Luthers Stellungnahme umgehend nach Rom geleitet wurde, war seine letzte Möglichkeit, die Angelegenheit hinauszuschieben. Nach einer Verurteilung durch Rom aber hätte er den Mönch nicht länger schützen können und gemäß den eigenen, erklärten Prinzipien auch nicht schützen wollen, da dann die höchste kirchliche Autorität ihren Spruch gefällt haben würde.
Doch der Tod des Kaisers wendete die Lage, und zwar auch für Rom. Die kaiserlose Zeit hatte eine Machtlücke zur Folge, in der die Kurfürsten weit über ihre Länder hinaus an Bedeutung gewannen. Die deutsche Königswahl, so hatte es das Reichsgesetz der Goldenen Bulle 1360 bestimmt, lag in den Händen von sieben Fürsten, dieses Wahlrechts wegen Kur(Wahl)fürsten genannt: die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, die weltlichen Herren vom Böhmen, der Pfalz, Brandenburg und Sachsen. Gegen Ende des Augsburger Reichstags, am 27. August 1518, hatte Maximilian eine Mehrheit des Wahlkollegiums für die Erhebung seines Enkels zum deutschen König gewinnen können. Nur Trier und Sachsen waren noch nicht bereit gewesen, sich festzulegen: Der Trierer Erzbischof wohl wegen seiner engen französischen Verbindungen; der Sachse hingegen hatte sich auf das Recht berufen, auf die Wahlordnung der Goldenen Bulle, und das mag auch tatsächlich sein Beweggrund gewesen sein.
Damit sind die Grenzen dessen erreicht, was historisch zu rekonstruieren ist. Von der Geheimdiplomatie, die seit dem Tod des Kaisers einsetzte, ist naturgemäß nur ein Teil aktenkundig geworden. Von Wahlgeschenken der um die Krone wetteifernden Kandidaten ist vieles bekannt, doch neue Entdeckungen lassen die Vermutung zu, daß von den finanziellen Manövern erst die Spitze des Eisbergs sichtbar geworden ist. Sicher ist, daß nach vorübergehendem Engagement des englischen Königs Heinrich VIII. und nach einem sächsischen Zwischenspiel, als der Papst den Kurfürsten Friedrich zur Kandidatur bewegen wollte, nur zwei ernsthafte Konkurrenten einander gegenüber standen: König Franz I. von Frankreich und Karl I., Herzog von Burgund, König von Spanien und Neapel-Sizilien und, zusammen mit seinem Bruder Ferdinand, Erbe der österreichischen Lande. Sollte er gewählt werden, würde der Kaiser eine bis dahin unbekannte Machtfülle auf sich vereinigen. Unter diesen Umständen mußte seine Kandidatur den Papst wie den französischen König herausfordern und auf lange Zeit, weit über die Wahl hinaus, zu Verbündeten machen.
Der finanzielle Aufwand, um die Wahl des einen oder anderen Kandidaten durchzusetzen, sprengte alle bis dahin gekannten Maßstäbe. Das Haus Habsburg wendete fast eine Million Gulden auf, von denen der größte Teil durch das Bankhaus der Fugger vorfinanziert wurde. Für Frankreich kennt man die exakten Zahlen nicht, doch scheint das Engagement des französischen Königs erheblich gewesen zu sein. Schon in Augsburg zeigte sich Maximilian über die Höhe der französischen Investitionen zur Bestechung der Kurfürsten bestürzt. Auch der Papst teilte mit offenen Händen aus und war großzügig im Angebot von kirchlichen Privilegien und mit der Zusage von Kardinals- und Bischofshüten.
Als das Wahlringen ergebnislos zu bleiben drohte, schlug im Frühjahr 1519 die niederländische Regierung der habsburgischen Lande einen Kompromiß vor, der Deutschland am ehesten den Weg in die Neuzeit gebahnt hätte, weil er der bereits im Spätmittelalter einsetzenden Entwicklung zu einem Europa der Nationen Rechnung trug: Nachfolger Maximilians sollte nicht Karl, sondern sein um drei Jahre jüngerer Bruder, Erzherzog Ferdinand, werden. Er wäre tatsächlich für alle Parteien als deutscher König annehmbar gewesen. Doch Karl hat diesen Vorschlag entrüstet und erzürnt zurückgewiesen: Die ›Verteidigung der Christenheit‹ erfordere ein starkes, universales Kaisertum.
Es war nicht Machthunger, der Karl nach der römischen Kaiserkrone greifen ließ; und sein Versprechen, später mit Ferdinand die Regentschaft zu teilen, hat er auch eingehalten. Zwölf Jahre später, lange vor seiner Abdankung im Jahre 1555, sollte er, gegen den Protest des der Wahl ferngebliebenen sächsischen Kurfürsten, seinen Bruder, Erzherzog Ferdinand, zum Römischen König wählen lassen. Die zwölf Jahre bis zur Erhebung Ferdinands sind entscheidend gewesen, für Deutschland wie für die Reformation.
Im Januar 1524 zeichnete sich für den Streit um die Reform der Kirche eine deutsche Lösung ab. Der dritte Reichstag zu Nürnberg entschied, für den Martinstag, am 11. November 1524, ein Nationalkonzil nach Speyer einzuberufen, ›eine gemeine Versammlung‹ deutscher Nation,12, um die Lutherfrage zu klären. Daß die Kurie in Rom diesem Reichstagsabschied Widerstand entgegensetzte, läßt sich leicht verstehen, würde doch durch ein solches Konzil die Gefahr verstärkt, daß die Deutschen ihre Kirche unabhängig von Rom zur Nationalkirche umgestalten. Für Frankreich hatte der Papst diese spätmittelalterliche ›Los-von-Rom-Bewegung‹ noch eben durch ein großzügiges Konkordat mit König Franz I. verhindern können. Als 1534, zehn Jahre nach dem Reichstagsbeschluß von Nürnberg, König Heinrich VIII. zur Etablierung der englischen Kirche schritt, war die Kurie nicht mehr in der Lage, sich dieser Umwälzung mit Erfolg entgegenzustemmen. In Deutschland hätte die nationalkirchliche Lösung eine ebenso reelle Chance gehabt wie in England, wenn nicht der Kaiser gewesen wäre.
ENDE DER LESEPROBE