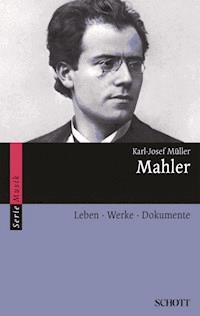
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schott Music
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Gustav Mahler wird heute mehr denn je als »Wegbereiter der Neuen Musik« gefeiert. Wie kaum ein anderer Komponist des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist er kometengleich ins Zentrum der musikalischen Öffentlichkeit gerückt. Mahlers Musik ist ein Abenteuer, so schön und furchterregend, so beschaulich und unberechenbar wie die Welt, von der sie redet. Zu Lebzeiten war Gustav Mahler eher als mächtiger Hofoperndirektor und weniger als Komponist bekannt, denn eigene Werke konnte er nur während der Sommermonate komponieren. Als solcher musste sich Mahler jedoch mit seinen Zeitgenossen Anton Bruckner und Richard Strauss messen. Diese Diskrepanz zwischen Mahlers hohem ethischen Anspruch als Komponist und seiner Qualifizierung durch die Umwelt versucht Karl-Josef Müller in seinem neu aufgelegten Buch zu beleuchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 879
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Josef Müller
Mahler
Karl-Josef Müller
Mahler
Leben — Werke — Dokumente
SCHOTT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bestellnummer SDP 121
ISBN 978-3-7957-8545-1
© 2015 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Als Printausgabe erschienen unter der Bestellnummer SEM 8418
©1988, 2010Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
www.schott-music.com
www.schott-buch.de
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung kopiert und in ein Netzwerk gestellt werden. Das gilt auch für Intranets von Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen.
Inhalt
Vorwort
Zeittafel
Biographie
Jugend und Lehrjahre (1860–1881)
Kleinbürgerliches Elternhaus
Garnisonsstadt Iglau
Weltstadt Wien: Lehrjahre
Verehrung für Bruckner – Enthusiasmus für Wagner
Jugendfreunde
Keine Auszeichnung für Das klagende Lied
Wanderjahre (1881–1888)
»Theaterhöllenleben« in Laibach und Olmütz
Preußische Disziplin in Kassel
Johanna Richter – Lieder eines fahrenden Gesellen
Kapellmeister bei Angelo Neumann in Prag
Rivalität mit Nikisch in Leipzig
Auf Webers Spuren: Die drei Pintos
Die 1. Sinfonie
Budapest (1888–1891)
Ein 28jähriger als Operndirektor
Wagner auf Ungarisch!
Kapellmeistermusik? – Mißerfolg der »Ersten«
Pressekritik an Mahlers Arbeit
Hamburg (1891–1897)
Pollinis Erfolgsrezept
Hans von Bülow
Gastspiel in London
Konflikte mit Pollini
Bülows Abscheu gegenüber Mahlers Musik – Arbeit an der 2. Sinfonie
Verstärkte Kontakte zu Richard Strauss
Felix Weingartner
Erfolg der 2. Sinfonie – Anna von Mildenburg
Arbeit an der 3. Sinfonie
Cosima Wagner
Wien in Sicht!
Wien (1897–1907)
Der Geist Potemkins
Kapellmeister Mahler debütiert mit Lohengrin
Stellvertretender Direktor
»Gott der südlichen Zonen«
Mit eisernem Besen
Mahler und Hans Richter
Anna von Mildenburg in Wien
Mahler übernimmt die Philharmonischen Konzerte – Antisemitische Hetze
Publikumserfolg der »Zweiten« in Wien
Sommer 1899 in Aussee
Optimale Ensemble–Arbeit durch Neu–Engagements
Sakrileg an Beethovens »Neunter«!
Richters Abschied
Wiederbelebung der Freundschaft mit Richard Strauss
Mit den Philharmonikern in Paris
Sommer 1900 in Maiernigg – Vollendung der 4. Sinfonie
Triumph der »Zweiten« in München – »Fort mit den Programmen!«
Desaster der »Ersten« in Wien – Bruch mit den Philharmonikern
Sommer 1901 in Maiernigg – Rückert-Lieder und Arbeit an der »Fünften«
Bruno Walter in Wien
Uraufführung der »Vierten« in München
Alma Maria Schindler wird Mahlers Frau – Wiens junge Kunstszene
Uraufführung der »Dritten« in Krefeld – Durchbruch zu internationalem Ansehen
Sommer 1902 in Maiernigg – Vollendung der 5. Sinfonie
Alfred Roller – Einfluß der Sezession
Zunehmende Gastdirigate
Erste Erfolge in Amsterdam
Probleme mit der Generalintendanz
Vollendung der »Sechsten« und der Kindertotenlieder
Uraufführung der »Fünften« und der Kindertotenlieder
Mahlers Werk auf dem Weg ins Repertoire
Pfitzners Rose vom Liebesgarten
Strauss’ Salome wird von der Wiener Zensur abgelehnt!
Die »Siebte« »in einem Furor«
Mozart-Zyklus in der Hofoper
Gastdirigate und neue Presse-Attacken
Uraufführung der »Sechsten«
Maiernigg 1906: Die 8. Sinfonie – Figaro in Salzburg
Die letzte Wiener Saison
Der schicksalsschwere Sommer 1907
Verhandlungen in New York
Amerika (1908–1911)
Kraftakt ohne Tatkraft
Mahler und Toscanini?
Plan eines Mahler-Orchesters
Erste Rückkehr nach Europa – »Dunkel ist das Leben, ist der Tod«
Uraufführung der »Siebten«
Zum zweiten Mal in den USA
Mahler wird Chef der New Yorker Philharmoniker
Sommer 1909 in Toblach – Die »Neunte«
Dritter Aufenthalt in New York
Vorbereitung der Uraufführung der »Achten« aus der Ferne
Sommer 1910: Ehekrise – Arbeit an der »Zehnten«
Uraufführung der »Achten«
Gerüchte um Mahlers New Yorker Zukunft
Zum letzten Mal in New York
Probleme mit Orchester und Damenkomitee
Krankheit
Rettungsversuch in Paris
Tod in Wien
Dokumente
Alma Mahler
Bruno Walter
Natalie Bauer-Lechner
Berta Zuckerkandl
Alfred Roller
Anna Bahr-Mildenburg
Erinnerungen an Gustav Mahler
Verzeichnis der Abkürzungen
Chronologisches Werkverzeichnis
Literaturverzeichnis (Auswahl)
Register
Vorwort
Die Musik Gustav Mahlers ist seit den sechziger Jahren in ständig steigendem Maße zum selbstverständlichen Repertoire von Konzert- und Rundfunkprogrammen in aller Welt geworden, und auch die Schallplattenindustrie hat sich ihrer in einer Intensität angenommen, wie es in diesem Maße keinem Komponisten der vergangenen hundert Jahre widerfahren ist; weder Richard Strauss noch Max Reger oder Arnold Schönberg haben eine solche Aktualisierung erfahren wie Gustav Mahler.
Nach dem Mahler-Fest von 1920 in Amsterdam, dessen Initiator der Dirigent Willem Mengelberg war, und dem ersten deutschen Mahler-Fest im April 1921 in Wiesbaden unter der Leitung von Carl Schuricht wurde es still um Gustav Mahler, den Sohn jüdischer Eltern. Nur die Emigranten, allen voran Bruno Walter und Otto Klemperer, Weggefährten des Komponisten aus frühen Jahren, setzten sich im Ausland für ihn ein, bis Leonard Bernstein 1960 zusammen mit Dimitri Mitropoulos das erste große Mahler-Fest nach dem Krieg in New York, Mahlers letzter Wirkungsstätte, arrangierte, von dem in der Tat Signalwirkung an viele Dirigenten vor allem der jüngeren Generation ausging.
Über die Gründe für ein seither auch bei Konzertpublikum und Schallplatten-Sammlern steigendes Interesse an der Musik Mahlers ist viel spekuliert worden. Mag sein, daß die in den sechziger Jahren einsetzende Stereophonie eine auf Raumwirkung angelegte Musik wie die Mahlers begünstigt; mag sein, daß Adornos Mahler-Buch von 1960 ein fachlich interessiertes Publikum aufhorchen ließ, und mag schließlich auch sein, daß der Film Tod in Venedig von Luchino Visconti, der das Adagietto aus der 5. Sinfonie als Untermalung benutzt, sowie der Mahler-Film von Ken Russel, beide aus den frühen siebziger Jahren, ihren Teil dazu beigetragen haben, die Musik Mahlers einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt zum ersten Mal ins Bewußtsein zu rücken: ohne Probleme ist das Verhältnis des Konzertpublikums zu Mahler bis auf den heutigen Tag nicht.
Denn: sich auf Gustav Mahler und seine Musik einzulassen, heißt immer, vertrautes Terrain einer gesicherten Kunst-Ästhetik preiszugeben und sich der »Gefahr« von Ungereimtheiten und Widersprüchen auszusetzen. Gustav Mahlers Musik ist ein Abenteuer, so schön und furchterregend, so beschaulich und unberechenbar wie die Welt, von der sie redet, eine Musik, die als skeptische Reflexion eben dieser Welt, als Widerpart der Realität all jene Brüche, Verletztheiten und hämischen Platitüden in sich aufnimmt, die Kunst zuvor sorgsam von sich fernzuhalten wußte. Darin findet sie ihren »Ton«, und darin ist Mahler sicher auch der natürliche Antipode seines Zeitgenossen Richard Strauss, ohne zugleich auch schon als Ziehvater der zweiten Wiener Schule gelten zu können, deren Sache die Diskontinuität kompositorischen Denkens Mahlerscher Provenienz nicht war.
Was immer aus heutiger Distanz die historische Position Mahlers sein mag – die internationale Musikwissenschaft nimmt sich des Themas »Mahler« seit Jahren mit bemerkenswerter Vehemenz an –: seinen Zeitgenossen war Mahler von alledem nichts, für sie war er zuallererst der mächtigste Hofoperndirektor der damaligen musikalischen Welt, der die Sommermonate nutzte, auch zu komponieren, und sich darin an Bruckner und Strauss messen lassen mußte.
Diesen Sachverhalt versucht das vorliegende Buch durch Präsentation authentischer Belege zu beleuchten und damit jenen tragischen Aspekt dieses Lebens, die Diskrepanz zwischen Mahlers hohem ethischen Anspruch als Komponist und der Qualifikation durch die Umwelt, in den Vordergrund zu stellen.
Mein Dank gilt vor allem Frau Eleonore Vondenhoff, Frankfurt/M., die mir immer wieder Einblick in ihre unvergleichliche private Dokumentation gewährte, sowie Frau Emmy Hauswirth, der Haupt-Sekretärin der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft in Wien, die mir bei der Arbeit im Archiv jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand.
Zeittafel
1860
Gustav Mahler wird am 7. Juli als zweites von vierzehn Kindern des Kaufmanns Bernard Mahler und seiner Frau Maria, geb. Hermann, in Kalischt (Böhmen) geboren.Im Dezember Übersiedlung der Familie nach Iglau (Jihlava), Pirnitzergasse 4. Der Vater betreibt im Hinterhaus eine Spirituosen-Destillation.
R. Wagner darf nach Deutschland zurückkehren. Hugo Wolf geboren, Schopenhauer gestorben. G. Th. Fechner veröffentlicht die Elemente der Psychophysik.
1866
Erster Klavierunterricht. Entscheidende Eindrücke durch die Militärmusik der nahegelegenen Kaserne.
Deutsch-österreichischer Krieg; Schlacht bei Königgrätz. F. Busoni geboren.
1868
Harmonielehre bei Heinrich Fischer.
Meistersinger in München. Requiem von Brahms in Bremen. 1. Sinfonie von Bruckner in Linz.
Max Slevogt und Stefan George geboren. Beginn der Gewerkschaftsbewegung.
1869
Eintritt ins Gymnasium Iglau.
Berlioz stirbt, Pfitzner wird geboren.
1870
Erstes öffentliches Auftreten als Pianist im Stadttheater Iglau. Die Stadt wird ans Eisenbahnnetz angeschlossen.
Ausbruch des deutsch-französischen Krieges.
1871
Im Herbst Wechsel ans Neustädter Gymnasium in Prag, von dem er bereits im nächsten Jahr zurückkehrt.
1872
Bernard Mahler erwirbt das Nachbarhaus, Pirnitzergasse 6. Mahler hört in Iglau zum erstenmal Mozarts Requiem.
R. Wagner siedelt nach Bayreuth über; Grundsteinlegung des Festspielhauses. P. Mondrian geboren.
1875
Sommerferien in der Nähe von Časlau; Bekanntschaft mit dem Domänenverwalter Gustav Schwarz, der sich bei Mahlers Vater für ein Studium am Wiener Konservatorium einsetzt. Gutachten des Pianisten Julius Epstein.
10. Sept. Eintritt ins Konservatorium Wien (Hauptfach Klavier). Freundschaft mit Hugo Wolf, Hans Rott und Guido Adler. Erste Kompositionen, darunter ein Opernprojekt Ernst von Schwaben.
Bruckner wird Lektor an der Wiener Universität. Ravel und Rilke geboren.
1876
23. Juni: Erster Preis bei einem Klavierwettbewerb.
1. Juli: Erster Preis für den I. Satz eines Klavierquartetts. Am 12. September spielt er in einem Konzert in Iglau u. a. eine eigene Violinsonate und ein Klavierquartett.
Erste Bayreuther Festspiele (Ring unter Richter). Erstes technisch brauchbare Telephon.
1877
Mahler fällt bei den Abitur-Prüfungen am Iglauer Gymnasium im Juli durch und holt sie am 12. Sept. nach. Inskription an der Wiener Universität, u. a. Harmonielehre bei Bruckner. Tritt dem »Wiener akademischen Wagner-Verein« bei, verläßt ihn aber 1879 wieder. Walzen-Phonograph von Edison. 2. Fassung der 3. Sinfonie von Bruckner; Mahler fertigt einen Klavierauszug davon an.
1878
11. Juli: Diplom des Konservatoriums. Beteiligt sich mit der Ouvertüre zur nicht vollendeten Oper Die Argonauten am Beethoven-Kompositions-Wettbewerb ohne Erfolg. Gibt Klavierstunden.
Bayreuther Blätter erscheinen. Erlaß des Sozialistengesetzes.
1879
Klavierlehrer auf einem ungarischen Gut in der Nähe von Budapest. Arbeit an der unvollendeten Oper Rübezahl (nur Libretto erhalten).
31. August: Alma Maria Schindler, Mahlers spätere Frau, wird geboren.
1880
Das klagende Lied. Vertrag mit dem Konzert-Agenten Lewy. Erste Kapellmeisterstelle in Bad Hall.
Jaques Offenbach gestorben.
1881
Mahler beteiligt sich mit dem Klagenden Lied, erneut ohne Erfolg, am Beethoven-Wettbewerb.
Kapellmeister am »Landschaftlichen Theather« in Laibach (Ljubljana).
Neutralitätsvertrag Österreich, Deutschland, Rußland. Erste deutsche elektrische Straßenbahn in Lichterfelde bei Berlin.
1882
Im März Ende der Kapellmeistertätigkeit in Laibach, Klavierunterricht in Wien. Arbeit an einer Nordischen Symphonie (verschollen) und an der Oper Rübezahl.
Strawinsky geboren. Berliner Philharmoniker unter Hans von Bülow gegründet.
1883
Januar bis März Kapellmeister in Olmütz; im April Chordirigent einer Stagione-Truppe im Carl-Theater Wien. Erster Besuch der Bayreuther Festspiele.
Ab August zweiter Kapellmeister und Chordirektor am Königlich-preußischen Theater in Kassel.
Wagner gestorben, Webern geboren. Eröffnung der Metropolitan Opera in New York.
1884
Beginn der Arbeit an der 1. Sinfonie. Bülow gastiert mit der Meininger Hofkapelle in Kassel. Bühnenmusik zu Der Trompeter von Säkkingen. Ab November Leiter des »Mündener Gemischten Gesangvereins«. Bewerbung bei Angelo Neumann, der noch Theaterdirektor in Bremen ist. Dezember Beginn der Komposition der Lieder eines fahrenden Gesellen.
Smetana gestorben.
1885
April: Dem Gesuch um Entlassung in Kassel wird stattgegeben. Im Juni dirigiert Mahler beim Musikfest in Kassel Mendelssohns Paulus. Ab August zweiter Kapellmeister am Deutschen Theater in Prag (Direktor Angelo Neumann). Alban Berg geboren. Erste Leipziger Mustermesse.
1886
Ab August zweiter Kapellmeister neben Arthur Nikisch am Stadttheater Leipzig (Direktor Max Staegemann). Lernt dort den Enkel C. M. von Webers kennen.
Liszt gestorben. Berner Konvention zum Schutze geistigen Eigentums.
1887
Bearbeitung der Skizzen zur Oper Die drei Pintos von C. M. von Weber. Im Februar übernimmt Mahler für den erkrankten Nikisch dessen gesamtes Repertoire, u. a. den Ring. Beginn freundschaftlicher Beziehungen zu Richard Strauss.
Chagall geboren. Erfindung des Platten-Grammophons durch Emil Berliner.
1888
Uraufführung der Drei Pintos am 20. Januar im Stadttheater Leipzig. Vollendung der 1. Sinfonie. Mahlers Gesuch um Entlassung wird stattgegeben.
Niederschrift des I. Satzes der 2. Sinfonie (Totenfeier). Ab Oktober Direktor der Königlich Ungarischen Oper in Budapest.
Kaiser Wilhelm I. gestorben.
1889
Mahler führt Rheingold und Walküre in ungarischer Sprache auf. Tod der Eltern und der Schwester Leopoldine. 20. November: Uraufführung der 1. Sinfonie in Budapest.
R. Strauss wird Hofkapellmeister in Weimar. Weltausstellung in Paris (Eiffelturm). Erzherzog Rudolf von Österreich erschießt seine Geliebte und sich.
1890
Engagementsverhandlungen mit B. Pollini in Hamburg. Brahms hört in Budapest mit Begeisterung eine Aufführung von Mozarts Don Giovanni unter Mahler.
Cavalleria rusticana von Mascagni in ungarischer Sprache. Aufhebung des Sozialistengesetzes. Erste internationale Maifeiern.
Dunlop entwickelt den Luftreifen.
1891
Neue Statuten für das Budapester Opernhaus führen zu Auseinandersetzungen zwischen Mahler und dem neuen Intendanten Geza von Zichy.
Im März tritt Mahler von der Direktion zurück.
Ab April Erster Kapellmeister am Stadttheater Hamburg (Direktor Bernhard Pollini). Erster Aufenthalt in Steinbach a. Attersee. Mahler spielt Bülow den I. Satz seiner 2. Sinfonie vor.
Prokofiew geboren. Päpstliche Enzyklika Rerum novarum im Sinne sozialer Reformen.
1892
Lieder und Gesänge erscheinen bei Schott.
Juni/Juli: Gastspiel der Hamburger Oper in London.
G. Hauptmann Die Weber. Cholera in Hamburg.
1893
Revision der 1. Sinfonie. Komposition des II. und III. Satzes der 2. Sinfonie und einiger Wunderhorn-Lieder. 27. Oktober Aufführung der revidierten Fassung der 1. Sinfonie und einiger Wunderhorn-Lieder.
Tschaikowsky gestorben. Nansens Nordpol-Expedition.
1894
Ab Februar: Übernahme der Leitung der Philharmonischen Konzerte nach Bülows Tod. Aufführung der 1. Sinfonie ohne Blumine-Satz bei der 30. Tonkünstler-Versammlung in Weimar. Vollendung der 2. Sinfonie. Bruno Walter wird Korrepetitor und Chordirektor am Hamburger Theater.
R. Strauss wird Hofkapellmeister in München.
Debussy L’Après-midi d’un Faune.
1895
Tod des Bruders Otto. Die ersten drei Sätze der 2. Sinfonie werden auf Veranlassung von Strauss in Berlin aufgeführt. Entwurf der Sätze II bis VI der 3. Sinfonie. 13. Dezember:
Uraufführung der gesamten 2. Sinfonie in Berlin. Hindemith und Orff werden geboren. Entdeckung der Röntgen-Strahlen.
1896
16. März: Uraufführung der Lieder eines fahrenden Gesellen in Berlin. Beendigung der 3. Sinfonie. Mahler bewirbt sich um eine Kapellmeister-Stelle an der Wiener Hof Oper. Bruckner und Clara Schumann gestorben. Erfindung der Drehbühne (München). Erste Olympische Spiele der Neuzeit in Athen.
1897
Mahler bittet im Januar um seine Entlassung in Hamburg. Am 23. Februar tritt er zum katholischen Glauben über. Aufführung des II., III. und VI. Satzes der 3. Sinfonie in Berlin. Konzerttournee nach Rußland. Konzerte in München und Budapest, dazwischen Engagements-Verhandlungen in Wien.
11. Mai: Antrittsvorstellung mit Lohengrin in Wien.
13. Juli: Ernennung zum Stellvertreter des Direktors Jahn, am 8. Oktober Ernennung zum Artistischen Direktor der Wiener Hofoper.
Brahms gestorben. Die »Christlich-Soziale Partei« gewinnt die Wiener Bürgermeisterwahl.
1898
Mahler wird Mitglied der Leitenden Kommission der »Denkmäler der Tonkunst in Österreich«. Er bezieht die Wohnung in Wien III., Auenbruggergasse 2 (Rennweg 5), die erst 1909 aufgelöst wird. Ab September Nachfolger Hans Richters als Leiter der Philharmonischen Konzerte. Erste ungekürzte Aufführung des Ring in Wien.
R. Strauss wird Hofkapellmeister in Berlin. Gershwin geboren. Bismarck gestorben. Erste Ausstellung der Wiener »Sezession«. Entdeckung des Radiums durch das Ehepaar Curie.
1899
Zunehmende antisemitische Angriffe auf Mahler, vor allem in der Deutschen Zeitung. Beginn der Arbeit an der 4. Sinfonie. Erwerb eines Grundstücks in Maiernigg am Wörthersee.
Johann Strauß gestorben. Haager Friedenskonferenz. Erstes registriertes Autoopfer in den USA.
1900
Aufführung einiger Orchesterlieder in Wien.
Mahler führt Beethovens 9. Sinfonie mit eigenen Retuschen auf. Konzerte der Wiener Philharmoniker unter Mahlers Leitung bei der Weltausstellung in Paris. Vollendung der
4. Sinfonie. Franz Schalk wird Kapellmeister an der Hofoper. Einbau einer Drehbühne. Wiener Erstaufführung der 1. Sinfonie.
Gründung der »Neuen Bachgesellschaft«. Nietzsche gestorben. Plancks Begründung der Quantentheorie.
1901
Mahler engagiert Leo Slezak. 17. Februar: Uraufführung von Das klagende Lied in Wien. Operation, danach Erholungin Abbazia (Opatija); dort Arbeit an der 4. Sinfonie. Im April Rücktritt von der Leitung der Philharmonischen Konzerte. Erste Entwürfe der 5. Sinfonie; Orchesterlieder auf Wunderhorn- und Rückert-Texte, darunter drei Kindertotenlieder. Bruno Walter wird neben Schalk erster Kapellmeister an der Hofoper. Im November: erste Begegnung mit Alma Schindler. 25. November: Uraufführung der 4. Sinfonie in München.
Verdi gestorben. Erstes deutsches Bach-Fest in Berlin. Beginn der »blauen Periode« Picassos.
1902
9. März: Heirat mit Alma Schindler. Konzertreise nach Petersburg. Beginn der Verbindung zu Künstlern der Wiener »Sezession«, u. a. zu Alfred Roller. 9. Juni: Uraufführung der 3. Sinfonie in Krefeld. Erste Begegnung mit Willem Mengelberg. Vollendung der 5. Sinfonie. 3. November: Geburt von Maria Anna (»Putzi«).
Strawinsky nimmt Unterricht bei Rimskij-Korsakow in Heidelberg. Urheberrechtsgesetz an Werken der Literatur und Musik tritt in Kraft. Opposition der ungarischen Unabhängigkeitspartei im österreichischen Parlament.
1903
Intensivierung der Dirigiertätigkeit vor allem eigener Werke. Beginn der Zusammenarbeit mit Roller. Mahler tritt der »Genossenschaft deutscher Tonkünstler« bei. Beginn der Arbeit an der 6. Sinfonie.
In der Hofoper wird der Orchesterraum tiefer gelegt.
Erste Aufführung einer Mahler-Sinfonie (»Dritte«) in Holland.
Hugo Wolf gestorben. Gründung des »Deutschen Museums« in München. Fertigstellung der transsibirischen Eisenbahn.
1904
Wiener Erstaufführung von Wolfs Corregidor. Mahler lernt A. Schönberg kennen. Er wird Ehrenpräsident der »Vereinigung Schaffender Tonkünstler«.
15. Juni: Geburt von Anna Justine (»Gucki«).
Vollendung der 6. Sinfonie, Komposition der letzten Kindertotenlieder, Arbeit an der 7. Sinfonie. 18. Oktober: Uraufführung der 5. Sinfonie in Köln. Erste Aufführung einer Mahler-Sinfonie (»Vierte«) in den USA.
Eduard Hanslick gestorben. Salvador Dalí geboren. New York bekommt eine U-Bahn.
1905
29. Januar: Uraufführung der Kindertotenlieder in Wien. Im März sagt Mahler eine Konzerttournee nach Moskau wegen Revolutionsunruhen ab. Die kaiserliche Zensurbehörde verbietet eine Aufführung der Oper Salome von R. Strauss an der Wiener Hofoper.
Richard Spechts Mahler-Biographie erscheint. G. Craig Die Kunst des Theaters. Lehar Lustige Witwe. Medizin-Nobelpreis an Robert Koch (Tuberkulose-Forschung).
1906
27. Mai: Uraufführung der 6. Sinfonie in Essen. Mahler bearbeitet Webers Oberon. Komposition der 8. Sinfonie. Gastspiel der Wiener Hofoper beim ersten Salzburger Mozartfest (Figaros Hochzeit).
Erstes Gastspiel von Enrico Caruso in Wien.
Kritische Gesamtausgabe der Briefe Beethovens erscheint. Gründung des Jüdischen Museums in Prag.
Erdbeben und Großfeuer zerstören San Francisco.
1907
Verstärkte Wiener Pressekampagne gegen Mahler. Demission. Tod der ältesten Tochter Maria Anna. Bei Mahler wird ein Herzfehler festgestellt. Abreise nach New York. Gründung der Künstlergruppe »Die Brücke« in Dresden. Zusammenschluß der Christlich-Sozialen Partei Österreichs mit den Deutschklerikalen. Allgemeines Wahlrecht in Österreich. Papst Pius X. gegen »Modernismus«.
1908
Dirigent an der Metropolitan Opera in New York. Gastspiel in Boston. Pläne für ein »Mahler-Orchester«, die aber wieder fallengelassen werden. Komposition des Lied von der Erde in Toblach, wo Mahler bis zu seinem Tode jeweils die Sommermonate verbringt. 19. September: Uraufführung der 7. Sinfonie in Prag. Beginn der zweiten Saison in New York. Gastdirigent des »New York Symphony Orchestra«.
Rimskij-Korsakow gestorben. Kubismus in Frankreich. Österreich-Ungarn annektiert – von Deutschland unterstützt – Bosnien und Herzegowina.
1909
Rodin-Büste in Paris. Komposition der 9. Sinfonie. Dritte Saison in New York: Dirigent des »New York Philharmonie Orchestra«. Einführung sogenannter Historischer Konzerte. Richard Strauss Elektra. Futuristisches Manifest von Marinetti.
1910
In Toblach Entwürfe zur 10. Sinfonie. Schwere Ehekrise. Mahler sucht Sigmund Freud in Holland auf. 12. September: Uraufführung der 8. Sinfonie in München. Aufbruch zur vierten und letzten Saison in New York.
Strawinsky Feuervogel. Erster Dieselmotor für Kraftwagen. Brücke über den East-River in New York.
1911
Unstimmigkeiten mit der »Philharmonie Society«. Krankheit und Rückkehr nach Europa. Behandlungsversuche in Paris, die erfolglos bleiben.
Gustav Mahler stirbt am 18. Mai in Wien. Die Beisetzung findet am 22. Mai auf dem alten Grinzinger Friedhof statt. Schönberg Harmonielehre (Mahler gewidmet). Regierungskrise in Österreich, Unruhen werden blutig niedergeschlagen.
Biographie
Jugend und Lehrjahre (1860–1881)
Kleinbürgerliches Elternhaus
Am Sonntag, den 21. Oktober 1860 erscheint in der Wiener Zeitung ein »Kaiserliches Manifest«, in dem es u. a. heißt:
Ich habe von den Wünschen und Bedürfnissen der verschiedenen Länder der Monarchie Kenntniß nehmen wollen und demzufolge mittelst meines Patentes vom 5. März l. J. Meinen verstärkten Reichsrath gegründet und einberufen.
In Erwägung der mir von demselben überreichten Vorlagen habe ich mich bewogen gefunden, in Betreff der staatsrechtlichen Gestaltung der Monarchie, der Rechte und der Stellung der einzelnen Königreiche und Länder ebensowohl, wie der erneuten Sicherung, Feststellung und Vertretung des staatsrechtlichen Verbandes der Gesammt-Monarchie am heutigen Tage ein Diplom zu erlassen und zu verkünden.
Ich erfülle Meine Regentenpflicht, indem Ich in dieser Weise die Erinnerungen, Rechtsanschauungen und Rechtsansprüche Meiner Länder und Völker mit den tathsächlichen Bedürfnissen Meiner Monarchie ausgleichend verbinde...
Als Kaiser Franz Joseph I. dieses Manifest erläßt, befindet sich der Habsburgerstaat, Konglomerat aus einer Vielzahl von Völkern, Sprachen und Religionen, in großen Schwierigkeiten. Jahrzehntelange Ignoranz gegenüber den Autonomiebestrebungen der Kronländer und eine Fehleinschätzung der Kräfteverhältnisse in Europa hatten erst ein Jahr zuvor zu den Schlachten von Magenta und Solferino geführt, in denen die Monarchie empfindliche Verluste erlitten hatte. Die schweren Staatsdefizite und die Unruhe unter den Völkern zwingen den Kaiser zum Handeln. Er greift zu einem Mittel, das – im sogenannten Oktoberdiplom niedergelegt – zweierlei bewirkt: indem er die politische Bevormundung der Kronländer reduziert und den Untertanen größere Mobilität zugesteht, aktiviert er zugleich die Wirtschaft, die damit ihren Teil zur Gesundung der Staatsfinanzen beitragen kann. Solche Politik schlägt durch bis auf die untersten Ebenen der ökonomischen Pyramide und bietet auch dem Handelsmann Bernard (Baruch) Mahler1 aus Kalischt in Böhmen die Chance zu wachsender Reputation und sozialem Aufstieg. Bernard Mahler hatte in Kalischt ein kleines Häuschen gekauft, in dessen Fenstern nach der späteren Beschreibung seines Sohnes nicht einmal Scheiben waren [...]. Vor dem Hause breitete sich ein Wassertümpel aus. Das kleine Dorf Kalischt und einige zerstreute Hütten waren alles, was in der Nähe lag2.
Immerhin: Bernard Mahler legt mit dem Erwerb des Häuschens den Grundstein für eine Existenz, die ihm die Gründung einer Familie erlaubt. Im Februar 1857 heiratet er, selbst Sohn jüdischer Eltern, die Tochter des jüdischen Seifensieders Abraham Hermann aus Ledeč, Maria Hermann, die ihn nicht liebte, vor der Hochzeit ihn kaum kannte und lieber einen andern, dem ihre Neigung gehörte, geheiratet hätte3. Bernard Mahler hatte bereits alle möglichen Erwerbsphasen hinter sich und hatte sich mit seiner ungewöhnlichen Energie immer weiter emporgearbeitet4. Die Heirat mit der Tochter aus »besserem Hause« ist – so will es scheinen – ein weiterer Schritt auf dem Weg nach oben. Der großväterliche Seifensieder in Ledeč hielt auf bürgerliche Reputation. In seinem Hause legte man auf Benehmen wert, was Bernhard Mahler als »nobel« erschien. Im Spaß nannte er die Familie des Schwiegervaters »die Herzoge«.5 Er selbst war der Sohn einer »fliegenden Händlerin«, die mit ihren Kurzwaren von Haus zu Haus zog, das Nötigste zum Leben verdiente und ihrem Sohn nicht mehr, aber auch nicht weniger als den Instinkt für das Erreichbare mitgab. Instinkt und ein unbeirrbarer Ehrgeiz des Vaters, der allzu oft in erster Linie als »Trieb- und Sinnenmensch« hingestellt worden ist, stellen jene Faktoren dar, ohne die der Werdegang des jungen Gustav Mahler nicht verständlich wird. Wahr bleibt wohl dennoch, daß Bernard Mahler seine Frau immer wieder aufs abscheulichste demütigt und daß sich die hinkende und ihr Leben lang herzkranke Mutter dem Sohn als Inkarnation des Leidens tief ins Bewußtsein einprägt.
In Kalischt ist die junge Familie noch klein. 1858 war das erste Kind, Isidor, geboren, aber bereits im Jahr darauf gestorben, so daß der zweite Sohn, Gustav, der am 7. Juli 1860 zur Welt kommt, der Älteste ist. Aber er ist kaum ein halbes Jahr alt, als der Vater beschließt, Kalischt zu verlassen. Das kaiserliche »Oktoberdiplom« gewährt nun auch den jüdischen Mitbürgern Niederlassungsfreiheit, und Bernard Mahler wittert sofort die Chance: die Familie übersiedelt am 22. Oktober 1860 in das nahegelegene Städtchen Iglau (heute: Jihlava) auf mährischem Boden, einem Zentrum der Leder- und Textilmanufaktur, in dem man überwiegend deutsch spricht.
Kurz nach dem Umzug im Dezember 1860 muß Bernard Mahler bereits einen Antrag beim zuständigen Bezirksamt eingereicht haben, in dem er um die Genehmigung zur Herstellung und zum Ausschrank von Branntwein oder Likör nachsucht. Am 28. Februar 1861 erhält er folgenden Bescheid:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























