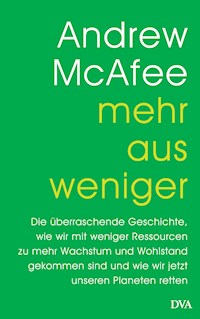
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wie der Kapitalismus doch noch die Welt rettet
Die Menschheit hat einen Scheitelpunkt ihrer Geschichte erreicht, und das Fazit ist verblüffend: Trotz stetigen Bevölkerungswachstums verbrauchen wir Jahr für Jahr weniger Ressourcen für Energie und Konsumgüter. Wie kann das sein, wo wir doch vom Gegenteil überzeugt sind? Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Andrew McAfee stützt seine brillante Analyse auf skrupulös erarbeitetes Zahlenmaterial und zeigt, welche technologischen Errungenschaften diese Wende herbeigeführt haben. Dennoch müssen wir den realen Bedrohungen von Erderwärmung, Verschmutzung und Überfischung der Ozeane begegnen. Dieses Buch wird einen Paradigmenwechsel einläuten, wenn es darum geht, über unseren Planeten und seine Ressourcen fernab von Alarmismus fundiert zu diskutieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Ähnliche
Über das Buch
Die Menschheit hat einen Scheitelpunkt ihrer Geschichte erreicht, und das Fazit ist verblüffend: Trotz stetigen Bevölkerungswachstums verbrauchen wir Jahr für Jahr weniger Ressourcen für Energie und Konsumgüter als zuvor. Wie kann das sein, wo wir doch vom Gegenteil überzeugt sind? Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Andrew McAfee stützt seine brillante Analyse auf skrupulös erarbeitetes Zahlenmaterial und zeigt, welche technologischen Errungenschaften diese Wende herbeigeführt haben. Dennoch müssen wir den realen Bedrohungen von Erderwärmung, Verschmutzung und Überfischung der Ozeane begegnen. Dieses Buch wird einen Paradigmenwechsel einläuten, wenn es darum geht, über unseren Planeten und seine Ressourcen fernab von Alarmismus fundiert zu diskutieren.
Über den Autor
Andrew McAfee, geboren 1967, wurde nach mehreren naturwissenschaftlichen Abschlüssen am MIT an der Harvard Business School promoviert und ist der Ko-Direktor der MIT Initiative on the Digital Economy und stellvertretender Direktor des Center for Digital Business an der MIT Sloan School of Management. Zusammen mit Erik Brynjolfsson hat er das Buch »The Second Machine Age« verfasst, das zu einem Bestseller wurde und 2015 den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis gewann.
Andrew McAfee
Mehr aus weniger
Die überraschende Geschichte, wie wir mit weniger Ressourcen zu mehr Wachstum und Wohlstand gekommen sind – und wie wir jetzt unseren Planeten retten
Aus dem Englischen von Karsten Petersen
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe ist 2019 unter dem Titel More from less. The surprising story of how we learned to prosper using fewer resources – and what happens next bei Scribner in New York erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28,81673 München Copyright © 2019 by Andrew McAfee Umschlaggestaltung: total italic, Thierry Wijnberg (Amsterdam/Berlin) Typografie und Satz: DVA/Andrea Mogwitz E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-24612-9V001www.dva.de
Inhalt
Einleitung
1 All die malthusischen Jahrtausende
2 Macht über die Erde: das Industriezeitalter
3 Industrielle Fehltritte
4 Der Earth Day und seine Debatten
5 Die überraschende Dematerialisierung
6 CRIB-Notizen
7 Was ist die Ursache der Dematerialisierung? Märkte und Wunder der Technik
8 Das hat Adam Smith gesagt: ein paar Worte zum Kapitalismus
9 Was brauchen wir noch? Menschen und Politik
10 Der globale Aufgalopp der vier Reiter
11 Es wird immer besser
12 Die Kräfte der Konzentration
13 Die zentrale Bedeutung zwischenmenschlicher Bindungen: soziale Isolation
14 Ein Blick in die Zukunft: So wird die Welt sauber
15 Interventionen: Wie wir Gutes tun können
Schlusswort
Dank
Anmerkungen
Sachregister
Personenregister
Für meine Mutter Nancy, die ihren Kindern die Welt gezeigt und sie gelehrt hat, sie zu lieben
Wir sind wie Götter, und wir sollten ebenso gut werden wie sie.
Stewart Brand, Whole Earth Catalog, 1968
Einleitung
README
Merk’ auf! Ich will zu dir aufrichtig sein. Ich biete nicht die alten glatten Preise an, sondern saftige neue Preise.
Walt Whitman, »Gesang von der freien Straße«, 1856
Wir haben endlich gelernt, schonender mit unserem Planeten umzugehen. Es wird auch langsam Zeit.
Fast im gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte war unser Wohlstand eng verbunden mit der Fähigkeit, der Erde ihre Ressourcen zu entreißen. Und so war es unvermeidlich, dass wir immer mehr nahmen, je zahlreicher und wohlhabender wir wurden: mehr Mineralstoffe, mehr fossile Brennstoffe, mehr Ackerland, Bäume, Wasser und so weiter.
Aber das hat sich geändert. In den vergangenen Jahren hat sich ein anderes Muster abgezeichnet: mehr aus weniger. In den Vereinigten Staaten von Amerika – einem großen, reichen Land, auf das etwa 25 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung entfallen – nutzen wir heute alles in allem von Jahr zu Jahr immer weniger Ressourcen, obwohl unsere Wirtschaft und Bevölkerung immer weiter wachsen. Und wir verschmutzen Luft und Gewässer immer weniger, setzen weniger Treibhausgase frei und verzeichnen wachsende Bestände zahlreicher Tierarten, die schon beinahe verschwunden waren. Kurzum, Amerika ist »post-peak« in seiner Ausbeutung der Erde, hat den Höhepunkt des Raubbaus also hinter sich gelassen. In zahlreichen anderen wohlhabenden Ländern ist es ähnlich, und selbst in Schwellenländern wie China wird heute schonender mit der Umwelt umgegangen.
Das Thema dieses Buches ist, wie wir die Kurve gekriegt haben, wie es anfing mit dem Mehr-aus-weniger-machen, und wie es von jetzt an weitergehen wird.
Zunächst möchte ich eines betonen: Ich sage nicht, dass heute alles in Ordnung sei oder wir uns keine Sorgen mehr machen müssten – das wären absurde Behauptungen. Die vom Menschen verursachte Erderwärmung ist real und alarmierend, und wir müssen dringend wirksame Maßnahmen zu ihrer Reduzierung ergreifen. Wir müssen auch die Umweltverschmutzung in aller Welt eindämmen und die Tierarten schützen, die durch unser Treiben beinahe ausgestorben sind. Und wir müssen auch in Zukunft Armut, Krankheiten, Unterernährung, gesellschaftlichen Zerfall und andere Probleme bekämpfen, die sich dem Gedeihen der Menschheit in den Weg stellen.
Also haben wir jede Menge Arbeit vor uns. Worauf es mir ankommt, ist diese Feststellung: Wir wissen, wie wir diese Arbeit erfolgreich erledigen können. In weiten Teilen der Welt haben wir schon jetzt die Kurve gekriegt und verbessern nicht nur die Lebensumstände der Menschen, sondern auch den Zustand der Natur. Der Konflikt zwischen diesen beiden Zielen ist beigelegt, und ich bin voller Zuversicht, dass er nie wieder hochkommen wird, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Auf den Seiten dieses Buches will ich erklären, woher ich meine Zuversicht nehme und ich will diese Zuversicht an Sie weitergeben.
Der rote Faden meiner Argumentation
Dieses Buch zeigt, wie wir schon jetzt mehr aus weniger machen, und es erzählt, wie wir diesen entscheidenden Meilenstein erreicht haben. Der seltsamste Aspekt dieser Geschichte ist, dass wir kaum radikale Kursänderungen vollzogen haben, um den Zielkonflikt zwischen dem Gedeihen der Menschheit und der Gesundheit des Planeten zu lösen. Vielmehr sind wir einfach sehr viel besser in dem geworden, was wir schon immer getan haben.
Vor allem sind wir besser darin geworden, den technologischen Fortschritt mit dem Kapitalismus zu verknüpfen, um die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Diese Sicht der Dinge werden viele Leser für grotesk halten, und das aus gutem Grund. Immerhin ist es ja genau diese Kombination, die dazu geführt hat, dass wir seit dem Beginn der industriellen Revolution gegen Ende des 18. Jahrhunderts unseren Ressourcenverbrauch erhöht und die Schädigung der Umwelt massiv vorangetrieben haben. Das Industriezeitalter war eine Ära erstaunlich weitreichender und schnell voranschreitender Verbesserungen des Wohlstands der Menschen, aber diese Verbesserungen gingen auf Kosten unseres Planeten. Wir haben Rohstoffe aus dem Boden gegraben, Wälder abgeholzt, Tiere abgeschlachtet, Luft und Wasser mit Schadstoffen verpestet und unzählige andere Umweltschäden angerichtet. Von Jahr zu Jahr haben wir der Umwelt immer mehr geschadet, ohne dass ein Ende absehbar gewesen wäre.
Dieses Doppelgespann aus technologischem Fortschritt und Kapitalismus trieb uns anscheinend zu mehr Bevölkerungswachstum und Konsum, während wir gleichzeitig unserem Planeten immer größeren Schaden zufügten. Als 1970 das erste Earth-Day-Festival stattfand, zweifelten viele Menschen nicht mehr daran, dass diese beiden Kräfte uns in den Untergang treiben würden, da wir den Planeten nicht endlos weiter ausbeuten konnten.
Und was ist tatsächlich passiert? Etwas völlig anderes. Das ist das Thema dieses Buches. Wie ich zeigen werde, setzte sich der Kapitalismus durch und fand fast überall in der Welt Verbreitung (sehen Sie sich nur einmal um), aber der technologische Fortschritt wandelte sich. Wir erfanden den Computer, das Internet und diverse andere digitale Technologien, die uns unseren Konsum dematerialisieren ließen: Diese Technologien machten es möglich, dass wir immer mehr konsumieren, während wir zugleich dem Planeten immer weniger Rohstoffe entnehmen. Digitale Technologien führen zu Kostensenkungen, weil Materie durch Bits ersetzt wird und der intensive Kostendruck des kapitalistischen Wettbewerbs unzählige Unternehmen motiviert, solche Möglichkeiten weiter auszubauen. Überlegen Sie nur einmal, wie viele andere Geräte Ihr Smartphone ersetzt.
Neben Kapitalismus und technologischem Fortschritt sind zwei andere Kräfte am Werk, die ebenfalls eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, dass wir aus weniger mehr machen: das öffentliche Bewusstsein für die Schäden, die wir unserem Planeten zufügen (etwa Umweltverschmutzung und Artensterben) sowie bürgernahe, reaktionsfähige Regierungen (»responsive governments«), die den Bürgerwillen zügig umsetzen und vernünftige Maßnahmen ergreifen, um solchen Umweltschäden tatkräftig entgegenzuwirken. Sowohl öffentliches Bewusstsein als auch bürgernahes Regieren wurden durch den Earth Day und die Umweltbewegung in den USA und vielen anderen Ländern maßgeblich vorangetrieben.
Ich nenne technologischen Fortschritt, Kapitalismus, öffentliches Bewusstsein und bürgernahes, reaktionsfähiges Regieren die »vier Reiter des Optimisten«. 1 Wenn alle vier präsent sind, kann eine Regierung sowohl die Lebensumstände der Menschen als auch den Zustand von Natur und Umwelt verbessern. Wenn nicht alle vier Reiter gemeinsam galoppieren, werden Mensch und Umwelt leiden.
Die gute Nachricht lautet, dass zurzeit in weiten Teilen der Welt alle vier Reiter vorangaloppieren. Das bedeutet, dass wir nichts radikal verändern müssen, sondern einfach mehr von den positiven Dinge tun sollten, die wir bereits tun. Lassen Sie mich im metaphorischen Sinne vom Pferd aufs Auto umsteigen: Wir müssen das Lenkrad unserer Ökonomien und Gesellschaftsordnungen nicht herumreißen, sondern einfach nur mehr Gas geben.
Hier findet jeder etwas, das ihm nicht gefällt
Während Sie dieses Buch lesen, sollten Sie aufgeschlossen bleiben, weil Sie wahrscheinlich über ein paar Ideen und Schlussfolgerungen stolpern, die Ihnen zunächst gegen den Strich gehen werden. Ich habe festgestellt, dass das fundamentale Konzept dieses Buches – nämlich, dass Kapitalismus und technologischer Fortschritt uns heute in die Lage versetzen, schonender mit der Erde umzugehen, anstatt sie auszuplündern – für viele Menschen schwer zu akzeptieren ist.
Auch für mich war es schwer zu akzeptieren, als ich zum ersten Mal davon hörte – nämlich durch Jesse Ausubels bemerkenswertes Essay »The Return of Nature: How Technology Liberates the Environment« (»Die Rückkehr der Natur: wie Technologie die Umwelt befreit«), das 2015 im Breakthrough Journal erschienen ist. 2 Als ich diese Überschrift las, musste ich sie einfach anklicken, was mich zu einem der interessantesten Texte führte, die ich jemals gelesen habe.
Darin dokumentiert Ausubel die Dematerialisierung der amerikanischen Wirtschaft. Obwohl er sorgfältig und gründlich argumentiert, dachte ich beim Lesen immer wieder: »Na ja, also so kann das ja gar nicht stimmen.« Es fiel mir schwer, mich von der Vorstellung zu lösen, dass eine Wirtschaft immer mehr Rohstoffe verbrauchen muss, wenn sie wächst. Ausubels Essay ließ mich diese Vorstellung hinterfragen und schließlich verwerfen.
Ein wichtiger Teil meiner Forschungsreise bestand darin, eine Erklärung dafür zu finden, wie wir begonnen haben, mehr aus weniger zu machen. Durch welche Ursachen wurde das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt? Was führte zur Dematerialisierung? Wie schon erwähnt und wie Sie in den folgenden Kapiteln sehen werden, ist der Kapitalismus ein großer Teil meiner Erklärung.
Dies ist keine weithin anerkannte Schlussfolgerung. Seit Karl Marx wird der Kapitalismus von unzähligen Menschen leidenschaftlich bekämpft – und von vielen anderen mit großer Skepsis betrachtet. Das heißt, dass viele Menschen mein Plädoyer für den Kapitalismus für ignorant oder etwas noch Schlimmeres halten werden. Falls Sie einer von diesen Menschen sind, bin ich froh, dass Sie dieses Buch lesen. Ich hoffe, dass Sie mir zuhören werden, wenn ich erkläre, wie ich den Kapitalismus sehe, und dass Sie meine Argumente aufgrund der hier präsentierten Daten und Überlegungen beurteilen werden.
Und falls Sie ein Kapitalismus-Fan sind, wird es Ihnen vielleicht nicht gefallen, dass ich hier für neue Steuern (auf CO2-Emissionen) und strenge Regulierungen (gegen Umweltverschmutzung und Handel mit Produkten, die von bedrohten Tierarten stammen) eintrete. Viele eingefleischte Kapitalisten wehren sich gegen solche Ideen. Davon abgesehen schlage ich vor, Kernenergie und gentechnisch veränderte Organismen (GVO) vermehrt zu nutzen – zwei Strategien, die von vielen Menschen vehement abgelehnt werden.
Das heißt, dass sich wahrscheinlich bei fast jedem Leser 3 zunächst das Gefühl einstellen wird, mit diesem Buch könne etwas nicht stimmen. Noch einmal möchte ich Sie bitten: Gehen Sie an Ideen, die ich Ihnen präsentiere, aufgeschlossen heran. Ich hoffe, Sie glauben mir, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen argumentiere. Ich habe nicht die Absicht, eine Polemik zu verfassen oder einen Flamewar zu entfesseln. Nichts liegt mir ferner, als jemanden provozieren oder abqualifizieren zu wollen (mit anderen Worten: Ich will wirklich niemanden aus der Fassung bringen oder Überlegenheit demonstrieren.) Ich will ein Phänomen beschreiben, das ich faszinierend und sehr ermutigend finde, will erklären, wie es entstand und seine Folgen zeigen. Ich hoffe, dass Sie mich auf dieser Reise begleiten.
1 All die malthusischen Jahrtausende
Was auch nur mit dem Krieg aller gegen alle verbunden ist, das findet sich auch bei den Menschen, die ihre Sicherheit einzig auf ihren Verstand und auf ihre körperlichen Kräfte gründen müssen. Da findet sich aber auch kein Fleiß (industria), weil kein Vorteil davon zu erwarten ist; es gibt keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine bequemen Wohnungen, keine Werkzeuge höherer Art, keine Länderkenntnis, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine gesellschaftlichen Verbindungen; statt alles dessen ein tausendfaches Elend; Furcht, gemordet zu werden, stündliche Gefahr, ein einsames, kümmerliches, rohes und kurz dauerndes Leben.
Thomas Hobbes, Leviathan, 1651
Viele Menschen wünschen sich, dass ihr Ruhm die Jahrhunderte überdauern möge, aber wohl kaum als Synonym für »lachhaft falsch«. Unglücklicherweise für ihn (und seine Nachkommen) ist dies die Rolle, die Reverend Thomas Robert Malthus in zahlreichen Diskussionen über das Verhältnis des Menschen zu unserem Planeten zukommt. Malthusisch ist zu einem jener Wörter geworden, die zugleich als Kürzel für ein Argument, dessen Ablehnung und als Beleidigung für jeden, der es vorbringt, gebraucht werden. 1 Dieses Adjektiv ist mittlerweile ein Synonym für grundlosen und mangelhaft informierten Zukunftspessimismus.
In einer Hinsicht ist das völlig gerechtfertigt. Wie wir noch sehen werden, haben sich die düsteren Vorhersagen, die Malthus in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts machte, als so falsch erwiesen, dass sie eine spezielle Bezeichnung verdienen. Doch in einer anderen Hinsicht gehen wir zu streng mit dem guten Reverend um. In den meisten Diskussionen über seine Arbeit wird übersehen, dass er sich zwar im Hinblick auf die Zukunft fundamental irrte, mit seiner Sicht auf die Vergangenheit jedoch weitgehend richtig lag.
Schlechte Schwingungen
Malthus kennt man vor allem für sein 1798 erschienenes Hauptwerk An Essay on the Principle of Population (Versuch über die Bedingung und die Folgen der Volksvermehrung, 1807). Für einen heutigen Leser ist sein Essay keine ganz einfache Lektüre, weil sich nicht nur Stil und Ausdrucksweise über gut zwei Jahrhunderte stark verändert haben, sondern auch, weil seine Formulierungen hier und da einen unbekümmerten Rassismus und lückenhaftes Faktenwissen zutage treten lassen, die aus heutiger Sicht nicht zusammenpassen. So behauptet er zum Beispiel über die Ureinwohner Nordamerikas: »Man machte allgemein die Bemerkung, daß die Amerikanerinnen nichts weniger als sehr fruchtbar waren, daß ihre Ehen selten mehr als zwei oder drei Kinder hervorbrachten. Einige haben diese Unfruchtbarkeit der Weiber der Lauheit der Männer gegen dieselben zuschreiben wollen, welche für die Amerikaner überhaupt charakteristisch seyn soll.« 2
Wenn man solche Passagen liest, kann man leicht zu dem Schluss kommen, sein Essay bestünde aus nichts weiter als selbstgefälligen, Europa-zentrischen Verallgemeinerungen. Doch spätere Forschungen haben gezeigt, dass Malthus durchaus recht hatte. Zwar nicht, was das Sexualleben der nordamerikanischen Ureinwohner angeht, aber bezogen auf einen Aspekt der menschlichen Geschichte, der über verschiedene Gruppen und über lange Zeiträume hinweg erstaunlich beständig ist, nämlich das, was Malthus als »Oscillationen« oder »Schwingungen« der Bevölkerung bezeichnete. Damit meinte er Wachstumsphasen, auf die Zeiten eines Bevölkerungsrückgangs folgten. So schrieb er: »Daß aber wirklich solche Schwingungen in allen ältern Staaten stattfinden, … muß jedem, der über diesen Gegenstand gescheit reflektirt, klar seyn.« 3
Eines der Hauptziele seines Essay war, mathematisch zu zeigen, warum solche »Schwingungen« bei jeder Bevölkerungsgruppe auftreten müssten. Malthus wies ganz richtig darauf hin, dass menschliche Populationen sehr schnell wachsen, wenn keine Kräfte auf sie einwirken, die ihre Größe reduzieren. Wenn ein Paar zwei Kinder hat, die jeweils wieder zwei Kinder bekommen und diese Vermehrung sich ungebremst fortsetzt, dann wird die Zahl der Nachkommen des ursprünglichen Paars sich von Generation zu Generation verdoppeln, von zwei auf vier, dann acht, dann sechzehn und so weiter. Die Menschen haben nur zwei Möglichkeiten, um dieses exponentielle (oder »geometrische«) Wachstum zu bremsen: entweder keine Kinder in die Welt zu setzen oder zu sterben.
Malthus schrieb, dass diese beiden Hemmnisse des Bevölkerungswachstums notwendigerweise auftreten müssten und dass sie häufig genug auftreten müssten, um das Wachstum einer beliebigen Bevölkerungsgruppe zu verlangsamen oder gar ihre Gesamtgröße zu verkleinern. Das müsse aus einem ganz einfachen Grund geschehen: Das Land könne nicht endlos eine exponentiell wachsende Zahl von Menschen ernähren. Malthus war zu dem Schluss gekommen, dass zwar die Bevölkerungsgröße exponentiell zunimmt (2, 4, 8, 16 …), die Menge der zu gewinnenden Nahrungsmittel jedoch nur arithmetisch oder linear (2, 3, 4, 5 …). Einen großen Teil seines Essay verwendet er darauf, seinem Leser die fatalen Folgen dieses Missverhältnisses vor Augen zu führen: »Wir sagen also zuversichtlich, daß, wenn keine Hemmnisse eintreten, die Bevölkerung alle fünf und zwanzig Jahre sich verdoppelt, daß sie in geometrischer Proporzion zunimmt. Das Verhältnis, in dem die Erzeugnisse der Erde sich vermehren, möchte nicht so leicht zu bestimmen seyn. Davon aber können wir uns wenigstens versichern, daß das Verhältnis ihrer Zunahme ein ganz andres, als das der zehrenden Volksmenge ist. Tausend Millionen Menschen verdoppeln sich in fünf und zwanzig Jahren eben so leicht, als simple Tausend. Nicht so die Nahrung. Wenn alles ackerbare Land, ein Morgen nach dem andern, urbar gemacht worden ist, so kann die Zunahme der Nahrungsmittel einzig von der Verbesserung des Landes abhängen. Aber diese Quelle, statt reichlicher zu fließen, würde unfehlbar jährlich mehr und mehr versiegen. Hingegen die Zahl der Verzehrenden würde, wenn nur hinreichende Nahrung geschafft werden könnte, mit unerschöpflicher Kraft sich vermehren, der Ueberschuß der einen Periode würde die folgenden in Stand sezen, einen noch größern zu liefern und so fort ohne Ende.« 4,5
Grenzen des Wachstums
Ist diese Vorhersage tatsächlich eingetroffen? Dank eines großen Bestandes an faszinierenden Forschungsstudien kennen wir heute die Antwort auf diese Frage. Im Laufe der vergangenen 40 Jahre haben Wirtschaftshistoriker, allen voran Angus Maddison mit seiner bahnbrechenden Arbeit, diverse Belegstränge zusammengeführt, die sich über viele Jahrhunderte erstrecken und die Lebensstandards der Menschen zeigen – ihre Möglichkeiten, sich die Dinge anzuschaffen, die sie haben wollten und brauchten.
Lebensstandards werden häufig in Form von Reallöhnen oder – einkommen angegeben. 6 Obwohl die Währungen, die in verschiedenen Ländern verwendet wurden, sich im Laufe der Zeit veränderten, und obwohl Kleinbauern im Mittelalter nicht mit Geld im modernen Sinne dieses Wortes bezahlt wurden, sind die Konzepte von Löhnen und Einkommen nützlich, weil wir mit ihrer Hilfe Wohlstand und Armut auf konsistente Weise untersuchen und vergleichen können. Ein anderer Forschungszweig hat uns ein klares Bild demografischer Entwicklungen im Laufe der Zeiten geliefert – wie groß die jeweiligen Bevölkerungen waren und wie ihre Größen schwankten.
Der Wirtschaftshistoriker Gregory Clark hat diese zwei Arten von Forschungsergebnissen zusammengeführt und daraus meine bevorzugte Sicht des Lebens in England entwickelt, wie es mehr als 600 Jahre vor der Veröffentlichung von Malthus’ Essay gewesen sein dürfte. Es ist kein schönes Bild.
In Clarks Grafik (siehe unten) hat er die Bevölkerungsgröße Englands auf der horizontalen Achse aufgetragen und einen Näherungswert für persönlichen Wohlstand auf der vertikalen Achse. 7 Sie hat für jedes Jahrzehnt zwischen 1200 und 1800 einen Datenpunkt und verbindet diese Punkte mit einer Linie (ich habe die Linien am Anfang jedes Jahrhunderts beschriftet und einen anderen Grauton verwendet, um es leichter zu machen, der Linie zu folgen).
Bevölkerung und Wohlstand in England, 1200–1800 8
Wenn diese Linie sich stetig nach oben und rechts fortsetzen würde, dann würde das bedeuten, dass die Bevölkerung Englands im Laufe der Jahrhunderte sowohl größer als auch wohlhabender geworden wäre. Aber das ist keineswegs das, was sich tatsächlich abspielte. Stattdessen ist die Linie seit 1200 jahrhundertelang auf- und abgesprungen, in einem Bogen zwischen dem oberen linken und dem unteren rechten Bereich der Grafik – mit anderen Worten, zwischen einem Zustand kleiner Bevölkerung und relativ hohem Wohlstand und dem Gegenteil: einem Zustand großer Bevölkerung und niedrigem Wohlstand. (Für alle in diesem Buch abgebildeten Grafiken sind die Datenquellen in den Anmerkungen angegeben; die Daten selbst stehen unter http://morefromlessbook.com/data zur Verfügung.)
Nach 1200 schwankte die Bevölkerung Englands jahrhundertelang, ganz so, wie Malthus es beschrieben hatte. Bis etwa 1700 schrumpfte und wuchs die Bevölkerung des Landes um einen Faktor drei, zwischen zwei und sechs Millionen Menschen. Sie lebten nur dann in relativem Wohlstand, wenn es nur vergleichsweise wenige von ihnen gab. Im Grunde gab es eine Höchstgrenze der Menge an Rohstoffen, die der Mensch dem Land abringen konnte, hauptsächlich in Form von Nahrungsmitteln. Wann immer die Bevölkerung so weit wuchs, dass diese Höchstgrenze erreicht war, wurde sie durch den grausamen Korrekturmechanismus leidvoller Entbehrungen wieder nach unten gedrückt.
Der Konflikt zwischen Bevölkerungsgröße und Wohlstand entschärfte sich im 18. Jahrhundert ein bisschen, wahrscheinlich aufgrund verbesserter landwirtschaftlicher Anbaumethoden, aber das ändert nichts an dem düsteren Gesamtbild. So ging es zum Beispiel dem durchschnittlichen Briten im gesamten 18. Jahrhundert schlechter als um 1200. Clark fasst es so zusammen: »Wenn wir die 600 Jahre zwischen 1200 und 1800 betrachten, stellen wir fest, dass eine der Grundannahmen des Malthus’schen Modells der präindustriellen Gesellschaft sich bestätigt hat.« 9
Andere Forscher haben für denselben Zeitraum auch für die Bevölkerungsgrößen von Schweden, Italien und anderen europäischen Ländern malthusische »Schwingungen« festgestellt. 10 Der Übergang der meisten menschlichen Gesellschaften von einem Leben als Jäger und Sammler oder einer nomadischen Lebensweise zu festen Siedlungen mit Landwirtschaft – die sogenannte »neolithische Revolution« – schützte sie nicht vor Hungersnöten und Hungertod. 11 Das schiere Verhältnis von »der Zahl der zu ernährenden Menschen« zur »Menge der verfügbaren Ressourcen« hatte harsche und erbarmungslose Konsequenzen, und es führte dazu, dass die Bevölkerungsgrößen immer wieder schwankten. Wenn eine Bevölkerung zu groß für das Land wurde, dann wurde sie durch Ressourcenknappheit dezimiert.
Wir gegen die Welt
In der Zeit, als der Homo sapiens vor über 100000 Jahren seine afrikanische Wiege verließ, bis zum Anbruch des Industriezeitalters gegen Ende des 18. Jahrhunderts lebte der Mensch in einer malthusischen Welt. 12 Wir breiteten uns auf dem Planeten aus, aber wir eroberten ihn nicht.
Der Mensch zog auf alle Kontinente, außer der von ewigem Eis bedeckten Antarktis, und passte sich an praktisch alle regionalen und klimatischen Bedingungen unseres Planeten an. Wir waren unermüdlich, emsig und clever. Wir domestizierten Tiere und Pflanzen, wir veränderten ihre Gene durch Zucht, damit sie nützlicher für uns waren. Wir errichteten große Städte; die im 16. Jahrhundert erbaute Aztekenstadt Tenochtitlán (die sich dort befand, wo heute Mexico City liegt) erstreckte sich über eine Fläche von 13 Quadratkilometern. 13 Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erreichte die Einwohnerzahl Londons die Marke von einer halben Million. 14 Und wir erfanden eine riesige Palette von Technologien, mit denen wir unsere Umgebung gestalten konnten, von Bewässerungssystemen und Feldpflug bis hin zu Zement und Schießpulver.
Aber es gab nie besonders viele von uns. Vor 10000 Jahren lebten etwa fünf Millionen Menschen auf dem Planeten. 15 Als wir in unbesiedelte Gebiete zogen und unsere Technologien verbesserten, stieg diese Zahl entlang einer flachen, aber exponentiellen Kurve und erreichte etwa um die Geburt Christi einen Wert von 190 Millionen. Durch Landwirtschaft wurden höhere Bevölkerungsdichten möglich, und als nach der Zeitenwende immer mehr Fläche landwirtschaftlich genutzt wurde, beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum.
Im Jahr 1800 lebten etwa eine Milliarde Menschen auf dem Planeten. Das klingt wie eine riesige Zahl, aber wenn man sie ins Verhältnis zur bewohnbaren Fläche der Erde 16 setzt, wirkt sie deutlich kleiner. Wären alle im Jahr 1800 auf der Erde lebenden Menschen gleichmäßig über die bewohnbare Fläche des Planeten verteilt worden, hätte jeder von ihnen eine Fläche von 6,5 Hektar für sich gehabt – etwa so viel wie neun Fußballplätze. Wir hätten uns gegenseitig nicht hören können, auch dann nicht wenn der andere laut geschrien hätte.
Einer der Gründe, warum die Bevölkerung in all diesen Jahrtausenden so langsam wuchs, war, dass wir nicht lange lebten. Dem Demografen James Riley zufolge betrug »im Jahr 1800 die weltweit durchschnittliche Lebenserwartung ab Geburt etwa 28,5 Jahre«, und in keiner Region der Welt erreichte sie 35 Jahre. 17 Wir wurden nicht nur nicht alt, wir wurden auch nicht reich. Angus Maddison stellt fest: »Die Pro-Kopf-Einkommen stiegen quälend langsam – im weltweiten Durchschnitt in 800 Jahren [ab dem Jahr 1000] nur um 50 Prozent«, und davor in der Regel sogar noch langsamer. 18
Kurzum, der moderne Mensch hat größtenteils in einer malthusischen Welt gelebt. Die wichtigste Aufgabe für jegliche Gruppe von Menschen ist es, der natürlichen Umgebung genug Nahrung und andere Ressourcen abzuringen, um überleben zu können. Aber die Natur ist geizig und gibt ihre Schätze nicht so leicht her. Jahrtausendelang machten wir erstaunlich wenig Fortschritt dabei, dem Planeten mehr abzugewinnen – und zwar so viel mehr, dass es einen nennenswerten Unterschied gemacht hätte, wie groß oder wohlhabend eine Gruppe werden konnte. Wir sind zähe Geschöpfe und legten uns mächtig ins Zeug, aber es wäre weit hergeholt, wenn man sagen wollte, wir hätten vor dem Ende des 18. Jahrhunderts die Natur erobert. Tatsächlich war es umgekehrt: Die Natur hatte uns unter Kontrolle.
2 Macht über die Erde: das Industriezeitalter
Wenn wir die breite Masse der Menschen in jedem Land an den Tisch des Überflusses bringen wollen, wird das nur durch die unermüdliche Verbesserung aller unserer technischen Produktionsmittel zu schaffen sein.
Winston Churchill, MIT Mid-Century Convocation, 1949
Wenn Malthus recht hatte mit den Schwankungen von Bevölkerungsgrößen und allem anderen, womit die Natur während der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte die Größe menschlicher Gemeinschaften eingeschränkt hatte, warum wird sein Name dann heute weithin als abwertender Begriff benutzt? Weil die industrielle Revolution alles verändert hat. Vor allem eine Maschine, die 22 Jahre vor dem Erscheinen von Malthus’ Essay der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, sorgte dafür, dass die flächendeckenden Hungersnöte, die er prophezeit hatte, sich als eine der verkehrtesten Vorhersagen aller Zeiten erweisen würden.
Die machtvollste Idee der Welt
Im März des weltbewegenden Jahres 1776 1 führten der Erfinder James Watt und sein Kompagnon, der Investor Matthew Boulton, im Kohlebergwerk Bloomfield unweit von Birmingham, England, ihre neu entwickelte Dampfmaschine vor.
Die Idee, von Dampf angetriebene Maschinen zu nutzen, um vollgelaufene englische Kohlegruben leerzupumpen, war nicht neu; schon seit Jahrzehnten war eine von dem Engländer Thomas Newcomen entwickelte Maschine für diesen Zweck eingesetzt worden. Eigentlich wurde diese Maschine für kaum etwas anderes genutzt, da sie für ihren Antrieb so viel Kohle verschlang, dass sie nur dort wirtschaftlich eingesetzt werden konnte, wo Kohle billig und reichlich vorhanden war: direkt vor einem Kohleschacht. Die Dampfmaschine, die Watt in Bloomfield vorstellte, war das Ergebnis genialer Eingebungen und jahrelanger verbissener Entwicklungsarbeit; sie lieferte mehr als doppelt so viel nutzbare Energie pro Zentner Kohle wie Newcomens Maschine. 2 Watt, Boulton und andere erkannten rasch, dass die neue Maschine durch ihren besseren Wirkungsgrad und ihre höhere Leistung auch für zahlreiche, sehr unterschiedliche andere Zwecke geeignet war.
In der gesamten Menschheitsgeschichte bis zu diesem Punkt waren die einzigen Energiequellen, die wir nutzbar machen konnten, Muskelkraft (die eigene und die von Nutztieren), Wind und fließendes oder fallendes Wasser. James Watts Dampfmaschine und ihre Nachfolger verlängerten diese Liste um eine Kategorie von Maschinen, die fossile Brennstoffe wie Kohle nutzten und unser Verhältnis zu unserem Planeten fundamental veränderten. Die neuen energieerzeugenden Maschinen führten die industrielle Revolution nicht allein herbei – dafür waren zahlreiche andere Innovationen erforderlich, etwa Aktiengesellschaften, Patente und andere Formen von Urheberschutz sowie die Ausbreitung von wissenschaftlichem und technischem Wissen, das vorher weitgehend den Eliten vorbehalten war, in der gesamten Gesellschaft –, aber ohne sie wäre nichts entstanden, was die Bezeichnung Revolution verdient hätte. William Rosens Buch zur Geschichte der Dampfkraft trägt den passenden Titel The Most Powerful Idea in the World. 3
Mit Dampfkraft auf den Acker
Wie genau konnte denn die Dampfkraft genug Macht entfalten, um die malthusischen Schwankungen zu beenden? Wie kann eine Maschine, die große Mengen an chemischer Energie aus Kohle extrahieren und sie in mechanische Energie umwandeln kann (um zum Beispiel ein Rad anzutreiben oder ein Gewicht zu heben), die Zyklen von Bevölkerungswachstum und – rückgang beenden, die uns im gesamten Verlauf der Geschichte geplagt hatten? Eine erste Vermutung könnte sein, dass durch Dampf angetriebene Traktoren die Farmen wesentlich produktiver gemacht hätten, aber so war es nicht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden einige Exemplare solcher Traktoren gebaut, aber sie erwiesen sich als zu unzuverlässig und zu schwerfällig, um nützlich zu sein. Sie blieben leicht im Matsch stecken, und Äcker können sehr matschig sein. Dampfkraft änderte die Geschichte der Menschheit nicht, weil sie half, Äcker zu pflügen, sondern weil sie half, sie zu düngen.
Seit Jahrtausenden wissen Bauern, dass verschiedene Mineralstoffe wirksame Düngemittel sind. Als Anfang des 19. Jahrhunderts in der chilenischen Atacama-Wüste riesige Natriumnitrat-Ablagerungen entdeckt wurden, war das eine spannende Nachricht für die englischen Landwirte und die Unternehmer, die sie beliefern wollten, da dieses Salz ein zentraler Bestandteil verschiedener Düngemittel ist. Ebenso spannend war die Entdeckung riesiger Mengen von Vogeldung, dem sogenannten Guano, der auf etlichen Inseln vor der südamerikanischen Küste gefunden wurde, die Seevögeln seit Jahrhunderten als Sammelpunkte dienen.
Im Jahr 1838 gründete William Wheelwright ein Unternehmen, das Frachtschiffe auf die Reise schickte, die zwischen England und der Westküste Südamerikas pendelten. 4 Anstatt jedoch vom Wind angetriebene Segelschiffe zu verwenden, setzte Wheelwright Dampfschiffe ein. Sie waren damals eine relativ neue Entwicklung – die erste Transatlantikreise, die fast vollständig unter Dampf zurückgelegt wurde, hatte nur 15 Jahre früher stattgefunden –, die aber schon bald die Art und Weise veränderten, wie Menschen und Güter über die Gewässer der Erde reisten. 5 Die ersten Schiffe, die Wheelwrights Pacific Steam Navigation Company auf Kiel legte, wurden auf die Namen Chile und Peru getauft und 1840 in Dienst gestellt. Schon bald waren zahlreiche andere Schiffe des Industriezeitalters auf den Meeren unterwegs, transportierten englische Kohle nach Südamerika und brachten auf der Rückreise Mineralstoffe nach England, die dort als Dünger die Äcker produktiver machten.
Auch aus den Knochen geschlachteter Tiere ließ sich guter Dünger herstellen, und aus Koprolith, versteinertem Tierkot, von dem in den 1840er-Jahren in Südostengland riesige Ablagerungen entdeckt wurden. 6 Auf jeder Stufe der Umwandlung dieser Rohstoffe in Düngemittel spielte Dampfkraft eine entscheidende Rolle. All diese Materialien mussten transportiert werden, und das erledigten immer häufiger Dampfschiffe und Dampfloks. Die Produktionsverfahren, mit denen Mineralstoffe durch chemische Reaktionen im industriellen Maßstab in Dünger umgewandelt wurden, erforderten jede Menge Energie. Diese Energie wurde durch Kohle geliefert, und die Bergwerke, aus denen diese Kohle kam, wurden mit dampfgetriebenen Anlagen ausgepumpt und belüftet. In die Schmelzöfen der chemischen Fabriken wurde unter hohem Druck Luft gepumpt, um die Verbrennungsreaktionen anzufachen, und die Blasebälge der Pumpen wurden von Dampfmaschinen angetrieben. Dann wurden die Düngemittel von den Fabriken mit Dampfloks in die landwirtschaftlichen Anbaugebiete transportiert. Kurzum, im 19. Jahrhundert wurden Dampf und Landwirtschaft durch Dünger untrennbar miteinander verknüpft.
Farmen, die den Dünger des Industriezeitalters nutzten, produzierten mehr Nahrung und konnten daher mehr Menschen ernähren. Dieses Phänomen war nicht nur in England zu beobachten; Großbritannien war zwar der Ursprung der industriellen Revolution, aber keineswegs ihr einziger Nutznießer. Dampfschiffe und – eisenbahnen, massenhaft produzierter Kunstdünger und zahlreiche andere industrielle Neuerungen fanden schnell Verbreitung, weil sie einfach viel besser waren als das, was vorher zur Verfügung stand.
Die rapide Verbreitung leistungsfähiger Technologien fachte eine seit Langem schwelende Spannung an, die dadurch entstanden war, dass in einigen Regionen auf dem europäischen Festland Getreide billiger produziert werden konnte als in England. Das passte den Großgrundbesitzern des englischen Adels nicht, die genug politische Macht besaßen, um etwas dagegen zu unternehmen. Also brachten sie ab 1815 eine Reihe von Gesetzen auf den Weg, die als die »Corn Laws« bekannt wurden und den Verkauf von importiertem Getreide einschränkten. 7
Die meisten anderen Bevölkerungsschichten des Landes lehnten die Corn Laws vehement ab, da sie Nahrungsmittel teurer machten. Nach langwierigen parlamentarischen Auseinandersetzungen wurden die Corn Laws 1846 aufgehoben. 8 Durch den dann einsetzenden Freihandel traten die Schwächen der englischen Landwirtschaft zutage. Spätestens 1870 begann die landwirtschaftlich genutzte Gesamtfläche des Landes zu schrumpfen, da immer mehr Farmen brachlagen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren.
Technologischer Fortschritt, Bazillen und Mahlzeiten
Die Briten hatten das Glück, dass durch den Freihandel die Überlegenheit ihrer Fertigungsindustrien und ihres Bergbaus zum Tragen kam. England wurde zu einer treibenden Kraft des Welthandels, und seine Wirtschaft wuchs und diversifizierte sich rapide. 9,10 Im Jahr 1750 produzierte das Land 8 Prozent des europäischen Eisens; ein knappes Jahrhundert später waren es beinahe 60 Prozent. 11 Mitte des 19. Jahrhunderts entfielen auf Großbritannien mit seinen knapp 2 Prozent der Weltbevölkerung die Hälfte der globalen Baumwoll-Textilproduktion und über 65 Prozent der weltweit geförderten Kohle. 12 Bis 1825 hatte das Land keine Dampflokomotiven im kommerziellen Einsatz, aber schon 1850 betrug die Gesamtlänge seines Gleisnetzes über 9600 Kilometer. 13 In den hundert Jahren vor 1850 stieg die Anzahl der erteilten Patente um das Zwanzigfache. 14
Die neue Klasse von englischen Erfindern und Unternehmern – Menschen wie Watt und Boulton – wurde im Laufe des Industriezeitalters sagenhaft reich. Aber wie ist es mit dem Rest der britischen Bevölkerung? Wie erging es ihnen? Eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ist zum Beispiel, Gregory Clarks grafische Darstellung der Gesamtbevölkerung im Vergleich zu den Reallöhnen zeitlich zu erweitern. Wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, liefert diese Grafik für die Jahrhunderte vor 1800 deutliche Belege für die durch Entbehrungen verursachten Schwankungen der Bevölkerungsgröße, wie Malthus sie beschrieben hat. Aber was geschah nach 1800?
Etwas völlig anderes. So anders, dass wir die Grafik entlang beider Achsen – Gesamtbevölkerung und Durchschnittslohn – ganz erheblich erweitern müssen, um alle Zahlen abzudecken, weil sie ansteigen wie noch nie zuvor. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts schießt die Linie, die Bevölkerungsgröße und durchschnittlichen Wohlstand (mit anderen Worten, die Reallöhne) miteinander verbindet, nach oben und nach rechts und ändert danach kaum noch einmal die Richtung. Die malthusischen »Oscillationen« und »Schwingungen« der Bevölkerungsgröße Englands verblassen in einem kleinen Winkel der Vergangenheit.
Bevölkerung und Wohlstand in England, 1200–2000 15
Unter Wirtschaftshistorikern, die sich mit den Auswirkungen der industriellen Revolution beschäftigen, ist umstritten, ab wann genau die Reallöhne des durchschnittlichen englischen Arbeiters stiegen. Einige von ihnen, darunter auch Clark, schließen aus ihrer Forschung, dass diese Entwicklung ziemlich genau zu Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzte. Andere meinen, dass sie erst Jahrzehnte später begann, und zwar nachdem die Arbeiterschaft sich mehr Verhandlungsmacht gegenüber den Arbeitgebern erkämpft hatte. Diese Jahrzehnte werden als Engels’ Pause bezeichnet, benannt nach dem deutschen Philosophen Friedrich Engels (Sohn des Besitzers einer Textilmühle in Manchester), der davon überzeugt war, dass die englische Arbeiterklasse unter den Verhältnissen des Kapitalismus im ersten Jahrhundert des Industriezeitalters – dem sogenannten Manchesterkapitalismus – sehr zu leiden hatte. Im Jahr 1845 veröffentlichte Engels sein Frühwerk Die Lage der arbeitenden Klasse in England und verfasste dann gemeinsam mit Karl Marx das Manifest der kommunistischen Partei, das 1848 erschien.
Ganz gleich, wie real und wie lang Engels’ Pause auch gewesen sein mag – spätestens in der Zeit, als das Kommunistische Manifest veröffentlicht wurde, ging sie zu Ende. Und als Marx in seinem 1867 erschienenen Hauptwerk Das Kapital schrieb, »daß im Maße wie Kapital akkumuliert, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig, sich verschlechtern muß«, 16 zeigte der tatsächliche Gang der Ereignisse, wie anhaltend falsch diese Einschätzung war. 17,18 Kapital akkumulierte und die Ökonomien wuchsen wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, doch anstatt sich zu verschlechtern, verbesserte sich auch die Lage der Arbeiterschaft wie noch nie zuvor. 19
Selbstheilende Städte
Aber Löhne erzählen nicht die ganze Geschichte. Der Lebensstandard einer Person hängt von mehr ab als von ihrer Kaufkraft, so wichtig diese auch sein mag. Uns allen ist unsere Gesundheit wichtig, und generell herrscht die Auffassung, dass die ersten Jahrzehnte der industriellen Revolution der Gesundheit nicht förderlich waren. Das gängige Narrativ besagt, dass die Ortschaften und Städte Englands durch die Industrialisierung in dicht besiedelte Slums voller Krankheiten und Elend verwandelt wurden.
Dieses Narrativ ist einigermaßen zutreffend als Situationsbeschreibung, aber es erklärt nicht die Ursachen. Das Leben in den Städten war schon lange vor der industriellen Revolution wesentlich ungesünder als ein Leben auf dem Land. Die großen und kleineren englischen Städte waren dicht besiedelt, hatten eine schlechte Kanalisation, und es gab zahlreiche ungesunde Praktiken – und das lange bevor mit Dampfkraft betriebene Fabriken wie Pilze aus dem Boden schossen. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass mit der fortschreitenden Industrialisierung das Leben in den Städten in vielerlei Hinsicht gesünder wurde, nicht ungesünder. 20 Das lag in der Hauptsache daran, dass sich zwar in den Städten viele Krankheitserreger leichter ausbreiten konnten, Städte aber auch weitaus besser geeignet sind für epidemiologische Untersuchungen und gezielte und wirksame Gegenmaßnahmen (die Epidemiologie ist die Lehre von der Entstehung, Verbreitung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten).
Mein bevorzugtes Beispiel dafür ist Londons Kampf gegen die Cholera, eine schreckliche, von bakteriellen Infektionen verursachte Krankheit, die um sich greift, wenn Trinkwasser durch den Durchfall der bereits Erkrankten verunreinigt wird. Nachdem 1832 die Cholera den Weg aus ihrem Ursprungsgebiet im Gangesdelta nach London gefunden hatte, 21 fielen ihr bei zwei großen Ausbrüchen über 15000 Menschen zum Opfer. 22 »König Cholera« verbreitete Angst und Schrecken, und zwar auch, weil die Ursprünge der Krankheit nicht bekannt waren. Die Tatsache, dass zahlreiche Krankheiten von Mikroorganismen verursacht werden, war noch kein Allgemeinwissen; viele Wissenschaftler und auch die Bevölkerung glaubten, dass Krankheiten sich über Miasmen – »üble Dünste« – ausbreiten, die von verfaulendem Gemüse und verwesenden Leichen aufsteigen.
Ein dritter Choleraausbruch im Londoner Stadtteil Soho forderte 1854 innerhalb von zwei Wochen über 500 Todesopfer und drohte, die ganze Stadt in Panik zu versetzen. Er konnte erst gestoppt werden, als der Arzt John Snow alle Cholera-Todesfälle auf eine Karte von London einzeichnete; 23 sie traten dicht konzentriert rings um eine öffentliche Wasserpumpe in der Broad Street auf, deren Wasser kontaminiert war.
Snow überzeugte die Stadtverwaltung, diese Pumpe stillzulegen, wodurch der Ausbruch gestoppt wurde. Nachdem Louis Pasteur sehr überzeugend demonstriert hatte, dass Krankheiten wie die Cholera durch bakterielle Erreger verursacht werden, wurden in der ganzen Stadt Leitungen für sauberes Wasser und Abwasserkanäle gebaut, woraufhin König Cholera sich geschlagen gab und in London nie wieder gesehen wurde.
Choleraausbrüche deuten auf eine wichtige Tatsache hin: So etwas wie Engels’ Pause trat hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit zu Beginn des Industriezeitalters auf, 24 und Verbesserungen wurden nicht von einem Tag auf den anderen erreicht. So nahm zum Beispiel in den Städten die Säuglingssterblichkeit ab 1800 mehrere Jahrzehnte lang zu, 25 bevor sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts allmählich wieder zurückging. 26,27,28 Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, war das unter anderem auf Umweltbelastungen zurückzuführen. Die Luft in den Städten war so verpestet, dass sie junges Leben beenden und körperliches Wachstum behindern konnte. Aber seit damals ist es deutlich besser geworden: 1970 zählten die Engländer zu den längsten Menschen der Welt. 29
Ja, wir haben Bananen!
Die bemerkenswertesten Veränderungen des Lebensstandards der Menschen, die während des Industriezeitalters herbeigeführt wurden, waren Verbesserungen ihrer Nahrungsmittel und Ernährung. 30 Auch diese Verbesserungen machten sich nach dem Beginn der industriellen Revolution erst nach einer Pause weithin bemerkbar. A Plain Cookery Book for the Working Classes (»Ein einfaches Kochbuch für die arbeitenden Klassen«), das 1852 von Charles Elmé Francatelli (dem ehemaligen Chefkoch von Queen Victoria) veröffentlicht wurde, enthält Rezepte, die von faden Zutaten und unerbittlicher Sparsamkeit geprägt sind. Zum Frühstück gab es gekochte Milch mit einem Löffel Mehl und einer Prise Salz, vielleicht noch mit einem Stück Brot oder einer Kartoffel. Wenn grünes Gemüse oder Bohnen gegart worden waren, sollte die restliche »Topfbrühe« mit Haferflocken verzehrt werden. Francatelli wünschte seinen Leserinnen alles Gute: »Ich hoffe, dass Sie sich hin und wieder ein altes Huhn oder einen Hahn leisten können.« 31
Über kurz oder lang konnten sie das. Im Jahr 1935 stellte der englische Sozialreformer B. Seebohm Rowntree fest, dass die arbeitende Bevölkerung in York sich nahezu genauso ernährte wie ihre Arbeitgeber – eine erstaunliche Veränderung gegenüber dem, was er bei einer ähnlichen Erhebung im Jahr 1899 festgestellt hatte. 32 Rowntree beobachtete, dass arme Familien sich selbst in der schlimmsten Phase der Weltwirtschaftskrise einmal pro Woche Roastbeef oder Fisch leisten konnten, und an zwei weiteren Tagen Wurst oder anderes tierisches Eiweiß.
Damals konnten solche Familien wahrscheinlich sogar Bananen essen, ein zuvor unvorstellbarer Luxus. Da Bananen weit von England entfernt wachsen und nach dem Ernten relativ schnell verderben, waren sie auf der Insel bis weit ins Industriezeitalter hinein so gut wie unbekannt. In Charles Dickens’ 1843 erschienener Erzählung A Christmas Carol (Eine Weihnachtsgeschichte) werden Äpfel, Birnen, Orangen und Zitronen als saisonale Leckerbissen erwähnt, aber keine Bananen. Durch den Einsatz gekühlter Frachtdampfer schrumpfte die Reisezeit zwischen den tropischen Plantagen und Nordeuropa. Im Jahr 1898 wurden von den Kanarischen Inseln über 650000 Stauden mit jeweils bis zu 100 Bananen exportiert. 33
Wie weitreichend waren also die insgesamt von der industriellen Revolution herbeigeführten Veränderungen? Eine auf Daten gestützte Antwort liefert der Historiker Ian Morris, der einen numerischen Index entwickelt hat, mit dem das Niveau der gesellschaftlichen Entwicklung einer Zivilisation quantifiziert werden kann. 34 Sein Index wird aus vier Parametern berechnet: Energiegewinnung pro Kopf der Bevölkerung, Informationstechnologie, Kriegsführungskapazität und Organisation.
Er zeigt einen erstaunlichen Wandel. Morris hat es so ausgedrückt: »[Bis] 1776 … hatte sich die gesellschaftliche Entwicklung des Westens 35 seit den eiszeitlichen Jägern und Sammlern, die auf Nahrungssuche die Tundra durchstreift hatten, gerade einmal mühsam auf 45 Punkte hochgearbeitet. Binnen der folgenden 100 Jahre schoss sie indes um weitere 100 Punkte in die Höhe. Die Verwandlung war schier unglaublich, sie stellte die Welt auf den Kopf.« 36
Soziale Entwicklung des Westens, 2000 v. Chr. – 1900 n. Chr. 37
Das elektrifizierende, leicht entflammbare zweite Jahrhundert des Industriezeitalters
Doch die Veränderungen der nächsten 100 Jahre waren noch weitreichender. Im Westen kletterte Morris’ sozialer Entwicklungsindex, nachdem er in den 100 Jahren vor 1900 um 120 Punkte auf einen Stand von 170 Punkten gestiegen war, bis zum Jahr 2000 um weitere 736 Punkte. 38
Soziale Entwicklung des Westens, 2000 v. Chr. – 2000 n. Chr. 39
Diese enormen Fortschritte wurden zum großen Teil dadurch erreicht, dass drei weitere weltbewegende Technologien zu dem Mix hinzukamen: der Verbrennungsmotor, elektrischer Strom sowie Wasser- und Abwasserleitungen in Wohngebäuden. Die ersten beiden erweiterten die Möglichkeiten, die die Dampfkraft uns eröffnet hatte: die Fähigkeit, Energie in großen Mengen zu erzeugen und effektiv einzusetzen. Die dritte festigte Londons Triumph gegen »König Cholera« und versetzte uns in die Lage, länger und gesünder zu leben, vor allem in den dicht besiedelten Städten, die sich in vielen Teilen der Welt entwickelten.
Mehr Macht dem Volke: Verbrennungsmotor und elektrischer Strom
Dampfschiffe trugen das enorme Gewicht ihrer Maschinen und der zugehörigen Kohle, weil sie auf dem Wasser schwammen, und Dampfloks, weil sie auf Gleisen fuhren, die darauf ausgelegt waren, große Lasten zu tragen. Doch abgesehen von diesen Anwendungen war die Dampfkraft nicht mobil. Als der deutsche Büchsenmacher Gottlieb Daimler an frühen Verbrennungsmotoren arbeitete, erkannte er, dass solche neuartigen Maschinen für den mobilen Einsatz gut geeignet sein könnten. Sie waren nicht nur relativ leicht, sondern verbrannten zudem energiereiche Treibstoffe wie Benzin. Im Jahr 1885 führten Daimler und sein Kollege Wilhelm Maybach ihren mit Leichtbenzin betriebenen »Reitwagen« vor, ein motorradähnliches Gefährt mit Stützrädern – das erste von einem Verbrennungsmotor angetriebene Fahrzeug der Welt. Von diesen Vehikeln würde es bald immer mehr geben, und nicht wenige davon wurden von der Firma gebaut, aus der dann Daimler-Benz hervorging, die Heimat der Marke Mercedes-Benz.
Der elektrische Strom fing klein an, wurde groß und schrumpfte dann wieder. Im Jahr 1837 wurde dem in Vermont lebenden Schmied und Bastler Thomas Davenport ein US-Patent erteilt, für ein »Improvement in Propelling Machinery by Magnetism and Electro-Magnetism« 40 – heute nennen wir solche »Antriebsapparate« Motor. Davenport erhielt das weltweit erste Patent auf einen Elektromotor, hatte jedoch das Pech, dass die Batterien seiner Zeit zu primitiv waren, um seinem Apparat genug Energie zu liefern, und Stromleitungen, Energieversorger und ein Stromnetz gab es noch nicht. Davenport war offenbar bankrott, als er 1851 starb.
Ungefähr ein halbes Jahrhundert, nachdem Davenport sein Patent erhalten hatte, entdeckten Thomas Edison, Nikola Tesla und andere, dass ein Elektromotor auch umgekehrt genutzt werden kann – er kann eingesetzt werden, um mechanische Energie (etwa durch fallendes Wasser oder sich ausdehnenden Dampf) in elektrische Energie umzuwandeln. Wenn er auf diese Weise genutzt wird, dann wird ein Elektromotor zu einem Generator. Die erzeugte elektrische Energie kann dann über Leitungen an einen oder mehrere entfernt stehende Motoren übertragen werden.
Das klingt ineffizient, aber das war es nicht. Ein 1891 gezogener Vergleich zwischen Dampfkraft und elektrischer Energie kam zu dem Schluss: »Wir müssen elektrischen Strom als ein enorm leistungsfähiges und praktisches Medium betrachten, um Energie mit größter Einfachheit und sehr geringen Verlusten von einem Punkt an einen anderen zu übertragen.« 41 Von diesem Zeitpunkt an war die Elektrifizierung der Industrie nicht mehr aufzuhalten.
Zunächst wurden Fabriken elektrifiziert, indem ihre zentrale große Dampfmaschine einfach durch einen zentralen großen Elektromotor ersetzt wurde. Die neue Energiequelle war, ebenso wie die alte, mit allen Maschinen der Fabrik über ein aufwendiges und anfälliges (und häufig unsicheres) System aus Wellen, Scheiben und Riemen verbunden. Diese Riemen waren meist aus Leder, und in den Fabriken wurden große Mengen davon gebraucht, sodass 1850 die Riemenmacherei die fünftgrößte Wirtschaftsbranche der USA war. 42
Menschen, die sich eine andere Art von Fabrik vorstellen konnten, erkannten schnell, dass elektrischer Strom genutzt werden kann, um dieses Gewusel aus laufenden Riemen und sich drehenden Scheiben zu beenden. Sie begannen, kleinere Elektromotoren einzusetzen, um kleinere Maschinengruppen anzutreiben, statt einer ganzen Fabrikhalle voller Gerätschaften. Im Laufe des 20. Jahrhunderts brachten sie diesen Gedanken zu seinem logischen Ende und montierten an jeder einzelnen Maschine, die Energie brauchte, einen Elektromotor – eine Idee, die noch im Jahr 1900 den meisten Fabrikbesitzern absurd vorgekommen wäre. 43
Aber elektrischer Strom veränderte nicht nur die Fabriken von Grund auf. Er beleuchtete Räume, Bürgersteige und Straßen; er erleichterte die Hausarbeit, indem er Staubsauger, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Wäschetrockner antrieb; machte Lebensmittel durch Kühlschränke länger haltbar; ließ Städte auch nach oben wachsen, indem er die Fahrstühle von Wolkenkratzen antrieb, und er machte unzählige andere Neuerungen möglich. Und der Fortschritt durch Verbrennungsmotoren machte keineswegs bei Motorrädern halt. Solche Motoren, die Ölprodukte in mechanische Energie umwandeln, fanden rasch Verwendung in diversen Errungenschaften, von Autos über Flugzeuge und Schiffe bis hin zu Traktoren und Kettensägen.
Alles im Fluss: sanitäre Anlagen
Man könnte denken, Wasserleitungen und Kanalisation seien keine solch tiefgreifenden Innovationen, als dass sie es verdient hätten, in einem Atemzug mit elektrischem Strom und dem Verbrennungsmotor genannt zu werden. Eine Toilette mit Wasserspülung und Leitungswasser sind zweifellos praktische Errungenschaften, aber spielen sie wirklich in der Wachstumsgeschichte des 20. Jahrhunderts eine tragende Rolle? Auf jeden Fall. Die Gesundheitssoziologen David Cutler und Grant Miller schätzen, dass allein die Verfügbarkeit von sauberem Wasser für die Hälfte des Rückgangs der Gesamtsterblichkeitsrate in den USA zwischen 1900 und 1936 verantwortlich ist und für 75 Prozent des Rückgangs der Säuglingssterblichkeit. 44 Der Historiker Harvey Green nennt die Technologie von flächendeckend verfügbarem, sauberem Leitungswasser »die wahrscheinlich wichtigste Intervention zur Förderung der öffentlichen Gesundheit im 20. Jahrhundert«. 45
Wasserleitungen waren auf dem Lande ebenso wichtig wie in der Stadt. Bevor es sie gab, konnte die Hausarbeit auf Farmen buchstäblich eine Schinderei sein. Genug Wasser für einen großen Haushalt von einem abgelegenen Brunnen heranzuschleppen bedeutete ein immenses Arbeitspensum, das häufig den Frauen und Kindern oblag, da die Männer den ganzen Tag draußen arbeiteten. So lag zum Beispiel im texanischen Hill Country der Brunnen typischerweise so weit vom Wohnhaus entfernt, dass jedes Jahr 500 Arbeitsstunden und fast 3000 Kilometer Fußweg erforderlich waren, um genug Wasser herbeizuholen. 46,47
Elektrischer Strom und sanitäre Anlagen machten diese ständige Plackerei überflüssig. In den 1930er-Jahren fasste ein Farmer aus Tennessee den immensen Wert der Technologien des zweiten Jahrhunderts des Industriezeitalters so zusammen: »Die beste Sache der Welt ist, die Liebe Gottes im Herzen zu tragen – und die zweitbeste, Strom im Haus zu haben.« 48
Die Fortschritte, die im ersten Jahrhundert des Industriezeitalters – also ungefähr in den Jahren von 1770 bis 1870 – erzielt wurden, stellten die Welt gründlich auf den Kopf. Die Trendlinien, die auf grafischen Darstellungen den Fortschritt der Menschheit markieren – ganz gleich, ob sie nun auf Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsgröße oder sozialer Entwicklung basieren – verlaufen in den Jahrtausenden vor Ende des 18. Jahrhunderts nahezu flach. 49 Danach jedoch schießen sie in die Höhe wie eine Rakete beim Start.
Erstaunlicherweise schoss die Rakete im zweiten Jahrhundert des Industriezeitalters immer weiter nach oben. Es erscheint unglaublich, dass der von der prometheischen Dampfmaschine und ihren Artverwandten in Gang gesetzte Fortschritt anhalten konnte, aber Elektrizität, Verbrennungsmotor und sanitäre Anlagen schafften das mit Leichtigkeit.
Brot für die Welt
Vor allem schafften sie es, eine exponentiell wachsende Zahl von Menschen zu ernähren. Auch dabei waren Innovationen in der Herstellung von Kunstdünger entscheidend. Im ersten Jahrhundert des Industriezeitalters waren die Düngemittel, die gebraucht wurden, um immer mehr Menschen zu ernähren, natürlicher Herkunft. Doch 1898 warnte der Chemiker William Crookes, Vorsitzender der British Association for the Advancement of Science, die unablässig wachsende Zahl der »Brotesser der Welt« würden schon bald die südamerikanischen Vorräte an Guano und Nitraten aufgebraucht haben. Crookes prognostizierte eine weltweite »generelle Knappheit« an Weizen, es sei denn, Wissenschaft und Technologie kämen rechtzeitig zu Hilfe. 50
Und sie kamen, dank zweier deutscher Chemiker, die es schafften, »Brot aus Luft zu gewinnen«, wie es der Physiker Max von Laue ausdrückte. 51 Das gelang ihnen, indem sie Stickstoff banden und dadurch ein riesiges Problem lösten.
Wir Menschen sind hauptsächlich an Sauerstoff interessiert, weil sein Fehlen schon nach sehr kurzer Zeit sehr unangenehm für uns wird, aber Stickstoff ist für irdische Lebensformen das bei Weitem wichtigste Element. Es ist ein unentbehrlicher Baustein für so lebensnotwendige Dinge wie Eiweiße, DNA und Chlorophyll. 52 Auch in der Atmosphäre ist es im Überfluss vorhanden; die Luft, die jeder von uns atmet, besteht zu 80 Prozent aus Stickstoff. Freilich ist der atmosphärische Stickstoff nicht besonders nützlich für das Leben auf unserem Planeten, da er chemisch inert (reaktionsträge) ist – er mag sich nicht mit anderen Atomen verbinden. Also muss er an Elemente wie Wasserstoff gebunden, »fixiert« werden, bevor er als Dünger genutzt werden kann, der Pflanzen besser wachsen lässt.
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten Chemiker demonstriert, dass sie atmosphärischen Stickstoff fixieren und daraus Ammoniak synthetisieren konnten (das aus einem Stickstoff- und drei Wasserstoffatomen besteht; für uns ist es giftig, doch für Pflanzen ist es ein hervorragendes Düngemittel). Aber diese Laborvorführungen waren viel zu klein und zu teuer, um in der Praxis nützlich zu sein. Fritz Haber stellte sich der Herausforderung, ein massentaugliches Ammoniaksyntheseverfahren zu entwickeln.
Habers Arbeit erhielt einen maßgeblichen Schub, als er begann, mit der BASF zusammenzuarbeiten, dem damals größten Chemiekonzern der Welt. 53 Im Jahr 1909 lieferte ein etwa ein Meter hohes Labormodell fünf Stunden lang ununterbrochen flüssiges Ammoniak. Einen weiteren Schub bekam seine Erfindung, als die BASF Carl Bosch beauftragte, Haber bei seiner Arbeit zu unterstützen.
Keine fünf Jahre nach dieser Vorführung produzierte eine BASF-Fabrik Stickstoffdünger im industriellen Maßstab. Für die Ammoniaksynthese erhielt Haber 1918 den Chemienobelpreis. Bosch und sein Kollege Friedrich Bergius gewannen den ihren 1931 für »chemische Hochdruckverfahren«. Heute ist das Haber-Bosch-Verfahren zur Düngemittelproduktion so fundamental wichtig für alle menschlichen Unternehmungen, dass es laut dem Energieanalysten und Autor Ramez Naam etwa ein Prozent der weltweit industriell genutzten Energie verbraucht. 54
Ist diese Energie gut angelegt? Auf jeden Fall. Vaclav Smil, ein herausragender Wissenschaftler, der sich mit der Beziehung der Menschheit zu unserem Planeten beschäftigt, hat geschätzt, dass »der Großteil der Ernährung von 45 Prozent der Weltbevölkerung« vom Haber-Bosch-Verfahren abhänge. 55 Der Autor Charles Mann schreibt: »Über drei Milliarden Männer, Frauen und Kinder – eine unfassbar große Wolke aus Träumen, Ängsten und Erkundungen – verdanken ihre Existenz diesen beiden deutschen Chemikern des frühen 20. Jahrhunderts.« 56
Energie im Überfluss gab uns die modernen Düngemittel, und diese Kunstdünger machten uns frei von den bedrückenden, durch Entbehrungen herbeigeführten malthusischen Bevölkerungsschwankungen, von denen menschliche Gesellschaften bis zum Industriezeitalter heimgesucht wurden. Um uns diese Freiheit zu erhalten, brauchten wir auch andere bahnbrechende Entwicklungen, etwa die Green Revolution, die von dem amerikanischen Agronomen Norman Borlaug initiiert wurde. Borlaug verband schwere körperliche Feldarbeit mit sorgfältigen Forschungen im Labor, um neue Getreidevarianten zu entwickeln. Seine Arbeit an Weizen in Mexiko zeigte, was möglich war, und hat ähnliche Durchbrüche inspiriert, vor allem im International Rice Research Institute auf den Philippinen. Borlaug wurde 1970 der Friedensnobelpreis zugesprochen.
Herrscher über unser Reich
Die technologischen, wissenschaftlichen, institutionellen und intellektuellen Durchbrüche des Industriezeitalters setzten einen sich selbst verstärkenden Zyklus von menschlichem Bevölkerungswachstum und zunehmendem Wohlstand in Gang. Der Homo sapiens hat 200000 Jahre gebraucht, um eine Weltbevölkerung von einer Milliarde zu erreichen. 57 Bis zur zweiten Milliarde dauerte es dann nur noch 125 Jahre, ein Meilenstein, der 1928 erreicht war. Und dann wurden die Intervalle immer kürzer – die nächste Milliarde war jeweils nach 31, 15, 12 und 11 Jahren erreicht.
Dank besserer Ernährung und medizinischer Versorgung lebten all diese Menschen immer länger. Die weltweite durchschnittliche Lebenserwartung verdoppelte sich von unter 29 Jahren im Jahr 1770 auf 60 Jahre zwei Jahrhunderte später. 58 Darüber hinaus wurden die Menschen in aller Welt wohlhabender und genossen höhere Lebensstandards. So stieg zum Beispiel in den 100 Jahren vor 1970 das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf der Bevölkerung in den westeuropäischen und lateinamerikanischen Ländern um mindestens 500 Prozent, im Nahen Osten und Nordafrika um 400 Prozent und in Ostasien um 250 Prozent. 59
Es stimmt nicht, dass diese im Industriezeitalter erreichten Fortschritte dem Menschen erlaubt hätten, unseren Planeten vollständig zu beherrschen. Auch heute noch können wir das Wetter nicht steuern, können Blitzschläge, Wirbelstürme, Vulkanausbrüche, Erdbeben oder Flutwellen nicht kontrollieren. Die Erdkruste wiegt 4,7 Billionen-mal so viel wie wir alle zusammen 60 , und sie besteht aus tektonischen Platten, die sich nach Belieben verschieben, ganz gleich, was wir dagegen tun. Also sind wir nicht der Boss. Aber wir sind den malthusischen Launen unserer Umgebung nicht mehr hilflos ausgeliefert, wenn wir versuchen, unseren Lebensunterhalt aus dem Boden zu kratzen.
Tatsächlich haben wir inzwischen den Spieß umgedreht: Heute zwingen wir uns der Erde auf, nicht umgekehrt. Die vielleicht anschaulichste Art, sich diese Umkehrung vor Augen zu führen, ist die, sich die Entwicklung der Biomasse – das weltweite Gesamtgewicht – aller Säugetiere anzusehen. Noch zur Zeit von Christi Geburt wogen alle Menschen zusammen wahrscheinlich nur etwa zwei Drittel so viel wie alle Bisons in Nordamerika und hatten weniger als ein Achtel des Gewichts aller Elefanten in Afrika.
Doch im Industriezeitalter explodierte das menschliche Bevölkerungswachstum, und wie wir sehen werden, haben wir die Bestände an Bisons und Elefanten im industriellen Maßstab und in grauenerregenden Massen dezimiert. Das führte dazu, dass sich dieses Gewichtsverhältnis massiv verschoben hat. Heute bringen wir Menschen über 350-mal so viel Masse auf die Waage wie alle Bisons und Elefanten zusammen. Wir wiegen über zehnmal so viel wie alle wild lebenden Säugetiere auf der Erde zusammengenommen. Und wenn wir alle Säugetiere hinzunehmen, die wir domestiziert haben – Rinder, Schafe, Schweine, Pferde und so weiter –, wird das Verhältnis wahrhaft grotesk: Auf uns und unsere Nutz- und Haustiere entfallen inzwischen 97 Prozent der gesamten Säugetier-Biomasse der Erde.
Dieser Vergleich illustriert eine fundamentale Tatsache: Statt durch die Umwelt eingeschränkt zu werden, haben wir im Laufe des Industriezeitalters gelernt, sie für unsere eigenen Zwecke zu gestalten. Und das wiederum wirft die Frage auf, ob wir das auf kluge Art und Weise getan haben. In vielerlei Hinsicht und in vielen Regionen der Welt muss diese Frage mit »nein« beantwortet werden.
3 Industrielle Fehltritte
Vielleicht denkt ihr, der Schöpfer habe euch gesandt, um nach Belieben über uns zu verfügen. Würde ich denken, ihr wäret vom Schöpfer geschickt worden, könnte mich das glauben machen, ihr hättet ein Recht, über mich zu verfügen. Versteht mich nicht falsch, aber versteht auch zur Gänze meine Liebe für das Land. Ich habe nie gesagt, ich könne nach Belieben über das Land verfügen. Der Einzige, der ein Recht hat, darüber zu verfügen, ist der Eine, der es geschaffen hat.
Hinmaton-Yalaktit (bekannt als »Chief Joseph«), in einer Rede vorUS-Regierungsvertretern, 1876
Nicht alle Entwicklungen des Industriezeitalters waren Verbesserungen. Jeder, der sich eingehend mit dieser Epoche beschäftigt hat, hat vermutlich zumindest eine informelle Liste ihrer Fehltritte, Verbrechen und moralischen Verfehlungen zusammengestellt. Ganz oben auf einer solchen Liste stehen Sklaverei, Kinderarbeit, Kolonialismus, Umweltverschmutzung und die Ausrottung verschiedener Tierarten.
Es ist aus zwei Gründen wichtig, sich mit diesen Problemen zu beschäftigen. Erstens verlangt das die Ehrlichkeit – es ist schlichtweg falsch, das Industriezeitalter als großartig für alle oder für die Umwelt darzustellen. Das vorangehende Kapitel beschreibt zutreffend die enormen Fortschritte, die erreicht wurden, aber es erzählt nicht die ganze Geschichte. Wir müssen uns auch mit der dunklen Seite dieses beispiellosen Kapitels der Menschheitsgeschichte beschäftigen.
Zweitens führten die Fehler und Versäumnisse des Industriezeitalters zu einer neuen Reihe von Ideen, die auch heute noch sehr präsent sind. Im Kern dieser Ideen findet sich die Vorstellung, dass wir Menschen uns nicht hinreichend umeinander und den Planeten, auf dem wir leben, kümmern. Wir setzen außerordentlich mächtige Werkzeuge wie die Dampfmaschine und elektrischen Strom ein, beherrschen damit andere Völker, plündern die Erde aus und verschmutzen sie.
Wie wir in diesem Kapitel sehen werden, liefert das Industriezeitalter zahlreiche gute Gründe für diese Sicht der Dinge. Die interessante Frage ist, ob sie nach wie vor berechtigt ist. Wir werden bald zu dieser Frage kommen, doch zunächst wollen wir uns die Geschehnisse ansehen, die so viele Menschen glauben ließen, die Industrialisierung – jene Verbindung aus Kapitalismus und technischem Fortschritt, die eine Epoche definierte – sei eine schrecklich negative Kraft gewesen.
Wie wir gesehen haben, stellte das Industriezeitalter eine so abrupte Zeitenwende dar, weil wir Menschen so viel besser darin wurden, Dinge zu produzieren – Inputs in Outputs umzuwandeln. Man kann die moralischen Verfehlungen dieser Epoche als Perversionen des Wunsches betrachten, immer mehr zu produzieren. Unser großer Fehler war es, Menschen als Rädchen ins Getriebe der Produktionsmaschinerie zu zwingen (Sklaverei und Kinderarbeit), ihnen ihr Land und ihre Rohstoffe zu nehmen und sie als Inputs zu nutzen (Kolonialismus), Tiere so hemmungslos als Inputs zu missbrauchen, dass wir sie fast oder ganz ausrotteten, und zu wenig auf die desaströse Umweltverschmutzung zu achten, die das Ergebnis industrieller Produktion war.
Wenn wir die großen Fehler dieser Epoche aus dieser Perspektive betrachten, zeichnet sich ein interessantes Muster ab. Als die industrialisierten Länder sich entwickelten und wohlhabender wurden, behandelten sie auch die Menschen besser. Sie wurden nicht mehr versklavt, Kinder nicht mehr zur Arbeit gezwungen, und schließlich hörte auch der Anspruch auf fremde Länder auf. Tiere wurden erst nach und nach besser behandelt – in manchen Fällen konnte man eine bedrohte Art nicht mehr retten. Und ein besserer Umgang mit unserem Planeten kam zuletzt; über fast zwei Jahrhunderte seit Beginn des Industriezeitalters plünderten wir ihn rücksichtslos aus und verschmutzen ihn.
Sehen wir uns etwas genauer an, wie sich dieses Muster von Fehlern und Korrekturen entwickelte.
Menschen als Eigentum
In vielen Gesellschaften im gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte war es akzeptabel, dass Menschen andere Menschen besaßen, vor allem, wenn sie anderen ethnischen Gruppen, Religionen oder Stämmen angehörten. Dem Kognitionswissenschaftler Steven Pinker zufolge änderte sich die Einstellung zur Sklaverei gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Humanismus – dem Glauben, dass »die universelle Fähigkeit einer Person, zu leiden und sich zu entfalten, … an unser moralisches Empfinden appelliert.« 1 In seinem Buch Enlightenment Now (Aufklärung jetzt) schreibt Pinker: »Zuweilen bezeichnet man die Aufklärung als humanitäre Revolution, weil sie zur Abschaffung barbarischer Praktiken [wie Sklaverei] führte, die jahrtausendelang zum Alltag der Zivilisationen gehört hatten.« 2





























