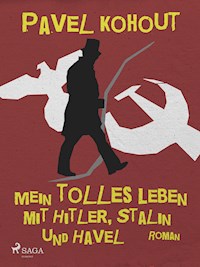
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Literarisch brillant erzählt Pavel Kohout seine Wandlung vom überzeugten Kommunisten zum freiheitsliebenden Demokraten – das Schicksal von Tausenden in Osteuropa. Den Prager Frühling gestaltet Kohout als Wortführer mit. Dieser wird zur Achse, an der sich sein Leben spiegelt: Vorher meistgespielter Stückeschreiber der CSSR und treues KP-Mitglied, nachher führender Dissident, der Partei und des Landes verwiesen, seine Stücke verboten. Sein Leben – eine Entscheidung gegen die Ideologie und für die Freiheit. Sein Buch – eine spannende Erzählung, die zeigt, wie Politik persönliches Schicksal bestimmt.Im Frühjahr 1948 versucht die Kommunistische Partei die politische Macht in der Tschechoslowakei endgültig an sich zu reißen. Einzig im Weg stehen ihr noch die Sozialdemokraten, an ihrer Spitze der charismatische Parlamentsabgeordnete Fischer, der sich gegen die Auflösung seiner Partei wehrt. Vor diesem realen Hintergrund entspinnt sich die Handlung des Romans. Im Zentrum stehen Felix Fischer, seine Frau, die SchauspielerinKamila Nostitzová, und der junge Dichter Jan Soukup. Letzterer, ein glühender Kommunist, ist leidenschaftlich in die Frau seines Freundes verliebt. Eine Dreiecksgeschichte, deren Ursprünge bis in die Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkriegzurückreichen. Als der tschechische Geheimdienst versucht, Soukup anzuwerben, muss dieser sich entscheiden: Zwischen seinen Idealen und seiner Loyalität, zwischen Liebe und Freundschaft.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 878
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pavel Kohout
Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel: Erinnerungen
Erlebnisse – Erkenntnisse
Mit einem Geleitwort von Jiří Gruša
Aus dem Tschechischen vonMarcela Euler, Friederike Gürbig,Silke Klein und Aleš Půda
Saga
Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel
German
© 2010 Pavel Kohout
Alle Rechte der deutschen Ausgabe © Osburg Verlag Hamburg 2009 www.osburg-verlag.de. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711449059
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
In memoriam
Meinen Lebensgefährten, die es nicht schafften, ihre Erlebnisse und Erkenntnisse aufzuzeichnen.
In spe
Unseren Enkelinnen und Enkeln, damit sie verstehen können, was wir nicht verstanden haben.
Die deutsche Fassung dieses Buches ist Gerda Neudeck gewidmet, in der ich meine späte Schwester fand.
P.K.
Jiří Gruša
Geleitwort
Dieses Buch ist eine Harmonie der Gegensätze. Die Gegensätze kamen von allein, das Harmonische musste man wollen. Die achtzig Jahre, um die es hier geht, verkörpern die schlimmste Zeit Europas. Der Antagonismus übte sich kontinental. Wie kann man also den Widerspruch in Einklang verwandeln? Nun, man muss Pavel Kohout heißen und als Lebensbühne Prag oder Praha wählen. Denn hier endete das goldene »Dazwischen« der dreißiger Jahre, hier begann de facto zuerst der Heiße und dann der Kalte Krieg, hier schaute man den verunsicherten Russen ins Gesicht, als sie uns brüderlich helfen kamen und endlich sahen, dass sie niemand mag. Hier marschierte die samtene Revolution durch die Straßen als das Schlussstück der Wende, einst von Havel & Ko(hout) begonnen und jetzt feierlich zu Ende gebracht.
Die Mitte meint Maß, und Maß muss man üben. Pavels Vita ist ein Ritterturnier in diesem Sinne. Die Attacken kamen nämlich von überall, und meistens von hinten. Nur derjenige, der sie bestanden hat, kann uns erzählen, wo Stabilität zu finden ist. Denn Pavels Leben mit Hitler, Stalin und Havel ist nicht nur ein witziger Titel, es ist auch der Lebenslauf einer Dramatik, deren Plot, metaphorisch gesagt, mit dem Untergang des Abendlandes beginnt und mit einem Sommernachtstraum endet.
Die Exposition schildert das Prag der Ersten Tschechoslowakei als eine angenehme Adresse. Die Stadt von Pavels Kindheit lockt mit Wohlstand und Vielfalt. Natürlich gibt es Meister der Vereinfachung, die das Übliche möchten, also das Übel. Aber noch hofft jeder und feiert unter einem Himmel voller Feuerwerk. Bald aber werden die Feuerkörper explosiv. Und die Jungs zu Rekruten und Gefallenen.
Das tschechische Trauma jedoch ist die Kapitulation. Weniger militärisch, mehr moralisch. Es geht um das Debakel der Demokratie von 1938, die den Werdegang von Pavels Generation bestimmen wird. Man hat nicht bloß das Brüllen von Hitler im Ohr, sondern auch das Stillschweigen des Westens. Frankreich und England haben bei den Tschechen verspielt. Sie sind zu den »Glöcknern des Verrats« geworden.
Das Leben unter Hitler brachte zusätzlich eine geschichtlich nie dagewesene Erniedrigung und somit eine Schädigung des tschechischen Selbstbilds. Die Erfahrung der Okkupation als zweiter Akt des Kohout’schen Vita sorgte für die für Dramen so typische steigende Handlung. Man konnte die Vendetta-Sehnsucht merken, die Duplizität der Charaktere und den Rollentausch als Lebensstil. Die Heuchelei und das Heroische auf derselben Bühne. Dies wird Pavels großes Thema in diesem Buch. Es wird auch das Paradoxon seiner Texte, in dem der dritte Akt seines Spiels beginnt, die klassische Umkehrung. Es ist ein Jugendgesang, die Euphorie der Selbstbefreiung, die man leicht mit der Freiheit verwechselt. Verglichen mir dem deutschen Diktator, erscheint der russische human.
Sein Stahlglanz nämlich – dem Eponym Stalins »der Stählerne« entsprechend – täuscht zuerst Strahlkraft vor, erst dann folgt die Wucht des Stichs. Die Freude der Altersgenossen von Pavel ist aber ebenfalls traditionell. Die Tschechen waren Russophile. Im Unterschied zu Polen oder Ungarn hatten sie keine direkte Erfahrung mit der »riesigen Eiche« im Osten. Die Eiche der Deutschen wollte man fällen. Die russische hat man besungen.
Und jetzt lag der deutsche Baum wirklich danieder. So, wie das nicht einmal seine ärgsten Feinde bei uns für möglich gehalten haben. Doch wohlgemerkt, eben Kohouts Bilder der »gerechten Vergeltung«, wie die antideutschen Gräueltaten nach 1945 euphemistisch genannt wurden, haben von Anfang an die Gesetzlosigkeit und Brutalität des Geschehens kodifiziert.
Doch auch die Wende von 1948 wurde doppelsinnig. Alle wollten das Gute und beschleunigten den Gulag. Demokratie hat man verspottet als Metapher der Krise, ökonomisch und politisch. Die Nation dagegen wurde heilig, inklusive Sozialismus. Und so geschah es, dass die Tschechen, als das einzige Volk des zukünftigen Ostblocks, sich 1946 ihre Diktatur mit dem Stimmzettel besorgt haben.
Der unbekannte Schreiber der Weltdramen verfasste aber den dritten Akt von Pavels Werdegang. Die wahre Peripetie. Eine Umkehr der Situation ohnegleichen. Denn hinter dem euphorischen Rausch des Anfangs, wie soeben geschildert, befand sich bei manchen Akteuren ein echtes Ethos. Bei Kohout vielleicht am stärksten. Das Pathetische wurde komisch, das Kritische real. Ein neuer Duktus war entstanden, der alles ändern sollte.
Du kannst fabulieren, um schreiben zu können. Du kannst aber zu einer Fabel werden, um schreiben zu müssen. Diese zweite Art hat Pavel verinnerlicht. Weil aber Ethos als solches das Maß der Dinge bedeutet, schuf er als Autor fabelhafte Texte. Und startete eine sehr sachliche Auseinandersetzung mit der Nachkriegsära. Bald wurde er zu einem der wichtigsten Träger des tschechischen Reformdenkens. Dieses Mal sollten Geschichten von ähnlichen Menschen wie er Geschichte werden.
Jedenfalls wurde er zu der Hauptfigur des vierten Aufzugs unsers Stückes mit ungeahnten Konsequenzen. Denn was hier als tschechischer Heimatfilm begonnen hat, wurde zum Weltthriller. Die tschechischen Literaten wollten eine Sprachreform, einen freieren Duktus des Schreibens. Dies alles fing 1967 an, mit einem Schriftstellerkongress. Doch die Sprache zu erneuern meinte schon immer die Nomenklatur zu wechseln. Die große Invasion von 1968 sollte die alte retten. Es sah zu Anfang danach aus.
Der Faden aber entwirrte sich. Es wirkten nämlich die retardierenden Momente. Da nur die deutschsprachige Grenze (BRD, Österreich) friedlich blieb, kam alsbald die Potenz der nationalen Erzählkunst zum Erliegen. Die Tschechen hatten sie antideutsch aufgebaut, und jetzt wirkte sie wie ein Kitsch. Im Gegenteil, die freien Deutschen halfen den unfreien Nachbarn. Wien, München, Köln oder Hamburg wurden jetzt Exiladressen. Und als Kohout nicht zurückkonnte, verwandelte er sich in einen Wiener Vermittler der tschechischen Internationalität.
Der fünfte Akt unseres Schauspiels war da. Lustigerweise hatte er Absurdes in sich, etwas im Sinne der Texte von Ionesco. Übrigens hatte der Mitgestalter dieses Teiles, Havel, in der betreffenden Schule viel einstudiert. Es ist kein Zufall, dass sein Name den Titel unseres Buches krönt. Havel ist meine Generation, und wir dachten anders als die Nachkriegsoptimisten. Als er feststellen musste, dass seine Stücke nicht mehr aufgeführt werden, hat er das Politische nicht gefeiert, sondern analysiert. Er schrieb Die Macht der Machtlosen (1972) und nutzte die internationale Präsenz der tschechischen Literatur, die der Einmarsch zeitweilig sogar stärkte. Wien hat hier viel geholfen.
Das Leben unter Hitler und Stalin hat er ebenfalls absolviert, das Leben danach jedoch hat er als Politiker mitgestaltet. Seit Plato im alten Griechenland träumten die Schreibenden von der eigenen Macht und begründeten sie historisch und philosophisch. So wie Havel die Macht der Machtlosen als Macht der Wortstarken definierte. Ja, und sie brachte ihm die Macht. Ein Burgherr aus dem Bürgerforum.
Katharsis meint aber ebenfalls eine Auflösung, die reinigt und festigt. Die Kohout’sche wurde zum Kontrastprogramm. Seine Rückkehr nach Hause ist bürgerlich und burgfrei.
Dadurch endet die Kohoutiade in einer Auflösung der Kontradiktionen. In der philosophischen Tradition gesagt, wie die klassische coincidentia oppositorum: der Zusammenfall der Gegensätze. Pavels Ethos produziert das Maß und führt zur Mäßigung, so dass alles, was scheinbar gegeneinander lief, sich nebeneinander auf einem Punkt befindet, wo die Gegensätze harmonieren. Macht der Machtlosen ist hier die machtfreie Macht. Und Kohout benutzt sie mit Milde, als die Vitalität des Erzählens, denn letztendlich geht es hier um eine Kohout’sche Vita. Und da Kohout auf Tschechisch Hahn bedeutet, sehe ich in ihm einen Wetterhahn auf einer ewigen Kathedrale, die man baut, indem man so lebt wie er.
Jiří Gruša
2. Kapitel
Der Polenbub wird tschechisiert
Es ist Sonntag oder Feiertag, ich weiß es nicht mehr, ich bin schon drei Jahre alt und spiele in unserer Villa, die im Warschauer Żoliborz in der General-Zajonczek-Straße liegt, als der eben noch heitere Himmel pechschwarz wird und ganz in der Nähe ein Blitz einschlägt. Nie mehr hat mich in meinem Leben etwas so geblendet wie dieser grelle Strahl, der Himmel und Erde, wie mir schien, unendlich lange vereinte, und nie mehr habe ich ein fürchterlicheres Geräusch gehört als das, was folgte: Da zersplitterte die große Glastafel in der französischen Tür, als Baryk in panischer Angst durch sie hindurchsprang. Stellen Sie sich das Bild vor: Direkt vor mir bricht mit einem großen Knall eine Glaswand in sich zusammen und im grellen violetten Lichtschein fliegt durch die Luft zu mir mit wehenden Ohren und phosphoreszierenden Haaren – wer, wenn nicht der Teufel?
So erinnert sich die fiktive polnische Schriftstellerin in meinem Drama Zyanid um fünf an ihre Kindheit, aber der stattliche Hund Baryk lebte tatsächlich, und diese Szene spielte sich genauso ab. Die Villa stand im polnischen Kurort Oświęcim, und das Kind mit der blonden Tolle auf dem Kopf hieß in Wirklichkeit Kohout Pavel, auch Pawlik oder Pawlitschek genannt. Es ist seine früheste abrufbare Wahrnehmung, und er wird sich noch viele Jahre vor Hunden fürchten, bis ihn vor seinem Vierzigsten der erste Dackel mit dem treffenden Namen Adam für immer an jene Spezies bindet. Aber das war auch der einzige Makel an dem Gefühl des langen und ungetrübten Glücks, das von drei geliebten Gesichtern getragen wurde: dem des Vaters, dem der dicke samtweiche Pelzkragen so gut stand, dem der Mutter, bisweilen geheimnisvoll durch eine breite Automobilbrille verdeckt und dem von Nána; sie war eine polnische Bauersfrau, die sich um die Villa, den Garten, den Hund und hauptsächlich um das Blondchen mit der flotten Haarwelle kümmerte. Um eine ausreichende Zahl an Cabriolets und Limousinen der Marke Praga, die er im südlichen Polen vertrat, verkaufen zu können, musste der elegante und witzige Otomar Abend für Abend Gesellschaften besuchen – dies erleichterte ihm seine hübsche und fröhliche Gattin Ludvíka, geborene Ťalská, die sogar erfolgreich die ersten Autorallyes fuhr.
Wo kamen sie her, bevor sie sich das Jawort gaben? Wer entsandte die beiden in die Welt und bestimmte so ihr Schicksal und Wesen, bevor sie beides an ihren einzigen Sohn weitergaben?
Über den Vater des Vaters, der sechs Sprösslinge in die Welt setzte, legt die ehrwürdige k.u.k. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen in Nummer 24 des dreiundvierzigsten Jahrgangs vom 15. Juni 1895 Zeugnis ab. Johann Kohout, bezeichnet als »Aut. Bergingenieur und Betriebsleiter in Karwin«, schildert eingehend die Ursachen und den Verlauf des gewaltigen Bergwerkunglücks sowie die anschließenden Aufräumarbeiten, zu dem es in Karwin am 14. Juni 1894 in den Gruben des Grafen Larisch-Mönnich kam und bei dem er, wie es ihm seine Funktion gebot, als Rettungsleiter tätig war. An diesem Tag verwaisten etwa eintausend Kinder von zweihundertfünfunddreißig tschechischen, deutschen und polnischen Bergleuten und Technikern.
Der Enkel erbte von der Mutter seines Vaters, Marie, die er als Kind immer begeistert besucht hatte, neben dem Rezept für sein heiß geliebtes Gericht, schlesische ›Linsen mit Reis‹, auch eine Messinglampe von Großvater Jan mit einem feinen Schutznetz gegen Methangas und der eingravierten Aufschrift Direktor, mit der er während jener tragischen Stunden in den Schacht fuhr, bevor er selbst schwer verletzt wurde. Später wird sie dauerhaft den von Vater Otomar geerbten Bücherschrank in Wien schmücken und zum Symbol jener Sympathien werden, die sein Enkel für die Atomenergie hegt; sie werden ihm dauerhafte Probleme einbringen, weil er in Österreich mit ihnen nahezu allein bleibt.
Mutters Vater war Bankdirektor, zunächst in Tábor, wo sie geboren wurde, und danach sogar in der Prager Gewerbebank, in der er nach und nach die Hälfte seiner Kinder unterbrachte, von welchen es, wie es dem damaligen Durchschnitt entsprach, auch sechs an der Zahl gab. Zuvor noch gelang es den Söhnen, sich gegenseitig zu bekriegen, der eine war Soldat der kaiserlichen Majestät, zwei weitere wurden Legionäre unter Professor Masaryk. Der jüngste von ihnen, Karel, lehnte sich später gegen die Deutschen auf und fiel für sein Vaterland auf dem Richtplatz in Prag-Kobylisy. Der kleine Bub schöpft seine Erinnerung an Großvater Vilibald Ťalský nur aus vergilbten Fotografien: Ein standesgemäß gekleideter beleibter Mann mit einem Zwicker auf der Nase trinkt Sprudelwasser an der Kolonnade in Karlsbad, wo sein Enkel ungleich mehr erleben sollte; er wird dort unter anderem seinen Militärdienst ableisten, ein paar Stücke nebst erster Prosa schreiben und zum dritten Mal heiraten.
An seinem Vater Otomar kommt ihm am wundersamsten vor, dass er bei seinem abenteuerlichen Flug durch das Leben und die Welt überhaupt heiratete, dass er sich dafür von allen Frauen, die ihn bis zum Tod umschwirren sollten, gerade jene aussuchte, die er dann heiratete, und dass er als Sechsunddreißigjähriger die Zeit und vor allem die Lust fand, mit ihr einen Sohn zu zeugen, der ihm nachhaltig die Flügel band. Der Student der Handelsakademie unternahm 1914 einen Ferienausflug ins damals russische Warschau, wo ihn der Beginn des Weltkriegs einholte. Just an diesem Tag kaufte er sich einen Amethystring, der in Polen rynk kavalierski genannt wird und signalisiert, dass sein Träger Personen weiblichen Geschlechts voller Wohlwollen alles anbietet – außer der Ehe. Seine Freudenfeiern zog er um ein paar Stunden in die Länge, die ihn dann zwar ein paar Jahre kosteten, ihn dafür aber mit einer ungeheuren Erfahrung für den Rest seines Lebens ausstatteten. Die Zarenregierung schottete die Grenzen urplötzlich komplett ab und erklärte auch den jungen Studiosus aus Prag zum Zivilgefangenen. Als ein Graschdansko-plennyj machte er eine unfreiwillige, dennoch einzigartige Sonderfahrt die ganze sibirische Magistrale entlang. Der bewachte Transport wurde im entlegenen Wladiwostok einfach aufgelöst und man wies die Gefangenen an – o tempora, o mores! –, sich irgendwie durchzuschlagen und sich einmal im Monat bei der Polizei zu melden.
Dem jungen Mann half es, dass er Buchhaltung, Sprachen und das Wodkatrinken beherrschte. Beim Sohn, der das Schmuckstück erbte und es innerhalb der Familie zum Wanderring erklärte, bleiben einige suggestive Schilderungen haften, zum Beispiel, warum der Vater die feste Stelle des Kassierers in einer Firma, die Holzbrücken für die Eisenbahn baute, aufgab: Er musste mit ansehen, wie man von den Baustellen Material abzog, so dass ihm der örtliche Brauch einigermaßen schwerfiel, wonach die Bauherren jede neue Brücke persönlich überqueren und dicht vor dem ersten Zug hergehen mussten, der die Belastbarkeit prüfte. Daher nahm er bald das Angebot irgendeines mongolisch-chinesischen Zirkus an, mit dem er Russland in der entgegengesetzten Richtung durchpilgerte. Das Kriegselend dokumentierte er in seinen späteren Berichten unvergesslich mit dem Bild eines Zuckerkegels, der über dem Samowar im Speisezelt hing, damit jeder vor einem bitteren Schluck Tee wenigstens daran schlecken konnte.
Gern erzählte er, wie er während des Bürgerkriegs einen roten Kommissar vor den weißen Kosaken in einem Kamelfell versteckte und ihm so das Leben rettete. Gerade dank dieser Tat durfte er als einer der wenigen Tschechen über die neue polnisch-sowjetische Grenze nach Hause zurückkehren.
Ein ähnlich großzügiges Schicksal, das auch sein Sohn erleben wird, brachte ihn bald nach seiner Rückkehr mit einem der damaligen gesellschaftlichen Dandys zusammen, dem fast gleich alten Grafen Kolowrat. Ganze sieben Jahre arbeitete er für ihn als Sekretär, und man kann sich vorstellen, worauf das in Prag hinauslief, das nach zwei Jahrhunderten der Germanisierung und hundert Jahren nationaler Wiedergeburt allmählich lernte, sich weltläufig zu geben. Es war vermutlich diese Bekanntschaft, welche dem jungen Otomar zur Geschäftsvertretung der tschechischen Automobilmarke Praga verhalf, die der Graf favorisierte. Das unvorhergesehene Erdbeben der Weltwirtschaftskrise liquidierte den jungen Direktor gleich nach seinen Kunden; Anfang der Dreißiger holte er, der nun zu den anderthalb Millionen Arbeitslosen zählte, seine Frau sowie sein Polenbüblein nach Prag zurück. Aus dem Letzteren machte die Prager Schule schnell ein tschechisches Kind; die Münchner Krise und ihr Sieger, der deutsche Führer, machten noch während seiner Kindheit einen politischen Tschechen aus ihm, genauer gesagt einen Tschechoslowaken! Als erwachsener Mann wird er begreifen, dass er dem Führer auch Stalin zu verdanken hat, den Hitler ihm als Befreier von den Besatzern und dann als Befreier von der Freiheit herbeirief.
Die Rückkehr nach Prag war für den Vierjährigen ein Schock. Anstatt der Villa mit Garten ein Zimmerchen, das ursprünglich für die Dienstmagd bestimmt war und das der nette Onkel Josef seiner notleidenden Schwester zur Verfügung stellte; sein dankbarer Neffe wird sich nach vierzig Jahren revanchieren, wenn er ihn, abgeschoben in ein stadtnahes Altenheim, Woche für Woche rasiert. Wie sich die Familie dank zweier fleißiger und begabter Menschen wieder aus ihrer notdürftigen Lage aufzuschwingen begann, gehört zum Genre der klassischen Arbeiterliteratur. Die Gemahlin des Direktors vergisst ihren Stolz und strickt und strickt und strickt Pullover, Schals, Mützen und Handschuhe für hiesige Metzger, Schreibwarenhändler und Schuster, der polnische Salonlöwe kommt und geht, um sich vorzustellen und abermals vorzustellen, bis ihn vielleicht die vereinte Bewunderung der Chefsekretärinnen in die Tschechoslowakische Handelskammer befördert, und von da an bringt ihn sein Talent bereits in eine leitende Position, dieses Mal in das moderne Gebäude der Prager Mustermessen.
Kurz vor dem Krieg ernannte man ihn zum Generaldirektor der Firma Ossa, die einen Fabrikenkomplex im Prager Stadtteil Vysočany besaß. Der erhaben klingende lateinische Name bedeutet schlicht »Knochen«, und um nichts anderes ging es auch; der Vater leitete das wohl am meisten stinkende Unternehmen im Lande, welches aus den ekligsten Abfällen einen betäubend riechenden Leim und eine geschmacksfreie Gelatine für Feinkostprodukte herstellte.
Sobald sein Sohn anfängt, aus dem eigenen Leben eine Bilanz zu ziehen und schrittweise die einzelnen Summae summarum zusammenzuzählen, wird er bis zum Überdruss proklamieren, dass das schicksalhafte Versagen des Kapitalismus, das er an seiner eigenen kindlichen Haut miterlebte, die früheste Motivation gewesen war, die ihn gleich nach dem Krieg zusammen mit seinen Eltern in die kommunistische Partei führte.
Einstweilen befinden wir uns allerdings noch tief in Masaryks Vorkriegsdemokratie, und der Junge leidet vor allem daran, dass er ein Kümmerling ist.
3. Kapitel
Freud und Leid des kleinen Kümmerlings
Nachdem unser Pawlik die ganzen damaligen Kinderkrankheiten – Diphtherie, Masern, Windpocken und Co. – nacheinander bekommen hatte, war er so schwach, dass ihn seine Mutter hin und wieder auf dem Rücken in die zweite Klasse der Volksschule tragen musste. Er fühlte sich gedemütigt, mehrfach versteckte er sich während der Pause hinter den Mänteln in der Kleiderablage, um seinen Traubensaft wenigstens nicht vor den Mitschülern trinken zu müssen oder gar – Schande, Schauer und Schauder, der schiere Schrecken! – Lebertran.
Mit Rücksicht auf seinen jämmerlichen Zustand konnte ihn seine Mutter nicht einmal verprügeln, so dass sie auch nur im Stillen am Verzweifeln war. Die Weihnachtsfeste des Knaben wurden traditionell von einer eitrigen Angina begleitet, und vor dem Ersticken rettete ihn jedes Mal ein chirurgischer Schnitt im Hals, der aus irgendeiner ärztlichen Erwägung heraus ohne Narkose vollzogen wurde. Als sich die schmerzhafte Bescherung zum dritten Mal wiederholte, hatte der Himmel mit dem Jämmerling Erbarmen, und das Christkind legte ihm, während er beim Herrn Doktor litt, ein herrliches Puppentheater unter den Weihnachtsbaum, ja, das Christkind!, denn dieses Geschenk überstieg eindeutig die finanziellen Verhältnisse. Erst viel später wird ihm seine Mutter gestehen, dass sie und der Vater sich in der ganzen Familie Geld zusammengeliehen hatten.
Das Theater war mit einem Dutzend Kulissen – dem Fond, vier Seitenstützen und auch einer Soffitte – prunkvoll ausgestattet; zum Mobiliar gehörten der Königssaal, die Bauernstube, der dichte Wald, die Höhle und die Hölle, wo sich die meisten klassischen Puppenstücke abspielen, und ein Ensemble von etwa zwanzig Drahtfigürchen samt einem Spielkreuz, mit dem die Handgelenke und die Knie durch Fäden verbunden waren. All dies wurde von elektrischer Beleuchtung gekrönt, nicht einmal ein Reflektor mit Farbfiltern fehlte! Es war ein wunderbares Theater, das viele Jahre seinen Dienst tat, und dennoch geriet es irgendwie in Vergessenheit, so dass man gar nicht mehr zurückverfolgen kann, zu welchem Zeitpunkt dies eigentlich geschah. Es fiel wohl der pubertären Eruption zum Opfer, wo auf einmal nahezu alle Requisiten der Kindheit verschwinden, um durch die neuen Utensilien des Erwachsenwerdens ersetzt zu werden. Als die erste ernste Kulturinstitution, in deren geräumigem Rumpf sowohl die Dekorationen als auch die Puppen das Meer der Zeit durchschwommen hatten, sticht sie dem aus dem unfreiwilligen Exil Heimkehrenden erst im Jahre 1990 ins Auge, als er sie, in verblasstes Packpapier gewickelt und mit Bindfäden umschnürt, auf einem ausgemusterten Schrank in der Garage der kleinen Villa in Sázava mehr erahnt als entdeckt.
Die Befürchtung, dass er anstelle der leuchtenden Erinnerung nur deren klägliche Überreste auspacken könnte, wird ihn bis heute davon abhalten, die kostbare Reliquie herunterzunehmen und auszupacken. Mögen die Erben ihr doch eine würdige Feuerbestattung gewähren!
Ein oder zwei Jahre später tauchte an Weihnachten ein Wunder der modernen Technik auf: eine schwarze Blechwalze, in der eine Glühbirne so stark brannte, dass sie oben einen kleinen Schornstein brauchte, damit die Hitze nach draußen entweichen konnte. Der Projektionsapparat, Laterna magica genannt – die Bezeichnung wird viel später noch kommerziell verwertet! –, trug zwei Spulen vor sich, zwischen welchen sich mit Hilfe einer Kurbel glänzende Zelluloidschlangen über das Objektiv wickeln ließen. Zu alldem brachte das Christkind noch eine weiße Leinwand, die sich wie ein Rollladen ausziehen ließ, und vor allem auch zwei Filme: Auf einem tobten ein dicker und ein dünner Herr, die sich andauernd aus Tolpatschigkeit so wehtaten, dass der Bub trotz seiner Schmerzen lachen konnte; das ganze Leben lang wird er, wann auch immer Laurel und Hardy auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm erscheinen, innerlich beben, oft auch vergeblich, wenn er darauf hofft, denselben Spaß wie damals erleben zu können. Auf der zweiten Spule kam ihm sein nur um ein paar Tage jüngerer Altersgenosse entgegengelaufen, der anders als er niemals altern wird, die berühmteste aller Mäuse, Mickey Mouse, samt dem arglistigen Enterich Donald und dem dümmlichen Hund Pluto. Wenn es dem Vater danach war, drehte er schneller an der Kurbel, und da musste man schon vor Lachen weinen!
Ehrlich gesagt, er war ein bei weitem besserer Vater, als es sein Sohn je werden sollte. Es verging kaum ein Sonntag, wo er ihn nicht in den größten Prager Park, den Baumgarten Stromovka, mitgenommen hätte, wo es ihm selbst bei der Zeitungslektüre gelang, auf die nicht versiegenden Fragen des Jungen geduldig zu antworten und ihm sogar eine Mnemotechnik beizubringen, so dass dieser von nun an alle Telefonnummern immer in Zahlenpaare aufteilen und sie mit historischen Jahreszahlen besetzen wird, damit sie ihm im Gedächtnis haften bleiben. Mindestens einmal im Monat nahm der Vater seinen Nachkömmling ins ›Reich der Puppen‹ in der Stadtbibliothek mit, wo er ihm den Sitzplatz so einstellte, dass er gut sehen konnte, und nach dem Schauspiel holte er ihn wieder ab, um an seinen Eindrücken teilzuhaben; viel später wird dem Sprössling ein Licht aufgehen, dass der Vater derweil wohl galante Intermezzi hatte. Nach einem halben Jahrhundert geht er mit der Tochter seiner Stieftochter dorthin, die intelligent gearbeiteten anpassungsfähigen Sessel trifft er immer noch funktionsfähig an, und als er sich nach dem Stück hinter die Bühne zu den versammelten alten Puppen und Kulissen gesellt, wird er, ohne lange zu überlegen, sagen können, was in welchem Stück vorkam. Bald darauf spült das tausendjährige Wasser der Moldau diesen bis dahin unversehrten Ort der Kindheit für immer fort.
Die frühesten Erinnerungen haben auch einen Klang. So läutete zum Beispiel eine gellende Stimme den Frühlingsanfang ein; in den Höfen inmitten des Häuserblocks verkündete sie Dutzenden Mietsparteien, dass sie mit ihrem Hausgeschirr nach unten kommen können, um es dort sofort draaahten und löööten zu lassen! Ein Geselle aus der Slowakei trat auf das Pedal, setzte sein Schleifrad in Bewegung, und zu beiden drängte sich eine Schar Hausfrauen mit Messern und Steintöpfen, die ein Draht gerade noch vor dem Zerspringen bewahrte. Und mindestens einmal im Monat ertönte die immer gleiche Melodie eines umherziehenden Harmonikaspielers, worauf aus den Fenstern aller Stockwerke Zeitungsschnipsel hinabflogen, in welche die damals noch wertvollen Zehnhellerstücke eingewickelt waren.
Das Radio, ein solch neues Wunder, dass es auch die Eltern faszinierte, blieb dem Jungen am stärksten im Gedächtnis haften und beeinflusste ihn am intensivsten. Viel früher, noch bevor ihn das Kinderensemble im tschechischen Rundfunk wie ein Magnet anzieht und damit eine lebenslange Bindung schafft, wurde das Radio zum unzertrennlichen Begleiter in seiner einzelkindlichen Einsamkeit. Sobald er gelernt und seine Hausaufgaben erledigt hatte, drückte er sein Ohr an den Kasten, zu dem ihn schon allein das geheimnisvoll grün leuchtende magische Licht lockte, und er lauschte und lauschte. Bei Hörspielen saß er wie angewurzelt vor dem Empfänger, lange bevor er selbst im Rundfunk in Kinderrollen auftreten sollte.
Nachträglich scheint es ihm, dass die heute schon längst vergessene Institution, der sogenannte ›Schulfunk‹, während der ganzen fünf Jahre in der Volksschule das wichtigste Medium seiner und nicht nur seiner Erziehung war. Morgen für Morgen erschallte, kurz nachdem die Lehrer die Klassen betreten hatten, ein Klopfen am Mikrofon, und aus dem quadratischen Lautsprecher neben dem Porträt des Präsidenten Masaryk und später dem von Beneš ertönte ein »Hallo, hallo, hier ist der Direktor unserer Schule, liebe Schüler, heute hört ihr ...«, und dann folgten die Titel: Slawische Tänze, Mährische Duette, Mein Vaterland, Aus der Neuen Welt, von all dem zwar nur Passagen, die nach fünf Minuten ins Nirgendwo entschwanden, damit man zum eigentlichen Unterricht übergehen konnte, mixed pickles, ein Mischmasch, aber doch ein tagtägliches Eintauchen in die tschechische Musik, die folgerichtig zur musikalischen Begleitung seiner Kinderjahre wurde, um welche die nachkommenden Generationen betrogen werden sollten. Dank der damals aufgeklärten Lehrpläne lässt die Musik auch weiterhin nicht ab, auf den Bub einzuwirken, da capo al fine!
Der Erwachsene fängt jedes Mal an, die Erinnerung regelrecht zu riechen, wenn er das weiße Bauhaus-Gebäude der Tschechischen Nationalgalerie am Messegelände betritt; sie wird einen eindringlichen Geruch von Parkettpolituren oder Waschmitteln ausströmen. Als sein Vater Administrator der Prager Mustermessen war, zog sich durch die hinreißende mehrstöckige Halle, vor der sich damals sogar Le Corbusier verneigte, ein Band von Ausstellungsständen verschiedenster Firmen. Wenn der Junge mitgehen durfte, um farbige Reklamezettel, Aufkleber, Abdrücke oder Muster zu sammeln, wurde er dort, wo sich dereinst die ständige Ausstellung der modernen Kunst ausbreiten wird, der Obhut einer molligen Blondine oder einer schlanken Brünette anvertraut, die bei den Kojen der Firmen Pexider (Pasten) und Pilnáček (Seifen) repräsentierten.
Der Nachkomme, der dies gerade auf dem stilvoll geschnitzten väterlichen Schreibtisch der altehrwürdigen Wiener Firma Gerstl schreibt, der ihn zusammen mit dem Sessel und dem Bücherschrank das ganze Leben hindurch begleiten und danach mit seinem Sohn Ondřej zu ihm zurück nach Wien emigrieren sollte, sieht sich allzeit in Gedanken bei demselben damals noch neuen Tisch im Zimmer des Vaters, wie er verzweifelt auf das leere Papier starrt und fragt: »Vati, worüber soll ich schreiben?« Und er, der stets etwas studiert oder liest, hat immer ein Thema für ihn parat. Die stolze Mama gab dann dem Papierhändler Herrn Chroust aus der Nachbarstraße irgendetwas zum Lesen. Der hagere Mann im blauen Arbeitsmantel, der auf einer Leiter sein Leben zu fristen schien, wie er da in seinem kleinen Laden unentwegt Waren aus steil bis zur Decke steigenden Schubfächern herunterholte, war der Erste, der dem jungen Poeten ein Honorar anbot, wenn er Verse für seine Ausmalbilder dichtete. Die einzigen beiden Zweizeiler, vom Katerchen und vom Kätzchen, welche er hervorbrachte, reichten für ein Buch noch nicht aus.
Seine Mutter sang gerne und gut. Am meisten Volkslieder, hauptsächlich aus der Region um das hussitische Tábor, wo sie geboren wurde, und aus Polen, wo sie am glücklichsten gewesen war. Allmählich kamen Arien aus tschechischen Opern oder politische Couplets hinzu, die sie jedes Mal bei ihrer nächtlichen Heimkehr aus den Theatern vor sich hin trällerte und sich gleich auf Schellackplatten besorgte. Ihr Sohn kennt bis heute beinahe alle auswendig. Dem schlossen sich Melodien mit unbekannten Wörtern an, die ihn, wenngleich er sie in verballhornter Form bei sich abgespeichert hatte, daran erinnern, in welch wunderbarer Stadt der Städte er damals lebte, »Adjööömeinkleiiinergardeoffiziiiier« oder »Laaachebajaazzooo!« je nachdem, ob die Eltern in der jüdischen großen Operette oder im Opernhaus des erhabenen »Neuen Deutschen Theaters« gewesen waren. Prag konnte sich damals aus eigener Kraft internationale Konkurrenz verschaffen! Das wird den Jungen ein halbes Jahrhundert später auf die Idee bringen, aus der das »Prager Theaterfestival deutscher Sprache« entsteht.
Im fortgeschrittenen Kindesalter spielte sich auch eine Episode mit dauerhaften Auswirkungen ab. In einer Krisensituation, als sich der Orthopäde entschied, radikal gegen den runden Rücken des kleinen Lazarus vorzugehen, begann ihm sein Vater fortlaufend Rostands Cyrano de Bergerac vorzulesen. Der in die Jahre gekommene Junge kann sich die bittersüße Situation heute noch lebhaft vorstellen: Er liegt hinter dem Paravent, in der Küchenecke der kleinen Wohnung, wie immer nachts mit Riemen am Bogengestell des harten Gipsbettes festgebunden, um es sich nicht heimlich bequem machen zu können, und in seine Seele dringt die Geschichte des fechtenden Dichters, dessen »Schicksal ist, stets der zu sein, der vorsagt und den man vergisst«, womit die eigene Armseligkeit übertönt wird. Cyrano sollte ihn schon bald als Dichter, Dramatiker und Schriftsteller auf ewig mit seiner schwarz-weißen Ethik und schreiend farbigen Ästhetik positiv wie auch negativ prägen. Cyranos trotzigen Monolog aus dem zweiten Akt mit dem Refrain »Nein, niemals« wird er sich später immer wieder in den Dienststellen der tschechoslowakischen Staatssicherheit im Geiste aufsagen.
Wie soll ich’s halten künftig?
Mir einen mächtigen Patron entdecken
Und als gemeines Schlinggewächs dem Schaft,
An dem ich aufwärts will, die Rinde lecken?
Durch List empor mich ranken, nicht durch Kraft?
Nein, niemals! Oder soll ich, wie so viele,
Ein Loblied singen auf gefüllte Taschen,
Soll eines Hofmanns Lächeln mir erhaschen,
Indem ich seinen Narren spiele?
...
Nein, niemals, niemals, niemals! – Doch im Lichte
Der Freiheit schwärmen, durch die Wälder laufen,
Mit fester Stimme, klarem Falkenblick,
Den Schlapphut übermütig im Genick,
Und je nach Laune reimen oder raufen!
Ein ›kontroverses‹ Paar stellten auch seine Großmütter dar, die weitaus länger lebten als die Großväter. Der Enkel liebte kindlich naiv die Mutter seines Vaters, vor der Großmutter mütterlicherseits hatte er irrationale Angst. Die erste kochte jene ›Linsen mit Reis‹ für ihn, ein Gericht, das bis heute seine Gäste aufgrund des Namens abschreckt, dann aber durch Aussehen wie auch Geschmack Begeisterung hervorruft; Feinschmecker finden das Rezept in Wo der Hund begraben liegt. Die zweite drängte den kränklichen Bub, Rhabarberkuchen zu essen, damit er sich wieder aufrappelte. Er fürchtete sich vor jedem Besuch bei ihr, weil er in einem modrig riechenden Jugendstilesszimmer aushalten musste, solange er nicht ganz zu Ende gekaut hatte. Niemals wird er den furchtbaren Abend vergessen, an dem sich die Großmutter nicht abhalten ließ, aus dem fernen Stadtteil Kobylisy mit der Straßenbahn quer durch ganz Prag bis nach Bubeneč zu fahren, um der Mutter den Blumentopf vorzuführen, in den der kleine Betrüger ein Stück Kuchen unter die Pelargonie gestopft hatte.
Der Kleine war auch ängstlich, tolpatschig und verschämt. Zu seinem Glück musste er im Sommer 1936 aus der privaten Ferienanlage, genannt Camp Allen bei Ledeč nad Sázavou, vorzeitig abgeholt werden, weil er sich schwer erkältet hatte, als er nachts beim Schein einer Taschenlampe über die Baumwurzeln auf dem Waldweg holperte, der vom Städtchen in die Zeltkolonie am Flussufer führte. Die beeindruckende Vorstellung des Puppenspielers Matěj Kopecký, die von Petroleumlampen am Bühnenrand erleuchtet war, wird ihm in fiebriger Erinnerung bleiben. Aus den zwei nachfolgenden Sommerzeltlagern der Organisation Junger Christen YMCA sandte er wie sein Idol Cyrano aus Arras täglich Korrespondenzzettel mit einer bereits vorgeschriebenen Adresse, die statt Roxane den Eltern gehörte, und als Christian wiederholte er in ihnen stets: Ich habe Euch gern! Zudem beschwor er sie immer wieder vergeblich: Holt mich hier ab!
Sein Ausflug durch Prag wurde zur Familienlegende; er sollte zum Legionärsonkel Jindra und der wunderbar großmäuligen Tante Anka fahren, die an Silvester 1935 auf ihn aufpassen sollten, damit sich die Eltern amüsieren gehen konnten. Die Fahrt mit der Straßenbahn wurde im Voraus hin und zurück eingeübt, die Mutter gab ihrem Sohn die ganze Zeit moralische Rückendeckung durch ihre Anwesenheit in der zweiten Hälfte des damals schon modern aufgeteilten Waggons, den man U-Boot nannte. Die selbständige Fahrt endete in einem Fiasko, der Reisende kam schon vom Wenzelsplatz mit der Behauptung zurück, dass »drei Männer mit Blechkannen« ihn böse angeschaut hätten. Das Zitat fungierte zu Hause jahrelang als Bezeichnung für einen Zustand höchster Bedrohung. Aber die größte Erniedrigung erlebte der Junge, als ihn die Mutter mit einem Saft aus Holunderblüten zu ›Onkel Eman‹ schickte.
Der straffe und stämmige Emanuel Procházka kämpfte als tschechoslowakischer Legionär in Italien, und wenn man ihn darum bat, wies er stolz seine Kniekehle vor, wo ihm der Splitter eines österreichischen Schrapnells ein geradezu Shylock’sches Pfund Fleisch herausgerissen hatte; im Nachhinein erscheint er wie ein Freund der Mutter, der sie wohl am ehesten von den väterlichen Seitensprüngen heilte. Das Mietshaus mitsamt dem Kino stand als letztes am äußersten Rand des damaligen Prag an der Endstation der Straßenbahnlinie 23. Und der Holunderblütensaft wurde aus einer Mischung von Zucker, Wasser und drei bis vier großen gelblichen Blütenrispen hergestellt, diese musste ein paar Wochen in Fünf-Liter-Gurkengläsern gären, bevor sie auf Dreiviertelliterflaschen umgefüllt wurde. Ein Dutzend von ihnen bekam der Junge in zwei Taschen eingepackt, damit er sie seinem Onkel mit der Straßenbahn bringen konnte. Niemandem kam in den Sinn, dass schon die Hälfte der kurzen Strecke ausreichen würde, um in den durchgeschüttelten Flaschen Sprengstoff entstehen zu lassen. Zunächst flog ein erster, dann noch ein zweiter und ein dritter Stöpsel aus den Flaschenhälsen, gefolgt von einem Geysir aus süßem Schaum, der sich anschließend auf dem Träger und den Herumstehenden niederließ. Der Schaffner des Waggons fing an, wild an der Glockenschnur zu ziehen, so dass der Fahrer des Motorwagens heftig auf die Bremse trat. Weitere Fontänen schossen mitten in die Reisenden, die massenhaft zu Boden stürzten, aber da wurde der unschuldige Täter samt seinen Taschen zum ersten Mal aus der anständigen Gesellschaft ausgestoßen, so wie es ihm noch mehrmals im Leben widerfahren sollte. Zu seinem Ziel gelangte er per pedes, nur mit einem kümmerlichen Saftrest, dafür weinend und von einer solch harten Zuckerschicht überzogen, dass sie sich erst unter der heißen Dusche aufweichen ließ.
Die geradezu unüberschaubaren Flächen mit Bauparzellen, die gleich hinter dem Haus begannen und ihren Charakter als einstige Felder und Wiesen nicht verleugnen konnten, wurden zum Eldorado des Jungen und zu dem Ort, wo zum ersten Mal der Wetteifer in ihm ausbrach. Bald war er der Meister im Murmelspiel, so dass er kurz darauf nur noch riskant mit Glasmurmeln warf, von denen jede einen Tauschwert von zehn Tonkugeln besaß. Als er auf dem Gipfel seines Ruhmes angelangt war, wurde er zu seinem Leidwesen von einer Bande böser Jungs seines ganzen Schatzes beraubt. Schon damals zeigte sich, was ihm offenkundig angeboren war: Jede Wiederholung sollte ihn langweilen, daher ließ er seine Murmelkumpels links liegen und erschien mit Pfeil und Bogen samt Strohzielscheibe auf den Parzellen. Eine dunkle Erinnerung drängt sich ihm auf, dass er seine Ausrüstung an niemanden verlieh, damit ihn keiner übertreffen würde. Anerkannter Champion wurde er dann im Münzenprägen. Die Hellerstücke, die man aufs Gleis legte, sahen, nachdem die Straßenbahn darübergefahren war, tatsächlich wie alttschechische Silberlinge aus und wurden auf den Parzellen zum begehrten Zahlungsmittel, um das man beim Münzwerfen spielte. Der kleine Junge tauschte für seine erste Sucht mindestens eine von fünf Kronen ein, die er allwöchentlich fürs Schuheputzen und Geschirrwaschen bekam. Bald spürte er mit innerster Gewissheit, die ihn sein Lebtag begleiten sollte: dass er niemals etwas gewinnen würde. Deshalb hörte er damals und für immer mit Glücksspiel und Wetten auf.
Was den schulischen Fortgang betrifft, so entsprach er der Formel ›Einzelkind aus guter Familie‹: Im Zeugnis lauter Einsen bis auf zwei Zweien, im Turnen und im Zeichnen. Das letztere Fach entwickelte sich zu einem wahren Leidensweg in der Prima des Realgymnasiums, wo sie der aufbrausende Professor F. X. Böhm unterrichtete. Er fühlte sich nicht nur, wie es seine Initialen andeuteten, als Künstler, sondern er besaß auch ein Patent für teure Malstifte, die sich »Efixböhms« nannten und die nur risikofreudige Eltern ihren Sprösslingen sich vorzuenthalten trauten. Zu solchen gehörte auch die Mutter des Jungen, die an die Gerechtigkeit glaubte. Als sie sah, wie ihr Kleiner zum fünften Mal verzweifelt eine griechische Amphore malte, weil der schreckliche Mann alle vorherigen Versuche durchgestrichen hatte, veranlasste dieses Unrecht sie dazu, sich dem Lehrer, allen flehentlichen Bitten des Sohnes zum Trotz, vor dem Unterricht in den Weg zu stellen. Auf dem Gehsteig vor der Schule sahen Dutzende wartender Schüler, wie der Pädagoge mit einem neuen Kunstwerk über seinem Kopf wedelte und dabei rief: »Gnädige Frau, das ist keine Amphore, das ist ein Arsch!« Der Himmel sollte es dem armen Jungen damit vergelten, dass er dereinst für das Gebiet der bildenden Kunst einen Malersohn haben wird.
Die Höllenangst vor jeder Stunde in der Turnhalle, wo sich nicht nur die Ringe, der Bock, der Kasten und der Balken in Folterwerkzeuge verwandelten, sondern auch eine gewöhnliche, vom Schweiß tausender Leiber bis in die letzte Faser verhärtete Matte, auf der er keine Rolle schaffte, führte zu einem überraschenden Ende: Der kleine Junge entschied sich, kein Kümmerling mehr zu sein. Seine sportliche Karriere nahm er auf dem Sportplatz der Schule in Angriff, wo er ganz allein nach dem Unterricht die Latte beharrlich immer wieder auf die Ständer legte und sich in den Sand fallen ließ, der auch noch zu Hause von ihm herabrieselte, so lange, bis er sich am Ende des Frühlings von einhundert Zentimetern auf einhundertunddreißig hochschwingen konnte. Im Herbst begann er Schlittschuh zu laufen, und weil das Eisstadion zu teuer war, lief er am liebsten auf der Moldau, die vor dem Bau der Staudamm-Kaskade so dick zufror, dass schwere Walachen Pritschenwagen mit Fässern aus der Brauerei in Smíchov über das Eis an das rechte Ufer und aus der konkurrierenden Brauerei in Braník wieder zu den Trinkern an das linke Ufer schleppten. Zur gleichen Zeit begann er auch Ski zu fahren. Die Bretter schnallte er sich direkt vor Onkel Emans Haus mit Riemen an gefütterte Schuhe, rutschte auf ihnen über die Gleise der Linie 11 und stieg gleich den freien Hügel hinauf, wo er durch menschenleeres Terrain im Schuss bis ins Tal hinabfuhr; eines Tages werden auf dieser Piste einhunderttausend Prager wohnen. Wie jeden Skifahrer kostete ihn damals diese eine Minute glückseligen Flugs eine Viertelstunde beschwerlichen Anstiegs. Im Jahr darauf spielte er schon Eishockey. Auf den Wendepunkt all dieser Bemühungen, den Sturzflug auf Skiern in Harrachov, wird man noch rechtzeitig zu sprechen kommen. Der Gipfel besteht in der Entscheidung des Sechzigjährigen, täglich ausgiebig zu turnen und die Einheiten mit jedem weiteren Jahr – zu verringern? Falsch, zu erhöhen! Der Kümmerling würde staunen.
Eine Kette von Krankheiten und Operationen in Verbindung mit dem Spott der mitleidslosen Altersgenossen führte dazu, dass sein Minderwertigkeitsgefühl wuchs und er sich häufig in die Einsamkeit flüchtete. Damit überhaupt jemand mit ihrem armen Jungen sprach, wenn sich schon niemand danach sehnte, mit ihm befreundet zu sein, lud seine Mutter einmal in der Woche selbst zu einem nicht allzu reich gedeckten Tisch die noch ärmeren Mitschüler aus der Holzbarackenkolonie ein, die dort stand, wo sich heute das nun schon wieder veraltete postmoderne Hotel Diplomat neben dem immer noch modernen Gymnasium aus den dreißiger Jahren befindet.
Die armen Jungs verschlangen das Mittagessen, packten ihre Schildmützen und rannten dann hinaus, um sich über Erdhügel, Löcher und Gräben zu den riesigen, damals noch unbebauten Parzellen zu schleichen; dem kleinen Jungen blieben wieder nur Bücher und Schreibblöcke übrig. Damit versorgten ihn seine Eltern fleißig. Aus der bekannten Reihe Bastel es dir selbst! kaufte ihm sein Vater den Band Mach dir deine eigene Zeitung! Als ihm der Sohn dann feierlich die maschinengeschriebene Ausgabe der Zeitschrift »Studiosus« vorstellte, besorgte er ihm auch eine kleine Vervielfältigungsmaschine. Diese funktionierte mit Matrizenfolien, in welche die Schreibmaschine ohne Schreibband die Buchstaben ›setzte‹ und sie so perforierte. Die Seiten wurden auf eine Walze gespannt, die die Farbe auf das Papier durchdrückte – die Mutter war am Verzweifeln, dass sie auf jeglichem Textil wie Pech und Schwefel hielt! Die Matrize ließ erst nach sechzig Umdrehungen nach, eine ausreichende Auflage für die ganze Klasse und die Verwandten, die allerdings als Vorläufer künftiger Sponsoren für diese einzigartige Drucksache blechen mussten. Die Korrekturzeichen, aus jener lehrreichen Publikation übernommen, werden den angehenden Literaten das ganze Leben lang begleiten, wurden daher auch beim Anfertigen dieses Schriftstücks benützt.
Die Bücher führten dazu, dass der Junge, der endlich robuster wurde, zum Glück rechtzeitig ein weiteres Unvermögen in sich entdeckte. Unweit seiner Wohnung hatte ein Buchhändler seinen Laden, den er gerne besuchte, da jener für einen Pappenstiel zerfledderte Romanhefte, Detektivfälle von Charlie Chan und Kriegsabenteuer des Piloten Biggles anbot. Diese Erinnerung taucht auch heute noch auf, wenn jemand über die Kinder zetert, welche den Schund der Gegenwart, vor allem den des Fernsehens, gierig in sich aufnehmen; kaum einer konsumierte mehr Mist als unser kleiner Junge, und siehe da, schon zweimal fand er Eingang in die Lesebücher und schon einmal wurde er aus ihnen wieder gestrichen! In dem kleinen Laden tauchte plötzlich ein volles Regal mit gut erhaltenen Büchlein im sogenannten Kolibriformat auf, welche die Lebensbeschreibungen tschechischer Geistesgrößen enthielten. Als der Buchhändler das Interesse des Kleinen wahrnahm, bot er an, ihm alle auf Lager befindlichen Exemplare für lediglich zwei Kronen zu verkaufen, damit er sie begierigen Schülern für fünf Kronen weiterverkauft, folglich mit einem Gewinn von hundertundfünfzig Prozent. Der künftige Unternehmer leerte voller Eifer seine Sparbüchse, wo er sein Taschengeld hortete, damals schon sieben Kronen pro Woche und dazu verschiedene Prämien für kleine Gefälligkeitsdienste oder etwaige Schulerfolge. Seine hundert Exemplare schaute er dann zu Hause gebannt wie eine Lebensversicherung an, eigentlich wollte er sich von ihnen gar nicht trennen. Er musste es auch nicht. Er verkaufte kein einziges, auch wenn er sie letztendlich aus Verzweiflung für jeweils eine Krone anbot! Von da an war ihm wiederum ein für allemal klar, dass er sich niemals seinen Lebensunterhalt durchs Geschäftemachen verdienen könnte.
Der Vater musste auch ein ausgezeichneter Pädagoge gewesen sein, da der Sohn einige seiner Anweisungen, Ratschläge und Sprüche erfolgreich seinem Sohn und noch dem Sohn seines Sohnes vermachen wird. Auch sie werden den Frauen in den Mantel helfen. Auch sie werden beim Trinken unbeirrt zwei Grundregeln einhalten – stets dabei mäßig zu essen und niemals den Geist unter den Alkoholspiegel sinken zu lassen, also darauf zu achten, noch denken und sprechen zu können. Weil der Junge ferner ein Aufschneider war, der häufig den Pluralis majestatis benützte, um sich als Erster unter Gleichen erkennbar zu machen, widmete ihm sein Vater folgendes Gleichnis: Auf der Moldau schwimmen die Äpfel und dazwischen wird ein Scheißhäufchen angeschwemmt; als sich alle gemeinsam der Karlsbrücke nähern, von wo aus einige Leute auf den Fluss schauen, fängt das Scheißhäufchen an, begeistert zu winken und zu rufen: »Wir Äpfel schwimmen!«
Auf höchst einfallsreiche Weise servierte sein Vater ihm Maupassant, Dickens, Cervantes, Čapek und weitere Autoren seiner Wahl, indem er sie in die hintere Reihe seines Bücherschranks neben das Dekameron platzierte und sie zu libri prohibiti erklärte. Die verbotenen Früchte wurden jeden Abend, wenn beide Eltern weggingen, eifrig konsumiert, so dass der Junge gleich in mehrere Richtungen grundlegende Informationen bekam, vor allem aus Der Hausarzt, in dem verschiedenste sehr interessante Organe, vorzugsweise weibliche, detailliert abgebildet waren. Buchstäblich in natura, das heißt in belebter Natur, führte sie ihm dann der ältere Cousin Jiří vor, später führender Gastroenterologe an der Karlsuniversität: Er lockte den Jüngeren, wenn er im Vorort Spořilov auf ihn aufpassen sollte, in das nahe gelegene Wäldchen, wo er für ihn von seinen heimlichen Beobachtungsposten aus mit Hilfe eines Fernglases die Aktivitäten der sich liebenden Pärchen fachmännisch kommentierte; er bestätigte damit den wachsenden Verdacht seines Schutzbefohlenen, wonach Kinder keinesfalls von der Vogelwelt oder von der Post gebracht werden, sondern auf jenen Unterschied zurückgehen, den er bei den Mädchen – scharfsinnig wie er war – schon vor seiner Aufklärung wahrnehmen konnte. So flammte das erotische Feuer im Leben des Jungen auf.
4. Kapitel
Sex mit acht
Der verheißungsvolle Titel kündigt keine Gruppenspiele an, sondern konstatiert lediglich das Faktum, dass schon die frühen Äußerungen des Jungen sein ganz und gar alleiniges Interesse am anderen und nicht am eigenen Geschlecht untrüglich signalisierten; zu den flüchtigen und peinlichen Begegnungen mit dem männlichen wird es noch kommen. Auf Familienfotos hält er grundsätzlich seine Cousine oder wenigstens die Tante an der Hand, und schon im zarten Alter bekam er im öffentlichen Schwimmbad zunächst vom Bademeister und dann von der bestürzten Mutter eine Ohrfeige, als ihr ein Holzstück aus einem Astloch vorgeführt wurde, das der schüchterne Junge meisterlich aus der hölzernen Zwischenwand der gemeinschaftlichen Herrenumkleide herauszuziehen gelernt hatte, um Personen jeglichen Alters, die sich in der Damenkabine umzogen, beobachten zu können. Dieses rege Interesse sollte ihn sein Leben lang begleiten.
Die ersten ernsthafteren Sympathien weckten bei dem sich mausernden Adoleszenten Jarunka Landsmannová und Věra Urbanová. Mit der Erstgenannten richtete er sich im vierten Stock über die Hofecke der rechtwinklig angrenzenden Häuser eine Seilbahnpost ein. Ihre letzte Sendung enthielt die Abmachung, dass beide wieder zur selben Zeit für ihre Väter Bier vom Fass holen gingen. Anstelle der üblichen Kostprobe aus den Krügen versuchte der Briefverehrer gleich bei ihrer Begegnung in einer spärlich beleuchteten Einfahrt jene Stellen zu berühren, die ihn an Frauen besonders interessierten, so wollte er endlich herausfinden, woraus sie bestehen. Jarunka flüchtete entsetzt mit ihrem leeren Krug. Vermutlich blieb ihr zu Hause nichts anderes übrig, als sich geständig zu zeigen, da ihre Mutter die Seilbahn am nächsten Tag einfach abschnitt und somit auch die ganze Bekanntschaft. Wenig später wurde mit Věra Urbanová aus dem fünften Stock beim Treppensteigen längere Zeit über Doktorspiele verhandelt. Den Andeutungen reiferer Mitschüler zufolge ließen sich dabei gegenseitig auch weitere, noch interessantere Organe erforschen. Als man schon mal zur selben Zeit allein zu Hause war, schreckte man beiderseits davor zurück und kam nicht zu Besuch.
Da brauten sich schon über dem Leben der Kinder und Erwachsenen die Wolken der bevorstehenden Generalprobe zu einer Apokalypse zusammen. Der Junge fing damals an, sich aus Zeitungen und Zeitschriften wichtige Nachrichten auszuschneiden und sie in seine Hefte zu kleben, so als würde er sie sich im Alter noch einmal in Erinnerung rufen wollen. Sie begannen mit einem Bild, auf dem der Kaiser Haile Selassie seine treuen Abessinier, nur mit Speeren bewaffnet, in den Kampf gegen italienische Panzer begleitet. Besonders dokumentiert wurde ein Ereignis, das dem kleinen Archivar umso wichtiger erschien, als es sich am Tag seines achten Geburtstags abspielte: der volle Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs. Der Kampf der Republikaner, über den die Zeitungen schrieben, dass er auch für Prag geführt würde, faszinierte ihn so sehr, dass er schon in wenigen Jahren sein erstes Versuchsstück Barcelona ruft darüber schreiben wird. Dazwischen überwogen die Bilder von Eishockeyspielern, von denen der Tscheche Bóža Modrý und die drei Schweizer Gebrüder Torriani ihm am meisten imponierten.
Im Jahre siebenunddreißig nahm der Vater seinen Jungen zum ersten Mal mit ins »Café Slavia« beim Nationaltheater, wo er wohl Stammgast gewesen sein musste, da man ihn an diesem Tag überhaupt hineinließ, die Garderobenfrau bemerkte ihn und kam, um ihm aufzumachen. An den großen Fenstern sollte ein Trauerzug mit jenem Herrn Präsidenten vorbeikommen, den auch die Erwachsenen tatíček, also Väterchen nannten, so dass er, Masaryk, für die Kinder eine Art dritter, geheimnisvoll erhabener Großvater war. Dem Bub musste ebenfalls ein Papierperiskop gekauft werden, damit er über das Gedränge hinweg den Sarg auf der Kanonenlafette erspähen konnte, die von Legionären aller vier Fronten des Ersten Weltkriegs begleitet wurde. Damals sah er auch zum ersten Mal seinen Vater und andere Männer weinen.
Und schon war das schicksalsschwere Jahr achtunddreißig mit seinen weiteren Eindrücken da, die in seinen Sinnen für immer haften blieben. Zu den Erinnerungsbildern gehörte auf dem zweiten Zeltlager YMCA in Nordböhmen, dem damaligen Sudetenland, die rätselhafte Verwandlung seines netten Erziehers, eines gewissen Herrn Ilchmann, der ein Jahr zuvor das Heimweh des Jungen nach seinen Eltern in freundlichem Gesprächen zu lindern versucht hatte; dieses Mal erschien er in einer kurzen Lederhose mit bestickten Hosenträgern und in dicken weißen Kniestrümpfen, aber vor allem ließ er sich auf Deutsch mit »Herr Ilchmann!« anreden und begann mit allen deutschen Jungs in der gemischten Abteilung, obgleich sie alle auch Tschechisch konnten, nur in ihrer Sprache zu plaudern, während er die Tschechen lediglich mit einsilbigen Befehlen abfertigte. Die tschechischen Erzieher grüßten ihn spaßeshalber mit der hochgestreckten Rechten und gaben ihm unter sich den Spitznamen skopčák, also Hammelknecht, den man seinerzeit wohl allen gab, die in ähnliche Trachten gewandet waren.
Zur lautlichen Wahrnehmung gehörten schon vor den Ferien die immer häufigeren Proben von Alarmsirenen, die kürzlich auf die Dächer öffentlicher Gebäude montiert worden waren.
Die Geruchswahrnehmung wurde beherrscht vom Gummigestank einer Gasmaske, die man in einem Blechbehälter über die Schulter gehängt auch zur Schule tragen musste. Doch wieder einmal – was war das nur für ein Spaß, als die Frau Lehrerin das Klassenzimmer betrat und eine Elefantenherde vor sich sah. Das kam davon, dass die Filter an den langen Schläuchen den Schülern bis zum Bauch hinunter baumelten, und zudem konnte sie jene auch nicht erkennen! Das Lachen verging dann allen recht schnell, als eines Nachts der Hausmeister, in Begleitung eines Soldaten, sie Hals über Kopf mit den Eltern in den Keller schickte, weil die Nachricht kam, dass der Führer Adolf ohne Vorwarnung als Erster losschlagen würde.
Alle Eingeschüchterten beruhigte bald schon eine überdimensionale visuelle Wahrnehmung: das riesige Stadion von Strahov, wo eine ganze Viertelmillion Zuschauer die tschechoslowakische Armee bewunderte und begeistert grüßte, die zusammen mit den Sokol-Turnern allegorische Bilder aus der Geschichte vorführte, angefangen bei den berühmten Siegen der wackeren Hussiten bis hin zu den tapferen Legionären aus dem Ersten Weltkrieg. Als zum Abschluss die Jagdflieger, Akrobaten der Lüfte, am Himmel erschienen, um einen Luftkampf vorzuführen, zweifelte niemand mehr daran, dass sie im Gefecht bestehen würden. Dann kam der 23. September 1938, und auf einmal wurde über Nacht aus jedem erwachsenen Mann ein Soldat. Das Wort Mobilmachung war allgegenwärtig. Man zieht in den Krieg, auf den ersten Blick fahren alle mit den Straßenbahnen hin, ganze Trauben von einrückenden Zivilisten hängen an den Trittstufen, die Passanten winken ihnen zu, und die ganze Stadt stimmt immer wieder von neuem patriotische Lieder an, die aus den Straßenlautsprechern tönen.
Und dann die Empfindung aller Empfindungen, an dem Abend, als der Vater den Knaben auf jenen riesigen runden Platz im Prager Dejvice mitnahm, wo gegenüber einem Balkon, auf dem ein General mit einer Augenbinde stand – er ähnelte Žižka –, Hunderttausende umsonst die verzweifelte Kampflosung der Steuerzahler skandierten, welche die Kapitulation ablehnten:
Gebt uns Gewehre,
wir haben sie bezahlt!
Darauf folgten nur noch Bilder der Schmach – entwaffnete tschechoslowakische Soldaten, die sich auf den Straßen zwischen den Fuhrwerken tschechischer Vertriebener aus dem Sudetenland schleppten, und der Aufschrei des Dichters Halas, der sich so unvergesslich in das kollektive nationale Gedächtnis einbrannte, dass er nach acht Jahren, im Mai 1946, die Mehrheit der Wähler so beeinflussen wird, dass sie für den Schutzschirm der Sowjetunion stimmen.
Es läutet, läutet die Glocke des Verrats,
Und klingt durch wessen Hand?
Süßes Frankreich, stolzes Albion,
Wir haben sie geliebt, doch nicht gekannt!
Und ein paar Wochen später, nach jenem Morgen, als schmutziger Schnee niederging und die Leute, wie man auf den Fotografien von damals sieht, vergebens die bloßen Fäuste ballten, steht auch ein junger Bursche in einer fremden Uniform mit Gewehr vor der Volksschule, in die seine Kameraden Pritschen von den Lastautos trugen, um das Gebäude bis zum Kriegsende in eine Wehrmachtskaserne zu verwandeln. Während sich seine weiteren Mitkämpfer für die bei ihnen zu Hause nahezu wertlose Mark, die durch den Überfall einen Wert von zehn harten Kronen bekommen hatte, in Prager Metzgereien und Konditoreien mit längst vergessenen Delikatessen die Bäuche vollschlugen, versperrte dieser deutsche Bengel den tschechischen Kleinen den Zugang zum Lernen und zu ihrer Kindheit. Dort, wo gewöhnlich das eigentliche Leben eines Menschen beginnt, winkte ihnen plötzlich der Tod.
5. Kapitel
Protentokrát
Bubeneč, das neue Prager Viertel, das kurz nach dem Krieg gebaut wurde, war auch dahingehend modern, dass dort keine deutschen oder jüdischen Enklaven existierten, wie es im Stadtzentrum üblich war, denn hier wohnten alle beisammen. In einem einfachen Mietshaus in der Dr.-Zikmund-Winter-Straße Nummer 19, wo sich das Fehlen eines Aufzugs schmerzlich bemerkbar machte und die Miete deshalb proportional zum nächsthöheren Stockwerk sank, mieteten die Eltern eine Wohnung in der vierten Etage, wie es ihnen der Geldbeutel erlaubte und das Prestige gebot: Das eigentliche Proletariat bewohnte nämlich das Dachgeschoss mit den Gemeinschaftssanitäranlagen. Von dreizehn Familien waren zwei deutsch und eine jüdisch. Die beiden deutschen Familienoberhäupter arbeiteten auf dem Prager Magistrat und zogen bald nach der Okkupation fort; Hausmeister Říha, der mithalf, die Speditionswagen zu beladen, verriet, dass sie Richtung ›Kleinberlin‹ abgefahren seien; so begann man jene Villengegend zwischen Struhy, Stromovka und Sparta zu nennen, wo die Eigentümer, meist reiche Juden, es noch rechtzeitig geschafft hatten, ins Ausland zu flüchten.
Noch bevor es zu den beiden ersten Sympathieäußerungen gegenüber Jarunka L. und Věra U. kam, musste der Bub, der allmählich wieder zu Kräften kam, wenigstens im Schnelldurchgang die Zeit der Schelmerei und des Schabernacks absolvieren, um die ihn vorher seine Erkrankungen gebracht hatten.
Er meisterte alles im Großen und Ganzen mit Bravour. Ein zufälliger Passant, dem er einen Knallfrosch vor die Füße geworfen hatte und dabei vor Freude wegzulaufen vergaß, packte ihn einmal am Ohr und führte ihn zu seiner Mutter, das zweite Mal griff ihn der Hausmeister am Kragen und schrie, damit ihn auch alle Mietparteien hören konnten, dass er den ganzen Monat nichts anderes tun konnte, als dem Lotterbuben aufzulauern, der es täglich fertigbrachte, im ganzen Haus die Fußmatten zu vertauschen, so dass die Bewohner sie fluchend auf allen Etagen suchten. Zur Strafe gehörte eine klassische Tracht Prügel, für welche man die Mutter heute einsperren würde. Sie griff dann noch öfter zu dieser Maßnahme, und allen Fachleuten zum Trotz trieb sie ihren Sprössling damit nicht in den Selbstmord, sondern erzog ihn durchaus passabel. Zu der damaligen Zeit bestand allerdings die Gefahr, dass es ganz umsonst sein könnte, weil gerade das große Sterben begann. Nur ganz große Optimisten konnten glauben, dass das Protektorat Böhmen und Mähren keineswegs die von Hitler verheißenen tausend Jahre Bestand haben würde, sondern dass der tschechische Spottname Protentokrát – zu deutsch »Für dieses eine Mal« – recht behalten würde.
Unmittelbar zu Beginn des Protektorats wartete die erste imaginäre, gleichwohl aber entscheidende Hürde auf den Jungen, seine Zeit in der Volksschule neigte sich dem Ende zu, und er befand sich an jenem Scheidepunkt, von welchem mehrere unterschiedliche Wege ausgingen. Seine bisher gähnend langweiligen Vorzeigezeugnisse, denen gerade die Zweien im Turnen und Zeichnen das Prädikat der Echtheit verliehen, öffneten ihm überallhin die Tür, und die Lehrer machten seinen Eltern einige namhafte Gymnasien mit humanistischer Ausrichtung schmackhaft, wo sich die Beseeltheit des Sohnemanns beweisen könnte und seine Kränklichkeit keine Rolle spielen würde, ganz im Gegenteil, sie gehörte doch irgendwie zur zeitgenössischen Vorstellung eines gebildeten Menschen. Der weise Vater wollte aber auf Nummer sicher gehen und finanzierte ihm einen sogenannten psychotechnischen Test. Diesen führte eine gewisse amerikanische Firma oder Institution in der Prager Altstadt durch, also rückte der Prüfling für ganze drei Tage an. Endlose Stunden füllte er Dutzende Formularvordrucke aus, wobei weniger das Wissen geprüft wurde, sondern eher seine Schlagfertigkeit, seine Ausdauer und die Fähigkeit, mit einer Aufgabe innerhalb einer eng begrenzten Zeit fertig werden zu können. Am vierten Tag errechnete man aus der Gesamtsumme der Resultate, dass der Junge das gerade eröffnete Realgymnasium in Prag-Dejvice besuchen sollte, wo Altgriechisch und Geometrie zwar wegfielen, Latein allerdings nicht fehlte. Zwei Fremdsprachen dominierten, Englisch und ursprünglich Französisch, das aber ausgerechnet durch Deutsch ersetzt worden war. Sein Erfolgserlebnis bei diesem Test war ein mächtiger Impuls zu grundlegendem Selbstvertrauen. Sprachen sollten für ihn nie mehr ein Hindernis sein, in der zuletzt genannten wird er einmal sogar genauso denken und schreiben wie in seiner Muttersprache. Und die Zeit, für so manchen wie eine Peitsche, wird für ihn zum Freund und Helfer, weil er immer verlässlich einschätzen kann, wie viel Zeit er für etwas benötigt. Seine nahezu krankhafte Genauigkeit, ihm hauptsächlich durch seine anfänglichen Jahre im Rundfunk angetrimmt, wird zum Dauerschrecken seiner Mitarbeiter und seiner Familie. Sogar noch später in Wien, wo die Verspätung um eine akademische Viertelstunde zum guten Ton gehört, wird er als Besucher zur verabredeten Zeit bei den Gastgebern klingeln, so dass er nicht nur einmal den Hausherrn in Unterhosen und seine Gemahlin mit Lockenwicklern antrifft ..., aber das konnte sich der Junge damals höchstens in seinen Fieberfantasien ausmalen. Als er im Sommer 1939 froh gelaunt seinen Ferienkoffer packte, konnte er nicht einmal ahnen, dass mit dem ersten September gleichzeitig das Gymnasium und der Weltkrieg für ihn begannen.
Nachdem er sich mit all seiner kindlichen Willenskraft geweigert hatte, die Ferien ohne seine Mutter zu verbringen, hielt er sich in den Kriegsjahren in einer Mansarde eines Fotografen, Herrn Rakušan, im nordböhmischen Städtchen Bělá pod Bezdězem auf. Zum Taschengeld in beständig gleicher Höhe, aber jetzt anderer Währung – sieben Protektoratskronen pro Woche –, für die er weiterhin den Hausdiener spielte, verdiente er sich in Bělá bescheiden etwas hinzu, indem er hinter den Särgen mit den Toten im Schlepptau der örtlichen Blaskapelle anstelle des verstorbenen Esels einen Karren mit der großen Trommel zum entlegenen Friedhof zog. Als Lehrling in der Zaubererschule des Meisters Beránek in Prag-Podolí, die er zwei Jahre lang fleißig besuchte, unterhielt er mit seinem Freund Jiří Alexa gleichermaßen gegen Bezahlung die Gäste des örtlichen Grandhotels mit recht ordentlichen Tricks. Einmal in der Woche, wenn die erwähnte Kapelle zur Abwechslung für lebendige Menschen im Pavillon am Marktplatz spielte, stand er mit seiner gestrickten roten Lieblingsmütze auf dem Kopf hinter einer Steinbalustrade und sang Texte zeitgenössischer Schlager zum Stolz der Mutter und zur Freude ihrer Freundinnen, die sich möglichst weit nach vorne drängten, damit seine Kinderstimme im Getöse der Blechbläser zu ihnen dringen konnte. Bei einem bestimmten Lied nahm er die Mütze genauso ab wie die flanierenden Männer ihre Hüte, wobei die Vorsichtigeren vorgaben, jemanden zu grüßen oder sich Luft zuzufächeln. Es war »Jenes unser tschechisches Lied«, und alle wussten, dass sein Autor Karel Hašler zu den Opfern des Nazi-Terrors gehörte. Zudem galt diese Ehrenbezeigung der Statue. Sie stellte einen tschechoslowakischen Legionär dar, wurde hier zu Ehren der Gefallenen des Befreiungskrieges aufgestellt, und als die Deutschen ihre Beseitigung anordneten, zersägten die Hiesigen sie so klug, dass man sie dereinst wieder zusammensetzen könnte, und vergruben sie direkt im Park auf dem Marktplatz, der so zum historischen Grab der Freiheit wurde.





























