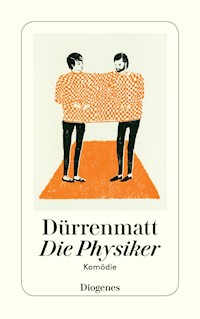Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ab und zu besuchte ich die Kirche in meinem Heimatort. Und eigentlich hätte ich rundum zufrieden sein müssen, denn meine Wünsche und Lebensziele erfüllten sich mit der Zeit weit mehr als erwartet. In stillen Stunden, wenn ich alleine war, stellte sich jedoch in meinem Herzen – trotz Wohlstand und Familienglück – eine Sehnsucht nach etwas ein, das sich fast wie Heimweh anfühlte. Diese unerklärliche Leere verging zwar nach einiger Zeit, aber ab und an kehrte sie wieder zurück. Der plötzliche Tod meines ersten Sohnes zerstörte dann alle meine bisherigen Vorstellungen vom Leben und machte es plötzlich völlig sinnlos für mich. Mein Herz zerbrach. Durch mein Schreien zu Gott in jener Not fand ich dann die Antwort, die zu einem sinnerfüllten Leben mit einem tiefen inneren Frieden führte, den ich mit meinem Verstand nicht begreifen kann. Ich erlebte und erlebe die Information Gottes durch Sein Wort: „Wer mich findet, der findet das Leben.“ Spr. 8,35a In diesem Buch berichte ich über meinen Weg mit Gott zum Ziel meines Lebens. Dieser Weg dauert nun schon länger als 50 Jahre an. Meine Hoffnung ist, dass auch die Leser meiner Berichte jene Stillung der Sehnsucht in ihren Herzen erfahren und dass auch sie zur Gewissheit des ewigen Lebens gelangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Weg zum Ziel
VON GOTT • DURCH GOTT • ZU GOTT
Heinz Flock
Heinz Flock wurde 1927 in Rheinhausen geboren.
Von 1953 bis 1958 Reisender im Außendienst für die Firma Verseidag, ab 1959 selbständiger Handelsvertreter.
Nach verschiedenen Wegführungen und dem Tod seines ersten Kindes findet er mit 35 Jahren zum Glauben.
Von 1968 bis 1980 setzt Heinz Flock die Arbeit von Willi Bolender als leitender Mitarbeiter der Überkonfessionellen Zeltmission Hannover (ÜZH) fort. Seitdem dient er als Mitarbeiter und Verkündiger in verschiedenen freikirchlichen Gemeinden.
Seine erste Frau stirbt nach 47 Ehejahren, er heiratet zum zweiten Mal im Mai 2000. Aus der ersten Ehe stammen zwei Söhne und eine Tochter.
Impressum
© 2014 Folgen Verlag, Wensin
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-944187-95-2
Umschlaggestaltung: Agentur für Werbung » Thomas Weißenfels
Titelbild “ab in den himmel”: PowderPunk! © photocase.com
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Mein Weg zum Ziel ist früher als Buch im Verlag Edition Sermon erschienen.
Bibelzitate nach der Lutherbibel, revidierte Fassung von 1984, 2011, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart,
und nach Elberfelder Bibel, revidierte Fassung von 2006, 2010,
© SCM R. Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG.
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Mein Leben ohne Gott
Als Gott mich fand: Mitten im Leben – mitten im Leid
Gemeinschaft mit Christen in der Gemeinde Jesu
Bibellesen: Gottes Worte verstehen – aber wie?
Was bedeutet Wiedergeburt nach Gottes Wort?
Drei wichtige Wahrheiten für ein praktisches Glaubensleben
Jesus praktisch erlebt: Persönliche Erfahrungen mit Gottes Wort
Vom Glauben zum Dienen: Die Geschichte der Überkonfessionellen Zeltmission Hannover
Alles hat seine Zeit: Mein weiterer Weg ab 1981
Meine Wege sind nicht Eure Wege
Dankbarkeit trotz Ablehnung durch die Menschen
Allein und doch nicht einsam
Hat sich Opa einen Hund angeschafft?
Was wirklich zählt in meinem Leben
TOD – und was kommt dann?
Religionen oder Evangelium von Jesus Christus?
Echt oder unecht?
Schlusswort und Zusammenfassung
Anhang: Fotos
Vorwort
Wir leben in einer Medien- und Informationsgesellschaft, die auf ein riesiges Wissen zurückgreifen kann. Ein beträchtlicher Teil davon wurde in den vergangenen 100 Jahren erworben. Mit Hilfe moderner Technik können wir zudem jederzeit an dieses Wissen herankommen und es zu einem nicht unerheblichen Teil auch für unser persönliches Leben nutzen. Dieses Wissen und all die weiteren Errungenschaften und Fortschritte sollen vorrangig unserem Wohlergehen dienen, sollen das Leben erleichtern, mehr Freizeit und Ruhe ermöglichen und uns dadurch zufriedener, glücklicher und dankbarer machen. Das Ergebnis aber ist ein anderes: Weder die Gesellschaft als Ganzes noch der einzelne Mensch sind zufriedener, glücklicher und dankbarer geworden.
Da stellt sich natürlich die Frage, was wir falsch machen. Übersehen wir bei den vielen Informationen, die uns vorliegen, eine Information, die wichtiger ist als alle anderen? Die uns darüber unterrichtet, wer uns geschaffen hat und wozu wir geschaffen wurden, wozu wir leben und wie wir zu einem sinnvollen und damit glücklichen, zufriedenen und dankbaren Leben voller Ruhe und Frieden kommen, nach dem sich jeder Mensch sehnt? Gibt es eine solche Information? Und wenn ja, warum ist sie uns dann nicht bekannt? Hat sie uns noch nicht erreicht? Oder wird sie uns verwässert, fehlerhaft oder falsch übermittelt?
Nachdem ich nun 86 Jahre lang auf dieser schönen Erde leben darf, möchte ich von Informationen berichten, die mich erst in meinem 36. Lebensjahr bewusst erreichten. Diese Informationen Gottes, unseres Schöpfers, sind niedergeschrieben in der Bibel. Hier heißt es zum Beispiel:
… wer mich (Gott) findet, der findet das Leben … Spr. 8,35a
oder die Worte Jesu:
... ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Joh. 10,10
Diese Worte erlebte ich durch Gottes Gnade als die Wahrheit. Aus eigener Erfahrung kenne ich den großen Unterschied zwischen einem Leben als religiöser Mensch und einem Leben als wiedergeborener Christ, als ein Kind Gottes in persönlicher Gemeinschaft mit Gott.
Als der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945, an meinem 18. Geburtstag, in Europa endete, waren die Städte in Deutschland völlig zerstört. In allen Bereichen herrschte großer Mangel, sodass das Leben der Menschen zunächst in dem Bemühen bestand, das Lebensnotwendige wie Wohnung, Heizmittel, Kleidung und vor allem Nahrung zu besorgen. Der Schwarzmarkt blühte. Allerdings behielten die meisten es nicht für sich, wenn sie einen Ort gefunden hatten, wo man etwas Lebenswichtiges oder andere Hilfe erhalten hatte. Sie sagten es ihren Nachbarn und Freunden weiter, damit auch sie diese Hilfe fänden. Um ihre eigene Not wissend, die sich auch in ihrem täglichen Leben bemerkbar machte, nahmen sie die Nachricht dann freudig auf und begaben sich sofort zu dem angegebenen Ort. Hier durften auch sie dann erleben, wie ihnen geholfen wurde, denn sie fanden, was sie benötigten.
Mit meinen folgenden Berichten möchte ich allen Lesern, darunter meine Lieben, Freunde und Bekannte, den Weg und Ort mitteilen, wo und wie ich persönlich Sinn und Ziel meines Lebens sowie Ruhe und Frieden fand und wo die stille Sehnsucht, die in mir wie in allen Menschen ist, gestillt wurde. Jeder Mensch findet sein Leben in den Informationen Gottes in der Bibel wieder. Bei ehrlicher Prüfung der Diagnose Gottes über sein Leben, seine Gedankenwelt, das Verborgene in ihm, wird jeder Leser der Bibel feststellen müssen: Das bin ich, es gilt auch mir. Ich habe festgestellt und erlebt, wie wichtig es für uns Menschen ist, den folgenden Rat Gottes anzunehmen:
… lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ps. 90,12
Weiterhin sagt Er uns durch Sein Wort, wie wir klug werden und zeigt uns darüber hinaus den Weg und Ort, wo uns geholfen wird. In den vielen Jahren meines neuen Lebens konnte ich die Erfahrung machen: Alle Menschen, die mir begegnet sind, haben eine innere ungestillte Sehnsucht, ohne zu wissen, wie diese Sehnsucht gestillt werden kann.
Ich danke dem Herrn Jesus, dass er mir Menschen zur Seite gestellt hat, die mir geholfen haben, diese Berichte zu schreiben. Der HERR weiß um ihre Hilfe und ich bitte IHN, sie zu segnen.
Heinz Flock, im Dezember 2013
Mein Leben ohne Gott
Zunächst möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen: Ich heiße Heinz Flock und bin am 8. Mai 1927 in Rheinhausen geboren. Mein Geburtsort befindet sich im Kreis Moers am Niederrhein im Westen Deutschlands.
Wie jeder Mensch wurde ich als ein Original wunderbar geschaffen – also einmalig, unverwechselbar, unaustauschbar, ausgerüstet mit herrlichen Fähigkeiten wie Denken, Fühlen, Wollen, Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Ps. 139,14
Mein Schöpfer, der in mein Leben Wachstum hineingelegt hat, überließ mich, Sein Geschöpf, meinen Eltern, mit der Aufgabe, mich zu lieben, das heißt zu behüten, zu beschützen, zu nähren, zu pflegen, zu erziehen, zu lehren, bis ich ein reifer selbständiger Mann geworden wäre.
Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Ps. 127,3
So vertraute Gott, mein Schöpfer, mich meinen Eltern an. In den ersten vier Jahren meines Lebens wohnten wir in Rheinhausen. Hier betrieb mein Vater als Friseurmeister einen Damen- und Herrensalon zusammen mit einem Gesellen, einem Lehrling und meiner Mutter als seiner rechten Hand. An diese Zeit in Rheinhausen gibt es in mir keine besonderen Erinnerungen. Später erzählten mir meine Eltern, dass 1929 mein Bruder Helmut geboren wurde, aber leider kurz nach einer schweren und fehlerhaft ausgeführten Zangengeburt verstarb.
1931 sind wir dann nach Krefeld umgezogen. Im Jahr 1932, ich war fünf Jahre alt, erlitt ich einen schweren Unfall. Wie üblich spielte ich mit anderen Kindern auf der Straße, denn es gab zu dieser Zeit noch wenig Autoverkehr. Ein Junge hatte ein Spielzeug bekommen, das aus einer großen Zielscheibe und etlichen Pfeilen mit einer Metallspitze bestand. Heute sagt man Dart-Spiel dazu. Aus zwei bis drei Metern Entfernung musste dann ein Pfeil mit der Hand auf die Zielscheibe geworfen werden. Natürlich spielte ich mit, denn es machte großen Spaß, und jeder wollte der Beste sein. Als ich an der Reihe war, warf ich den Pfeil auf diese Zielscheibe, dann ging ich zur Scheibe, zog meinen Pfeil heraus, drehte mich um und wollte zur Seite gehen. In dem Augenblick hatte ein Spielkamerad bereits vorschnell seinen Pfeil abgeworfen. Anstatt nun in die Scheibe zu fliegen, landete der Pfeil mit der Spitze genau in der Pupille meines rechten Auges. Trotz aller Bemühungen der Ärzte war die Sehkraft meines Auges nicht mehr zu retten; ich war auf dem rechten Auge blind. In allem Leid durfte ich noch von Glück sprechen, denn mein Auge war nicht ausgelaufen. Meine Sehfähigkeit wurde natürlich sehr beeinträchtigt. Da ich aber mit fünf Jahren noch sehr jung war, lernte ich nach und nach mit dieser Einschränkung zu leben. Äußerlich war mir die Blindheit auf dem rechten Auge nicht anzusehen; lediglich im Zeichenunterricht in der Schule gab es einige Probleme.
Mein Bruder Manfred wurde 1932 und meine Schwester Wilma 1936 geboren. Als Ältester musste ich dann oft das Kindermädchen spielen und auf die kleinen Geschwister aufpassen.
Während meiner Grundschulzeit in der Volksschule ab 1933 begann ich mit Begeisterung Fußball zu spielen. Obwohl ich ein Rechtshänder war, stellte sich heraus, dass ich – wie man so sagte – ein starker „Linksfuß“ war, der sehr schnell laufen konnte und eine gute Kondition hatte, sodass ich gerne als Mitspieler in den einzelnen Mannschaften aufgenommen wurde. Bereits mit zwölf Jahren spielte ich in der 1. Schulmannschaft der Schule 40 in Krefeld. Im gleichen Jahr, 1939, wurde unsere Schulmannschaft Stadtmeister von Krefeld-Uerdingen. Das Endspiel wurde im Rahmen eines großen Festes mit vielen Vorführungen in der Grotenburg-Kampfbahn, einem Fußball- und Sportstadion, ausgetragen. Das Stadion war voll besetzt, und ich war natürlich sehr stolz, vor so vielen Menschen in einer Mannschaft spielen zu dürfen, die dann auch noch den Sieg davontrug.
Die erste Zeit in Krefeld, von 1931 bis 1934, war für unsere Familie eine sehr schwere Zeit, denn wir hatten in Deutschland fünf bis sechs Millionen Arbeitslose, und das waren in der Mehrzahl Familienväter. Zu jener Zeit gab es fast nur Einverdiener-Ehen, sodass von dieser Arbeitslosigkeit circa 25 Millionen Menschen betroffen waren. Das wirkte sich auch auf die Einnahmen meines Vaters im Damen- und Herrensalon aus. Ich kann mich entsinnen, dass wir am Monatsende aufgrund der mageren Umsätze gerade einmal die Miete für unsere kleine 2-Zimmer-Wohnung nebst einem Zimmer im Dachboden aufbringen konnten. Eine 2-Zimmer-Wohnung bedeutete damals Folgendes: Wenn ich die Wohnungstür öffnete, stand ich direkt in der Wohnküche, die mit einem Kohleofen ausgestattet war, welcher auch zum Kochen und Backen benutzt wurde. Von diesem Raum ging es direkt in das unbeheizte Schlafzimmer meiner Eltern. Anfangs schliefen wir Kinder mit bei unseren Eltern, später, Ende der 30er Jahre, mieteten meine Eltern zwei identische Zimmer eine Etage über uns als Schlafzimmer hinzu, sodass wir das bisherige Schlafzimmer neben der Küche als Wohnzimmer benutzen konnten. Wenn ich heute im Jahr 2013 die Leute über Armut in Deutschland reden höre, dann kann ich solche Aussagen vor diesem Hintergrund nicht verstehen.
Nachdem ich die Volksschule im Jahr 1941 im Alter von 14 Jahren nach acht Schuljahren mit „Gut“ und „Sehr Gut“ bestanden hatte, ermöglichte mir der Staat, in der Lehrerbildungsanstalt Xanten – kurz LBA – eine weiterführende Ausbildung zu absolvieren. Was lernten wir auf der LBA? Begabten Schülern, die zumeist aus finanziellen Gründen keine weiterführende Schule besuchen konnten – damals kostete der Gymnasialbesuch 20 Reichsmark pro Monat –, wurde nach erfolgreichem Besuch der Volksschule hier die Möglichkeit einer Ausbildung zum Volksschullehrer eröffnet. Um den Bedarf an Lehrern zu decken, war geplant, jährlich 16 000 Schüler in die LBA aufzunehmen. Begabte Schüler wurden von ihren Lehrern empfohlen, aber über die endgültige Aufnahme in die LBA entschied dann das Bestehen eines zweiwöchigen Ausleselehrgangs. Die Ausbildungszeit sollte vom Volksschulabschluss bis zur 1. Lehrerprüfung fünf Jahre betragen, gleichzeitig hatte man damit auch das Abitur in der Tasche. Die Ausbildung in Internaten sowie Kleidung, Lehrmittel und ärztliche Betreuung waren mit eingeschlossen. Darüber hinaus erhielten wir ein Taschengeld. Die Auswahl geschah nach allgemeiner Haltung (Führereignung), körperlicher Leistungsfähigkeit (Sport), geistiger Begabung, musikalischen Fähigkeiten und Werkschaffen. Es ging sehr militärisch und diszipliniert zu. Bei den Fächern rangierte die Leibeserziehung ganz oben. Diese Form des Internatslebens gefiel mir überhaupt nicht. Hinzu kam, dass ich als unmusikalischer Mensch auch noch Geige lernen musste. Am schlimmsten war jedoch, dass ich großes Heimweh bekam. Nach sechs Monaten Internatsleben konnte mich dort niemand mehr halten; ich wollte nur noch nach Hause. Direkt nach meiner Heimkehr am 1. Dezember 1941 begann ich dann in der Seidenweberei Jammers in Krefeld eine Ausbildung zum Industriekaufmann.
Inzwischen hatten die Angriffe der Alliierten auf deutsche Städte und Industrieanlagen begonnen. Ab 1942 nahmen die Nachtangriffe immer mehr an Stärke und Häufigkeit zu. Jedes Mal waren wir erleichtert, wenn die großen Bombengeschwader über uns hinwegflogen und wir nicht das Ziel waren; einige Zeit später beobachteten wir dann, wie der Himmel über dem Ruhrgebiet oder über anderen Städten wie Düsseldorf und Köln in der Nacht glühend rot wurde. Die Engländer hatten Krefeld jedoch nicht vergessen. Die Stadt konnte auch gar nicht uninteressant für sie sein, denn auch hier wurde für die Rüstung produziert. Die Deutschen Edelstahlwerke lieferten hochwertiges Metall und die Seidenindustrie Stoff für Fallschirme. Gab es ab 1940 zunächst nur kleine Luftangriffe, so brachte der 3. Oktober 1942 Tod und Verderben über Krefeld. Englische Bomberbesatzungen warfen an diesem Tag aus 152 Flugzeugen 366 Tonnen Spreng- und Brandbomben ab.
Dann kam der 21. Juni 1943. Meine Geschwister waren damals mit der Kinderlandverschickung in ländliche Gebiete Ostdeutschlands evakuiert worden. Mein Vater hatte an diesem Abend Dienst bei der Flugabwehr, die circa anderthalb Kilometer von unserem Haus entfernt im Feld postiert war. Nur meine Mutter, einige Hausbewohner und ich befanden sich in unserem Haus. In den vergangenen Nächten waren bereits viele Angriffe auf benachbarte Städte geflogen worden. Meine Mutter und ich legten uns daher halb angezogen ins Bett. Gegen Mitternacht gab es großen Alarm, und meine Mutter begab sich mit den anderen Hausbewohnern sofort in den Luftschutzkeller, der sich unter unserem Haus befand. Auch ich hatte den Alarm gehört, wollte aber noch ein wenig liegen bleiben und bin dann offenbar wieder eingeschlafen. Plötzlich wurde ich wach und hörte ein ungeheures Brummen in der Luft. Trotz Verdunkelung der Fenster war das Schlafzimmer taghell erleuchtet. Die ersten Flugzeuge flogen über uns und warfen als Leuchtmittel die gefürchteten „Christbäume“ ab, um das Ziel für die nachfolgenden Bomber sichtbar zu machen. Unsere Schlafzimmer waren in der 2. Etage des Hauses. Heute denke ich, dass wenige Menschen jemals von der 2. Etage so schnell in den Keller gelaufen sind wie ich in dieser Nacht. Kaum hatte ich den Kellerraum erreicht und die Tür hinter mir zugezogen, schlugen auch schon die ersten Bomben nur circa 200 Meter von unserem Haus entfernt ein. Es waren 661 Bombenflugzeuge, die in Wellen über unsere Stadt flogen und zunächst 1033 Tonnen Sprengbomben und dann im Anschluss 1041 Tonnen Brandbomben abwarfen. Für uns, die wir alle voller Angst hilflos im Keller saßen, verging die Zeit quälend langsam, denn Geschwader auf Geschwader folgte. Ich betete und rief Gott, den ich in meinem sonstigen Leben bisher kaum beachtet hatte, um Hilfe und Bewahrung an.
Nach circa anderthalb Stunden hörten die Bombeneinschläge auf, und es wurde ruhiger. Unser Haus, ein Eckhaus, war nicht direkt getroffen worden. Verursacht durch die Bombeneinschläge in circa 200 Meter Entfernung von uns ging ein Riss von oben nach unten durch unser Haus. Alle Fenster und Türen waren vollkommen zerstört. Die Feuer, die durch die Phosphorbrandbomben entstanden waren, konnten durch den Einsatz der Bewohner gelöscht werden. Ganze Straßenzüge waren nur noch Trümmerhaufen, es gab viele Tote und Verletzte. Die Schreckensbilanz des Infernos in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 1943: 1036 Menschen starben und 9349 wurden verletzt. Die gesamte Innenstadt war auf rund vier Quadratkilometer dem Erdboden gleich gemacht. 82 Prozent der Wohnungen waren zerstört oder schwer beschädigt. Krefeld hatte das erfahren, was deutsche Bomber zuvor in England angerichtet hatten. Eine Stadt auszuradieren heißt in Anlehnung an das englische Coventry „coventrieren“. Krefeld hatte in der warmen Sommernacht vor 70 Jahren eine Apokalypse erlebt, wie es sie im hiesigen Raum noch nicht gegeben hatte. Drei Tage und Nächte brannte die Stadt. Tagsüber war der Himmel schwarz und nachts loderte der Feuerschein.
Unsere Stadt hatte in allem Unglück noch Glück, denn die Piloten hatten bereits ein bis zwei Kilometer vor dem eigentlichen Stadgebiet damit begonnen, die „Christbäume“ und Leuchtbomben zur Zielmarkierung für die nachfolgenden Bomber abzuwerfen. Hierdurch fiel ein großer Teil der Bomben aufs Land und ins benachbarte Moor, sodass die Südstadt und ein Teil der Oststadt verschont blieben. Nachdem es hell geworden war, lief ich zu den Flugabwehrstellungen, umarmte meinen Vater und konnte ihm berichten, dass wir vor dem Schlimmsten bewahrt worden waren. Zunächst war unser Haus unbewohnbar, und so zogen wir zu meinen Großeltern nach Goch. Nach kurzer Zeit begab ich mich jedoch zurück nach Krefeld zu meinen dortigen Großeltern, die in einer kleinen unbeschädigten Wohnung lebten. Mein Ausbildungsbetrieb war total zerstört und in die weniger verwüstete Südstadt ausgelagert worden. Nach einigen Wochen war unsere Wohnung wiederhergestellt, und wir konnten dort wieder einziehen. Bis Ende des Krieges gab es dann noch etliche kleinere Luftangriffe bei Tag und Nacht, aber unsere Wohnung blieb von weiteren Beschädigungen verschont. 200 Meter von unserem Haus entfernt war mittlerweile ein großer Luftschutzbunker gebaut worden, in dem die Menschen während der Angriffe Schutz suchten. Er wies mehrere Etagen auf, davon einige oberhalb der Erde. Zwar wurde auch der Bunker von Sprengbomben getroffen, aber durch die sichere Konstruktion waren an den Außenwänden lediglich kleine Einschlaglöcher entstanden. In den letzten Monaten des Krieges wohnten und schliefen viele Anwohner ununterbrochen in Doppelbetten im Bunker.
Am 31. Mai 1944 beendete ich meine Lehre und bekam nach einer Abschlussprüfung, die mit „Gut“ bewertet wurde, den Industriekaufmanns-Gehilfenbrief. Kurze Zeit später erhielt ich einen Stellungsbefehl der Wehrmacht. Zu dieser Zeit war ich in der Hitlerjugend im Bereich Sport tätig, natürlich in der Abteilung Fußball. Der Führung der Hitlerjugend Krefeld gelang es, mich aufgrund meiner Behinderung durch das blinde rechte Auge vom Wehrdienst freizustellen. Am 1. Juli 1944 wurde ich dann von der Hitlerjugend dienstverpflichtet. So wurde mein Unfall im Alter von fünf Jahren jetzt für mich zur Bewahrung vor der Einberufung in den Wehrdienst. Wie ich im Nachhinein erfahren musste, sind viele meiner Altersgenossen im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einer Infanteriedivision aus Krefeld nach Nordrussland einberufen worden. Diese Division ist nach vielen Rückzugsgefechten in der Nähe von Danzig bei der Schlacht um die Tucheler Heide vernichtet worden. Nur eine kleine Zahl von Soldaten überlebte damals, sodass nur wenige meiner Altersgenossen wiedergekommen sind.
In der Bannführerschule Grefrath nahe der holländischen Grenze wurde ich in der Verwaltung und im Bereich Sport eingesetzt. Anfang 1945 erhielten wir den Auftrag, Panzergräben und Ein-Mann-Löcher vor Venlo an der deutsch-holländischen Grenze mit dem Spaten auszuheben. Die amerikanischen Truppen waren von Westen kommend bereits sehr nahe an Venlo herangekommen, und wir bekamen den Befehl, uns in Richtung Krefeld abzusetzen. Einige Tage später tauchten amerikanische Panzer vor Krefeld auf. Wir flohen auf Lastwagen über die Rheinbrücke in Krefeld-Uerdingen in südöstlicher Richtung über Duisburg in das circa 60 Kilometer entfernte Wuppertal-Barmen. Zwischenzeitlich hatten wir einige Jagdbomberangriffe unverletzt überstanden. In der folgenden Nacht erlebten wir dann einen Großangriff auf Wuppertal-Barmen. Wir hatten Schutz in einem Luftschutzbunker gefunden. Am nächsten Tag wurden wir in die Nähe von Radevormwald circa 20 Kilometer weiter südöstlich von Wuppertal-Barmen verlegt. Kurze Zeit später, Mitte April 1945, wurde unsere Gruppe aufgelöst, und jeder für sich konnte versuchen, durch die Wälder, Felder und Orte nach Hause zurückzugelangen.
Mein Freund Herbert und ich besorgten uns zunächst Zivilkleidung, um uns dann auf den Heimweg zu machen. Zunächst kamen wir fast 50 Kilometer westwärts bis nach Gerresheim gut voran, welches am östlichen Stadtrand von Düsseldorf liegt. Dort erlaubte man uns im Keller eines Hauses zu übernachten. Es trennten uns nur noch knapp 30 Kilometer von der Heimat. Am nächsten Tag, es war der 20. April 1945, gingen wir weiter nach Düsseldorf Richtung Rhein, denn wir mussten ja an das gegenüberliegende Rheinufer gelangen, weil Krefeld an der linken (westlichen) Rheinseite liegt. Die Rheinbrücke lag jedoch völlig zerstört im Flusslauf, sodass wir nach einer anderen Möglichkeit suchen mussten, den Fluss zu überqueren. In einem Bootshaus entdeckten wir unversehrte Paddelboote. Das fanden wir super, denn so konnten wir jetzt ohne großen Kraftaufwand mit der Strömung des Rheins die circa 18 Kilometer Richtung Krefeld-Uerdingen paddeln. Nur noch ein paar Stunden und wir wären zu Hause. Was für eine Freude erfüllte uns, aber es sollte anders kommen. Wir waren mitten auf dem Rhein, als wir plötzlich einige Schüsse hörten. Sofort lenkten wir unser Boot auf das linke Rheinufer Richtung Oberkassel zu. Nachdem wir nichts weiter hörten und auch keine Soldaten sahen, paddelten wir in der Nähe des linken Ufers weiter in Richtung Heimat. Das sollte unser Verhängnis sein, denn einige hundert Meter weiter flussabwärts kam dann das abrupte Ende unserer schönen Reise. Auf einem Anleger standen amerikanische Soldaten mit Maschinengewehren. Das erste Mal im Leben habe ich damals in das Gesicht eines Farbigen gesehen. Die Soldaten forderten uns auf, sofort an Land zu paddeln. Kaum ausgestiegen wurden wir festgenommen, auf einen Jeep geladen und in ein Gefangenenlager gefahren. Dort wurden wir wiederholt von Offizieren verhört. Ihnen konnten wir überzeugend glaubhaft machen, dass wir nicht der Wehrmacht angehörten und damit keine Soldaten waren. So wurden wir drei Tage später entlassen und nach Krefeld in unsere Heimat gefahren.
Jeder kann sich vorstellen, wie groß die Freude bei meinen Lieben war, als ich plötzlich vor dem Haus stand, denn sie wussten nicht, wo ich in der vergangenen Zeit im Ruhrkessel gewesen war. Meine Schwester Wilma war inzwischen schon einige Zeit aus der Kinderlandverschickung nach Hause zurückgekehrt. Nun befand sich unsere Familie wieder heil und ohne körperliche Schäden zu Hause, aber mein Bruder Manfred fehlte noch. So hofften wir, dass auch Manfred bald wieder bei uns sein würde. Dies geschah dann einige Wochen später. Er hatte sich als 13-Jähriger von Tschechien kommend fast tausend Kilometer quer durch Deutschland bis nach Krefeld durchgeschlagen.
Vierzehn Tage, nachdem ich zu Hause angekommen war, fuhr ein Jeep mit bewaffneten amerikanischen Soldaten vor unser Haus. Sie fragten mich knapp: „Sind Sie Heinz Flock?“ Ich antwortete mit „Yes“ und ihre knappe Antwort war „Come on“, und ich wurde in den Jeep gesetzt. Sie nahmen mich ohne jeden Kommentar gefangen. Meine Eltern waren zu der Zeit gerade in unserem Garten, der einige hundert Meter von unserem Haus entfernt in einer Kleingärtnerkolonie lag. Als sie abends nach Hause kamen, war ich verschwunden. Erst Wochen später sollten sie erfahren, wo ich hingebracht worden war. Das Kommando fuhr mich zunächst nach Düsseldorf zum Polizeipräsidium. Dort angekommen, wurde ich in eine Gefängniszelle gesperrt, in welche bereits einige Kameraden aus der Hitlerjugend eingeliefert worden waren. Hier wurden wir einige Tage verhört und mussten etlichen Reportern Fragen beantworten, die anschließend im amerikanischen Fernsehen gesendet werden sollten. Einige Tage später, im Mai 1945, wurden wir auf offenen Lastwagen unter Bewachung nach Wuppertal gefahren. Dort hatte die amerikanische Besatzungsmacht ein Internierungslager eingerichtet, das durch hohe Stacheldrahtzäune und starke Bewachung abgesichert war. Der Empfang war sehr „rustikal“, denn wir hatten zur Bewachung Frontsoldaten, die viel Elend und Tod ihrer Kameraden durch die deutsche Wehrmacht erlebt hatten; entsprechend brutal war unsere Behandlung. Für uns gab es pro Tag eine Hand voll Sauerkraut zu essen oder eine Scheibe Brot, während wir vor unseren Fenstern (durch die wir bloß nicht schauen durften) GI´s mit schönen großen Weißbroten vorbeilaufen sahen.
Ich habe in diesen knapp sechs Monaten der Internierung gelernt, was Hunger ist und wozu Menschen fähig sind. Mir wurde deutlich vor Augen geführt, was der Mensch ist, wenn seine Titel wertlos sind, seine vormalige Stellung in Wirtschaft und Gesellschaft nichts mehr bedeutet und er in der Internierung wie jeder andere Gefangene nur noch eine Nummer ist. Das war für mein zukünftiges Leben äußerst lehrreich und hat mich sehr geprägt. Im Oktober 1945 wurden wir dann freigelassen und konnten zurück zu unseren Familien.
Die Hauptbeschäftigung von diesem Zeitpunkt an bis zur Währungsreform im Juni 1948 – also in den nächsten fast drei Jahren – bestand darin, zu überleben, denn in den zerstörten Städten fehlte es an allen Mitteln, die zu einem Leben nötig sind, darunter Wohnung, Heizungsmaterial, Bekleidung, Lebensmittel und so weiter. Rückblickend waren wir in dieser Zeit bei allen Nöten, Schwierigkeiten und allem Mangel zwar ohne Zukunftsperspektive, dennoch aber nicht niedergeschlagen, depressiv oder unzufrieden. Wir waren vielmehr dankbar, dass wir den Krieg überstanden hatten, dass wir zu Hause bei unseren Eltern, Geschwistern und Freunden sein durften und nicht zuletzt, dass wir nachts wieder ungestört schlafen konnten.
Nachdem der harte Winter 1946 überstanden war, begann wieder der Fußballbetrieb in den einzelnen Ligen. Es wurde jeweils am Sonntagnachmittag gespielt und die Massen bewegten sich über die Straßen der Stadt Richtung Grotenburg-Kampfbahn. Zu den Spielen gehörte dienstags und donnerstags das Training. Ich spielte in der 1. Mannschaft des VfL Preußen-Krefeld und erlebte viel Freude und schöne Gemeinschaft mit meinen Mannschaftskameraden. Zu den Auswärtsspielen wurden wir anfangs auf Lastwagen zu den entsprechenden Orten gefahren. Nach dem Sonntagsspiel trafen wir uns im Vereinsheim und jeder Spieler erhielt ein schönes Abendessen. Anschließend kamen die Frauen oder Freundinnen der Spieler sowie weitere Freunde. Wir hatten bei Musik und Tanz frohe Gemeinschaft und waren wie eine große Familie.
Es gab Fußballspiele bei Gastvereinen auf dem Land, die für uns besonders attraktiv waren, denn als Belohnung gab es Naturalien (Kartoffeln und anderes mehr), die am darauf folgenden Montag bei den einzelnen Spielern abgeliefert wurden. Es gab auch für unseren Verein Sponsoren. So erhielt ich mit meinen Spielerfreunden einmal einen wunderschönen Stoff für einen Anzug als Prämie. Ich denke, wenn man wie ich noch so jung war, sieht die Welt auch in solch schweren Zeiten froh und hoffnungsvoll aus, denn es liegt ja noch das ganze Leben vor einem, und schlimmer, als es gewesen war, konnte es kaum werden.
Es war im August 1947 – wir hatten auf dem Nebenübungsplatz der Grotenburg-Kampfbahn trainiert –, als ich zunächst mit den anderen zum Duschen unter die Haupttribüne des Stadions ging. Es war ein lauer Sommerabend und auf den Tribünenplätzen saßen die Leichtathleten und Leichtathletinnen in fröhlicher Gemeinschaft mit einigen Spielern unserer Fußballmannschaft. Damals hatte die Leichtathletikabteilung von Preußen Krefeld sieben deutsche Meistertitel errungen und war also sehr erfolgreich. Inmitten der Schar entdeckte ich eine wunderschöne Leichtathletin. Sie hatte dunkle lange Haare, eine dunkelgebräunte Haut und eine tolle Figur. In mir entstand der Wunsch, dieses Mädchen näher kennenzulernen. Ich bat einen Mannschaftskameraden, der sie kannte, mich ihr vorzustellen. Nachdem wir uns eine Zeit lang gut unterhalten hatten, nahm ich allen Mut zusammen und lud sie mit meinem Mannschaftskameraden und seiner Freundin zum Tanzen in die „Bosi Bar“ ein. „Bosi“ steht übrigens als Abkürzung für Bombensicher. Diese Tanzbar war in den Kellerräumen des „Seidenfadens“, einem schönen Varieté, eingerichtet und 1947 wiedereröffnet worden. Wir haben uns sofort gut verstanden; es war ein wunderschöner Abend für uns, sodass wir uns beim Abschied aufs Neue verabredeten. Wir verliebten uns ineinander so sehr, dass wir uns nach fünf Jahren verlobten und im August 1953 heirateten.
Rückblickend danke ich Gott dafür, dass Er uns Menschen so wunderbar geschaffen hat, besonders auch dafür, dass wir lieben können und geliebt werden – sei es die Liebe der Kinder zu den Eltern oder umgekehrt die Liebe der Eltern zu den Kindern, aber besonders die Liebe zwischen Mann und Frau. Was wäre unser Leben ohne Liebe, wenn ich nicht Anteil nehmen dürfte am Leben meiner Frau und umgekehrt. Wie schade, dass wir Menschen oft blind sind für dieses Geschenk Gottes an uns. Gerne schaue ich auf die sechs Jahre zurück, in welcher die Liebe zwischen uns wuchs. Als verantwortlicher Mann erzogen, wollte ich natürlich erst dann heiraten, wenn ich in der Lage wäre, auch eine Familie zu ernähren, denn Kinder wollten wir schon beide haben.
Nach der Währungsreform im Juni 1948 war es mein Bestreben, einen guten Arbeitsplatz zu bekommen und dadurch weiter zu lernen. Mein Ziel war, wie man sagt, „etwas zu werden“ und gut zu verdienen, um meiner späteren Familie ein schönes, sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Ich hatte ja als Kind erlebt, wie es ist, wenn man nicht genug Geld besitzt und kannte die Zeit der sechs Millionen arbeitslosen Familienväter, sodass ich wusste, was Armut ist. Durch Vermittlung eines Sponsors des VfL Preußen erhielt ich dann am 15. September 1949 eine Praktikantenstelle in der Verseidag Krefeld. Damals war dieses Textilwerk mit mehreren Abteilungen und Werken eines der größten Textilunternehmen in Deutschland. Es beschäftigte einige tausend Mitarbeiter. In etwa zur gleichen Zeit wurde der bezahlte Vertragsfußball eingeführt. Ich erhielt einen Vertrag und hierdurch ein gutes Monatsgehalt. Durch diese beiden Einkommensquellen konnte ich nicht nur für die Zukunft sparen, sondern auch meine Eltern mit unterstützen, denn wie schon erwähnt, fehlte es nach dem Krieg an allem.
Die Verseidag unterhielt für ihre kaufmännischen Lehrlinge eine in der ganzen Textilbranche Deutschlands bekannte Textilschule, die nach gutem Abschluss ein guter Türöffner war, um in der Textilwirtschaft eine höhere Position zu erreichen. Um die Lehre machen und diese Schule besuchen zu können, musste man jedoch ein Abitur vorweisen. Als Praktikant durfte ich zunächst mit den aus dem Krieg zurückgekommenen Offizieren, die ja bereits älter waren als ich, einen einjährigen Textilkurs besuchen. Mir genügte das aber nicht, und so bat ich den Personalchef, an der dreijährigen Schulklasse, die am 1. April 1949 begonnen hatte, teilnehmen zu dürfen. Er lehnte das mit der Begründung ab, dass ja nur noch eineinhalb Jahre bis zur Abschlussprüfung zur Verfügung stehen würden. Ich blieb aber hartnäckig und wies darauf hin, dass ich doch während meiner Kaufmannslehre in der Kriegszeit auch Textilunterricht gehabt habe, der allerdings nicht mit der Qualität des Unterrichts der Verseidag-Textilschule zu vergleichen war. Ich sagte ihm, dass letztlich doch nur ich mich blamieren könnte, wenn es nicht klappen sollte. Das hat ihn offenbar beeindruckt und er ermöglichte mir den Besuch der Schule.
Die folgende Zeit bis April 1952 war nun voll ausgefüllt mit dem Nachholen des bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren gelehrten Stoffs, der laufenden Arbeit als Praktikant, dem zweimaligen Fußballtraining in der Woche und dem sonntäglichen Fußballspiel um die Meisterschaft. Meine Freundin Margarethe – kurz „Mäcci“ – konnte ich nun viel weniger oft sehen, aber sie war damit einverstanden, unterstützte mich und so lernte ich oft bis in die Nacht hinein. Wir hatten ein gemeinsames Ziel und trotz Mühe und Arbeit war es eine schöne Zeit.
Die Abschlussprüfung der Fachschule habe ich dann im April 1952 mit Auszeichnung bestanden. Sie konnten mir das Abschlusszeugnis einer dreijährigen Textilfachschule trotz der verkürzten Zeit nur mit „Sehr Gut“ bestätigen.
Ich hatte erreicht, was ich erreichen wollte, denn mein Name war in der Führungsetage bekannt geworden. So wurde ich zunächst als kaufmännischer Mitarbeiter in der Verkaufsabteilung Ornata angestellt; hier hatte ich bereits erste Kontakte mit Geschäftskunden, die zu uns in die Firma kamen, um sich Heimtextilien vor Ort für ihr Geschäft auszusuchen.
Mäcci und ich verlobten uns an Pfingsten 1952; ein Jahr später heirateten wir. Die vierzehn Tage Flitterwochen durften wir dann in Kalterherberg in der Nordeifel verleben. Einige Tage, nachdem ich wieder im Dienst war, wurde ich zum Direktor der Abteilung Ornata-Heimtextilien gerufen.
Er fragte mich: „Können Sie das Fußballspielen aufgeben?“ Ich antwortete: „Wenn es denn sein muss, ja, natürlich.“ Weiter fragte er: „Können Sie Auto fahren?“ Ich musste antworten: „Nein.“ Er fragte weiter: „Wie wollen Sie dann im Außendienst für die Verseidag arbeiten?“ Ich antwortete: „Kein Problem, den Führerschein kann ich schnell machen.“ Er sagte dann: „Machen Sie umgehend den Führerschein, denn Sie sollen ab November für die Verseidag in einem Gebiet in Nordwest-Deutschland mit Sitz in Bremen als Handelsreisender für uns arbeiten.“
Das war für mich zunächst unfassbar, denn für die in Deutschland schon vor dem Krieg bekannte Firma Verseidag Vertreter zu werden, das war wie ein Sechser im Lotto, noch dazu ohne ein Abitur zu haben. Meine Hartnäckigkeit bezüglich des Besuchs der Textilfachschule hatte sich also gelohnt. Da ich durch mein Fußballspielen in Krefeld unter den Fußballfreunden der Stadt bekannt war, ging ich zu einem Fahrschullehrer und sagte ihm: „Ich muss in möglichst kurzer Zeit den Führerschein machen.“ Er sagte zu mir: „Prima, Flocki, setz’ Dich dort in den Wagen auf den Fahrerplatz; dann wollen wir mal Autofahren lernen.“ Nach drei Wochen, am 11. September 1953, bestand ich die Fahrerprüfung; im Oktober 1953 erhielt ich den Führerschein.
Die Firma stellte mir einen Opel Olympia zur Verfügung, damit ich etwas Fahrpraxis erwerben könnte. In dieser Zeit schon ein Auto haben zu dürfen, war natürlich super. Anfang November fuhr ich dann nach Bremen und bezog im Stadtteil Schwachhausen/Alteneichen eine 1-Zimmer-Wohnung in einem Einfamilienhaus. Ich war sehr glücklich; der einzige Kummer war die örtliche Trennung von meiner Frau. Sie arbeitete damals bereits einige Jahre als Kassenaufsicht im Kaufhof in Krefeld. Einige Monate später, im Mai 1954, zog auch meine Frau in diese 1-Zimmer-Wohnung ein. Endlich zusammen sein zu können, stimmte uns natürlich glücklich. Im Sommer 1954 fand dann die Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz statt. Wir hörten im Radio die Übertragung des Endspiels Deutschland-Ungarn. Es war wahnsinnig spannend. Nach dem Sieg zogen wir singend mit Freunden durch die Straßen Bremens in Richtung Weser-Terrassen, um dort mit anderen den Sieg der deutschen Mannschaft zu feiern.
Im Frühjahr 1955 wurde meine Frau schwanger, und am 17. Dezember 1955 wurde unser erstes Kind Robert, genannt „Robby“, geboren. Die Freude war natürlich riesengroß. Zu dritt konnten wir jetzt allerdings nicht mehr in der 1-Zimmer-Wohnung bleiben. Was nun? Denn Wohnungen gab es zu jener Zeit nicht. Mit Hilfe meiner Firma – sie zahlte für mich eine Mietkaution von 10 000 DM, was damals sehr viel Geld war – konnten wir dann im Februar 1956 eine 3-Zimmer-Wohnung mit Garage in einem Neubau beziehen. Er befand sich im Bremer Stadtteil St. Magnus in wunderschöner Lage. Das Haus umfasste sechs Wohnungen. Wir waren die jüngste Familie, vier andere Familien waren im mittleren Alter und ein alleinstehender älterer Herr wohnte unten im Parterre. Es war eine gute, eine prächtige Hausgemeinschaft, und wir haben oft fröhliche Stunden gemeinsam verlebt.
Dann erfolgte am 25. Februar 1956 ein tiefer Einschnitt in meinem Leben. Ich wurde plötzlich nach Krefeld gerufen, denn mein Vater war in ein Krankenhaus eingeliefert worden Es stand nicht gut um ihn, er war an Leukämie erkrankt und hatte sich nicht richtig behandeln lassen. Als ich am Freitagabend in sein Krankenzimmer trat, hörte ich seine Erleichterung und er fragte: „Wo ist der Kleine?“ Er meinte Robby, seinen ersten Enkel, der zweieinhalb Monate alt war. Ich musste ihm leider sagen, dass die Straßenverhältnisse es nicht zugelassen hatten, Robby mitzubringen, denn auf den Straßen lag Eis und Schnee. Er hatte volles Verständnis, freute sich jedoch, dass ich gekommen war.
Als es meinem Vater besser zu gehen schien, gingen meine Mutter und ich nachts nach Hause. Mutter kehrte im Laufe des Morgens ins Krankenhaus zurück; wir hatten das Friseurgeschäft weiterhin geöffnet, da auch meine Schwester Wilma dort tätig war. Gegen Mittag ging ich zunächst in die Firma. Hinterher habe ich es sehr bereut, dass ich nicht die ganze Zeit bei meinem Vater geblieben war. Ich hatte nicht die Schwere seiner Erkrankung erkannt, und mir wurde das auch nicht gesagt. Nun saß ich an seinem Bett, in dem er ruhig lag. Dann hörte mein Vater offenbar herrlichen Gesang und Musik; er dirigierte mit seinem Arm und sprach zu mir: „Hör mal, ist das nicht herrliche Musik, eine herrliche Stimme?“ Ich hörte nichts. Meine Mutter sagte mir, dass Papa das in der letzten Woche öfter gehört habe, auch als er zu Hause lag. Plötzlich – es war gegen 14.30 Uhr – faltete mein Vater die Hände, hob seinen Kopf aus den Kissen und sagte: „Harre, meine Seele, harre des HERRN. Alles IHM befehle, hilft ER doch so gern.“ Dann legte er seinen Kopf zurück und war gestorben.
Was diese Worte bedeuteten, habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Rückblickend ist mir klar geworden: In der letzten Stunde seines Lebens erlebte mein Vater die Schächer-Gnade. Die hatte der Verbrecher, der rechts neben Jesus Christus gekreuzigt wurde, erlebt, als er kurz vor seinem Tod Jesus bat, an ihn zu denken, wenn er in Sein Reich käme. Mit seinen letzten Worten legte auch mein Vater sein Leben in die Hände Jesu Christi. Der Tod meines Vaters, den ich sehr liebte und der mein bester Freund war, hatte mich tief im Herzen getroffen. Trotz eines glücklichen Familienlebens, trotz des Erfolgs im Beruf, trotz der Liebe meiner Frau war ich viele Jahre in meinem Herzen betrübt, und ich konnte mich nicht mehr so richtig frei heraus freuen.
Anbei der Liedtext, aus dem mein Vater unmittelbar vor seinem Heimgang die ersten beiden Zeilen zitiert hatte:
Harre, meine Seele, harre des Herrn!
Alles Ihm befehle, hilft Er doch so gern.
Sei unverzagt, bald der Morgen tagt,
und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach.
In allen Stürmen, in aller Not
wird Er dich beschirmen, der treue Gott.
Mein Vater, der evangelisch getauft und konfirmiert war, musste dieses Lied aus dem deutschen evangelischen Gesangbuch gekannt haben und benutzte diese Worte, um sich Jesus anzuvertrauen.
Mitte 1957 wurde mir ein viel größeres Verkaufsgebiet mit Sitz in Hannover übergeben. Nun begann wieder die Suche nach einer schönen Wohnung, möglichst in einer guten Wohngegend. Das war zunächst wieder sehr schwierig, denn auch die Stadt Hannover war im Krieg stark zerstört worden. Endlich fanden wir in der Südstadt, in der Nähe des Maschsees und des Stadtwalds Eilenriede, einen Neubau mit einer schönen Wohnung und einer Garage. Natürlich war eine solche Neubauwohnung nur gegen eine Mietkaution – wieder in Höhe von 10 000 DM – zu bekommen. Auch hier wurde ich von meiner Firma unterstützt.
Im Juni 1957 konnten wir uns die ersten Ferien erlauben. Für 13 Tage fuhren wir in den Schwarzwald. In dieser Zeit blieb unser Sohn Robby bei meiner Mutter und meiner Schwester in Krefeld. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub zogen wir von Bremen nach Hannover um und holten anschließend Robby aus Krefeld ab. Zunächst war meine Frau von Robbys Reaktionen beim Wiedersehen etwas enttäuscht, denn er lief nicht direkt auf sie zu. Er war offensichtlich bei Oma und meiner Schwester so richtig verwöhnt worden. Nach kurzer Zeit aber lief er dann Mama mit strahlenden Augen in die Arme, und sie war wieder glücklich.
Die Aufbauarbeit in dem neuen Gebiet erforderte einigen Einsatz, der Arbeitstag dauerte nicht selten 12 bis 14 Stunden. In der Woche war meine Frau in jener Zeit mit Robby allein in Hannover. Die Erfolge blieben nicht aus, sodass mir von der Verseidag angeboten wurde, dieses Verkaufsgebiet als selbständiger Handelsvertreter zu übernehmen. Die Firma gab mir für den Start ein Darlehen, damit ich mir ein neues eigenes Auto kaufen konnte. Weiter gaben sie mir eine Garantiesumme als Einkommen für das erste Jahr als selbständiger Handelsvertreter. Nachdem das Jahr vorüber war, durfte ich dann dankbar feststellen, dass die von mir erwirtschaftete Provision doppelt so hoch war wie die von der Firma garantierte Summe; ich war also ein gesegneter Mann.
Es muss im Jahr 1959 gewesen sein. Bei einem Geschäftsbesuch erzählte mir der Firmeninhaber von seinem Glauben an Jesus Christus. Wie er mit dem Herrn Jesus täglich persönliche Gemeinschaft hatte im Gebet, also im Gespräch nicht nur sonntags oder hin und wieder. Er ließ den Herrn Jesus an seinem ganzen Leben, sei es Familie, Geschäft oder andere Lebensbereiche, teilnehmen und konnte auch von Gebetserhörungen berichten, die er hin und wieder in den unterschiedlichsten Gebieten seines Lebens erfuhr. In einfachen Worten erzählte er mir den zentralen Inhalt des Evangeliums von Jesus Christus. In meinen 35 Jahren hatte ich noch nie von einem Menschen, einem Christen, ein solches Zeugnis über sein Glaubensleben gehört, wo ich doch meinte, von Christen umgeben zu sein: meinen Eltern, Freunden, Kollegen, Bekannten, denn sie waren alle getaufte Christen.
Zu Hause angekommen, erzählte ich meiner Frau von dieser Begegnung und fügte hinzu: „So möchte ich auch glauben können.“ Dann holte mich der Alltag mit seinen vielen Aufgaben wieder ein, und ich vergaß dieses Gespräch. Meine Frau wurde erneut schwanger und so wurde dann unsere Tochter Dagmar am 12. September 1961 geboren. Ihr mittlerweile fünf Jahre alter Bruder Robby liebte sie sehr. Es kam die Zeit, als wir anfingen, uns mit dem Bau eines Einfamilienhauses zu beschäftigten. Meine Frau wollte allerdings nicht in einem alleinstehenden Haus wohnen, denn sie war mit den Kindern aufgrund meiner Geschäftsreisen oft allein. Deshalb suchten wir ein Reihenhaus am Rande oder in der Nähe von Hannover. Eines Tages lasen wir von größeren Reihenhäusern in Bad Nenndorf, die dort von einer Treuhandgesellschaft gebaut und angeboten wurden. Die Lage in Bad Nenndorf war für uns ideal, denn in fünf Minuten würde ich auf der Autobahn sein und meine Kunden in alle Richtungen schnell erreichen können. Das Haus lag zudem nur wenige Gehminuten vom Kurpark, von den Schulen, vom Schwimmbad und von den Sportplätzen entfernt. Auch der Grundriss war für uns passend, sodass wir Mitte 1962 einen Kaufvertrag abschlossen. Der Einzug sollte im Juli 1963 stattfinden.
In den nächsten Monaten beschäftigten wir uns natürlich viel mit dem Haus, der Ausstattung und der Einrichtung der einzelnen Zimmer. Am Wochenende waren wir oft in Bad Nenndorf und beobachteten, wie unsere neue Bleibe immer mehr Gestalt annahm. Robby kletterte Anfang Januar 1963 in die erste Etage, um sein Zimmer zu begutachten. Wir alle waren in freudiger Erwartung und waren dankbar, dass wir jetzt schon ein Haus mit Garten hatten erwerben können.
Anfang 1962 fuhr ich einmal auf der Autobahn nach Braunschweig zu meinen Kunden. Im Rückspiegel sah ich mein Gesicht und sprach mich in einem Selbstgespräch mit den Worten an: „Heinz Flock, wer bist du eigentlich, was für ein Mensch bist du?“ Bei der Überprüfung meiner Person konnte ich viele gute Eigenschaften und Taten feststellen. Als Kaufmann wusste ich jedoch, dass eine Bilanz zwei Seiten hat, und ich begann die zweite Seite über mich zu prüfen. Hierbei musste ich erkennen: Es ist nicht alles gut, was du gedacht und getan hast. Gern hätte ich so manches ungeschehen gemacht. Ich sagte zu mir: „Heinz, du bist nicht ganz in Ordnung.“ Dann hatte ich plötzlich das Bedürfnis zu beten und betete das „Vater Unser“, das ich bereits als Kind gelernt hatte. Am Ende des Gebets fügte ich den Satz hinzu: „Lieber Vater im Himmel, lass’ mich bitte so werden, wie du willst, dass ich, Heinz Flock, sein soll. Mache du mich bitte so, wie ich nach deinem Willen sein soll.“ Das geschah alles während der Fahrt auf der Autobahn. Dann besuchte ich meine Kunden in Braunschweig, und das Geschäftsleben hatte mich wieder voll im Griff, denn es gab viel zu tun.
An eines jedoch kann ich mich sehr gut erinnern: Wenn ich manchmal ganz allein war und Stille mich umgab, kam ein unbestimmtes Sehnen nach etwas in mein Herz. Ich wusste nicht, was es war und wonach ich mich sehnte. Ich hatte doch alles, was ich mir wünschte: Erfolg, Familienglück. Aber dennoch kam dieses Sehnen in der Stille immer wieder; es war wie ein Heimweh, wie die Antwort auf eine Leere, die ich in mir verspürte.
Es gibt ein Lied, dessen erste drei Strophen mein Leben zur damaligen Zeit treffend beschreiben. Dort heißt es:
Ich bin durch die Welt gegangen, und die Welt ist schön und groß, und doch ziehet mein Verlangen mich weit von der Erde los.
Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Müh.
Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück.
Als Gott mich fand: Mitten im Leben – mitten im Leid
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jes. 55,8–9
Es gibt eine Information für uns Menschen, die uns Auskunft gibt über die wichtigsten, entscheidenden Fragen unseres Lebens. Nicht alles verstehen wir, denn Gott, der Informant und Sender, ist anders als wir Menschen. Er denkt und handelt anders als wir. Seine Art und Weise, unsere Nöte und Probleme zu lösen, entspricht nicht unserem Denken und Handeln. Sie erscheint uns oft töricht, aber sie hilft, denn Er ist unser Schöpfer. Viele Jahre sind vergangen, seit mich diese Informationen Gottes, die in der Bibel niedergeschrieben sind, zum ersten Mal erreichten. Im Folgenden möchte ich davon berichten, wie es dazu kam, wo ich mich selbst in der Bibel wieder gefunden habe und was ich mit Gottes Wort, welches Geist und Leben ist, erlebt habe und noch immer erlebe.
Es kam der 6. Februar 1963. Dieser und die darauf folgenden Tage hatten den größten Einfluss auf das Leben, das ich bis dahin geführt hatte.
Wieder einmal war ich auf Geschäftsreise und übernachtete im Stadthotel in Kassel. Abends hatte ich wie üblich meine Frau angerufen und ihr mitgeteilt, wo ich war. Sie sagte mir: „Zu Hause ist alles in bester Ordnung.“ Robby hatte sich in mein Bett geschlichen, was er gern tat, wenn ich auf Reisen war, und schlief, ebenso wie seine kleine Schwester Dagmar. Auch ich ging zufrieden zu Bett und hatte einen tiefen Schlaf.
Nachts gegen halb drei wurde ich von der Rezeption geweckt und ans Telefon gerufen. Es meldete sich ein Arzt des Krankenhauses Cecilienstift Hannover. Er sagte zu mir: „Herr Flock, Sie müssen jetzt tapfer sein.“ Ich fragte ihn: „Wieso?“ Er antwortete in einem knappen Satz: „Ihr Sohn Robby ist tot.“ Unser Robby war doch erst sieben Jahre alt, ein hübscher lebendiger Junge, wie ihn sich jedes Elternpaar wünscht. Ich konnte die Worte des Arztes nicht fassen, nicht begreifen, und fuhr noch in der Nacht nach Hause. Wie ich diese Nachtfahrt überstanden habe, weiß ich nicht mehr. Zu Hause angekommen, lief mir meine Frau entgegen; wir umfassten uns und weinten gemeinsam, ohne ein Wort zu sagen. Nachdem wir uns etwas beruhigt hatten, erzählte sie mir, was geschehen war: Einige Zeit nach unserem Telefonat hatte sie sich in ihr Bett zum Schlafen gelegt, also neben Robby, der ja bereits in meinem Bett lag. Nachts wurde sie dann durch unruhige, etwas krampfhafte Bewegungen von Robby geweckt. Sie sprach Robby an, er aber reagierte auf ihre Worte nicht. Dann rief sie unseren Kinderarzt an. Nachdem dieser eingetroffen war, Robby untersucht hatte und keine Erklärung für Robbys Zustand fand, entschied er, Robby so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen zu lassen. Während der Fahrt im Krankenwagen lag Robbys Kopf in den Armen meiner Frau. Sie berichtete weiter: „Kurz vor der Ankunft im Krankenhaus wurde Robby ruhiger; darüber war ich froh.“ Nach der Einlieferung stellten die Ärzte dann fest, dass unser Sohn Robby noch in den Armen seiner Mutter gestorben war. Robby war tot – unfassbar!
Wir fuhren ins Krankenhaus und wurden in ein Zimmer geführt; dort lag unser Kind so friedlich, als ob es schliefe. Wir durften ihn jedoch nicht streicheln, berühren oder küssen, denn die Ärzte befürchteten eine ansteckende Infektion durch einen Virus. Später stellte sich heraus, es war ein Virus, der eine Grippe ausgelöst hatte. Dieser war in sein Gehirn eingedrungen und hatte den schnellen Tod verursacht. Der Arzt sagte uns: „Heilungen bei solchen Erkrankungen bleiben selten ohne nachfolgende Gehirnschäden, selbst wenn Robby nicht gestorben wäre.“
Bei dem Anblick unseres Kindes bin ich innerlich völlig zusammengebrochen. Mir war bewusst geworden: Wir können nicht mehr miteinander reden, spielen, lachen. Das Leben hatte für mich keinen Sinn mehr. In meinem Herzen war es wie eine offene Fleischwunde, in die man Salz hineingestreut hatte. Es war ein furchtbarer seelischer Schmerz. Ich kann sagen: Ich lebte nicht mehr, ich funktionierte nur noch. Das Leben, das ich geplant und bis dahin mit Erfolg glücklich gelebt hatte, war im Angesicht des Todes unseres Jungen mit einem Mal völlig sinnlos geworden.
Am 11. Februar 1963, einem Montag, beerdigten wir unseren Sohn Robby auf dem Friedhof in Bad Nenndorf. Ich stand vor dem geöffneten Grab, völlig zerschlagen, ohne jede Hoffnung. Statt mit Robby in fünf Monaten in unser neues Haus zu ziehen, mussten wir unseren Sonnenschein in die kalte Erde legen. In diesen Wochen erlebte ich sowohl körperlich als auch seelisch die Wahrheit der Information Gottes, die Er uns vor 3000 Jahren mitgeteilt hatte, die ich aber bis dahin noch nicht gekannt hatte. Sie lautet: Ein Leben auf dieser Erde ohne Gott ist sinnlos.
Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan, ich will Wohlleben und gute Tage haben! … und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe; und das war mein Teil von aller meiner Mühe … als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne … Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne IHN? Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Verstand und Freude; aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch dem gegeben werde, der Gott gefällt. Auch das ist eitel und Haschen nach Wind. Pred. 2,1.10-11, 25-26
Die Summe dieser und weiterer Ausführungen in der Bibel bestätigen: Ein Leben ohne Gott ist sinnlos. So war es laut obiger Information Gottes, ausgesprochen durch König Salomo vor rund 3000 Jahren, und so war es auch 1963 – also im 20. Jahrhundert. Noch kannte ich die Information Gottes nicht, dass das nicht so sein muss, sondern dass Gott etwas getan hatte, diese Sinnlosigkeit aufzuheben.
In dieser Zeit fiel es mir schwer, zu verstehen und zu begreifen, warum wir Menschen uns oft über Kleinigkeiten so sehr aufregen und streiten. Man sagt zwar so landläufig „Das Leben geht weiter“, aber mein Leben war zu jener Zeit kein Leben mehr. Dennoch musste ich natürlich meine Tätigkeit als Handelsvertreter fortführen.
Am 25. Februar 1963, vierzehn Tage nach der Beerdigung Robbys, begann ich wieder meine Reisetätigkeit. Ich fuhr in Hannover über die Hildesheimer Straße in Richtung Süden, denn ich wollte zu Kunden nach Goslar fahren. Während der Fahrt überfiel mich eine tiefe Traurigkeit und ich weinte und weinte.
Dann schrie ich zu Gott: „Lieber Gott, hilf mir, ich kann nicht mehr.“ Plötzlich hörte ich eine Stimme, die ganz klar und deutlich zu mir sagte: „Fahre zu Heinz Oelschläger.“ Das war der Geschäftsmann, der mir vor längerer Zeit von seinem persönlichen Glaubensleben mit Jesus Christus erzählt hatte. Zunächst folgte ich der Stimme nicht und fuhr weiter in Richtung Süden. Meine Gedanken waren: „Das kann doch nicht sein, du spinnst, es stimmt mit dir etwas nicht.“ Die Stimme kam jedoch erneut und wurde drängender. Schließlich fuhr ich nicht mehr weiter in Richtung Süden, sondern nach Westen zum Geschäftssitz des Kunden. Gegen Mittag, 12 Uhr, kam ich an und stellte fest, dass bereits ein anderer Vertreter dort war. So blieb ich zunächst im Hintergrund und wartete.
Nachdem mein Kollege gegangen war, erzählte ich dem Kunden vom Tod meines Sohnes. Er schwieg zunächst eine Zeit lang. Dann sagte er mir mit Tränen in den Augen: „Muss denn der HERR erst ihren Sohn zu sich holen, damit Sie sich retten lassen?“ Ich fand in diesem Augenblick eine solche Aussage nicht ungeheuerlich oder unverschämt, ich blieb einfach nur still. Dann legte er mir noch einmal die zentralen Inhalte des Evangeliums von Jesus Christus dar. Zwar hatte ich nicht alles ganz verstanden, aber dass Jesus Christus gekommen war, Sünder zu retten, das hatte ich verstanden. Denn in jener früheren Selbstprüfung auf meiner Autofahrt nach Braunschweig war mir bereits deutlich geworden, dass ich tatsächlich ein Sünder war.
Auf seine Frage „Wollen auch Sie sich retten lassen?“ antwortete ich spontan: „Ja, natürlich.“ Wir gingen dann in sein Büro; dort waren wir ungestört. In der Gegenwart des Kunden bekannte ich dem Herrn Jesus meine Sünden. Es tobte ein sehr schwerer Kampf in meiner Brust. Es war so, als ob sie zerrissen würde, denn fast 35 Jahre lang hatte ich als Sünder gelebt. An den Maßstäben Gottes gemessen, musste ich nun vieles meines verborgenen Lebens ans Licht bringen und dem Herrn Jesus bekennen. Dann dankte ich dem Herrn Jesus dafür, dass Er alle meine Sünden, meine ganze Schuld auf sich genommen hat. Ich dankte Ihm weiter, dass Er das Gericht auch über meine Schuld ertragen, mich durch Seinen Tod gerettet und meine Sünden getilgt hat. Ich bat Ihn, die Führung meines Lebens zu übernehmen.
Nachdem ich diese Worte klar und deutlich vernehmbar gesagt hatte, geschah Folgendes: Ich hatte das Gefühl, eine Hand streicht über meine Brust und nimmt alle Schmerzen weg. Gleichzeitig kam ein tiefer Friede in mein Herz, den ich bis dahin nicht gekannt hatte. Ich wusste nicht, was das war, aber es war sehr schön. Das Herrliche daran: Dieser Friede ist auch heute noch, nach über 50 Jahren, vorhanden. Zu einem späteren Zeitpunkt, durfte ich durch die Information Gottes an uns Menschen erfahren, was in dieser Mittagsstunde am 25. Februar 1963 mit mir geschehen war. Darauf werde ich an anderer Stelle noch näher zu sprechen kommen.
Nachdem ich zu Hause bei meiner Frau angekommen war, erzählte ich ihr von diesem persönlichen Erlebnis. Einige Tage später sagte meine Frau zu mir: „Du hast mir von deinem Erlebnis mit dem Herrn Jesus Christus erzählt. Mir ist eingefallen, dass ich Robby zwei bis drei Wochen vor seinem Tod fragte: ‚Robby, wen von uns dreien hast du am allerliebsten – Dagmar, Mama oder Papa?‘ Er schaute mich mit seinen großen braunen Augen ganz ernst an und sagte zu mir: ‚Mama, weißt du, am aller-, allerliebsten habe ich den Herrn Jesus.‘“ Über diese Aussage Robbys waren wir hinterher völlig überrascht, denn Jesus Christus kam in unseren Gesprächen mit ihm nicht vor, außer wenn meine Frau oder ich mit ihm das Abendgebet sprachen: „Ich bin klein, mein Herz mach’ rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein.“ Über den wirklichen Inhalt der Bedeutung dieses Gebets waren wir uns damals nicht im Klaren. Wir überlegten, wie Robby zu einer solchen Antwort hatte kommen können. Dann erinnerten wir uns an „Tante Rottmann“: Damals standen in der Nähe unserer Wohnung noch keine Kindergartenplätze zur Verfügung. Mit einigen Eltern organisierten wir deshalb eine Betreuung unserer Kinder durch eine ältere, aber noch sehr aktive Frau; sie hieß für alle „Tante Rottmann“. Die Betreuung erfolgte einige Stunden morgens. Da keine Räume zur Verfügung standen, ging sie mit den Kindern in der Eilenriede oder auf dem Engesohder Friedhof an der Alten Döhrener Straße spazieren. Auf vielen Gräbern stehen dort Kreuze und Bibelworte. Gewiss hat sie dort den Kindern von der Liebe Jesu zu den Menschen und besonders zu den Kindern erzählt, und dass Er für sie gestorben ist, damit sie in den Himmel kommen, wo es wunderbar ist.
Diese Erzählungen einer alten Frau von Jesus Christus hatte im Kinderherzen Robbys offenbar eine Liebe zu Jesus entzündet, die so groß war, dass sie an erster Stelle stand, noch vor der Liebe zu seiner Schwester Dagmar und zu Mama und Papa. Viele Jahre später – ich stand am Grab von Robby – erinnerte ich mich an diese Aussage meines Jungen gegenüber meiner Frau. Ich empfand in meinem Herzen: Genau das ist die Botschaft Jesu, die Er dir durch den Mund deines Sohnes gegeben hat. Robby hatte ausgesprochen, worin Sinn und Ziel unseres Lebens besteht:
Wer mich findet, der findet das Leben ... Spr. 8,35a
Gemeinschaft mit Christen in der Gemeinde Jesu
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Bibellesen: Gottes Worte verstehen – aber wie?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Was bedeutet Wiedergeburt nach Gottes Wort?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Drei wichtige Wahrheiten für ein praktisches Glaubensleben
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Jesus praktisch erlebt: Persönliche Erfahrungen mit Gottes Wort
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Vom Glauben zum Dienen: Die Geschichte der Überkonfessionellen Zeltmission Hannover
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Alles hat seine Zeit: Mein weiterer Weg ab 1981
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Meine Wege sind nicht Eure Wege
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Dankbarkeit trotz Ablehnung durch die Menschen
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Allein und doch nicht einsam
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Hat sich Opa einen Hund angeschafft?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Was wirklich zählt in meinem Leben
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
TOD – und was kommt dann?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Religionen oder Evangelium von Jesus Christus?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Echt oder unecht?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Schlusswort und Zusammenfassung
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Anhang: Fotos
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Unsere Empfehlungen
Die Lesebibel, übersetzt von Hermann Menge
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-72-3
Diese lesefreundliche Lesebibel ermöglicht mit einem minimalistischen Design und einer speziell für diese Bibel angepassten Typografie störungsfreies und langes Lesen. Sie enthält keine Versnummerierungen, Kapitel- und Abschnittsüberschriften und ermöglicht ein Lesen, wie es die ersten Leser der Bibel hatten. Lediglich die übliche Kapitelzählung haben wir der Übersicht halber beibehalten.
Das Ergebnis ist ein absolut neues Leseerlebnis, da die Bibel als eine verbundene und in sich abgeschlossene Geschichte wahrgenommen wird. Sie lesen mit der Menge Lesebibel nicht mehr Vers für Vers sondern Abschnitt für Abschnitt. Der Lesefluss und das Sinnverständnis werden somit optimiert.
Die Menge-Bibel ist textgetreu und gut verständlich. Fast 40 Jahre arbeitete Hermann Menge an dieser Übersetzung. Das Resultat ist eine literarisch hochwertige und genaue Übersetzung. Diese eBook-Ausgabe enthält den unveränderten Text von 1939. Sie ist optimiert für digitales Lesen und bietet eine einfache und schnelle Navigation zu jedem Buch und Kapitel. Aus jedem Kapitel gelangt man mit einem Klick wieder zurück zur Kapitelauswahl und dann zur Inhaltsübersicht.
Paul Olbricht: Der Bibelübersetzer Hermann Menge
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-11-2
Die Biografie über Hermann Menge (1841–1939) ist eine einfache Darstellung seines Lebens, das seinen Verlauf vor allem in seinem Studierzimmer nahm. Ein Leben, das dennoch und vielleicht gerade wegen seiner Bescheidenheit groß und im wahrsten Sinne des Wortes gottgesegnet genannt werden darf.
Paul Olbricht zeichnet den Weg nach, wie aus einem weltlichen Sprachwissenschaftler ein biblischer Theologe wird. Denn die letzten 40 Jahre seines Lebens hat er bis zu seinem Tod an seiner Bibelübersetzung gearbeitet. “Es ist kein übertriebenes Lob, wenn man der Menge-Bibel das Zeugnis der besten Bibelübersetzung nächst der Lutherbibel ausstellt.” E. Dicht
Die Menge-Bibel gilt bis heute als eine ausgezeichnete Übersetzung. Wer nähere Bekanntschaft mit diesem schlichten Gottesmann schließe möchte, bekommt hier von seinem Kollegen und Schwager einen Einblick in sein Leben und seine Werke. Menge strebte nicht nach Ruhm und Ehre. Wer ihn kennenlernen wolle, sollte sich seiner Meinung nach lieber mit seiner Bibelübersetzung beschäftigen und sich durch die auf diesem Wege gewonnene Kenntnis zu Gott und zum Heiland führen zu lassen — dann besitze man ein Wissen, das wirklichen Wert hat!
Jost Müller-Bohn: Im Blitzkrieg zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-29-7
Die Erlebnisse eine Kameramannes, der Wochenschaufilme vom Kriegsgeschehen drehen musste, stehen im Mittelpunkt dieses Buches.
Der gelebte Glaube seines Fahrers und dessen offene Diskussion mit einem gefangen genommenen atheistischen Politoffizier der Sowjets bringen ihn zum Nachdenken. In all den Schrecken des Krieges wird ihm klar, dass der Glaube an Gott mehr ist als eine Weltanschauung.