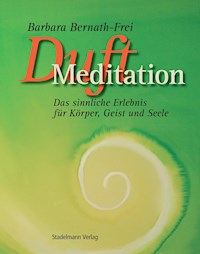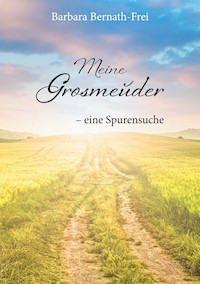
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Enkelin rollt das Leben ihrer mutigen und eigenwilligen Grossmutter auf, die 1914 mit nur 17 Jahren aus Plauen/Sachsen in die Schweiz kam und sich niederliess. Wie mochte es sich für diese junge Frau aus kargen Verhältnissen angefühlt haben, zum ersten Mal im ganzen Leben in der Eisenbahn zu sitzen – mit der sie ihre Heimat verliess? Eine Spurensuche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Plauen im Vogtland
Die Fahrt ins Ungewisse
In der Schweiz
Epilog
Dank
Vorwort
Sie duftete nach Uralt-Lavendel und hatte eine Haut wie Seidenpapier. Wenn sie lachte, bebte der ganze rundliche Körper und sie wischte sich die Tränen aus den Augen. Andererseits kam es vor, dass die ganze Tischrunde prustete, sie jedoch verwundert in die Welt blickte, weil sie als einzige den Witz nicht verstanden hatte. Also begann man von links und rechts, ihr die Pointe zu erklären. Hatte sie diese dann endlich begriffen, war sie nicht mehr zu halten. Kaum war sie wieder bei Atem, erklärte sie den Anwesenden nun ihrerseits den Scherz, bis alle sich die Seiten hielten und aufs WC eilten. Ein Perpetuum mobile der vergnüglichen Art.
In ihre Schmetterlingsbluse hatte ich mich als Kind Hals über Kopf verliebt, und es schien mir, als schwebten die zartgelben und hellblauen Flügelchen auf weissem Grund leicht und unbeschwert um sie herum. Wonnig kuschelte ich mich in ihre weiche, wohlduftende Fülle, schmiegte mich in die Sicherheit ihrer Anwesenheit und freute mich, jede Woche einige Stunden mit ihr und meinem Grossvater zu verbringen.
Sie, das war meine Grossmutter mütterlicherseits, Klara Notz-Meister. Sie zeigte uns Enkeln fast immer ein sonniges Gemüt, aus dem sie die schwierigen Erfahrungen ihres Lebens weitgehend verbannt hatte. Und deren muss es verschiedene gegeben haben. Als junges Mädchen hatte ihre Familie sie aus dem Osten Deutschlands in die Schweiz geschickt, um sie vor den Wirren des Ersten Weltkrieges in Sicherheit zu bringen. Ihren zwei Töchtern und sechs Enkeln erzählte sie verschiedene Episoden aus ihrer Kindheit und Jugend und verschwieg vermutlich ungleich mehr. Über die dunklen Seiten ihres Lebens mochte sie nicht sprechen; solange ich sie kannte, suchte sie nach dem Hellen und Heiteren.
Immer wenn ich im Nordosten Deutschlands Ferien verbrachte, rätselte ich über die Umstände ihres Lebens, versuchte ich, die verschiedenen Anekdoten in einen Zusammenhang zu bringen. Meine Mutter, Klara „Klärli“ Frei-Notz, erzählte uns Kindern alles, was sie wusste, und das war doch recht viel. Irgendwann wünschte ich mir, dass diese für die Menschheitsgeschichte unbedeutende, für uns Nachkommen aber spannende Biografie aufgeschrieben werden sollte. Ich sammelte alles, was an Wissen vorhanden war, um meine Erinnerungen an meine Grosmeuder, wie wir sie nannten, festzuhalten. Insbesondere meine älteste Schwester Edith, die zusammen mit unserer Mutter nach der Wende – da lebte schon lange niemand von der näheren deutschen Verwandtschaft mehr – in Klara Meisters Heimat reiste, konnte vieles aus ihrem exzellenten Gedächtnis beisteuern. Dennoch blieb und bleibt manches im Dunkeln verborgen. Der vorliegende Text ist somit eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit.
Unter „Dichtung“ fallen alle verbalen Brücken, die die einzelnen gesicherten Ereignisse miteinander verbinden. Anders ist es mir nicht mehr möglich, Grosmeuders Leben zu rekonstruieren. So liegen nebst vielen persönlichen auch einige der historischen, politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge im Dunkeln, die zu recherchieren mir zu aufwendig ist. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Geschichte meiner Grossmutter so zu verfassen, dass ich aus ihrer Sicht schreibe und die Passagen, in denen ich rätsle, wie sich was wohl verhalten habe, in kursiv gedruckter Schrift festhalte. Diese Variante scheint mir eine ehrliche zu sein und es den Lesenden zu ermöglichen, meine offenen Fragen zu teilen. Wer immer Lust hat, sich auf Grosmeuders Spuren zu begeben, ist nun herzlich eingeladen, weiterzublättern.
Frühling 2022, Barbara Bernath-Frei
Plauen im Vogtland
Katharina richtete sich vom Kartoffelacker auf, hielt sich das Kreuz und wedelte mit der anderen Hand die Fliegen aus dem verschwitzten Gesicht. Es schien ihr, sie habe die Andeutung einer ersten Wehe gespürt. Es wäre ihr recht, wenn ihr sechstes Kind nun auf die Welt käme, denn der dicke Bauch machte ihr in diesen heissen Tagen mehr und mehr zu schaffen. Sie bückte sich erneut, füllte den Eimer mit schönen, wohlgeformten Kartoffeln und leerte ihn dann in den Leiterwagen, um gleich danach weiter zu ernten. Wie sie sich erneut aufrichtete, schoss ihr der Schmerz so in den Unterleib, dass sie gekrümmt stehenblieb und ihn verebben liess. „Grethe“, rief sie dann, „mach dich auf zur Hebamme Kallenberg und sag ihr, es sei so weit. Und danach gehst du zum Vater auf den Roggenacker und sagst ihm Bescheid.“ Grethe stellte ihren Eimer, in den sie die kleinen Kartoffelchen gelegt hatte, ab, drehte sich zur Mutter um und sagte: „Hoffentlich wird es diesmal ein Schwesterchen!“ Dann machte sie sich auf den Weg.
Dicke Wolken türmten sich über der weiten Landschaft auf, als Katharina nach kurzer, fast schon routinierter Geburt ihr Jüngstes in den Armen hielt: Klara. Ein Mädchen, wie Grethe es sich gewünscht hatte. Katharina war froh, dass die erfahrene Hebamme Kallenberg ihr erneut zur Seite gestanden hatte, denn inzwischen war sie gegen Mitte dreissig und weiss Gott keine junge Mutter mehr. Die Hebamme packte die letzten verschmierten Tücher unter den Arm, ging auf den Gang hinaus und sagte zum wartenden Heinrich Meister: „Sie können jetzt hinein gehen. Es ist ein Mädchen.“ Heinrich setzte sich auf die Bettkante, betrachtete das verrunzelte Wesen, strich seiner Katharina übers verschwitzte Gesicht und meinte: „Zum Glück ist alles gut gegangen!“ Katharina war müde und erschöpft und erinnerte Heinrich daran, dass Klara nach den drei älteren Halbgeschwistern Martha, Lene und Felix und den beiden gemeinsamen Kindern Grethe und Leopold jetzt aber wirklich das allerletzte Kind sein solle. Nun sei sie einfach zu alt; und auch das Geld müssten sie sorgsam einteilen, damit es für eines mehr nun auch noch reiche. Das war Heinrich wohl bewusst, aber die Nachricht verunsicherte ihn auch. Noch immer war sie ansehnlich, seine Frau, und die beiden freuten sich regelmässig aneinander. Man würde sehen müssen, wie man sich in Zukunft verhalten sollte.
Dieser schwüle 27. August 1896 endete mit einem heftigen Gewitter: Die trockene Erde sog das Wasser gierig auf, Menschen und Tiere freuten sich über die willkommene Abkühlung. Nur eine liess sich vom Donnergrollen und den Blitzen, vom starken Wind und dem klatschenden Regen nicht im Geringsten stören: Klara ruhte friedlich an der Seite ihrer Mutter und verschlief mühelos die ersten Stunden ihres Lebens, das fast 85 Jahre dauern sollte.
In jener Zeit blieb man nicht lange im Kindsbett; nach einem, spätestens zwei Tagen war man wieder auf den Beinen, versorgte wie gewohnt die ganze Familie und ging der eigenen Arbeit nach. Katharina half auf dem kleinen Hof mit, verdiente ihr Geld aber vor allem als Wäscherin und Büglerin. Ihre älteren drei Kinder aus der Ehe mit Nikolaj Tröger wohnten noch zu Hause, gingen aber bereits alle einer Arbeit nach. Martha und Lene waren beide in der Kattunfabrik beschäftigt. Martha, die schon einige Jahre Erfahrung hatte, arbeitete wie viele andere am Webstuhl und musste aufpassen, dass sie rechtzeitig die Spulen nachfädelte, die Maschine stoppte, wenn ein Ballen fertig war, das Muster überprüfte und dafür sorgte, dass keine Fehler passierten. Lene war sehr geschickt im Nachliefern der benötigten Spulen. Die Vorarbeiter gaben ihr Zettelchen mit den genauen Angaben, mit denen Lene dann ins Lager ging und die entsprechende Anzahl pro Farbe heraussuchte. Dabei half ihr der schielende Ingemar, der in der Schule keine Leuchte gewesen war, aber über gut entwickelte Muskeln und ein heiteres Gemüt verfügte. Er karrte die Ladungen dann zu jenen Webstühlen, an denen sie gebraucht wurden. Felix wiederum hatte eine Stelle in der Ziegelei gefunden. Zunächst war er beim Ausheben des Lehms eingesetzt worden, doch mit seinem schmächtigen Körperbau war das nichts für ihn. Er fürchtete, man würde ihn nun sogleich wieder entlassen, aber Carl Scheel, mit dessen Bruder Lothar Felix befreundet war, sorgte dafür, dass Felix beim Aufschichten der Rohziegel in die Brennöfen mitarbeiten durfte. Obwohl er gefordert war, mochte er seine Arbeit und hatte es gut mit seinen Kollegen.
Martha, Lene und Felix hatten einst ein anderes Leben gekannt. Ihr Vater Nikolaj Tröger war ein vermögender, froher und sorgloser Spross russischer Herkunft gewesen. Schon in jungen Jahren Gutsverwalter, reiste er regelmässig umher, um seinen Geschäften nachzugehen. Anlässlich einer seiner Reisen begegnete er in Böhmen einem hübschen und temperamentvollen jungen Mädchen, dessen braune Locken und honiggelbe Augen ihn sofort faszinierten. Die Art, wie sie herausfordernd lachte, wie sie ihre Hüften schwang und ihm im letzten Moment dennoch keine Beachtung schenkte, reizte ihn. Es war nicht ganz einfach, ihre Herkunft ausfindig zu machen, aber schliesslich wurde er bei ihrer Familie vorstellig. Sie kam aus dem Böhmerwald, und wie die Bohemiens lebten die Mitglieder auch: nur bedingt sesshaft, von Beruf Kesselflicker und Scherenschleifer, dazu hielten sie einige Hühner und zwei Pferde. Wann immer es etwas zu feiern gab, wurde gefeiert. Dann machten sie Musik und tanzten – und wie Katharina tanzen konnte! Nikolaj musste wohl um das Mädchen werben, nicht aber ihre Eltern überzeugen, denn diese waren hocherfreut über den reichen Schwiegersohn. Da Tröger seinen Vater früh verloren und dessen Geschäfte bereits übernommen hatte, meldete zwar seine Mutter Bedenken an wegen der nicht standesgemässen Verbindung, aber Nikolaj schlug diese wie so manches in den Wind und so fanden sich zwei lebenslustige Menschen.
Ihr Leben auf dem Gutshof war komfortabel, sodass die drei Kinder munter gediehen und sich prächtig entwickelten. Weniger prächtig liefen hingegen mit den Jahren Trögers Geschäfte: Ein verregneter Sommer hatte die Ernte stark beeinträchtigt, und der darauffolgende kalte Frühling sorgte seinerseits für miserable Erträge. Tröger wandte sich vermehrt den weniger problematischen Seiten des Lebens zu und mochte ein Pils oder ein Pils mit Korn, allenfalls auch den Korn alleine niemals ablehnen. So kam denn eines zum andern und es ging bergab mit ihm und dem Gutshof. Eines Tages blieb Nikolaj Tröger morgens im Bett liegen und klagte, er fühle sich nicht gut. Seine Haut wurde immer gelber, er verlor an Gewicht und Lebenslust und starb schliesslich mit 44 Jahren. Katharina konnte den darniederliegenden Betrieb nicht mehr retten, musste die Angestellten entlassen, das schöne Meissen-Service samt Tafelsilber verkaufen und schliesslich mit den Kindern in einen kleinen Anbau eines Bauernhofes ziehen. Da Trögers Schulden sich mit dem Erlös aus dem Verkauf des Betriebes etwa aufwogen, blieb nichts mehr übrig. Als entschlossene und mutige Frau machte Katharina sich sofort an die Arbeit, ging waschen und bügeln, arbeitete auch auf dem Hof mit und hielt die Kinder dazu an, dort mitzuhelfen, wo es ihnen in ihrem jugendlichen Alter möglich war. Noch Jahre später erzählten sie dann von den Kutschenfahrten mit dem Vater, den rauschenden Festen und dem schönen Haus, in dem sie gewohnt hatten.
Davon sollte Klara erst von den Geschwistern hören. Ihr ganzes Leben lang würde sie bedauern, dass sie diese Zeit des Wohlstands nicht erlebt hatte.
Vorläufig wuchs das kleine Mädchen aber in Ruhe heran. Jemand aus der Familie war immer in der Nähe und hatte ein Auge auf sie, versorgte sie und gab ihr den Schnuller, wenn sie unglücklich war. Als sie zahnte und weinte, wies die Mutter Klaras grosse Halbschwester Lene an, einen Schnuller nach folgendem Rezept für die Kleine herzustellen: fünf Würfelchen Brot, in Milch eingeweicht, gut gezuckert, und drei Tropfen Korn vermischen und in ein Baumwolltuch binden, Klara ins Mündchen geben. Derart versorgt, verschwanden deren Schmerzen schnell und sie schlief bald ein.
Gerne spielte Klara mit den Klötzchen, die der Vater seinen Kindern gefertigt hatte. Heinrich Meister war in Katharinas Leben getreten, als diese ihre Kinder aus erster Ehe bereits zwei Jahre lang allein durchgebracht hatte. Er fand sie anziehend und bewunderte ihre Tatkraft, getraute sich kaum, sie zu fragen, ob sie seine Frau werden wolle. Katharina wollte, denn Heinrich war ein liebevoller Mensch mit einem Hang zum Träumen. Er war Instrumentenbauer, hatte ein gutes Händchen fürs Holz und stellte weich klingende Violinen her, manchmal auch Bassgeigen. Obwohl er fleissig und talentiert war, wurde er nicht reich mit seinem Beruf, aber ein klein wenig Erspartes hatte er schon. Das wollte er gerne mit Katharina und ihren drei Kindern teilen. So erstand er einen bescheidenen kleinen Bauernhof am südlichen Rand der Kreisstadt Plauen, wo es einen Kartoffelacker, ein Getreidefeld, einen Hausgarten und Gänse gab, die schöne, grosse Eier legten. Das Haus selbst glich eher einer Kate, verfügte aber doch über vier Zimmer und eine Küche. Vor allem im Winter arbeitete Heinrich in seiner Werkstatt im Hinterhof. In den andern Jahreszeiten konnte das nur eine Teilbeschäftigung sein, weil er dann in der Landwirtschaft gebraucht wurde. An seinen Kindern hatte er Freude, nahm sie gerne auf den Schoss, spielte Hoppe-hoppe-Reiter, bastelte ihnen Kleinigkeiten, mit denen sie spielen konnten. Den drei grossen fertigte er Holzschachteln an, in denen sie ihre Feder, die Kreide und ein Wischtuch versorgen konnten. Sie gingen ja bereits zur Schule. Katharina sah es dankbar, wusste um ihr Glück, dass die Kinder ihren Stiefvater mochten, und nahm es ergeben hin, dass ihr Heinrich sich manchmal in seiner Kunst verlor, stundenlang an einer Kleinigkeit polierte und nicht zufrieden war, bis alles ganz korrekt und gut war.
Am Sonntag nahm er dann hin und wieder seine Fiedel, spielte und sang mit der Familie die schönen alten deutschen Lieder. Wenn sie guter Laune war, tanzte Katharina manchmal zu den beschwingten Melodien, und natürlich wollten die Kinder mitmachen, tanzten anfangs Ringelreihen und später Polka, Marsch und Walzer. War die Mutter schlecht gelaunt, verzog man sich allerdings besser. Es kam nicht oft vor, aber wenn, dann schlug ihr Temperament eben auch in dieser Hinsicht Wellen. Da halfen sie dann lieber dem Vater oder machten eine Besorgung. Finanziell war die Situation nach wie vor eher angespannt. Katharina behielt deshalb ihre Aufträge und wusch und bügelte weiterhin für andere Leute.
Klara war in jeder Beziehung das Nesthäkchen: verwöhnt, gehätschelt und geherzt. Nicht nur von den Eltern, erst recht von den schon fast erwachsenen Schwestern Martha und Lene. Die sorgten dafür, dass es der Kleinen gut ging. Das ging so weit, dass Klein-Klärchen nur zu weinen brauchte, wenn es im Winter zum Essen halt wieder einmal Graupensuppe mit Gemüse gab oder zum wiederholten Mal Steckrüben an weisser Sauce. „Das mag ich nicht“, greinte sie dann, worauf Mutter, Vater oder eine der Schwestern zur Küchenschublade griff und den zweitletzten Groschen hervorholte, damit man der Kleinen beim Bäcker Giehse doch eine Semmel kaufen konnte. Diese wurde dann mit üppig Gänseschmalz bestrichen und mit Zucker bestreut, worauf Klara sehr zufrieden war mit ihrem Essen und genüsslich kaute. Sehr zum Missfallen ihrer Geschwister Grethe und Leopold, die auch lieber eine Semmel gegessen hätten, aber keine bekamen. Grethe maulte des Öftern deswegen, wurde aber sofort in den Senkel gestellt. Klara hingegen genoss ihre Privilegien mitleidslos, konnte sich voller Freude über ein Stück Weissbrot mit Butter (die gegen Gänseschmalz eingetauscht worden war) und Zucker hermachen, während die andern das karge Mahl in sich hineinlöffelten. So erkannte sie früh, dass sie etwas Besonderes war, ohne dass sie sich dafür hätte anzustrengen brauchen.
Es war ein kalter Wintertag, als die vierjährige Klara um die Mutter wuselte, die in der Küche bügelte und das Bügeleisen immer wieder mit glühender Kohle füllen musste. War dieses wieder richtig heiss, legte sie ein feuchtes Baumwolltuch über das Leinenkleid, das sie bügelte, und sobald sie mit dem Bügeleisen draufkam, zischte es laut. Klara fand das spannend, guckte gerne zu, hatte die Mutter auch eine Zeitlang für sich alleine und konnte so dies und das mit ihr reden. Überdies verströmte der Holzherd eine wunderbare Wärme. Katharina war in ihre Arbeit vertieft, aus der sie unerwartet durch Klaras lautes Schreien gerissen wurde. Sie sah sich um, und da rannte ihr jüngstes Kind auch schon mit brennenden Kleidern und Haaren auf sie zu. Geistesgegenwärtig schlug Katharina ihre langen Röcke um das Mädchen und erstickte so die Flammen. Es stank nach verbrannter Wolle und – schlimmer – nach verbranntem Fleisch. Kaltes Wasser hatte sie keines zur Hand, aber draussen lag Schnee. Katharina packte Klara, lief mit ihr hinaus und wälzte das Kind mitsamt den verbrannten Kleidern im Schnee, um die Brandwunden zu kühlen. Als sie die Kleiderfetzen löste, erschrak sie ob des Ausmasses der Verbrennung; die Haut war schwärzlich und offene Wunden wurden sichtbar. Binnen kürzester Zeit bekam Klara Fieber, und es war nicht sicher, ob man sie durchbringen würde. Der herbeigerufene Doktor empfahl, ihr viel zu trinken zu geben und das Fieber mit kühlen Umschlägen in Schach zu halten. Lange Zeit konnte sie lediglich auf dem Bauch liegen. Schliesslich brauchte es mehrere Wochen Geduld und Johanniskrautschmalz, bis die schlimmen Wunden langsam heilten und vernarbten.
Der Tag, an dem sie als kleines Mädchen Feuer gefangen hatte, hat sich tief in Grosmeuders Gedächtnis eingebrannt. Es war der Geistesgegenwart ihrer Mutter zu verdanken, dass Klara überlebte. Zeitlebens schämte sie sich aber für ihre groben Narben am Rücken, die vermutlich auch schmerzhaft waren.
Das bescheidene Anwesen der Meisters lag in nächster Nähe zum grösseren Bauernhof der Klingers. Johanna Klinger war eine ausgeglichene Frau mit vier Kindern, deren drittes gleich alt war wie Klara. Da die Klingers Milchkühe und Schweine hielten, tauschte Katharina oft Gänseschmalz gegen Butter, zwei Gänseeier gegen einen Krug Milch, eine Gans gegen eine Speckseite oder einen Hinterschinken. Letzteres kam allerdings nicht häufig vor, denn Fleisch gab es im Hause Meister nicht allzu oft zum Essen. Aber so ein Schwarzbrot mit Schweineschmalz samt Grieben, bestreut mit gerösteten Zwiebeln, das war eine Leckerei, die sie sich regelmässig gönnten. Die Klingers wiederum freuten sich jeden November auf eine gut gemästete Martini-Gans vom Nachbarhof.
Das Hüten der Gänse oblag Klara, als sie alt genug war, um auf sie aufzupassen. Der Gänseanger lag ein Stück entfernt vom Hof, und die Gänse mussten das Weglein entlang getrieben und vom Ausbüxen abgehalten werden. Damit Klara nicht so allein war beim Hüten und zudem Hilfe hatte, leistete Lene Klinger ihr Gesellschaft. So einfach, wie das erscheinen mag, war das Hüten der Gänse nämlich gar nicht: Es gab zwar einen Stall für sie, aber keinen Zaun um den Anger. Also ging es tatsächlich darum, die wagemutigen Viecher mit einem Stecken beisammenzuhalten, damit keines sich alleine aus dem Staub machte und womöglich nicht mehr nach Hause fand. Dann nämlich war es für den Fuchs ein leichtes Spiel, sich einen solchen verloren gegangenen Vogel zu schnappen. So kam es, dass die beiden Mädchen und die Gänse um die Wette schnatterten, denn alle hatten sich was zu erzählen.
Wenn unsere Grossmutter aus ihrer Kindheit erzählte, spielte die „Glingersch Lèène“ – so klang das auf Sächsisch – eine grosse Rolle. Sie war ihre erste Freundin, und die beiden teilten ihre jungen Jahre wie auch ihre Geheimnisse. Über die näheren Umstände bei den Klingers weiss man nicht viel, wohl aber gibt es diverse Episoden, die die beiden Mädchen miteinander erlebten. Bekannt ist ausserdem, dass Klara keine grossen Stücke hielt auf ihre Schwester Grethe; weshalb, kann man nur ahnen. Wissen tun wir es nicht. So kommt halt wiederum die Fantasie zum Einsatz, wo überlieferte Erzählungen fehlen.
Glingersch Lèène hatte ausschliesslich Brüder, deren ältere vormittags zur Schule gingen, nachmittags auf dem Hof mitarbeiteten, Kühe und Schweine hüteten und für ihre kleine Schwester nicht viel übrighatten. Sie war deshalb ein bisschen neidisch auf Klaras Schwestern. Klara wiederum hätte ihr Grethe gerne abgetreten, da diese immer spitze Bemerkungen anbrachte, wenn die beiden grossen Halbschwestern Martha und Lene das Nesthäkchen wieder einmal nach Noten verwöhnten. So hätte es also nicht besser sein können, als dass die beiden Lütten sich fanden, von Frühsommer bis Herbst die Gänse auf die Wiese liessen und dabei genügend Zeit fürs Plaudern hatten. Klara hatte eine Lieblingsgans: Lea. Das war ein junges, aufgewecktes Gänschen, das sich einen Spass daraus machte, Klaras Schürzenbändel aufzuziehen und sich dann erfreut aus dem Staub zu machen. Dann lachten Klara und Lèène und drohten Lea, sie würde als Braten enden, wenn sie so frech sei. (So endeten zwar alle Gänse früher oder später, aber das brauchten sie ja nicht zu wissen.) Damit die Mädchen über Mittag die Tiere nicht wieder nach Hause treiben mussten, durften sie auf dem Anger bleiben und den mitgenommenen Schmaus verspeisen. Hatte Johanna Klinger fürs kulinarische Wohl gesorgt, waren das oft Stullen aus Schwarzbrot mit gesalzenem Schweineschmalz, dazu eine Gurke aus dem Garten. War Katharina für das Essen zuständig, fanden sich im Essensbeutel hingegen gekochte Kartoffeln und ein hartes Gänseei, das die kleinen Hirtinnen miteinander teilten. Manchmal waren zu ihrer Freude auch noch Möhren im Beutel. So erlebten sie gemütliche Sonnentage, mussten hin und wieder den Gänsen nachlaufen und sie wieder einsammeln, und erst wenn die Kirchenglocke fünfmal schlug, machten sie sich auf den Heimweg. Dann dauerte es nicht mehr lange, und es begann vom Meister’schen Holzofen wieder fein zu duften. Wenn die Mutter oder eine der grossen Schwestern Porree, Zwiebeln und Petersilienwurz im Schmalz andünstete, um danach Kartoffeln beizugeben und – vielleicht – ein kleines Stück Speck, fanden sich die anderen Familienmitglieder ein und langten hungrig zu.
Johanna Klinger huschte am Abend hin und wieder zu Katharina Meister hinüber, um die neusten Nachrichten auszutauschen. Heinrich, der Einzelgänger, war dann oft in der Werkstatt und schliff ein Stück Holz für ein Instrument. Eines Abends tuschelten die beiden Mütter lebhaft miteinander, und Klara hätte gar zu gerne gewusst, worüber sie sich unterhielten und was der Grund für die spitzen kleinen Schreie hinter vorgehaltener Hand und die erschreckten Augen sein mochte. Die Mütter hatten jedoch entschieden, den kleineren Kindern nichts zu sagen, um sie nicht zu beunruhigen. Tags darauf wusste Lèène jedoch Bescheid und weihte Klara ins Furchtbare ein, das sie von einem ihrer grossen Brüder gehört hatte: Lehrer Plöns kleiner Gustav war im Burgteich ertrunken! Niemand hatte bemerkt, dass der Dreijährige aus dem Haus und ganz allein zur Burg gelaufen war. Erst Stunden später fiel jemandem auf, dass Gustav gar nicht da war, worauf die Plöns und die Nachbarn zu suchen begannen. Noch vor Einbruch des Abends fand man die Leiche des Buben am seichten Ufer des Weihers. Niemand hätte gedacht, dass seine kleinen Beine ihn so weit tragen würden.
Bei Meisters zu Hause wurde vorderhand nicht darüber gesprochen, doch bei Tisch sah Katharina ihre Kinder streng an und sagte, sie dürften nie, NIE, allein zum Burgteich gehen. Und auch nicht an den Rosenbach oder an die Weisse Elster. Das sei überaus gefährlich! Grethe und Leopold gingen den Rest der Woche nicht zur Schule und sprachen natürlich über den Unfall. Sie wussten zu erzählen, dass Lehrer Plön den kleinen Sarg allein in die Kirche getragen und die Gemeinde So nimm denn meine Hände gesungen habe. Klara und Lèène fanden die Tatsache, dass der kleine Gustav nun tot im Grab lag, erschreckend. Dort musste es ja dunkel und eng sein, das machte ihm bestimmt Angst.
Eines Tages im Frühling sassen die Glingersch Lèène und Klara zufrieden unter der Trauerweide, deren Äste sich eben in erstem lichtem Grün zeigten, und sahen den Gänsen beim Grasen zu. Sie flochten Kränze aus Gänseblümchen und Pu-steblumen, die sie einander auf den Kopf legten. Richtige kleine Prinzessinnen waren sie jetzt; bloss schade, dass keiner sie sah und bewunderte. Das änderte sich, als Grethe nahte und Lèène ausrichtete, sie solle nach Hause gehen, Besuch sei gekommen. Für das Prinzessinnenhafte hatte Grethe allerdings wenig übrig, aber sie war natürlich mächtig gespannt, wer denn nun zu den Klingers auf Besuch gekommen sei. So liefen Grethe und Lèène über die Wiesen zu den Klingers nach Hause, dem Abenteuer entgegen. Und wer sass, allein gelassen, unbewundert und entsprechend vergrätzt unter der Trauerweide? Klara. Sie hatte wieder das schlechte Los gezogen, musste diese dämlichen Gänse hüten und war allein mit ihrer Neugier. An jenem Tag wartete sie gar nicht erst, bis die Kirchenglocke fünf Uhr schlug. Sie trieb ihre Gänse vor sich her und marschierte schlecht gelaunt nach Hause, beklagte sich bei Katharina, immer müsse sie die Gänse hüten und jetzt wolle sie auch zu den Klingers. Die Mutter zögerte nicht lange, unterbrach die Gartenarbeit, buk der Tochter einen Pfannkuchen, gab ordentlich Holundermarmelade drauf und sagte, für einen Besuch bei Klingers sei es auch am nächsten Tag noch früh genug. Die hätten jetzt erst mal zu tun mit ihrem Besuch.
Klara ärgerte sich grün und blau, als Grethe triumphierend nach Hause kam und zu berichten wusste, Lenes Onkel Ludwig sei aus Dresden zu Besuch gekommen: mit dem Zweispänner! Onkel Ludwig hatte sich mit dem Import von Kolonialwaren einen guten Ruf und ein ebenso gutes Geschäft erarbeitet, war zu Geld gekommen und zudem der Lieblingsbruder von Lèènes Vater. Seine Geschäfte hatten ihn nach Westen geführt, und so machte er Halt bei Bruder und Schwägerin, die ihm alsogleich die Kammer richtete. Sie freuten sich über den Besuch, denn der weitgereiste Onkel kam in der Welt herum und hatte immer viel zu erzählen. Johanna jammerte bloss, dass man nicht früher von seiner Ankunft gewusst habe; jetzt hätten sie gar kein Schwein schlachten lassen zu Ehren des hohen Besuchers. Ludwig lachte und sagte, es gelüste ihn vor allem nach einem ordentlichen Pils und etwas Räucherspeck mit Brot; das hätten sie doch bestimmt vorrätig. Speck und Brot ja, auch noch verschiedenes anderes; fürs Pils gingen die beiden Brüder dann nach dem Essen in die Schenke Zum goldenen Ochsen. Es konnte nicht schaden, wenn die andern Plauener Männer sahen, wie weit Ludwig es gebracht hatte.
Zu Klaras Glück kam Lèène bereits am folgenden Morgen wieder vorbei, um beim Hüten zu helfen. Nicht nur hatte sie viel zu erzählen, sie hatte auch etwas mitgebracht: ein längliches gelbes Ding mit braunen Sprenkeln. Das sei eine Banane, klärte Lèène Klara auf, die könne man essen. Und das sei etwas ganz Besonderes, was sonst nur den reichen Leuten vorgesetzt werde. Wie immer war Lèène grosszügig und teilte mit ihrer Freundin. Allerdings wollte sie als Erste ins Objekt der Begierde reinbeissen; danach reichte sie die Frucht an Klara weiter. Auch diese nahm einen herzhaften Biss. Dann kauten sie, machten grosse Augen, und schliesslich war Lèène auch die Erste, die den Matsch in hohem Bogen ausspie. Dass die reichen Leute so etwas essen mochten! Das verstanden sie ganz und gar nicht. Nun wussten sie nicht, was sie mit dem Rest anstellen sollten, bis sie ihn schliesslich in schönster Einigkeit in ein zuvor gegrabenes Loch in den Boden steckten und sorgsam wieder Erde darüber schütteten. Niemand hatte ihnen gesagt, dass man eine Banane schälen solle.
Der Sommer war Klaras liebste Zeit: Dann reiften die Himbeeren und Brombeeren, auf den Wiesen blühten die Blumen, sie sass mit Lèène unter der Tausendeiche – so viele Jahre alt mochte der mächtige Baum mindestens sein – und sie sangen Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg. Das Lied gefiel ihnen, denn es hatte eine schöne Melodie, doch unter dem abgebrannten Pommerland konnten sie sich nichts vorstellen. Dafür sahen sie nichts als blauen Himmel mit einem Kranz weisser Wolken über dem Horizont, sogen den Duft nach Gras und Heu ein, klaubten Roggenkörner aus den Ähren und kauten die noch jungen, milchigen Körner voller Genuss. Ihre Füsse badeten sie im kühlen Bächlein, das durch den Gänseanger führte, und wenn es ganz heiss war, zogen sie ihre Kleider aus und setzten sich ins kühle Nass. Zum Abendbrot gab es jetzt Rote-Beete-Suppe mit saurem Schmand (Sauerrahm), Roggenbrot und am Sonntag zum Nachtisch Beerengrütze mit Schmand; ein Schlaraffenland in jeder Beziehung!
An einem dieser heissen und schwülen Spätsommertage trieben Klara und Lèène die Gänse wiederum über den Anger hinaus zur Tausendeiche, wo man so schön im Schatten sitzen und plaudern konnte. Die uralte Tausendeiche stand auf einem kleinen Hügel, von wo aus man erst noch eine fabelhafte Sicht über die Landschaft hatte und sogar Klingers Hof sehen konnte. Der Hof der Meisters lag hinter verschiedenen Bäumen etwas versteckt, aber manchmal konnten sie beobachten, wie Lèènes Vater mit dem Gaul auf den Acker zog, um den Boden zu pflügen, da das Korn bereits geerntet worden war. Die beiden Mädchen hatten es lustig miteinander und wussten später nicht mehr, wessen Idee es gewesen war, sich auf den Boden zu legen und den kleinen Abhang hinunterzurollen. Das Spiel gefiel ihnen – bis plötzlich Klara vor Schmerz aufschrie und sofort aufstand. Beim Rollen hatte sich eine spitze Glasscherbe in ihren Rücken gegraben und steckte nun fest. Lèène kam sofort herbei und zog diese aus Klaras Rücken; die Wunde blutete stark und Klara weinte vor Schmerz und vor Erschrecken. Schnell liefen die Mädchen zum Bächlein, Klara legte sich hinein und das kühle Wasser besänftigte den Schmerz. Sie wusste jedoch, dass sie nichts Gutes zu erwarten hatte, wenn sie zu Hause erzählen würde, wie sie sich diese Scherbe geholt hatte. Schliesslich erwarteten die Eltern, dass die Kinder die Gänse hüteten und nicht halbnackt den Hang hinunterrollten. Sie bat ihre Freundin deshalb, nichts davon zu erzählen, auch bei ihr zu Hause nicht, was diese versprach. Das verblutete Unterhemd wuschen sie im kalten Wasser aus und legten es zum Trocknen in die Wiese. Dann ging Lèène die Gänse einsammeln, die sich vergnügt im Gras verteilt hatten. Als sie die Tiere später nach Hause trieben, sah man die Wunde unter dem Kleid nicht mehr, und Klara achtete peinlich darauf, sich nie im Unterhemd zu zeigen. Wochenlang schmerzte die Blessur und Klara konnte nicht auf dem Rücken liegen. Schliesslich blieb eine Narbe mehr zurück, für die Klara sich ein Leben lang schämte. Am schlimmsten waren aber dennoch die Brandnarben von damals, als ihr Kleid beim Ofen Feuer gefangen hatte.
Einmal im Monat buk die Mutter Brot: Der geschrotete Roggen wurde mit Wasser, Sauerteig, Salz und Malz angesetzt und im grossen Bottich in der Küche einen bis zwei Tage gehen gelassen. Wenn er gärte und viele kleine Löchlein hatte, nahm sie jeweils grosse Klumpen aus dem Bottich und legte sie auf den bemehlten Küchentisch. Dann knetete und schlug sie ihn ausgiebig, formte einen Laib draus und legte diesen auf das grosse Brett, das der Vater oder Felix ihr jeweils aus der Scheune holten. Einen ganzen Nachmittag dauerte es, bis rund 30 grosse Laibe bereit lagen. Felix und Leopold mussten mit anpacken und das Brett am nächsten Morgen zum Backhaus bringen, wo Katharina schon zwei Stunden zuvor eingeheizt hatte. Eins ums andere wurden die Brote dann mit der grossen Schaufel in die heisse Höhle geschoben und nach rund einer Stunde wieder herausgeholt. Etwa fünfmal wiederholte sich dieser Vorgang, und wenn Backtag war, gab es am Mittag die aufgewärmte Kartoffelsuppe vom Vortag. Am Nachmittag war dann Johanna dran mit dem Backen ihrer in aller Frühe geformten Brote. Die beiden Frauen wechselten alle Monate ab, wer zuerst drankommen sollte. Abends wurde bei Meisters eines der frischen Brote angeschnitten und mit Schmalz und Zwiebeln bestrichen; ein einziges Brot und kein bisschen mehr! Die Familie hätte sonst ohne Weiteres zwei davon gegessen. Sämtliche Brote wurden in Baumwollsäcke gelegt und diese wiederum am Deckenbalken in der Küche aufgehängt, damit die Mäuse nicht dran kamen.
Gegen Ende des Sommers nahmen die Gewitter zu. Wenn es erst nachts losbrach, mussten sich alle Kinder anziehen, man sass um den Küchentisch und hielt die Bibel in der Hand, bereit, im Notfall sofort zu fliehen. Die Strohdächer brannten schnell, wenn der Blitz eingeschlagen hatte, und jedes Jahr hörte man von einem Hof in der Umgebung, der in Flammen aufgegangen war. Wenn es ganz dumm kam und der Südwestwind blies, sprang das Feuer auf andere Häuser über. Schon ganze Dörfer waren auf diese Weise abgebrannt und hatten ihre Bewohner ins Elend gestürzt. Erst wenn sich das letzte Donnergrollen verzogen hatte, konnte man sich wieder ins Bett legen und erleichtert dem Morgen entgegenschlafen.
Die schöne Seite des Herbstes waren die klaren, kühlen frühen Tagesstunden; Tau lag auf Gras und Blättern, der Duft kleiner Kartoffelfeuerchen zog über die Landschaft, wenn das vertrocknete Kraut auf den Felder verbrannt wurde. Die Kinder der Umgebung machten sich einen Spass daraus, vergessene Kartoffeln aufzulesen und in die Glut zu legen; nichts (fast nichts) schmeckte herrlicher als diese auf dem Feld gegarten Kartoffeln. Die Blätter der Buchen und des Ahorns begannen sich zu färben, jene der Eichen warteten noch zu. Die letzten Schmetterlinge hatten sich verabschiedet, dafür glitzerten mit Tautröpfchen verzierte Spinnennetze im Morgenlicht. Wie kleine Perlen lagen die Tröpfchen auf den elastischen Fäden und fingen das Sonnenlicht auf. Wehmut lag in der Luft, Dankbarkeit auch, dass die Ernte eingebracht und das Korn gedroschen werden konnte, Sicherheit brachte für die kommenden Monate. Jetzt waren die Äpfel und Birnen reif, saftig und köstlich schmeckten sie, verbreiteten ihre Süsse im Mund und füllten einen mit Glückseligkeit. Klara und Lèène sassen, gut in Wollkleidung verpackt, auf der Holzbeige hinter der Scheune und wünschten sich, es möge das ganze Jahr hindurch diese wunderbaren Birnen geben; jeden Tag wollten sie eine, lieber noch zwei davon essen. Zu Hause wischten Vadder oder Mudder mit dem Strohbesen die Blätter auf dem Hof zusammen, damit man nicht auf ihnen ausglitt im Regen. Abends wurde es früher dunkel, die Herbstregen setzten ein und verabschiedeten den Sommer still und leise.
Spät im Herbst wurde bei Klingers jeweils geschlachtet. Während die Rinder zu diesem Zweck zum Fleischer gebracht wurden, schlachtete Vater Klinger die Schweine jeweils mithilfe eines Störschlachters selber. Dann wurde das Wasser im grossen Siedebottich über Stunden auf dem Feuer aufgeheizt, bis man die gestochene Sau mit vereinten Kräften ins siedende Wasser legen und ihr danach die Borsten abschaben konnte. An Ort und Stelle wurde das Blut zu Blutwürsten verarbeitet, die, mit Schmand, Salz und Kräutern vermischt, im selben Wasser gekocht und damit haltbar gemacht wurden. Auch der Schweinekopf wurde sofort gekocht, ebenso die Füsse, Leberwürste oder ein Schinken. Die restlichen Fleischstücke wurden dann über dem grossen Ofen geräuchert. Die Arbeiten dauerten von morgens früh bis abends spät. Klara wurde jeweils von der Mutter mit einem Kessel zu Klingers hinübergeschickt, damit sie ein paar Liter von der Wurschtebrüe mit nach Hause bringen konnte. Davon gab es ja genug. Und Johanna war immer grosszügig: Meistens gab sie noch einige Fleischstücke aus dem Schweinskopf oder die Öhrchen, vielleicht ein oder zwei Füsschen oder das Schnörrchen mit, sodass an jenem Abend bei den Meisters ein herrliches Abendessen auf dem Tisch stand: Wurschtebrüe mit kleinen Fleischstückchen, ergänzt mit Porree und Kartoffeln, einen ganzen grossen Topf voll. War ausnahmsweise genügend Geld in der Familienkasse, glänzte sonntags sogar eine Blut- oder Leberwurst in der Brühe und sorgte für Feststimmung.
Im Winter blieben die Gänse dann im Hof, kleckerten überall hin, watschelten durch den Matsch und schnatterten um die Wette. Auch mit Barfusslaufen war es vorbei; die Männer und die Kinder trugen Holzschuhe, die grossen Schwestern hatten richtige Schnürstiefel aus Leder. Solche hätte Klara auch gerne gehabt, aber man vertröstete sie, dass sie anlässlich ihrer Konfirmation welche bekommen sollte. Das würde allerdings noch ein paar Jahre dauern, aber für Kinder im Wachstum lohnte es sich nicht, Lederstiefel herzustellen. Diese waren den Kindern aus den vornehmen Haushalten vorbehalten, beispielsweise den von Eversteins, die als Nachfahren des einstigen Vogtes das grosse Haus neben der Burg bewohnten. Oder dem Nachwuchs von Bürgermeister Schmankdorff, aber davon wusste Klara zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Vorerst galt es, auf den schlickigen Wegen nicht auszurutschen und sich nicht schmutzig zu machen. Mutter Katharina war wenig erfreut, wenn die wollenen Dreieckstücher verdreckt waren, denn sie waren schwer zu reinigen und man brachte die braunen Flecken kaum raus. Abends sass man um den Küchentisch und knackte Nüsse, deren Kerne man in grosse Vorratsgläser mit Bügelverschluss füllte. Diese Gläser standen nun neben den eingemachten Früchten und Gemüsen, den Marmeladen und dem Schmalz in der Vorratskammer und lockten unentwegt, ein wenig davon zu naschen. Das hingegen war unter keinen Umständen erlaubt; schliesslich mussten die Vorräte den ganzen Winter über halten, wenn die Familie einigermassen bei Gesundheit bleiben wollte. Dafür gab es nun hin und wieder Haferbrei mit Zucker und Butter oder mit eingemachten Kirschen – ein Leckerbissen, von dem Klara niemals genug bekommen konnte.
Der Vater musste in der Werkstatt nun den kleinen Holzofen bedienen, da es dort einfach zu kalt war und das Holz Schaden nahm, wenn es allzu starke Temperaturschwankungen aushalten sollte. Wenn Katharina und die älteren Töchter nähten, strickten und stickten, Löcher in den Strümpfen stopften und sich Geschichten erzählten, setzte sich später am Abend der Vater zu ihnen und schmauchte sein Pfeifchen. Manchmal arbeitete auch er noch an einem seiner Instrumente. Klara sah gerne zu, wenn er den Bogen mit Pferdehaar bespannte und mit dem Daumen immer wieder prüfte, ob die Festigkeit gut war. Weder zu weich noch zu straff sollte der Bogen bespannt sein, wenn er einen wohlklingenden Ton hervorlocken sollte. Martha, die eine schöne Stimme hatte und viele Lieder kannte, begann oft zu singen, und nach und nach stimmten die andern mit ein, sangen das traurige Lied vom Mariechen im Garten oder von den fünf wilden Schwänen, die nach Norden zogen und nie mehr gesehen wurden. Und dann die fünf Mädchen am Memelstrand, von denen keines den Brautkranz wand. „Was ist der Memelstrand, Vadder?“, wollte Grethe wissen. „Ganz oben im Norden“, sagte der Vater, „noch östlich der kurischen Nehrung und ihrer grossen Düne, dort liegt der schmale Streifen des Memelstrandes. Dort ist das Meer, endlos weit und tiefblau, und die Wellen schlagen an den Strand. Am Ufer liegen Bernsteine, die darf man jetzt neuerdings behalten.“ So träumten sie vom Meer, das der Vater in jungen Jahren gesehen hatte, als er auf der Walz in den Nordosten gezogen war. Wasser, soweit das Auge reichte, keine Bäume und keine Felder, keine Gänse und keine Lèène – das konnte sich Klara kaum vorstellen. Aber etwas anderes beschäftigte sie noch: „Warum hat denn keines der Mädchen einen Brautkranz geflochten?“, wollte sie wissen. „Am Meer gibt es keine Blumen“, sagte die Schwester Lene schnell. Damit gab sich Klara dann zufrieden. Vom Krieg und seinen Schrecken wusste sie zum Glück noch nichts. Wenn abgemacht war, dass jede und jeder noch einen Liederwunsch frei hatte, musste sich Klara nie lange besinnen: Aus dem Dörfchen da drüben vom Turme herab, da läuten die Glocken den Tag zu Grab … Da wurde sie ganz still und feierlich, denn das war doch wirklich schön. Und wenn es dann hiess: … und ich und du, wir hören so gerne dem Läuten zu, dann fühlte sie sich geborgen und sicher aufgehoben im Kreise ihrer Familie. So war der Winter gemütlich und schön, auch wenn die Schlafzimmer eisig kalt waren und nur die von der Mutter vorsorglich ins Bett gelegten, in Tuch eingewickelten und im Ofen erhitzten Steine die kalten Beine noch einigermassen zu wärmen vermochten. Grethe, mit der sie das Bett teilte, kehrte ihr immer den Rücken zu, und wenn Klara sich anschmiegen und wärmen wollte, trat sie ihr gegen die Schienbeine. Nein, Grethe und Klara hatten das Heu nicht auf der gleichen Bühne!
Wenn dann endlich die lange ersehnten ersten Flocken fielen, war das Glück der kleineren Kinder vollkommen! Als Klara eines Morgens erwachte, fiel ihr als Erstes die unnatürliche Helligkeit auf. Ein Blick aus dem von Eisblumen befreiten Fenster bestätigte dann, was sie ahnte: Eine grosse Schneedecke lag über der Landschaft – und es schneite noch immer. Klara war glücklich, doch musste sie bald feststellen, dass sie mit dem Vater und dem krank im Bett liegenden Felix allein war. Martha und Lene waren an der Arbeit, Grethe und Leopold waren in der Schule. Und die Mutter, die war bei den Sievers’ und sollte die ganze Woche über bei der Wäsche und beim Bügeln mithelfen. Normale Leute wuschen im Frühjahr, im Sommer und im Herbst, nicht aber im Winter, wo es so schwierig war, die Wäsche trocken zu kriegen. Die Sievers’ waren aber eben keine normalen Leute, denn sie lebten in einem der vornehmen Stadthäuser und Herr Sievers war Richter im alten Rathaus. Dort ging er täglich ein und aus, urteilte über Leute, die er oft gar nicht kannte, und brachte am Ende der Woche ein beachtliches Salär mit nach Hause. Wohl hatte man Bedienstete, aber auch diese brauchten Hilfe bei der anstehenden grossen Wäsche. So heizte Katharina den grossen Wäschekessel ein, gab Asche dazu und stiess mit der langen Holzstange die Wäsche immer wieder in die heisse Lauge. Mehrere Stunden blieben die Kleidungsstücke und Laken eingeweicht, bis sie einzeln am Waschbrett gerieben, schliesslich in einen grossen Bottich gelegt und von zwei Frauen zum Dorfbrunnen getragen wurden, wo man sie im eiskalten Wasser mehrmals spülte und auswrang. Aufgehängt wurde dann im Keller des Hauses, wo ein Ofen stand, den man extra einheizte, damit die Wäsche auch trocknen konnte. Nach solchen Arbeitstagen, so auch an diesem, kam Katharina völlig erschöpft nach Hause und rieb sich die roten, gesprungenen Hände mit Schmalz ein. Sie war froh, dass ihre beiden ältesten Töchter schon Kartoffeln und Zwiebeln gebraten hatten und sie nicht auch dafür noch sorgen musste. Da war das anschliessende Bügeln der Wäsche doch angenehmer; die Hitze des Bügeleisens wärmte die kalten Arme und Beine.
Klara indes tollte mit Lèène im Schnee herum. Die Gänse schauten aus dem vergitterten Stall zu und mussten drin bleiben, also hatten die beiden freie Fahrt fürs Vergnügen. Und was für ein Vergnügen das war! Sie bauten einen Schneemann, warfen sich Schneebälle zu und fingen sie auf, rollten sich den kleinen Hang hinunter und fanden den Winter fabelhaft. So lange, bis Leopold und Grethe von der Schule nach Hause kamen. Sie beteiligten sich an der Schneeballschlacht, bloss dass sie die Schneebälle einander nicht zuwarfen, sondern mit diesen auf die kleinen Mädchen zielten. Die fanden das nicht lustig und Klara rannte heulend zum Haus. Grethe rief hinter ihr her: „Heul nur! Keiner da, dich mit Semmeln zu trösten! Die Mutter ist bei der Arbeit, Martha und Lene noch nicht aus der Fabrik zurück und Felix ist krank. Äääätsch!“ So war es, keiner da, Klara zu herzen. Da sass sie nun mit dieser ganzen Ungerechtigkeit und hatte niemanden, bei dem sie sich beklagen konnte. Den Vater stören durfte sie nicht, denn der war gerade am Endschliff einer Violine. So stampfte sie wütend durch die Küche, die ganzen Freuden des Schnees waren vergessen. Und es sollte noch schlimmer kommen: Als Martha und Lene, von der Arbeit zurück, zu Hause angekommen waren und den Tisch decken sollten, hatte keine richtiges Gehör für Klaras Jammern. Auch ihr Tag war ein langer, der Heimweg durch den Schnee beschwerlich gewesen, und ausserdem mussten sie sich um Felix kümmern, der fiebrig im Bett lag. Die Mutter strich Klara abwesend über die Haare, brachte aber keine Kraft mehr auf für das erwartete Mitleid und die Schelte der Spielverderber. Dafür suchte der Vater nach dem Abendessen nach seiner Pfeife, die er einfach nirgends finden konnte, wo immer er auch suchte. Leopold hatte einen Tipp für ihn: „Schau mal draussen beim Schneemann.“ Als der Vater wiederkam, ging er stracks auf Klara zu und raunzte sie ungehalten an, es solle ihr nie mehr in den Sinn kommen, seine Pfeife, die aus Meerschaum war und die er auf der Walz gekauft hatte, auch nur zu berühren! Klara, nicht gewohnt, dass man sie schalt, brach erneut in Tränen aus, wurde aber ohne viel Federlesens ins Bett geschickt. Und so endete ein Tag, der so verheissungsvoll begonnen hatte, dunkel und einsam.
Wenige Wochen später sagte die Mutter am Mittag, als Klara noch mit ihren Klopsen beschäftigt war, heute würden sie an die Burgstrasse gehen und einkaufen, damit sie dann den Stollen für Weihnachten backen könne. Stollen! Weihnachten! Zauberworte für Klara, die sich beeilte, damit sie mit der Mutter möglichst schnell fortgehen konnte. Als sie beide gut eingepackt waren, stapften sie durch den matschigen Schnee der Innenstadt entgegen. Sie gingen die Syrastrasse entlang, bogen beim Postplatz in den Unteren Graben und schliesslich in die Marktstrasse ein. Dieses Gewimmel beim Postplatz! Klara traute sich selbst an der Hand ihrer Mutter kaum, ihn zu überqueren, da sie nicht nachkam mit Gucken: nicht nur Leute in dicken Wintermänteln, die sie noch nie gesehen hatte, auch Männer, die Karren über das Kopfsteinpflaster hinter sich herzogen, und Fuhrwerke mit einem Kutscher und zwei Pferden, aus deren Mäulern es dampfte und die der Kutscher hin und wieder mit der Peitsche zur Eile antrieb. Einige Frauen trugen Fuchspelze um den Hals und auf den Hüten farbige Federn. Und lärmig war es hier! Die neue Strassenbahn rumpelte auf engen Gleisen durch die Strassen, und wer konnte, brachte sich vor ihr in Sicherheit. Klara bewunderte ihre Mutter, dass diese sich so sicher durch das Gewimmel bewegen konnte und dann auch noch die Geschäfte fand, in denen sie einkaufen sollten. Es war einfach nur aufregend!
Zuerst gingen sie zum Gewürzhändler, wo sie von einem zugleich weichen und strengen Duft empfangen wurden, der für Klara neu war. Eine Tüte Zimt bestellte die Mutter, und der Gewürzhändler füllte das braune Pulver ab, faltete die Tüte und schlug sie an den Enden ein. Wörter wie Kardamom, Kanel und Pottasche fielen und es hatte unzählige Gläser mit Pulver aller Farben im Geschäft. Dort hätte man sich einen ganzen Tag verweilen können, soviel Neues gab es zu entdecken. Als die Mutter alles Gewünschte im Korb verstaut und bezahlt hatte, traten sie aus der wunderbaren Wärme wieder hinaus in die Kälte. Weiter gings zur Nobelstrasse, und da gab es ein Geschäft, vor dem Klara wie angewurzelt stehenblieb. Im Schaufenster sah man ein Puppenhaus mit richtigen Stühlen und einem Tisch in der Stube, mit einer Küche mit Kupferpfannen und Essgeschirr über dem Holzherd, mit einem Kinderzimmer, in dem zwei winzige, richtige Betten standen und – das war kaum zu glauben! – ganz kleine Vorhänge samt rosa Rüschen vor den Fenstern hingen! Klara konnte kaum fassen, was sie sah. Dass Leute ganz richtig so lebten! „So ein kleines Haus mit allem drin möchte ich gerne haben“, sagte Klara zur Mutter. Diese blieb mit ihr stehen und guckte sich die Wunderwelt ebenfalls an. Da gab es auch noch Puppen mit schön gemalten Augen, richtigen Haaren und zarten Gesichtern, eine davon gekleidet in die schönsten weissen Kleider. Wie Schneewittchen sah sie aus mit ihren zart rosa getönten Wangen. Klara zupfte an Meuders (so nannten sie ihre Mudder) Hand und wiederholte, was sie gerne haben würde. „Weisst du, solche schönen Dinge kosten viel Geld. Das können sich nur reiche Leute leisten. Und wir sind nicht reich“, erklärte diese ihrer Tochter. Fast konnte sich das Mädchen vom Anblick des heiss Begehrten nicht losreissen, und nur die Aussicht auf einen Besuch im Krämerladen bewog es, mit der Mutter weiterzugehen. Nun wurde eingekauft: drei Kilogramm ganz weisses Mehl, zwei Kilogramm vom feinen Zucker, ein Pfund Marzipan, Salzgurken aus dem Fass und noch vieles mehr. Weiter gings zum Kolonialwarengeschäft, das Orangeat und Zitronat, Korinthen und Sultaninen feilbot. Süsse Butter vom Stock sowie Hefe erhielten sie hingegen beim Bäcker. Klara war zum ersten Mal mit der Mutter in der Innenstadt beim Bäcker, und es dünkte sie, sie wolle von hier nie mehr fort. Süsse Weissbrötchen waren nur das eine; daneben gab es aber auch noch Kekse in verschiedenen Farben und zwei richtig grosse Gläser mit Bolschen: rot-weiss gestreifte mit Himbeergeschmack, wie die Mutter sagte, und grün-weiss gekringelte, die nach Pfefferminze schmeckten. Nun war Klara also nicht mehr gewillt, noch mehr Wunderdinge zu sehen und nichts davon zu bekommen. Sie gab keine Ruhe, bis die Mutter auch noch eine Tüte mit Himbeerbolschen gekauft und ihr eine davon gegeben hatte. Daran saugte sie nun glücklich, schob es von einer Backe in die andere und kostete seine Süsse mit jeder Faser ihres kleinen Mundes aus. Schade, dass sie von hier wieder wegmussten, aber nun wusste Klara, dass es diesen Bäcker gab und man dort solch himmlische Dinge bekam. Irgendwie würde ihr schon was einfallen, wie sie auch die grünen und all die andern Verführungen bekommen könnte. Der Heimweg erschien ihr dann unendlich lang, und die Füsse schleppte sie immer schwerer hinter sich her, obwohl es ihre Mutter war, die den beladenen Handwagen durch die Furchen der Strassen zog. Als sie bei Einbruch der Dämmerung endlich zu Hause waren, wurde Klara aus ihrem Wintermantel und den Schuhen geschält. Sie war so unendlich müde, dass sie sich auf der Küchenbank zusammenrollte und sogleich einschlief. Ihr letzter Gedanke war, dass sie Grethe in allen Details erzählen würde, wo sie mit der Mutter überall gewesen war. Äätsch!
Wenige Tage später holte die Mutter die grosse Steingutschüssel hervor und tat Mehl, Zucker, Eier und all die köstlichen Dinge hinein, die sie in der Stadt gekauft hatten. Klara kniete sich auf einen der Stühle und schaute interessiert zu. Die Mutter rührte und knetete den Teig, von dem ein wunderlicher Duft ausging, legte ihn zurück in die Schüssel und breitete ein grosses Küchentuch drüber. Nun müsse der Teig aufgehen, erklärte sie Klara, noch viel grösser werden, das dauere nun eine Weile. Die Mutter ging ihrer Hausarbeit nach und Klara war allein in der Küche. Sehr allein. Ganz allein, sozusagen. Und sie war vorsichtig. Äusserst behutsam hob sie das Baumwolltuch an, streckte Daumen und Zeigefinger aus, klaubte sich ein Stückchen ab und schob es sich in den Mund. Ooaaach, welche Wonne! Genüsslich zerdrückte sie mit den Zähnen die Rosinen, strich sich den Teig mit der Zunge über den Gaumen und schwelgte im siebten Himmel. Gerade als sie das Tuch ein weiteres Mal lüften wollte, hörte sie die Schritte der Mutter und zog ihren Arm hastig zurück. Die Mutter trat ein, warf einen Blick auf ihre Jüngste und stellte die Schüssel mit dem himmlischen Inhalt kommentarlos auf das obere Regal im Küchenbuffet. „Es ist Zeit, die Gänse zu füttern. Geh und gib ihnen ihr Futter und auch genügend Wasser. Hier ist der Korb für die Eier.“ Was sollte man da noch machen? Als Klara vom Füttern zurückkam, waren Grethe und Leopold bereits aus der Schule zurückgekehrt, sassen am Tisch und kauten ein Stück Schwarzbrot zur Suppe, redeten über den Lehrer Plön und wie er den Gerhard, des Krügers Ältesten, hatte nachsitzen lassen. Der musste jetzt in der Schule bleiben und so lange auf der Schiefertafel schreiben, bis die Buchstaben schön gerade aussahen. Das konnte ja Weihnachten werden, bis er damit fertig war! Klara stierte derweil sehnsüchtig nach der braunen Schüssel in schwindelerregender Höhe, getraute sich aber nicht, ihre älteren Geschwister zum Ungehorsam anzustiften. Wer wusste schon, ob diese Grethe dann nicht wieder schnurstracks zur Mutter rennen und sie verpetzen würde. Das Risiko war einfach zu gross.
Gegen Abend holte die Mutter den Teig dann wieder herunter und wirklich: Er war jetzt grösser als zuvor. Und vom Loch, das Klaras herausgeklaubter Teig hinterlassen hatte, war gar nichts mehr zu sehen. Nun wurde nochmals geknetet, und die Mutter formte zwei schwere Laibe, die sie auf ein Brett legte und wieder mit dem Tuch bedeckte. Grethe und Leopold wurden beauftragt, die Stollen zum Bäcker Knaus zu tragen, damit er sie am nächsten Tag in aller Frühe backen konnte. Aus der Traum für Klara, wenigstens vorläufig. Tags darauf ging sie dann aber zusammen mit der Mutter zu Bäcker Knaus, um die fertig gebackenen und herrlich duftenden Stollen abzuholen. Gut in braunes Papier eingepackt wurden sie nun in die Kühle des elterlichen Schlafzimmers gebracht und oben in die Truhe gelegt, wo keine Mäuse hinkamen. Auch diese hätten sich gerne etwas davon abgezwackt. Der Deckel war sowohl für Mäuse als auch für kleine Mädchen zu schwer und er schloss gut.
Im Haus wurden nun Vorbereitungen für den Weihnachtstag getroffen. Der Vater und Felix brachten eine schöne, mittelgrosse Tanne nach Hause, die in der guten Stube Platz fand. Sie stellten sie auf, sodass jetzt das gerahmte Bildnis vom streng guckenden Kaiser Wilhelm dem Zweiten von frisch duftenden Ästen verstellt war. Er musste über die Feiertage halt nun mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen, was ihm kaum behagt haben dürfte, da König Friedrich August der Dritte von Sachsen unverstellt zu sehen war. Die drei Kleinen wurden aus der guten Stube verbannt, als die drei Grossen gelbliche und rote Äpfel an die Zweige hängten. Martha und Lene hatten von ihren Patentanten in den früheren Jahren je zwei Kugeln aus hauchdünnem Glas erhalten, die den Baum nun richtig festlich machten. Fehlte nur noch der Sack mit den Nüssen, der vorsichtig am Stamm angelehnt wurde, damit die Baumnüsse nicht zu früh herauskollerten. Und schliesslich war es soweit: Am frühen Morgen des 25. Dezember zogen sie alle ihre besten Kleider an, verzehrten genüsslich eine Semmel von Bäcker Giehse mit süsser Butter und Zucker, tranken einen Kaffee und gingen dann zur Johannis-Kirche. Wie alle Jahre hörten sie die Weihnachtsgeschichte und die Predigt von Pastor Hamm, sangen Oh du fröhliche, oh du selige Weihnachtszeit mit Lehrer Plöns Begleitung auf dem Harmonium. Das war zwar nicht so eindrücklich, wie wenn er die Orgel gespielt hätte, aber diese war kaputt und sollte erst im Laufe des Winters repariert werden. Klara war nur halb bei der Sache, da sie nicht anders konnte, als ans bevorstehende Mittagessen zu denken und an den geschmückten Baum, den sie noch gar nicht gesehen hatte. Und sie hoffte inniglich, dass sie auch diesmal etwas geschenkt bekäme, denn letztes Jahr hatte sie selbst gestrickte warme Handschuhe von Martha und Lene sowie eine neue Schürze aus blauem Kattun mit roten Kirschen drauf von den Eltern bekommen. Als sie nach Hause kamen, war es sowohl in der Küche als auch in der guten Stube herrlich warm und es duftete verführerisch nach Geräuchertem. Während die Mutter und die grossen Schwestern das Essen fertig zubereiteten, deckte Grethe ganz alleine den Tisch. Felix und der Vater waren nirgends zu sehen, man hörte lediglich Geräusche aus der Werkstatt. Endlich trugen die erwachsenen Frauen das Festessen auf, das sie gekocht hatten: Eine grosse Schüssel mit Kartoffeln, die vor Butter glänzten, und die noch grössere braune Steingutschüssel, in der das Kraut dampfte und das Kasseler Nierstück sowie die zwei gut durchwachsenen Speckstücke einen Duft verbreiteten, der auch im grossen Burghaus bei den von Eversteins nicht besser hätte sein können. Der Vater bekam seinen Teller zuerst gefüllt, und zwar recht ordentlich, dann schöpfte die Mutter zuerst den kleinen, danach den erwachsenen Kindern und zuletzt sich selbst. Und dann schmausten sie, dass es eine wahre Wonne war! Niemand mochte reden, jetzt füllten sie sich einfach die Bäuche mit den saftigen Fleischstücken von Klingers gut gemästetem Schwein. Klara legte die schwarzen Wacholderbeeren vom Kraut säuberlich auf den Tellerrand, denn diese mochte sie ganz und gar nicht. Das Kraut und die buttrigen Kartoffeln hingegen schon, erst recht die rosafarbenen Fleischstücke und den weissen Speck. Als sich die Bäuche schon sichtbar gerundet hatten und die beiden Schüsseln ritzeratze leer gegessen waren, da begannen sie dann zu reden: vom feinen Essen, von der Kirche und den Leuten, die sie in der Messe gesehen hatten, vom Weihnachtsbaum, der festlich geschmückt dem Kaiser mit seinem imposanten Schnauzbart die Sicht nahm, und von den vier Gänsen, die sie verkauft und für die sie eine ansehnliche Summe an Goldmark erhalten hatten – eine an die Familie des Lehrers Plön, eine an die Familie der Hebamme Kallenberg und zwei an die Familie Richter Sievers, die das wohlgenährte und zarte Vogelvieh der Meisters in hohen Ehren hielten. Zum Kaffee für die Erwachsenen und heissem Holundersirup für die Kinder schnitt die Mutter den einen Christstollen an und bedachte jede und jeden am Tisch mit einer dicken Scheibe des umwerfend köstlichen Gebäcks. Nach diesem zusätzlichen Genuss hätte niemand auch nur noch eine einzige womit auch immer beladene Gabel essen mögen, sie waren alle einfach nur satt und zufrieden.
Wie es Brauch war, schlug die Mutter den zweiten Christstollen in ein Tuch und packte ihn zusammen mit schönen, reifen Äpfeln in den Korb, den Leopold, Grethe und Klara nun ins Armenhaus bringen sollten, damit jene, die kaum etwas zu beissen (meistens auch keine Zähne mehr) und wenig Freuden hatten, auch anständig Weihnachten feiern konnten. Leopold nahm den Korb, und die drei machten sich auf den Weg zur Klosterstrasse, wo die Stadtväter den Armengenössigen eine Unterkunft im ehemaligen Beginen-Haus eingerichtet hatten. Direkt neben dem weit über die Dächer ragenden Klosterturm lag dieses baufällige Haus, dessen Dach immerhin dicht war und den Menschen Schutz vor Kälte und Nässe bot. Drinnen war die Luft warm und stickig und es roch nicht gut. Klara hielt sich ganz gegen ihre Gewohnheit an Grethes Hand fest, denn ihr war es hier nicht richtig geheuer. Die Alten jedoch kamen eifrig angehumpelt, als Leopold den Korb auf den Tisch stellte und das feine Gebäck samt den Äpfeln vor sie hinlegte. Man sah, dass schon andere Wohltäter Speisen gebracht hatten, denn auf den Platten lagen noch Reste von Kartoffeln und schönem Brot. Die Fischgräten zeugten von bereits aufgegessenen Karpfen und die abgenagten Knochen von einem gebratenen Huhn. Hunger leiden mussten die Alten an diesen Weihnachten also nicht. „Vergelt’s Gott“ und „Habt Dank“ bekamen die Kinder zu hören, und ein zahnloser Alter versicherte mit listigen Äuglein, von diesem herrlichen Christstollen solle kein Mäuschen auch nur eine Krume erhalten. Dann erzählte er von der Dienstherrschaft seiner Mutter, die auch so wunderbare Stollen gehabt, den Bediensteten aber nie etwas davon abgegeben hätte. Klara klammerte sich ängstlich an Grethes Mantel fest, weil sie sich fürchtete inmitten der vielen unbekannten Leute. Sie war deshalb froh, als sie sich auf den Heimweg machten, vorbei am Lutherplatz und dem ehrwürdigen Rathaus mit seinen Renaissance-Giebeln, über die Pforten-Brücke, unter der die Weisse Elster gar nicht weiss, sondern schwarz, nass und kalt durchfloss.
Leopold erklärte Klara, sie seien jetzt vor der Sackgasse „An der Meisterei“ und unweit daneben liege die Trögerstrasse. Somit seien die Namen ihrer beiden Familien in Plauen für immer und ewig verankert und diese nicht minder wichtig als die von Eversteins mit ihren gräflichen Vorfahren auf der Burg. Das wiederum gefiel Klara: Ihre Familien hatten eine Bedeutung und sie selbst dadurch ebenfalls. Mit neuem Selbstbewusstsein wanderten sie den Rest des Heimwegs durch die beginnende Dämmerung und wurden zu Hause sogleich ausgefragt, ob sich die Alten über die Gaben gefreut hätten. Das bestätigten alle drei frohen Herzens, und noch froheren Herzens betraten sie die gute Stube, in der auf dem Tisch unter einem Tuch etwas Unförmiges versteckt war. Neugierig setzten sich die drei Geschwister zu den andern an den Tisch und fragten, was denn da unter dem Tuch sei. Der Vadder nahm seine Meerschaumpfeife aus dem Mund und sagte: „Klara, du bist die Kleinste, du darfst das Tuch vorsichtig wegziehen.“ Das liess sie sich nicht zweimal sagen, stand auf – und war zu spät. Grethe und Leopold waren schneller gewesen und liessen sich vom Protest des Vaters nicht beeindrucken. Zu schön war, was sie da sahen: ein kleines Haus aus Holz, in das man hineinsah. Zwei Stockwerke hatte es: unten die Küche mit dem Herd, dem Tisch und den Stühlen, daneben die gute Stube mit der Spitzendecke auf dem Tisch und den Stühlen sowie der Wanduhr in der Ecke und oben die Schlafkammern mit kleinen Betten und Truhen. Es sah fast so aus wie bei ihnen zu Hause. Klara war hingerissen, nahm vorsichtig eine der hölzernen kleinen Puppen und spazierte mir ihr durchs ganze Haus. Grethe tat mit, und eins, zwei waren sie wunderbar ins Spiel vertieft. Nun musste man vorderhand nichts mehr von den Mädchen wollen; selbst Leopold konnte nicht anders, als mitzuspielen, wobei er peinlich darauf achtete, den männlichen Part zu übernehmen. Ab sofort spielte das Puppenhaus, das Klara mit der Mutter im Schaufenster an der Nobelstrasse gesehen hatte, schlicht keine Rolle mehr; Klara dachte nicht einmal mehr daran.
Vadder, Mudder, Martha, Lene und Felix freuten sich am Anblick der begeisterten Kinder, hatten sie doch manche Woche spät am Abend noch gezimmert und gemalt, Tischdecken im Kleinformat gehäkelt und winzige Flickenteppiche geschneidert. Dass ihr gemeinsames Werk nun so viel Freude bereitete, war die grosse Genugtuung für sie. Sie genossen die Ruhe und das Nicht-viel-tun-Müssen, freuten sich über den schönen Weihnachtsbaum, der nun im fahlen Licht der Gaslampe und einer Kerze aus Bienenwachs seinen frischen Duft, die Erinnerung an die ruhende Natur und die Verheissung auf deren Wiedererwachen in den Raum verströmte. Durchwärmt bis auf die Knochen hätten sie in dieser Behaglichkeit noch lange verweilen mögen.
Das Spiel wurde erst unterbrochen, als man den Tisch fürs Abendessen abräumen musste. Weil noch niemand richtig Hunger hatte, gab es lediglich für jeden ein Stück des Pfannkuchens mit eingelegten Pflaumen. Danach wurden sie so richtig müde nach dem ereignisreichen Tag. Zu Klaras Leidwesen liess es sich nicht verhindern, dass sie vor dem Schlafengehen noch einmal in die Kälte und zum Aborthäuschen gehen musste, das neben dem Gänsestall lag. Sie war nicht die einzige; auch die andern Familienmitglieder spürten die Wirkung des Sauerkrauts und der eingelegten Zwetschgen.
Am zweiten Weihnachtstag marschierten Grethe und Klara schnurstracks zu den Klingers, um zu sehen, was es dort zu Weihnachten gegeben hatte. Lèène zeigte stolz das neue Wollkleid, das ihre Mutter für sie geschneidert hatte und dessen modische Knöpfe aus echtem Perlmutt schimmerten. Das