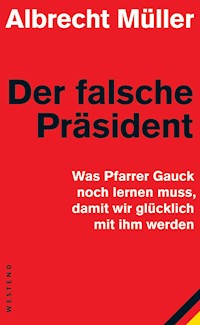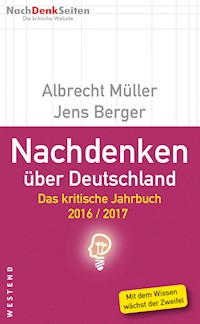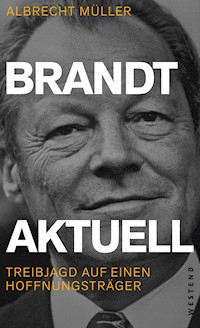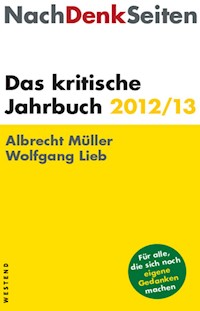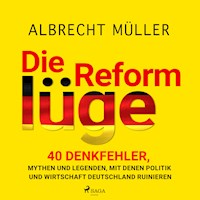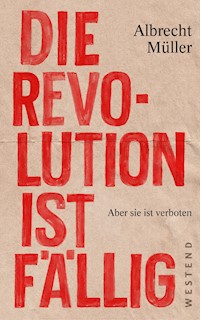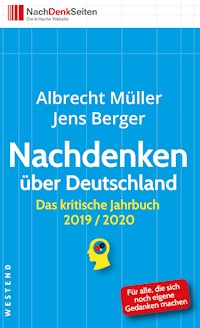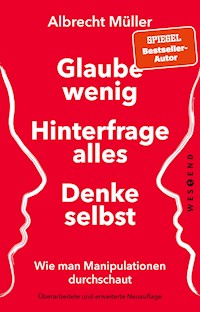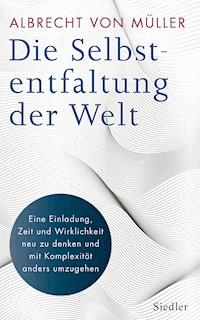7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Viele Wähler schließen mit der Politik ab, denn diese wird zunehmend über ihre Köpfe hinweg gemacht. Damit die Menschen trotzdem schlucken, was man ihnen vorsetzt, beeinflussen parteiische Experten und gezielte Kampagnen massiv die öffentliche Meinung. Albrecht Müller deckt auf, wer diese Kampagnen steuert und wie wir manipuliert werden. Ein kritisches Buch für kritische Bürger, das die Lust am Zweifel weckt – eine Anleitung zum Selberdenken, die auch verrät, woran wir erkennen, dass wir manipuliert werden sollen, und wo und wie wir uns noch zuverlässig informieren können. Meinungsmache von Albrecht Müller: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Ähnliche
Albrecht Müller
Meinungsmache
Wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Anke
Vorbemerkung des Autors zu unser aller Betroffenheit
Seit meiner Studienzeit beobachte ich das politische Geschehen und dabei insbesondere die Wege politischer Meinungsbildung und ihre Bedeutung für politische Entscheidungen. Als Student der Nationalökonomie habe ich mich damit beschäftigt, welche Wirkung Sprache in der Wirtschaftspolitik als Träger von Vorurteilen hat, und außerhalb meines Fachbereichs damit, welche Bedeutung der Propaganda beim Niedergang der Weimarer Republik zukam. Später musste ich beruflich die Wege der Meinungsmache beobachten und selbst – mit anderen zusammen – Strategien der Meinungsbeeinflussung entwickeln. Als Redenschreiber des Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller in den Jahren 1968 und 1969, danach als Verantwortlicher für Willy Brandts Wahlkampf und dann als Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt bei Brandt und Schmidt war ich ständig mit diesem Sujet befasst.
Ich bin also persönlich geprägt und beruflich vorbelastet, so könnte man sagen, ich bin sozusagen zu einem Spezialisten der Beobachtung von Meinungsbildung und zu einem Kenner der Meinungsbeeinflussung geworden. Ich habe solche Vorgänge nicht nur miterlebt, sondern aktiv mitgestaltet. Die Ostpolitik der Regierung Willy Brandt zum Beispiel hätte ohne eine eigene Öffentlichkeitsarbeit und die dahinterstehenden Strategien der Meinungsbildung gar nicht mehrheitsfähig werden können; Voraussetzung dafür waren Überlegungen zu den Prozessen der Meinungsbildung in einem Volk, das bis zum Mauerbau in Kategorien der Ost-West-Konfrontation und im Denken des Kalten Krieges verfangen war. Die Ostpolitik in den Köpfen und Herzen unseres Volkes zu verankern war eine der Hauptaufgaben Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre, als ich für die Öffentlichkeitsarbeit der damaligen SPD und ihres Vorsitzenden, Bundeskanzler Brandt, verantwortlich war.
Immer wieder waren schon damals die Kämpfe um politische Entscheidungen auch zugleich Kämpfe um die Meinungsführerschaft, also um die Prägung der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung, also der Meinung unter Multiplikatoren, vor allem der Medien. Ausbau der Kernenergie? Kindergeld oder Kindersteuerfreibeträge? Steuersenkung oben oder unten? Gibt es eine Raketenlücke? Sind die SS-20-Raketen der Sowjetunion eine Bedrohung oder nicht? Nachrüstung ja oder nein? Wichtige politische Entscheidungen waren auch damals Gegenstand öffentlicher Debatten.
Später, Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre, regte die von mir geleitete Planungsabteilung des Bundeskanzleramts beim damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt an, dass es um der Erhaltung der demokratischen Meinungsbildung willen wichtig sei, sich der Kommerzialisierung des Fernsehens und der Vermehrung der Programme zu widersetzen, sie jedenfalls nicht mit öffentlichen Finanzen zu fördern. Das zusammen mit Freunden initiierte Internetprojekt »www.NachDenkSeiten.de« setzt den Kampf um eine einigermaßen demokratische Willensbildung und um Aufklärung fort. »›NachDenkSeiten‹ wollen hinter die interessengebundenen Kampagnen der öffentlichen Meinungsbeeinflussung leuchten und systematisch betriebene Manipulationen aufdecken«, heißt es in der Begründung für den Start dieser kritischen Internetseite.
Wie auch immer – ich habe gelernt zu beobachten, welchen Einfluss Meinungsmache und Meinungsbildung auf politische Entscheidungen haben. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen komme ich zu fünf Feststellungen:
Erstens: Meinung macht Politik. Die öffentliche Meinung ist oft maßgeblich für die politischen Entscheidungen.
Zweitens: In vielen Fällen bestimmt allein die veröffentlichte Meinung, also die von den tonangebenden Personen, Gruppen und Medien mehrheitlich vertretene Meinung, die politischen Entscheidungen.
Drittens: Meinung kann man machen. Das wissen auch jene, die zur Durchsetzung ihrer Interessen politische Entscheidungen bestimmen wollen.
Viertens: Wer über viel Geld und/oder publizistische Macht verfügt, kann die politischen Entscheidungen massiv beeinflussen. Die öffentliche Meinungsbildung ist zum Einfallstor für den politischen Einfluss der neoliberalen Ideologie und der damit verbundenen finanziellen und politischen Interessen geworden. In einer von Medien und Geld geprägten Gesellschaft ist das zum Problem der Mehrheit unseres Volkes geworden, zum Problem des sogenannten Mittelstands und vor allem der Arbeitnehmerschaft und der Gewerkschaften, denn diese Mehrheit und ihre Interessen werden zunehmend kaltgestellt. Das erklärt die breite und wachsende Kluft zwischen den Interessen der Mehrheit und den von oben eingeleiteten politischen Entscheidungen.
Fünftens: Die totale Manipulation ist möglich. Die gleichgerichtete Prägung des Denkens vieler Menschen ist möglich.
George Orwell schrieb in seinem Roman »1984«: »Und wenn alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten – wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten –, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit.«
Wenn Sie diese Beobachtung von George Orwell gelegentlich zu Rate ziehen, werden Sie vieles, was um uns herum vorgeht, um vieles besser verstehen, als wenn Sie nach objektiven, in der Sache liegenden Erklärungen von für Sie rätselhaften Vorgängen suchen. Diese Mühe ist in der Regel nämlich müßig, denn das, was wir täglich hören und sehen und was uns als demokratisch gesonnene Staatsbürger häufig das Leben so schwer macht, sind in Wahrheit Mythen, Legenden und Lügen. Sie bestimmen in weitem Maß die öffentliche Debatte und damit auch die politischen Entscheidungen, die sich massiv auf unsere konkrete Lebenssituation am Arbeitsplatz, bei der sozialen Absicherung oder im Alter auswirken. Sie berühren und betreffen ganz unmittelbar unseren Alltag. Wenn Sie die Wirkung perfekter Meinungsmache durchschauen, dann werden Sie auch verstehen, dass wir als Steuerzahler so lautlos die Wettschulden derer bezahlen, die sich auf den internationalen Finanzmärkten verspekuliert haben und das Casino so weiterbetreiben, als wäre nichts geschehen.
Einführung
Jeder dritte Deutsche hat kein Vertrauen mehr in die demokratische Staatsform, in Ostdeutschland sind es sogar 53 Prozent.[1] Das hat Konsequenzen: Das Interesse an Politik schwindet. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 lag bei 44,4 Prozent – und war die bisher niedrigste auf Bundes- und Landesebene. Der dann weiterregierende Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) ist von gerade mal 15,7 Prozent der Wahlberechtigten gewählt worden. Auch bei anderen Wahlen geht es mit dem Interesse der Wähler bergab; im Januar 2009 in Hessen von 64,3 auf 61 Prozent und davor in Hamburg von 68,7 auf 63,5 Prozent, zur Wahl des Oberbürgermeisters in Kiel am 15. März 2009 gingen gerade mal 36,5 Prozent der Wahlberechtigten und zur Europawahl 2009 nur 43,3 Prozent. Ein Tiefpunkt. Fast überall gibt es historisch niedrige Wahlbeteiligungen.
Die meisten Parteien verlieren Mitglieder, zum Teil massiv. Die SPD ist von über einer Million auf weniger als die Hälfte geschrumpft, der CDU geht es nicht viel besser. Nur noch 34 Prozent sind zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung.[2] Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wenden sich von der Politik ab.
Sie tun dies, weil sie sich ohnmächtig fühlen und weil sie die politischen Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen können oder sogar als gegen sich gerichtet sehen. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die den Nerv der demokratischen Kultur berührt. Ich will in diesem Buch einer wichtigen Ursache des Unbehagens und des Gefühls der Ohnmacht und der Resignation nachgehen: dem Zugriff mächtiger Personen und Gruppen auf das Denken und die Meinung anderer – auf das Denken und die Meinung der Mehrheit.
Wir alle sind auf den Austausch von Gedanken mit anderen Menschen angewiesen, in einer arbeitsteiligen Welt sowieso. Beim Erkennen und Bewerten von Sachverhalten orientieren wir uns an den Urteilen anderer. Das fängt im Alltag schon bei relativ einfachen Fragen an: Wir tauschen uns über die Qualität von Büchern und Kinofilmen aus. Wir fragen andere nach der Qualität der Schulen in unserem Umfeld, wenn die Einschulung unserer Kinder oder Enkel bevorsteht. Erst recht sind wir bei komplexeren Fragen auf das Urteil von Fachleuten und Instituten angewiesen, denen wir vertrauen: zum Beispiel wenn es um die Chancen oder Gefahren der Kernenergie geht, um die Gentechnik oder die Beurteilung wirtschaftlicher Zusammenhänge. Wollen wir zum Beispiel die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank beurteilen, dann schaffen wir das kaum auf der Basis eigener Studien.
Nicht zu allem sich selbst ein Urteil bilden zu können und sich an anderen zu orientieren ist also gängige Praxis, ja sogar unumgänglich. Es ist auch ökonomisch sinnvoll, sich auf die Gedankenarbeit anderer zu verlassen. Dazu gibt es seit Menschengedenken Institutionen, die das Denken geprägt haben: Kirchen zum Beispiel und Hochschulen – von den alten Ägyptern über die Griechen bis zu den mittelalterlichen Universitäten.
Heute werden wir allerdings auf vielen Feldern und in schnellem Rhythmus zum Opfer von bewusst angelegten Kampagnen der Meinungsbeeinflussung. Diese Kampagnen werden systematisch und strategisch geplant. Hinter ihnen steckt oft der Einfluss starker Personen und Gruppen, die entdeckt haben, dass sie ihre Interessen in der Politik durchsetzen beziehungsweise absichern können oder ihrem Einwirken auf die politisch handelnden Personen Nachdruck und Legitimität verleihen können, wenn es ihnen gelingt, die Meinung der Medien, der Multiplikatoren und möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger zu beeinflussen und so die politischen Entscheidungen zu prägen.
Durch gezielte Meinungsmache beherrschen heutzutage große Interessen mit teilweise feudalem Charakter das gesellschaftliche und politische Geschehen. Das geschieht in engem Schulterschluss mit der neoliberalen Bewegung, deren Glauben an die heilsame Wirkung von Privatisierung, Deregulierung, Entstaatlichung und Kommerzialisierung aller Lebensbereiche hierzulande mit gekonnter und gut organisierter Meinungsbeeinflussung in politische Entscheidungen umgesetzt wurde. Der Siegeszug der neoliberalen Ideologie wäre ohne begleitende massive Propaganda nicht möglich gewesen.
Umso erstaunlicher ist es, dass sich viele Menschen der Fremdbestimmung entziehen. So ist Umfragen zufolge eine große Mehrheit immer noch gegen die Auflösung der sozialen Sicherheit und für einen solidarischen Staat; eine große Mehrheit war gegen Hartz IV und gegen die Rente mit 67; und ist für die Einführung von Mindestlöhnen. Wir befinden uns also in einer Phase, wo die herrschende Politik und die Meinungsmacher bei wichtigen Fragen gegen einen beachtlichen Teil des Volkes stehen, manchmal sogar gegen die Mehrheit. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Darauf setzen die Meinungsführer.
Wie wir ganz konkret durch Meinungsmache manipuliert werden und wie damit Politik gemacht wird, das illustrieren die folgenden Beispiele. Das Muster ist stets dasselbe: Unser Vertrauen in Experten, in Wissenschaftler, in Medien und in politische Parteien wird missbraucht. Das fängt bei einfachen Dingen an – eine nur kleine wirtschaftliche Belebung wird von den als unabhängig geltenden Professoren zum Boom erklärt, und viele Menschen glauben das. Es wird behauptet, die Agenda 2010 sei ein Erfolg, der Generationenvertrag trage nicht mehr, Altersarmut sei unabwendbar, wenn man nicht privat vorsorge, und so weiter … Und wir glauben mehr und mehr an diese Botschaften, weil fast alle dasselbe sagen und schreiben und senden. Es wird behauptet, die Finanzkrise komme aus Amerika und sei sozusagen überraschend über uns gekommen; es wird gesagt, wir müssten alle Banken retten, denn sie seien systemrelevant. Wir glauben es, weil die Verantwortlichen die Fakten über die hausgemachte Spekulation und die unseriösen Bankgeschäfte verschweigen und wir uns selbst nur schwer ein Urteil bilden können. Und auf der Basis dieser Meinungsmache zahlen wir Milliarden. Hunderte von Milliarden.
Man mutet uns auch die wendige Korrektur gemachter Meinungen zu. Jahrelang hat man uns erzählt, Konjunkturprogramme seien Strohfeuer. Neuerdings verabschieden die Erzähler selbst Konjunkturpakete. Immerhin ein Fortschritt. Aber das Werk von Wendehälsen.
Meinungsmache und Manipulation sind seit Jahrhunderten geläufige Erscheinungen. In jüngster Zeit jedoch entfalten diese Kampagnen eine zerstörerische Wirkung, wie sich an gravierenden Fällen belegen lässt: die Auslieferung unserer öffentlichen Universitäten an die Wirtschaft, die Zerstörung des Vertrauens in die sozialen Sicherheitssysteme, die bewusst betriebene Verarmung des Staates, die Kommerzialisierung und Privatisierung unserer Medien, der Verkehrssysteme und kommunaler Versorgungseinrichtungen. Gespielt, gezockt und geplündert wird aber nicht nur im öffentlichen Bereich, geplündert wird zu Lasten der betroffenen Arbeitnehmer und zu Lasten der Gemeinschaft auch im Bereich der privaten Unternehmen. Deutschland im Ausverkauf. Auch die Unfähigkeit zu einer wirksamen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik folgt aus der systematischen Irreführung des Publikums. Systematisch hat man auch versucht, uns beizubringen, die traumhaften Renditen und Boni der von nahezu allen Regeln befreiten Finanzwirtschaft kämen auf anständige Weise zusammen und seien deshalb erstrebenswert. Jetzt zahlen wir Steuerzahler die Zeche. Die neoliberale Ideologie erweist sich über weite Strecken als Instrument zur Bedienung privater Interessen zu Lasten der Allgemeinheit.
Nach gängiger politischer Theorie sollten wir vor der Bedrohung und dem Verlust unserer Gedankenfreiheit geschützt werden; das ist schon in Artikel 5 des Grundgesetzes niedergelegt, der das Grundrecht auf Meinungsfreiheit festschreibt. Bei dem Versuch, uns eine eigene und von der Sache und unseren Erfahrungen geprägte Meinung zu bilden, sollten wir unterstützt werden von den politischen Parteien und den Medien. Sie sollten als grundgesetzlich verbriefte Stützen einer sachlichen Meinungsbildung fungieren, doch über weite Strecken sind sie selbst zu einem Teil der Propaganda geworden. Viele Journalisten stehen unter massivem Druck, denn die Kommerzialisierung vor allem des Fernsehens und des Hörfunks und der Konzentrationsprozess in den Medien werden von Medienkonzernen und Sendern dazu benutzt, die personelle Ausstattung der Redaktionen immer weiter herunterzufahren und gleichzeitig nur noch Gefälliges zu bieten.
Hinzu kommt, dass den Medien und den Journalisten heute Public-Relations-Agenturen und ähnlich orientierte Beratungsunternehmen gegenüber- und zur Seite stehen, die über große finanzielle Mittel und über die organisatorische Kapazität zur Gleichschaltung der Meinung verfügen. Diese Public-Relations-Agenturen und die damit verbundenen Beratungsunternehmen sind die eigentlichen Produzenten der Meinungsmache. Ihre Macht über die Medien ist groß – Journalisten, die sich dem Mainstream widersetzen, müssen damit rechnen, isoliert zu werden.
Unsere Demokratie befindet sich am Rand ihrer Existenz. Wichtige Voraussetzungen für das Gedeihen demokratischer Willensbildungsprozesse sind nicht mehr gegeben. Vor allem wird uns keine wirkliche Alternative geboten, die Chancen hätte, die politische Macht zu erringen.
Mit der Lektüre dieses Buches wird Sie vermutlich nicht nur Zorn über den Missbrauch Ihres Vertrauens erfassen. Sie werden beim Lesen auch mehr und mehr spüren, dass es Lust bereitet, sich nichts vormachen zu lassen, selbst zu denken und seinen Gedanken wieder eine Stimme zu geben. Sie werden spüren, dass es guttut, wieder zweifeln zu lernen.
I. Der Boden, auf dem Meinungsmache gedeiht
Kapitel 1
Ein verbreitetes Gefühl der Ohnmacht
Vermutlich war die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger noch nie so miserabel wie heute. Die politischen Entscheidungen erscheinen rätselhaft, schlecht und gegen das Volk gerichtet.
In den siebziger Jahren konnte man in der Sozialforschung immer wieder das Phänomen beobachten, dass eine überwiegende Mehrheit der Menschen die allgemeine wirtschaftliche Lage kritisch sah, während gleichzeitig ein ähnlich hoher Prozentsatz mit der eigenen wirtschaftlichen Lage zufrieden war. Heute gibt es diese Wahrnehmungslücke, die sogenannte Angstlücke, nicht mehr. Heute hat die Unzufriedenheit und Unsicherheit über die allgemeine Lage bei vielen Menschen eine reale Basis in ihrer persönlichen Lebenssituation:
Die Masseneinkommen stagnieren seit nunmehr 15 Jahren; seit 1995 sind sie real um 0,9 Prozent gesunken, während gleichzeitig die Spitzengehälter und die Einkommen aus Gewinnen und Vermögen mit einer Steigerung um 36 Prozent explodierten.[3] Die Kluft zwischen den Bezügen der Manager und jenen der Mitarbeiter der Unternehmen ist maßlos gewachsen. Die Vorstände von DAX-Unternehmen verdienten 1987 im Durchschnitt 14-mal so viel wie die Beschäftigten, 2006 44-mal so viel.[4]
Vor allem diese Extreme sind es, die viele Menschen aufwühlen. Sie selbst müssen reale Verluste hinnehmen und gleichzeitig hören, dass die Einkommen der Vorstände der DAX-Unternehmen wieder zweistellig gewachsen sind. Um 650 Prozent sind sie in den letzten 20 Jahren gestiegen. Oder sie lesen, dass der Gründer des Hedgefonds Paulson & Co. im Jahr 2007 3,7 Milliarden Dollar verdient hat.[5] Ohne Experte zu sein, kann man wissen, dass diese Einkommen nicht vom Himmel fallen, sondern auf irgendeine Weise von anderen bezahlt werden müssen.
Wie es sich auswirkt, wenn oben zugelegt und unten weggenommen wird, kann man an der sogenannten Lohnquote ablesen. Die Lohnquote[6], der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Bruttoinlandsprodukt, ist von 69,8 Prozent im Jahr 1982 auf 62,3 Prozent im Jahr 2007 gesunken.[7] Damit liegt die Lohnquote um mehr als neun Punkte niedriger als Mitte der siebziger Jahre, als sie 1974 den Spitzenwert von 71,4 Prozent erreichte. Hinter dieser statistisch erfassten Verschiebung der Einkommensverteilung verbergen sich zutiefst ungerechte Verschiebungen der Lebenschancen. Das spüren viele Menschen, und das deprimiert und empört sie.
Besonders betroffen sind jene, die in den sogenannten Niedriglohnsektor abgewandert sind. 2006 gehörten schon gut 22 Prozent zu den »Niedriglöhnern«, 43 Prozent mehr als 1995. Der Anteil der Beschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung ist in der gleichen Zeit von 58,6 Prozent auf 67,5 Prozent gestiegen, das heißt: Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung werden zusehends ausgegrenzt. Vor allem jüngere, gering Qualifizierte, Frauen und Ausländer/-innen beziehen Niedriglöhne. Auch im internationalen Vergleich hat sich die Lage in Deutschland wesentlich verschlechtert.[8]
Während sich die Löhne auf der einen Seite und Gewinne und Vermögenseinkommen auf der anderen markant auseinanderentwickeln, ist die Produktivität der Arbeitnehmer stärker gestiegen als ihre Löhne. Dabei könnten die Löhne und Gehälter mindestens im Rahmen der Produktivitätsentwicklung steigen, ohne dass dies einen volkswirtschaftlichen Schaden zur Folge hätte. Realität ist aber, dass die Einkommen seit nunmehr mindestens 15 Jahren von der Steigerung der Produktivität der Arbeitnehmer abgekoppelt sind. Und wie zum Hohn wird von einigen Wissenschaftlern und Medienvertretern gefordert, die Löhne sollten weiter sinken.
Als Reaktion auf die Verschlechterung der Lebensbedingungen und auf den Versuch, diese Entwicklung auch noch als alternativlos darzustellen, wachsen Ohnmacht und Wut.
Vielen Menschen geht es noch schlechter. Sie sind arbeitslos. Oder sie werden in schlechte Jobs abgeschoben, entweder in Minijobs oder in Leiharbeit. Viele müssen ein gesichertes Arbeitsverhältnis aufgeben, um dann für die gleiche Tätigkeit in einem prekären Arbeitsverhältnis wieder angeheuert zu werden – zu einem niedrigeren Lohn. Auch das wird von manchen als Fortschritt gefeiert. »Mehr Flexibilität«, heißt die Parole. Was »Mehr Flexibilität« praktisch heißt, erfahren die Leiharbeiter reihenweise in der Wirtschaftskrise. Sie werden als Erste entlassen. Was empfinden die Betroffenen, wenn ehemalige Minister wie Wolfgang Clement, die in ihrer Amtszeit die Leiharbeit gefördert haben, nach dem Abschied aus der Politik in die Dienste von großen Leiharbeitsfirmen eintreten und so von diesen labilen Arbeitsverhältnissen profitieren?[9]
Einige Politiker und Wissenschaftler haben schon vor zehn Jahren für den sogenannten Niedriglohnsektor zu werben begonnen. Und so sieht das Ergebnis aus: Minijobs, Ein-Euro-Jobs, 400-Euro-Jobs, Hartz-IV-Aufstocker – diese Entwicklung drückt auf das Lohnniveau auch jener Menschen, die noch in gesicherten Arbeitsverhältnissen stehen. Kein Wunder, dass die Armut zunimmt. Zugleich wächst die Sorge vor dem sozialen Abstieg. Das betrifft auch gut ausgebildete Menschen und Familien aus dem sogenannten Mittelstand. In den vergangenen 15 Jahren nahm die Zahl der Haushalte im mittleren Einkommensbereich um 14 Prozent ab.[10]
In einer Marktwirtschaft verschlechtert sich die Einkommensverteilung für die Mehrheit der Menschen, wenn die Verhandlungsmacht zwischen den Nachfragern nach Arbeit, den Arbeitnehmern, und den Anbietern von Arbeitsplätzen so ungleich verteilt ist wie in den letzten 20 Jahren. Das Sinken der Lohnquote zeigt das Ergebnis: Die Einkommensverteilung hat sich zu Lasten der Arbeitnehmer verschoben. In einer solchen Situation versucht die Politik normalerweise, die Verteilung über die Steuerpolitik ein bisschen zu korrigieren. Die verantwortlichen Politiker aber haben nach der Wahl vom September 2005 noch einen draufgesetzt und eine steuerliche Umverteilung zu Lasten der Schwächeren und der Mitte und zugunsten der Oberen betrieben: Nach der schon vorher beschlossenen und umgesetzten Senkung des Spitzensteuersatzes und der Streichung der Vermögensteuer, die bereits zu Zeiten von Kanzler Helmut Kohl vorgenommen wurde, folgten 2007 weitere Steuergeschenke an die Unternehmen. Zuvor wurden alle Normalverdiener und die Einkommensschwächeren – die Rentner, die Arbeitslosen, die Auszubildenden und die Studenten – durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer um drei Punkte zusätzlich belastet. Auch dies mussten die Wählerinnen und Wähler hinnehmen, obwohl sie in dieser Frage bei der Wahl 2005 betrogen worden sind.
Im Wahlkampf 2005 hatte die Union mit Angela Merkel als Spitzenkandidatin eine Mehrwertsteuererhöhung um zwei Prozentpunkte gefordert, die SPD hatte sich dagegen mit einer Kampagne gegen die »Merkelsteuer« gewehrt. Nach der Wahl war dann vom Widerstand gegen die Mehrwertsteuererhöhung keine Rede mehr. Sie wurde sogar um drei Prozentpunkte erhöht.
Auch dieses Manöver mussten die Menschen hinnehmen, ohne sich gegen den Betrug wehren zu können. Die Wahl war vorbei, und weder die Opposition noch die Medien übten harte Kritik an diesem Vorgang. Franz Müntefering setzte sogar noch einen drauf. Laut »Tagesspiegel« vom 29. August 2006 sagte er: »Wir werden als Koalition an dem gemessen, was in Wahlkämpfen gesagt worden ist. Das ist unfair!«
Man lässt uns unsere Ohnmacht spüren. Im konkreten Fall auch im Geldbeutel. Und nicht einmal die Medien artikulieren mehrheitlich unsere Betroffenheit und unsere Gefühle, im Gegenteil. Nach jeder schlimmen Tat hebt ein Sturm der Meinungsmache an: Es gebe keine Alternative! Und viele Menschen glauben tatsächlich, dass es so ist.
Wir registrieren die Beliebigkeit und Verantwortungslosigkeit der Regierenden. Sie sind zum Beispiel im Herbst 2007 fähig, einen kleinen Aufschwung zum Boom aufzubauschen und diesen vermeintlichen Erfolg den Reformen der Agenda 2010 zuzuschreiben. Und wenn es dann bergab geht wie im Frühjahr 2008, ist die internationale Finanzkrise daran schuld. Ein Tross von Meinungsmachern in den Medien, der Wissenschaft und den PR-Agenturen macht diese beliebigen Deutungen in allen Wendungen kritiklos mit.
Die wirtschaftspolitische Kompetenz der herrschenden Kreise steht auf tönernen Füßen. Wo gibt es in Regierung und Opposition jemanden, der sich in der Makroökonomie wie auch in der Theorie der Marktwirtschaft auskennt? Statt Fachkenntnis herrschen Ideologie und Phrasen und Stereotype. Eichel, der Sparkommissar. Steinbrück, der gute Hausvater. Merz, der Wirtschaftsfachmann. Eine Bierdeckelsteuerreform als Kompetenznachweis.
In der Finanzkrise lässt man uns unsere Ohnmacht besonders hart spüren. Jahrelang hat man uns zum Beispiel Sparen gepredigt. Wenn es um Ausgaben für eine bessere Bildung und für ein gutes soziales Netz ging, dann wurde um jede Milliarde geknausert. Jetzt werden weit über 100 Milliarden für eine einzige Bank und nicht einmal eine große, für die Hypo Real Estate (HRE) in München, bereitgestellt. Und die Brandstifter gebärden sich als Feuerwehrleute. Unser stummer Protest prallt ab an einer wohlwollenden Medienbegleitung, die jeden Winkelzug nachvollzieht. Wir erleben so, dass das Grundelement der Demokratie außer Kraft gesetzt wird. Wer gravierende Fehler macht, muss nicht mehr mit der Sanktion der Abwahl rechnen, wenn er oder sie die mächtigen Medien auf die eigene Seite zu ziehen vermag.
Wir müssen mit ansehen, wie unsere soziale Sicherheit innerhalb weniger Jahre ruiniert wird. Wenn wir »Hartz IV« hören, denken wir vor allem an die direkt Betroffenen, an die schon arbeitslos Gewordenen. Hartz IV hat jedoch für nahezu alle, die noch Arbeit haben, gravierende Folgen: Ihnen wird nämlich signalisiert, dass sie im Falle der Arbeitslosigkeit ein Jahr (bei Älteren ein bisschen länger) Arbeitslosengeld I erhalten und dann auf das Niveau des Arbeitslosengeldes II entlassen werden. Damit hat dieses soziale Sicherungssystem die Funktion einer Versicherung verloren. Das widerspricht den berechtigten Erwartungen der meisten Menschen, die davon ausgegangen sind, dass die Arbeitslosenversicherung zwar nicht ewig trägt, aber dennoch den Charakter einer Versicherung hat, die sie finanziell zumindest so weit auffängt, dass sie sich einigermaßen in Ruhe einen neuen Job suchen können. Diese Sicherheit ist weg. Das prägt das Lebensgefühl der Menschen, und es prägt ihr Verhalten als Arbeitnehmer und als Gewerkschafter im Betrieb oder bei Tarifauseinandersetzungen.
Mit Hartz IV ist der Arbeitnehmerschaft der Schneid abgekauft worden. Das ist die eigentliche Funktion dieser Gesetze. Die Leute spüren ihre Ohnmacht; sie fühlen sich von diesem Staat unfair behandelt.
Obwohl alle Umfragen seit Jahrzehnten erkennen lassen, dass eine Mehrheit solidarische Lösungen bevorzugt, ist den meisten Menschen die soziale und solidarisch organisierte Sicherheit vor den Risiken des Älterwerdens und der Arbeitslosigkeit genommen worden. Offenkundig spielt der Wille des Volkes hier keine Rolle. Es entscheidet der Wille der Versicherungswirtschaft und der Banken.
Die Mehrheit des Volkes und die Mehrheit der Betroffenen sind auch dagegen, die Altersgrenze für den Renteneintritt auf 67 Jahre zu erhöhen. Fünfzigjährige werden in die Arbeitslosigkeit geschickt. Von den über Sechzigjährigen sind nur noch weniger als 20 Prozent in Arbeit.[11] Die anderen sind arbeitslos, ausgebrannt, krank oder im Vorruhestand – aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls gibt es wenig Arbeit für Menschen über 55, für die über 60 noch viel weniger und für über 65-jährige schon gar nicht. In dieser Situation das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen ist ein eindeutiges Signal zur Förderung der Privatvorsorge.
Wieder lässt man uns unsere Ohnmacht spüren. Logik und Lebenserfahrung, die Kosten, die Sicherheit und die Rendite – alles hätte dafür gesprochen, die gesetzliche Rente zu stabilisieren und auszubauen. Das Gegenteil geschieht, unfreiwillig subventioniert von den Steuerzahlern. Niemand hat uns gefragt, ob wir mit unseren Steuergeldern die Riesterförderung von Frau X. und Herrn Y. bezahlen wollen. Niemand hat den Geringverdiener, der sich nie im Leben ausreichend zu riestern wird leisten können, gefragt, ob er mit einer höheren Mehrwertsteuer die Riesterförderung der Besserverdienenden bezahlen will.
Wir erleben: Der Kommerz macht vor nichts halt – nicht vor der Versorgung von Kranken und Alten, nicht vor unseren Kindern, nicht vor der Schule. Ein Viertel der Schüler muss Nachhilfestunden nehmen, es ist ein Milliardenmarkt entstanden. Es ist das gleiche Bild wie an vielen anderen Stellen: Wenn der Staat seinen Aufgaben nicht nachkommt, weil ihm die Mittel genommen worden sind, macht die Privatwirtschaft Gewinne.
Wir sehen: Die Grundlinien der neoliberalen Ideologie und die daraus folgenden Forderungen und Rezepte – Privatisierung, Deregulierung und Entstaatlichung – werden gegen den erkennbaren Willen und das Interesse der Mehrheit durchgesetzt.
Die Mehrheit der Deutschen ist offensichtlich auch gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn. Trotzdem würde dieses Projekt rücksichtslos durchgezogen – vermutlich weil Einzelne daran verdienen wollen –, hätte nicht die Finanzkrise zum vorläufigen Anhalten gezwungen.
Die Mehrheit der Menschen hat nichts davon, wenn die Wasserwerke und die kommunale Abfallwirtschaft, wenn Stadtwerke und Schulen, Hochschulen und Verwaltungen privatisiert oder teilprivatisiert werden. In den meisten Gemeinden und Kreisen, die solche Projekte verfolgen, werden die betroffenen Menschen nicht um ihre Meinung gefragt. In der Regel werden die zugrundeliegenden Verträge mit privaten Unternehmen nicht offengelegt. Was ist das für eine Demokratie? Da wird Volksvermögen verscherbelt, und wir erfahren nicht einmal, zu welchem Preis.
Bei wesentlichen Entscheidungen zur Gestaltung unserer Gesellschaft wird heute gegen den Willen des Volkes regiert. Nach Sinn und Zweck wird häufig gar nicht gefragt, sondern es werden irgendwelche von außen vorgegebenen Pläne umgesetzt, weil sie von angeblichen Experten empfohlen werden oder auch nur weil »Modernisierung« zu betreiben international Mode geworden ist.
Sind Sie gefragt worden, ob unsere Universitäten der Wirtschaft überantwortet werden und in den Kontrollgremien von niemandem gewählte Wirtschaftsmanager das Sagen haben sollen? Dabei sind doch Sie es, sind wir alle als Steuerzahler es, die die Universitäten finanzieren. Haben die Mitglieder der Parteien unter sich, auf regionalen Parteitagen oder mit uns als Bürgerinnen und Bürger darüber gesprochen, ob wir es für gut und sinnvoll halten, Studiengebühren einzuführen? Gab es eine öffentliche Debatte darüber, ob Sie und unsere Jugend Studienabschlüsse in Form der angelsächsischen Bachelor- und Master-Abschlüsse wollen? Ist das wirklich eine Verbesserung, oder war unsere Form des Studiums und der Abschlüsse mit Diplomen und Staatsexamen besser? Zwingt uns die internationale Vergleichbarkeit zu dieser Lösung? Öffentliches Thema waren alle diese Fragen nicht.
In den Parteien und meist auch in den Parlamenten gibt es keine Auseinandersetzung mehr darüber. Gerade in der Hochschulpolitik liegt das daran, dass einflussreiche Meinungsmacher wie die Bertelsmann Stiftung über Jahre hinweg für Studiengebühren und für die unternehmerische Hochschule getrommelt haben. Meinungsmache von außen hat die innere Willensbildung in unserem Volk ersetzt.
Sicher, man könnte einwenden, dass wir in einer parlamentarischen Demokratie leben. Wir wollen diesen Hinweis auch ernst nehmen. In vielen Fällen ist es gut, dass wir den Filter des Parlaments haben. Doch damit kann auch Missbrauch betrieben werden: In einer parlamentarischen Demokratie zu leben darf nicht dazu führen, dass die gewählten Personen sich einer Ideologie verpflichtet fühlen, die den Interessen der Bevölkerung entgegensteht. Dieser grundlegende Widerstreit zwischen den grundlegenden Vorstellungen der Mehrheit der Menschen und der angeblich alternativlosen Grundlinie der neoliberalen Bewegung ist zu einem ernsthaften Problem geworden. Praktisch ist die herrschende neoliberale Ideologie nicht zu versöhnen mit den Vorstellungen der Mehrheit von einer einigermaßen solidarisch gestalteten Gesellschaft.
Wir könnten besser miteinander auskommen, besser leben, solidarischer und auch effizienter sein, wenn uns die Ideologie der neoliberalen Bewegung nicht so im Griff hätte – Privatisierung, Deregulierung, Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, Markt und Wettbewerb auch da, wo diese Prinzipien nichts zu suchen haben. Unsere Ohnmacht ist nicht gottgegeben. Sie ist das Ergebnis der politischen Vorherrschaft von Leuten, die nichts kennen außer ihrem Glaubensbekenntnis – und ihrem persönlichen Vorteil.
Unsere Eliten reagieren auf die Kluft, die zwischen ihrem Denken und ihren Absichten auf der einen Seite und dem erkennbaren Willen der Mehrheit der Menschen auf der anderen herrscht, auf zweierlei Weise:
Erstens: Sie versuchen einen Teil der Betroffenen in die politische Abstinenz abzudrängen. Das gelingt in beachtlichem Maße, wie sich am Niedergang der politischen Beteiligung zeigt.
Zweitens: Einen Teil der Betroffenen versuchen sie auf ihre Seite zu ziehen, indem sie Propaganda machen und die tatsächliche Kluft zwischen ihrer Ideologie und dem Widerstand der Menschen zu einem Vermittlungsproblem erklären. Und sie steigern sich in die durch keinerlei Fakten erschütterbare Gewissheit, das einzig Richtige zu tun, wie die Zukunft schon noch weisen werde.
So wird die Politik gegen die Interessen des Volkes zum Selbstzweck überhöht: »Für die Investoren ist entscheidend, dass es der Regierung gelungen ist, ein Projekt gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchzusetzen«, erklärte Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, zur Verabschiedung der Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre.[12] Gegen die Mehrheit der Bevölkerung Politik zu machen wird zur Tugend erklärt, und wer das kritisiert, wird des Populismus bezichtigt. Populisten sind dann alle, die den Wünschen des Volkes eine Stimme geben. Das kann sogar Politiker aus dem Lager der etablierten Parteien treffen wie Jürgen Rüttgers, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, wenn diese sich ein soziales Image zu geben versuchen. Vor allem aber werden die Linken unter den Dauerverdacht des Populismus gestellt. Oskar Lafontaine ist solch ein dankbares Objekt, das in jeder zweiten Zeitungszeile als Watschenmann herhalten muss.
Dass die Forderungen nach einer faireren und gerechteren Gesellschaft immer mehr Menschen bewegen, so dass bereits von einem Linksruck gesprochen wurde, irritiert die herrschende Gruppe nur wenig. Unbeirrt bleiben sie bei dem altbewährten Erklärungsmuster: Die Menschen seien vom Populismus verführt und von der Schwierigkeit der Materie überfordert. Nicht die Sache an sich sei das Problem, es gebe lediglich ein Vermittlungsproblem, behaupten die Merkels, die Kauders, Schäubles, Steinmeiers, Münteferings, Becks und Steinbrücks. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben zur Erforschung der Reformwiderstände. Die Untersuchung mit dem Titel »Psychologie, Wachstum und Reformfähigkeit« wurde vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim (ZEW) zusammen mit Vertretern der Universität Salzburg und der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität erstellt und befasst sich mit der Frage, warum die Reformpolitik von der Mehrheit der Bevölkerung nicht befürwortet wird.
Hier wird eines der Kernprobleme sichtbar: Die herrschenden Kreise reagieren auf die Ablehnung einer Serie von politischen Maßnahmen und auf die Ablehnung der politischen Grundlinie nicht mit Reflexion und Nachdenken, sondern mit Verachtung des Volkes. Sowohl um dem Willen der Mehrheit zu entsprechen wie auch aus der Sache heraus erscheint eine Kurskorrektur notwendig. Doch die Eliten in Politik und Wirtschaft machen stur weiter und vergeben lieber Forschungsaufträge, um ermitteln zu lassen, wie man das Volk rumkriegen kann. Die Steuerzahler bezahlen, was zu ihrer Manipulation entwickelt wird. Auf der Strecke bleibt der Glauben an die demokratische Verfassung.
Die heute tonangebenden »Eliten« stehen nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Sie nehmen den Willen des Volkes nicht ernst und eine Reihe von Versprechen unseres Grundgesetzes auch nicht – das Demokratieversprechen nicht, das Sozialstaatsgebot nicht, das Gebot, Meinungspluralität zu sichern, nicht. Der Verfassungsschutz müsste sich mit diesen Meinungsmachern beschäftigen: mit den Matadoren der neoliberalen Bewegung, auch mit den Spitzen unseres Staates, mit der »Bild«-Zeitung, mit der Bertelsmann Stiftung, mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und den vielen anderen Initiativen, die einzig der Agitation zugunsten mächtiger Einzelinteressen dienen.
Im Zusammenhang mit dem Versprechen der Sozialstaatlichkeit in Artikel 20 des Grundgesetzes wird ein Widerstandsrecht zugesagt:
Artikel 20 Grundgesetz
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Was hier leider nicht gesagt wird, ist, wie wir das anstellen sollen. Auch in klugen Kommentaren des Grundgesetzes ist keine praktische Handlungsanweisung zu finden. Also sind wir auf uns selbst gestellt. Die Möglichkeit zum Widerstand liegt unter Umständen genau da, wo die Herrschenden ansetzen, um die Mehrheit der von ihnen Drangsalierten auf ihre Seite zu ziehen: im Versuch, Einfluss zu nehmen auf die öffentliche Meinungsbildung, im Aufbau einer Gegenöffentlichkeit.
Kapitel 2
Meinungsbildung: Ideal und Wirklichkeit
In der Theorie funktioniert die demokratische Meinungsbildung wie folgt: Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, und nach Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes wirken Parteien an der Willensbildung des Volkes mit. Das Volk ist der Souverän, Volkes Wille steht über allem. Der Wille des Souveräns muss sich zu allen die Politik und den Staat betreffenden Fragen aber erst bilden. Hierbei mitzuwirken, dazu sind die Parteien durch das Grundgesetz ausdrücklich aufgerufen. In der modernen Massendemokratie gibt es weitere »Faktoren« und »Medien« der Meinungsbildung (wie das Bundesverfassungsgericht das nennt): unter anderem die Gerichte (als dritte Gewalt), die Medien (gerne auch vierte Gewalt genannt), außerdem gesellschaftliche Gruppen wie die Wissenschaft, die Verbände, die Kirchen und mehr oder weniger organisierte Interessen. Den im Zusammenwirken dieser Faktoren gebildeten Willen umsetzen sollen die von den Parteien ausgewählten und vom Volk gewählten Abgeordneten in der Volksvertretung, dem Parlament. Die Mehrheit der Parlamentarier wiederum wählt, kontrolliert und bestimmt die Regierung und entscheidet über die Politik der Exekutive. Anders als etwa in der Schweiz sind die Elemente direkter Demokratie in Deutschland nicht sehr ausgeprägt. Das Parlament hat nach den Vorstellungen des Grundgesetzes eine Vertretungs- und Filterfunktion. Stimmungen, Vorurteile oder gar der Volkszorn sollen nicht unmittelbar in politisches Handeln durchschlagen.
Das Kernelement der Willensbildung ist die Meinungsfreiheit. Und da die kollektive Meinungsbildung in einer Massendemokratie nicht mehr wie im alten Griechenland auf dem Marktplatz stattfinden kann, sind Presse- und Rundfunkfreiheit, die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, die Freiheit, sich in Vereinen und Verbänden zusammenzuschließen, und vor allem auch die Koalitionsfreiheit, also der Zusammenschluss zu Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, wichtige Errungenschaften der Demokratie und des demokratischen Verfassungsstaats.
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben nach den bitteren Erfahrungen mit der Rolle der Medien beim Niedergang der Weimarer Republik Wert darauf gelegt, dass es Meinungspluralität und damit unabhängige Medien gibt. Das postuliert Artikel 5 des Grundgesetzes.
Im Großen und Ganzen funktionierte die parlamentarische Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland recht gut. Es gab eine einigermaßen pluralistische Meinungs- und Willensbildung, nicht perfekt, aber doch im Sinne des Grundgesetzes. Es gab Parteien, die für ihre unterschiedlichen Konzepte warben und sie in Wahlen zur Abstimmung stellten, es gab eine Vielzahl und vor allem auch eine gewisse Vielfalt der Medien, es gab eine zwar meist konservativ geprägte, aber unabhängige Wissenschaft, das Wort der Kirchen fand Gehör, Interessenverbände wurden als solche wahrgenommen und beurteilt, die Gewerkschaften waren mächtig genug, um der Arbeitgeberseite einigermaßen Paroli zu bieten. Insgesamt kein Glanzbild, aber besser als je zuvor – und besser als heute.
Es standen in der Geschichte der alten Bundesrepublik viele grundlegende Entscheidungen an, über die in der Gesellschaft heftig debattiert und gerungen wurde. Das gilt für die Westorientierung der Bundesrepublik unter Adenauer genauso wie für die neue Ostpolitik Willy Brandts. An diesem letzteren Wechsel des politischen Paradigmas lässt sich beispielhaft skizzieren, wie eine pluralistische Meinungsbildung funktioniert:
Schon in den fünfziger Jahren und dann insbesondere nach dem Bau der Mauer war einigen Verantwortlichen – namentlich Willy Brandt und Egon Bahr, Helmut Schmidt und Herbert Wehner in der SPD, Richard von Weizsäcker und Walter Scheel in CDU und FDP – klargeworden, dass mit der Westpolitik und der Westbindung allein die Frage der deutschen Einheit nicht zu lösen sein würde. Gleichzeitig gab es in den Parteien und außerhalb, zum Beispiel in Gewerkschaften und in den Kirchen, ein wachsendes Unbehagen an der Stagnation und Unbeweglichkeit der damals von der Union verantworteten Außen- und Deutschlandpolitik, vor allem an der Konfrontation von West und Ost.
Die Willensbildung für die neue Ostpolitik spielte sich innerhalb der gewählten Parlamente wie auch außerhalb ab – in den Parteien und Verbänden und gesellschaftlichen und privaten Zirkeln. In einigen Medien und Teilen der Parteien gab es damals heftige Gegenwehr gegen eine Neuorientierung. Die Debatte für eine Veränderung der bisherigen Linie war aber so virulent, dass ab 1966 auch auf der Ebene der Bundesregierung – damals eine große Koalition mit Kurt Georg Kiesinger als Bundeskanzler – die Weichen in Richtung einer neuen Politik gestellt werden konnten. Willy Brandt, den das Scheitern der Konfrontationspolitik seit den fünfziger Jahren umtrieb, war Außenminister geworden, die neue Linie war mit dem Koalitionspartner, der Union, grob ausgehandelt. Dort waren die Widerstände dennoch groß. Dass sich die Union später dann doch unter Schmerzen zu einer Veränderung ihrer politischen Linie durchrang, war auch von der öffentlichen Debatte in den Parteien, in den Kirchen, in konservativen Kreisen und in der Wirtschaft, die Interesse am Osthandel hatte, geprägt.
Doch dieser Paradigmenwechsel geschah nicht ohne Widerstände. Nach dem Kanzlerwechsel 1969 von Kiesinger (CDU) zu Brandt (SPD) gab es gerade wegen der Ost- und Reformpolitik einen massiven Versuch der Meinungsmache: Die Ostpolitik wurde umgedeutet in die Unterstellung, die Regierung Brandt wolle mit der Verständigung mit dem Osten auch den dortigen Sozialismus übernehmen. Doch trotz massiven Einsatzes finanzieller Mittel war diese Kampagne nicht erfolgreich; die damaligen Anhänger der sozialliberalen Koalition dominierten die Debatte inhaltlich, wobei auch ihre starke emotionale Beteiligung half, so dass sich dieser Versuch der Meinungsmache schließlich gegen die Verursacher selbst wendete.
Sowohl für die sicherheitspolitische Debatte wie auch für die beginnende Reformdebatte der sechziger und siebziger Jahre waren Impulse aus der Mitte der Gesellschaft, den Gewerkschaften, den Verbänden und Parteien wichtig. Die ungerechte Einkommens- und Vermögensverteilung, der Muff an den Hochschulen, die Undurchlässigkeit des Schulsystems, die skandalösen Spekulationsgewinne auf den Grundstücksmärkten, die ungelösten Probleme des modernen Städtebaus, die ökologische Belastung in Regionen wie dem Ruhrgebiet, ein verstaubtes Strafrecht und ein als inhuman erkannter Strafvollzug, eine einseitige Abtreibungsgesetzgebung, das Verdrängen der Nazivergangenheit durch die Älteren, die Gefahren kriegerischer Konflikte mit Atomwaffen und Raketen hochgerüsteter Gegner in Ost und West – dies und vieles mehr waren Themen von lebendigen Debatten in Studentenkreisen und Zirkeln von Wissenschaftlern, bei Gewerkschaften, in den Betrieben und in bildungsbürgerlichen Kreisen wie auf vielen Ebenen der Parteien, hier wiederum insbesondere der SPD, die bis Dezember 1966 auf Bundesebene in der Opposition geblieben war. Auch im konservativen Lager wurde in den sechziger und siebziger Jahren um Positionen etwa zur Ostpolitik oder zur Mitbestimmung gerungen.
In den Ortsvereinen und Kreisverbänden gab es damals inhaltliche Debatten auch jenseits der unmittelbar interessierenden Kommunalpolitik. Die Steuerreformkommission und die Bodenreformkommission der SPD zum Beispiel waren nicht zuerst von der Parteiführung angestoßen, sondern entsprachen dem Wunsch vieler Mitglieder.
In der FDP gab es eine bemerkenswerte Debatte um das Freiburger Programm von 1971, mit dem die Liberalen einen Richtungswechsel hin zu einer sozialen Verpflichtung der Wirtschaftsordnung vollzogen. Wer sich vor Augen hält, wie die FDP in einer Zeit wirtschaftlicher Verwerfungen wie heute, da eine erneute Positionsbestimmung dringend erforderlich wäre, von der Abwesenheit einer wirklichen inhaltlichen Debatte geprägt ist, erkennt, was sich in der Zwischenzeit verändert hat.
Auch wichtige Impulse für den Umweltschutz kamen in den sechziger und siebziger Jahren nicht nur von den politischen Spitzen, sondern aus den verschiedensten Ecken, zum Beispiel aus den Wirtschaftswissenschaften: In der Nationalökonomie waren die theoretischen Ansätze Jahrzehnte vorher in den sogenannten Welfare Economics formuliert worden. Lange vor der öffentlichen umweltpolitischen Debatte wurde hier die Vorstellung entwickelt und formuliert, dass es bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen externe Effekte geben könne (»external economies« und »diseconomies«) . Wenn ein Lkw von Rotterdam nach Basel fährt, verursacht er Kosten, die nicht beim Spediteur anfallen, sondern bei den Menschen, die entlang der befahrenen Strecke wohnen, und bei uns allen, die wir mit unseren Steuern für die Straßen aufkommen und unter der Belastung des Klimas leiden. Dass der Markt in diesen Fällen versagt und deshalb staatliche Entscheidungen getroffen werden müssen, die die externen Effekte in die privaten Kalkulationen zwingen, war unter Ökonomen, die sich mit diesen Fragen beschäftigten, unstrittig. In den Sechzigern erreichte die einschlägige wissenschaftliche Diskussion allmählich die publizistische und politische Ebene. 1972 erschien der Bericht des Club of Rome »Die Grenzen des Wachstums«. Im April desselben Jahres veranstaltete die IG Metall unter dem Vorsitz von Otto Brenner eine Konferenz zum Thema Lebensqualität. Der Begriff zierte dann ein halbes Jahr später den Titel des SPD-Wahlprogramms. Diese öffentliche Debatte hatte immerhin den Effekt, dass ab 1969 eine größere Zahl von politischen Entscheidungen pro Umweltschutz getroffen wurde. Erst 1979/80 gründeten sich die Grünen, die den Umweltschutz zum Leitmotiv ihres Parteiprogramms machten.
Aufgrund solcher inhaltlicher Debatten waren die Parteien für Außenstehende attraktiv; junge Leute und Menschen, die fachlich etwas zu bieten hatten, traten ihnen wegen des inhaltlichen Engagements bei. Dass die SPD einmal mehr als eine Million Mitglieder zählte, folgte ja nicht aus der Erwartung von Hunderttausenden, mit dem Parteibeitritt Karriere machen zu können, sondern sie wollten etwas bewegen. Das reichte den meisten. Und sie haben tatsächlich viel bewegt.
Unter den damaligen Umständen konnten die Parteiführungen nicht ohne Rücksicht auf die inhaltliche Orientierung der Parteimitglieder und Funktionäre programmatisch schalten und walten, wie sie wollten. Ihre Bindung an die Willensbildung unter den Parteimitgliedern und in den Parteigliederungen wurde in den Auseinandersetzungen mit den Eurokommunisten in Italien damals sogar zum Gütesiegel für den demokratischen Charakter einer Partei erklärt.
Innerparteiliche Debatte und innerparteiliches Ringen um Inhalte sind eine – kleine – Garantie dafür, dass die Parteiführungen nicht machen können, was sie wollen. Das Thema ist nach wie vor hochaktuell. Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi und seine Partei sind Musterbeispiele für mangelhafte innerparteiliche Demokratie. Was die deutschen Konservativen von damals von den italienischen Eurokommunisten forderten, müssten ihre Nachfolger heute ebenso dringlich von ihrer Schwesterpartei, Berlusconis »Partei der Freiheit«, fordern. Und von sich selbst auch.
Heute entsprechen die meisten Parteien dem Bild, das sich konservative Kreise in Deutschland in den siebziger Jahren von Italiens Eurokommunisten machten: Inhaltliche Debatte? Weitgehend Fehlanzeige.
Entsprechend frei und unabhängig von der Willensbildung der eigenen Mitgliedschaft sind die Parteiführungen heute. Ob sie von anderen Instanzen und vor allem von großen Interessen frei sind, ist eine andere Frage.
1999, mit dem Wechsel von Oskar Lafontaine zu Hans Eichel im Bundesfinanzministerium, und dann offener nach der Wahl 2002 vollzog die Regierung Schröder einen Kurswechsel: weg von ihrem bei der Wahl 1998 in Aussicht gestellten Kurs rot-grüner Reformen, hin zu einer neoliberal geprägten Politik. Ende Dezember 2002 erschien ein Kanzleramtspapier, das über weite Strecken dem entsprach, was die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und andere wirtschaftsliberal geprägte Organisationen und Personen forderten. Das geschah vor allem auf der Basis einiger Behauptungen, die weltweit zum Zwecke des Sozialabbaus in die Debatte eingeführt worden waren: Die Lohnnebenkosten müssten gesenkt werden; der Sozialstaat sei in Zeiten der Globalisierung nicht mehr finanzierbar; die Steuern müssten gesenkt werden, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig würden; der schlanke Staat wurde propagiert; der Markt könne alles besser; wir müssten endlich den sogenannten Reformstau überwinden …
Die Senkung der Lohnnebenkosten war die Kernforderung des Kanzleramtspapiers, und dieses wiederum war die Basis der Agenda 2010. Wir wissen heute, dass dieses Werk in hohem Maße auf die Einflüsterungen des britischen Premierministers Tony Blair zurückging, der die Labour Party zu »New Labour« umgestaltete, und auf den Einfluss und die Zuarbeit der Bertelsmann Stiftung.
Am 14. März 2003 wurde die Agenda 2010 verkündet. In der SPD regte sich heftiger Widerstand. Die Linken in der SPD verkündeten, sie wollten die Agenda 2010 einer Mitgliederbefragung unterwerfen. Das klang gut und war ein sympathisches Unterfangen. 25 Jahre früher wäre ein solcher Versuch vermutlich auch erfolgreich gewesen. Unter den aktuellen Bedingungen jedoch, die durch die Möglichkeit gekennzeichnet sind, die Willensbildung der Parteimitglieder und der Parteifunktionäre auf allen Ebenen von außen zu bestimmen, indem man sich der Mithilfe von PR-Agenturen und der Medien bedient, war das ein aussichtsloses Unternehmen.
Der innere Wille unserer Parteien wird heute in der Regel von außen gemacht
Der damalige SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder wusste, dass er eine Mitgliederbefragung gewinnen würde, wenn er mit Unterstützung aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die Medien und zusätzlich direkt über die Kanäle seiner Partei die Meinung der Mitglieder und Funktionäre beeinflussen kann. Wichtig dabei ist, dass diese Meinungsmache nicht nur von einer Seite kommt, sondern aus verschiedenen Ecken auf die Mitglieder einwirkt. Schröder wusste, was PR-Agenturen, was »›Bild‹ und Glotze« zu leisten vermögen. Das war schon deshalb absehbar, weil das größte Medienunternehmen, Bertelsmann, am Entstehen der Agenda 2010 direkt beteiligt war – und Bertelsmanns wirtschaftlich-publizistischer Einfluss reicht bis zum »Spiegel«. Auch Springer, und damit »Bild«, sind der Agenda 2010 eng verbunden; ebenso die meisten anderen, stark von Arbeitgeberinteressen geprägten Medienunternehmen – und inzwischen leider auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Wie die Willensbildung der Parteien über gezielte Meinungsmache fremdbestimmt und damit massiv von der Idealvorstellung unseres Grundgesetzes abgewichen wird, lässt sich an weiteren Beispielen ganz ähnlich beobachten wie bei der Agenda 2010. So wurde auch die Entmachtung des sozialen Flügels der Union bis hin zu seiner völligen Bedeutungslosigkeit mit Unterstützung der Medien betrieben und war nicht Ergebnis einer Debatte innerhalb der Unionsparteien. Beispielhaft dafür ist die mediale Demontage des früheren Arbeitsministers und Vorsitzenden der CDU-Sozialausschüsse Norbert Blüm. Die Häme ihm gegenüber und welcher Erfolg ihr in der öffentlichen Meinungsbildung beschieden war, blieb nicht ohne Folgen für die Richtungsentscheidung der CDU. Der Arbeitnehmerflügel wurde degradiert und ist heute nahezu ohne messbaren Einfluss.
Ähnlich ist die Lage bei den Grünen. Ohne die andauernde Einmischung der Medien und jener, die sich ihrer bedienen, in die innere Willensbildung der Grünen wäre das Erstarken der Realos so nicht möglich gewesen.[13]
Wie unabhängig die Unionsführung von den Interessen ihrer Sympathisanten und wohl auch ihrer Mitglieder agieren kann, zeigt die Erhöhung der Mehrwertsteuer um drei Punkte. Davon betroffen war ein großer Teil von Anhängern der Union im Einzelhandel, beim Handwerk, in der Gastronomie und im gewerblichen Mittelstand. Doch deren Interessen und Meinungen wurden durch ein Dekret einfach übergangen.
Nicht immer gelingt die Fremdbestimmung auf Anhieb
Zumindest bisher scheint von den Mitgliedern der beiden großen Parteien, der Linken und der Grünen noch nicht akzeptiert zu sein, dass die Deutsche Bahn AG zum Teil privatisiert werden soll. Bei Umfragen hatten sich zuletzt 78 Prozent der Wahlberechtigten gegen eine Privatisierung der Bahn ausgesprochen.[14] Trotz dieser seit langem erkennbaren Mehrheitsmeinung fällte das Kabinett am 30. April 2008 den Beschluss zur Teilprivatisierung der Bahn – um den Börsengang dann im November 2008 angesichts des Tiefs auf den Aktienmärkten bis auf weiteres zu verschieben. Mit Öffentlichkeitsarbeit wird aber weiterhin versucht werden, den Mehrheitsunwillen zu korrigieren.
Die Privatisierung von kommunalen öffentlichen Einrichtungen stößt ebenfalls noch auf Widerstand, obwohl gerade hier der Außeneinfluss enorm groß ist. Auch bei kriegerischen Einsätzen gibt es einen Widerstand, der nicht so leicht zu überwinden ist. Aber penetrante Meinungsmache wie im Fall des Kosovo-Kriegs, als der britische NATO-Sprecher Jamie Shea[15] und der deutsche Verteidigungsminister Rudolf Scharping mit spannenden, weil mit Filmen und Fotos von militärischen Aktionen angereicherten Pressekonferenzen fast täglich die Bildschirme belegten, zeigt auch bei einer widerstrebenden Bevölkerung auf Dauer Wirkung.
Willensbildung und Entscheidungsfindung funktionieren also heute oft auf dem kurzen Weg – und werden hinterher über Meinungsmache medial abgesichert. Mitunter werden aber auch Fakten geschaffen, ohne sich die Mühe zu machen, die Mehrheit wenigstens nachträglich zu überzeugen. So hat die Bundesregierung in einer beeindruckend schnellen Aktion die Befugnis zur Verteilung von 480 Milliarden Euro auf den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (Soffin) ausgelagert und damit der parlamentarischen Kontrolle weitgehend entzogen. Die politisch Verantwortlichen machen sich nicht einmal die Mühe, uns diesen erstaunlichen Vorgang wenigstens nachträglich zu erklären.
Was politisch zu geschehen hat, wird zwischen der politischen Führungsschicht und einflussreichen Kreisen um Bertelsmann, Springer und andere Medienunternehmen sowie der Finanzindustrie und der Großwirtschaft besprochen oder auch nur erfühlt. Angela Merkel, der Bundesfinanzminister und der Verkehrsminister hören in diesen Kreisen, dass die Privatisierung der Bahn erwünscht sei und dass man sich ja darauf verständigen könne zu sagen, die Privatisierung, genannt »Bahnreform«, sei notwendig, um Kapital zu beschaffen, also folgen sie dem. Einigkeit herrscht in diesen Kreisen samt der angegliederten Politik auch darüber, dass die Finanzwirtschaft Erleichterungen braucht und dass die Unternehmenssteuern sinken sollten, während die Steuerzahler die Wettschulden der Spekulanten wie im Falle der IKB Deutsche Industriebank zehn Milliarden Euro, der HRE über 102 Milliarden Euro, der Commerzbank im Kontext der Übernahme der Dresdner Bank 18,2 Milliarden Euro[16] und vielen anderen bezahlen sollten. Die entscheidenden Personen in den Zirkeln der Entscheidungsfindung sind inzwischen so abgehoben und so unabhängig von uns, dass sie sich die groteskesten Einlassungen erlauben können. So beklagten die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister öffentlich, die Banken wollten unser Geld nicht nehmen, und sie baten inständig darum, die Herren möchten doch so gnädig sein.
Zwischen den Staats- und Regierungschefs und ohne Beteiligung des Volkes ist das neue europäische Vertragswerk ausgehandelt worden. Am 18. und 19. Oktober 2007 einigten sich die Regierenden auf den endgültigen Vertragstext. Er wurde am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichnet. Über die weitreichenden Entscheidungen im Kontext dieses Vertrages, mit dem der in Frankreich und den Niederlanden abgelehnte Vertrag über eine europäische Verfassung ersetzt werden soll, gab es in der Bundesrepublik keine öffentliche Debatte, die auch nur einen Teil des Volkes einbezogen hätte. Auch die Parteien – das heißt: ihre Mitglieder, die Ortsvereine und sonstigen Gliederungen – sind nicht am Willensbildungsprozess beteiligt gewesen. Ausnahme: die Iren, die zur Volksabstimmung aufgerufen waren und mit Nein gestimmt haben.
Wenn man das Schema der Willensbildung nach diesem Muster im Blick hat, versteht man etwas besser, dass die führenden Personen in Politik und Wirtschaft es für legitim halten, wenn Mitarbeiter der Wirtschaft zur Bearbeitung, zur Steuerung und zur Kontrolle von politischen Entscheidungen sowie zur Beratung und Formulierung von Gesetzen direkt in den Ministerien plaziert werden. Nach Auskunft des Bundesrechnungshofs waren allein zwischen 2004 und 2006 jedes Jahr im Durchschnitt einhundert dieser sogenannten Leihbeamten in den Ministerien tätig.[17]
Die Politik wird immer den Eindruck zu erwecken versuchen, sie bestimme das Geschehen allein und die Entscheidungen fielen im vorgesehenen demokratischen Prozess. In Wahrheit fallen die wichtigsten Entscheidungen in kleinen Zirkeln. Sie sind geprägt von einer auf den eigenen Vorteil bedachten Selbstbedienungsmentalität. Das Volk wird wenig gefragt, weil man sich in den Führungsetagen der eigenen Meinungsbildungsmacht bewusst ist. Man braucht die Rückkopplung nicht. Man braucht das Volk für Entscheidungen nicht. Damit es nicht aufbegehrt, jedenfalls nicht in seiner Mehrheit, wird Stimmung für die getroffenen wie für die zu treffenden Entscheidungen gemacht.
II. Meinungsmache beherrscht das politische Geschehen und wichtige Teile von Wirtschaft und Gesellschaft
Kapitel 3
Meinung macht Politik
Mit der Manipulation von Meinung wird Politik gemacht. Das ist keine graue Theorie. Das geschieht unentwegt und auf verschiedenen Feldern des politischen Geschehens. Eine Reihe von konkreten Beispielen soll veranschaulichen, wie Meinungsmache und die gleichgerichtete Prägung des Denkens hierzulande das politische Geschehen über weite Strecken bestimmen:
Es wurde uns erzählt, die deutschen Akademikerinnen seien zu 40 Prozent oder gar zu 43 Prozent kinderlos – und siehe da: Unsere politische Führungselite streicht das Erziehungsgeld und setzt dafür ein Elterngeld durch, das den Besserverdienenden und damit vielen Akademikerinnen 1800 Euro pro Kind und Monat bringt und den Schlechtverdienenden und Arbeitslosen 300 Euro. Dabei konnte man schon im Jahr 2005 in den Medien lesen, dass die Angaben über die Zahl der kinderlosen Akademikerinnen nicht stimmen.[18] Die Bestätigung der Manipulation lag damals allerdings noch nicht vor. Hier ist sie:»Haben wir über ein Phantomproblem geklagt?«, fragt der »Spiegel« die CDU-Bundestagsabgeordnete Kristina Koehler im August 2007. »Es spricht einiges dafür«, sagt sie. »Nach einer Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung [DIW] bleiben 25 Prozent der Frauen mit Hochschulabschluss ohne Kinder – und das ist nur ein geringer Unterschied zur Quote der kinderlosen Frauen insgesamt.«Als Kristina Koehler dies eingesteht, war die politische Entscheidung zur Umstellung vom Erziehungsgeld zum Elterngeld schon längst gefallen.
2.»Mindestlöhne kosten 200000 Arbeitsplätze« (DIW) – Mindestlöhne führen zu höheren Preisen, behaupten »Bild« und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft – »Mindestlöhne unterminieren die Gesellschaft«, meint Professor Hans-Werner Sinn. 20 von 27 EU-Ländern hatten schon zum 1. Januar 2007 einen branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn eingeführt, berichtete das Statistische Bundesamt. In Frankreich, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Luxemburg gilt ein Mindestlohn von acht Euro und darüber; Großbritannien hat gute Erfahrungen damit gemacht, und auch die USA kennen diese Einrichtung. Nur bei uns tut man so, als folge der wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenbruch, wenn der Gesetzgeber dafür sorgen würde, dass eine Untergrenze für Löhne eingezogen wird, die den Betroffenen wenigstens die Basis ihres Lebensunterhalts sichert. Diese Agitation hat politische Folgen: Die Position von CDU/CSU und FDP in dieser Frage hat sich völlig verhärtet; sie werden ihre Hand zu einer positiven Entscheidung nicht reichen. Sachliche Erwägungen, selbst der Rat von Beobachtern außerhalb Deutschlands, machen keinen Eindruck. Im August 2008 trafen 14 Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften in Lindau zusammen. Der amerikanische Professor Robert Solow legte eine Studie zum Vergleich der Mindestlöhne in europäischen Ländern und den USA vor. Es sei in der Praxis kaum belegbar, dass Mindestlöhne die Beschäftigung im Niedriglohnsektor von Ländern wie Deutschland gefährden, meinte er. Doch die Meinungsmache ist abgehoben von sachlichen Erwägungen, und sie wird ungeachtet der Tatsache betrieben, dass eine überwiegende Mehrheit in Deutschland für die Einführung eines Mindestlohns ist. »Beim Thema Mindestlohn ist weiterhin eine große Mehrheit von 78 Prozent für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns für alle Branchen«, heißt es im Pressebericht zum ZDF-Politbarometer vom August 2007.
3.»Wer arbeitet, ist der Dumme!« So prangte es am 11. Februar 2008 in Riesenlettern auf der »Bild«-Zeitung. Im Text wird behauptet, dass immer mehr Arbeitnehmer weniger Geld bekommen als Hartz-IV-Empfänger. Auf der gleichen Welle schwimmt auch der »Stern«, dessen damaliger stellvertretender Chefredakteur Hans-Ulrich Jörges schon im Mai 2006 sagte, der Kommunismus siege, Arbeit werde verhöhnt, Nichtstun belohnt. – Das sind gängige Parolen. Die Essener Professorin Helga Spindler hat die Aussagen von Jörges für die »NachDenkSeiten« überprüft:[19] Der vom »Stern« beschworene Kommunismus konnte bei gerade mal 147 Familien in ganz Deutschland gefunden werden, das sind 0,1 Prozent der sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Doch diese Kampagnen haben Wirkung. Hartz-IV-Empfänger werden damit stigmatisiert und jede Debatte um eine Verbesserung der Leistungen von vornherein blockiert.Die Agitation vom angeblich grassierenden sozialen Missbrauch war übrigens Grundlage der Politik, die mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen Einzug gehalten hat. Der Missbrauch, den es bei allen sozialen Leistungen schon immer gegeben hat und den ich nicht verniedlichen will, wurde im Vorfeld der politischen Umorientierung der Regierung Schröder jedem und jeder unterstellt. Jeder und jede ist zum Zielobjekt des »Forderns« geworden, jedem wird unterstellt, dass sie oder er nicht von sich aus dringlich Arbeit suchen und dass man ihnen deshalb Druck machen müsse. Die Folge: Allen möglicherweise Betroffenen wird gewissermaßen mit einem staatlich verordneten Misstrauen begegnet. Das ist ein komplett anderes Menschenbild, als es dem Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland bisher gemäß war. Selbst wenn soziale Leistungen heute häufiger missbraucht werden als früher, ist das noch lange kein Grund, alle Menschen unter den Verdacht des Missbrauchs zu stellen. Wir haben mit dem Vertrauen in die Leistungsbereitschaft von Menschen in der Geschichte der Bundesrepublik beste Erfahrungen gemacht. Die hervorragenden Leistungen im Wirtschaftswunderland Deutschland wären gar nicht möglich gewesen, wenn nicht Millionen von Menschen gerne und verantwortungsvoll gearbeitet hätten, mit Phantasie und Engagement. Dieses Kapital aufs Spiel zu setzen durch die Verbreitung der Vorstellung, dass Menschen nur dann richtig parieren, wenn sie »gefordert« werden, ist leichtfertig. Und doch wird diese bornierte betriebswirtschaftliche Sicht der Welt heute von den Meinungsmachern und Meinungsführern im Schild geführt.
4.»Mehr Netto vom Brutto!« (Erwin Huber, CSU). »Sozial ist, wer/was Arbeit schafft.« (Alfred Hugenberg, Medienzar und Wegbereiter des Nationalsozialismus; leider ähnlich auch Wolfgang Clement) – Natürlich wäre es schön, mehr netto zu haben. Und es ist auch nicht falsch, dass Arbeit zu schaffen eine auch gesellschaftlich und sozial vernünftige Tat ist. Aber die Sprüche haben zugleich eine gegen den Sozialstaat gewandte Stoßrichtung. Warum sollte man nicht Arbeit schaffen und gleichzeitig für eine Korrektur der Ungerechtigkeiten kämpfen? »Mehr Netto vom Brutto« stützt zugleich die Entstaatlichungskampagne und zielt wohl auch genau darauf ab. Doch die hat schon genug Unheil angerichtet.
5.Es wurde und es wird uns immer noch erzählt, Konjunkturprogramme seien Strohfeuer, sie führten nur zu neuen Schulden; Keynes sei out; wir seien im nationalen Rahmen ohnehin wirtschaftspolitisch nicht mehr handlungsfähig – und als Folge dieser wiederkehrenden Behauptungen wird über Jahre hinweg, inzwischen schon über zwei Jahrzehnte lang, keine aktive Steuerung mehr zum Ausgleich konjunktureller Schwankungen betrieben. Diese Missachtung der makroökonomischen Verantwortung für das Ganze führt zu einer Unterauslastung unserer Kapazitäten. Die Vorurteile über die angebliche Unmöglichkeit konjunktureller Steuerung haben konkret dazu geführt, dass hierzulande die Warnzeichen einer abkühlenden Konjunktur nicht gesehen wurden und nicht rechtzeitig gegengesteuert wurde. Der herrschende Dogmatismus kostet Millionen von Arbeitnehmern und Hunderttausenden von Selbständigen die Existenz und ihre finanzielle und soziale Sicherheit.Ein Appell international renommierter Ökonomen unter Federführung des amerikanischen Nobelpreisträgers Robert Solow unter dem Titel »Der Staat muss die Nachfrage stimulieren« ist angesichts dieser Front neoliberaler Dogmatik ebenso verhallt wie die Mahnungen von deutschen Wirtschaftswissenschaftlern wie Peter Bofinger, Heiner Flassbeck, Gustav Horn, den Ökonomen der »Memorandum-Gruppe« (wie die Bremer Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik auch genannt wird) und weitere Analysten. Die Dominanz der neoliberalen Dogmatiker ist erdrückend. Ideologie macht Politik, Meinung macht Politik – auf Dauer ist das höchst gefährlich für unser Land.Man könnte die Aversion der herrschenden Lehre gegen Investitionsprogramme gerade noch ertragen, wenn verlangt würde, es solle Geld in unsinnige Projekte investiert werden. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir haben einen enormen Nachholbedarf bei den öffentlichen Investitionen. »Deutsche Infrastruktur braucht 700 Milliarden Euro«, das konnte man am 19. August 2008 bei »welt.de« lesen, einem Medium, das nicht verdächtig ist, die Argumente für keynesianische Investitionsprogramme zu liefern. Und weiter: »Lange haben es die Kommunen schamhaft verschwiegen, jetzt ist es nicht mehr von der Hand zu weisen: Den Städten drohen gigantische Kosten wegen des Erneuerungsbedarfs der Infrastruktur. Bis 2020 sind kommunale Investitionen von mehr als 704 Milliarden Euro notwendig – eine Zahl, die nun auch den Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) alarmiert. Errechnet wurde sie vom größten deutschen Stadtforschungsinstitut, dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) in Berlin. Laut Difu zeigt sich der größte Investitionsbedarf bei Straßen (162 Mrd. Euro), Schulen (73 Mrd. Euro) und bei der kommunalen Abwasserbeseitigung (58 Mrd. Euro).«Noch im Oktober 2008 warnten Vertreter der Großen Koalition vor »irrationalen Konjunkturprogrammen«[20]. »SpiegelOnline« vom 20. Oktober 2008 offenbart die Befangenheit in Sprachformeln und Meinungsmache beispielhaft: »Obwohl die Zielrichtung klar ist, sind beide Koalitionspartner weiterhin peinlichst darum bemüht, das Wort Konjunkturprogramm zu vermeiden. Es gehe nicht um ein ›traditionelles, schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm‹, sagte Regierungssprecher Steg. Vielmehr gehe es um ›punktgenaue‹ und ›branchenspezifische‹ Maßnahmen. … Müntefering erklärte, die SPD rede nicht von einem Konjunkturprogramm, weil es nicht um die Konjunktur gehe. ›Konjunktur ist nicht das, was bei den Menschen ankommt.‹« – Das ist wirr und fast schon ein bisschen komisch, aber es ist selbst in diesem Rückzugsgefecht noch der Versuch verschleiernder Meinungsmache. 14 Tage später, am 5. November 2008, wurde das erste Konjunkturpaket beschlossen und dann am 13. Januar 2009 das zweite. Die zuvor betriebene kollektive Meinungsmache hat die Verantwortlichen daran gehindert, diese Entscheidungen rechtzeitig und gebündelt zu treffen. Daran war die Bundesregierung durch ihre eigene Propaganda und entsprechend falsche Analysen gehindert.