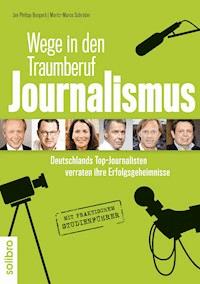21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Amerika ist ein Pulverfass, die gesellschaftlichen Verwerfungen sind explosiv. Das haben die Unruhen nach dem Tod von George Floyd und die dramatischen Szenen rund um die Erstürmung des Kapitols gezeigt. Ist Amerika noch das »Land der unbegrenzten Möglichkeiten«? War es das je? Wird es dem neuen Präsidenten Joe Biden gelingen, das Land zu versöhnen, oder wird es versinken in einem Strudel von Angst, Gewalt und Zerstörung? Jan Philipp Burgard geht dahin, wo die Bruchstellen Amerikas sichtbar werden, und zeichnet in packenden Reportagen das Bild eines Landes im Ausnahmezustand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.deFür Anna-Maria© Piper Verlag GmbH, München 2021Abbildungen: [1] und [7]: Oliver Richardt; alle anderen: Archiv AutorCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Andreas Hornoff; John Greim/LightRocket/Getty Images; Abrar Sharif / Alamy Stock PhotoKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Prolog
Amerika. Macht. Angst.
Wie im Wahn tanzen die Flammen auf dem Skelett einer Lagerhalle. Meterhoch klettern sie in den wolkenlosen Nachthimmel über Minneapolis, als wüssten sie, dass niemand sie einfangen kann. Schnell und gierig erobert das Feuer ein Gebäude nach dem anderen. Andächtig betrachtet ein schlaksiger junger Mann sein Werk, wie der Maler Botticelli seine Interpretation von Dantes Inferno. Der Brandstifter zieht seelenruhig sein Handy aus der Tasche, wählt den passenden Bildausschnitt und lädt sein Foto in den sozialen Netzwerken hoch. Amerika und der Rest der Welt sollen seine unbändige Wut sehen, die der gewaltsame Tod von George Floyd aus ihm herausbrechen lässt. Noch nie hat er sich gehört gefühlt. Das ändert sich heute.
Das Knistern des Feuers wird von einem heiseren Schrei durchbrochen: »Die Cops rücken vor!« Gummigeschosse und Tränengas kündigen die Ankunft der Einsatzkräfte an. Hunderte vermummte Gestalten rennen davon. Eine junge Frau wird getroffen. Der Lichtschein eines brennenden Hauses gibt den Blick auf ihren Hinterkopf frei. Blut bahnt sich den Weg über ihr pechschwarzes Haar. Ein Teenager läuft an mir vorbei, in der Hand trägt er eine Axt. Plötzlich holt er aus und beginnt, die Fensterscheiben von Geschäften einzuschlagen. Seine Freunde tragen kistenweise Waren heraus. Mich überrascht, dass Polizei und Nationalgarde bei diesen Plünderungen und Brandstiftungen lange scheinbar tatenlos zusehen. Man will wohl unbedingt vermeiden, dass es bei Zusammenstößen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten Tote gibt. Dennoch setzt man auf Präsenz. Allein hier in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota werden 13 000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Es ist der bis dahin größte Einsatz in der Geschichte der Reservistenarmee.
Plötzlich geraten mein Kamerateam und ich zwischen die »Frontlinien« von Einsatzkräften und Demonstranten. Wir geben uns als Presse zu erkennen und bitten die Polizei, uns einen Ausweg zu ermöglichen. Doch ein offensichtlich überforderter oder genervter Beamter brüllt uns nur barsch entgegen: »Verpisst euch!« Wir entkommen der Situation, indem wir den Demonstranten entgegenlaufen, und haben Glück, nicht von Steinen getroffen zu werden. Im Laufe der Nacht setzt die Polizei verstärkt Tränengas und Gummigeschosse ein. Doch auch davon lassen sich viele Demonstranten nicht abschrecken. Immer wieder gehen um uns herum Gebäude in Flammen auf.
»Diese Gewalt ist eine direkte Reaktion auf die Polizeigewalt. Wir reagieren mit Gewalt, weil wir es nur so kennen«, sagt mir Sarina Samentelli. Die junge Frau ist trotz einer Ausgangssperre mit einer Gruppe von Freunden auf der Straße. »Black Lives Matter!«, brüllt sie in ein Megafon. Ihre Stimme überschlägt sich. Immer wieder höre ich von den schwarzen Demonstranten, dass sie sich in vielen Lebensbereichen schon lange und systematisch diskriminiert fühlen. Viele halten Gewalt für das einzige Mittel, um sich endlich Gehör zu verschaffen. »Das hier ist Gerechtigkeit, auch wenn andere Leute die Proteste als rücksichtslos oder barbarisch betrachten«, sagt mir James Miller. Er trägt eine Skibrille, um seine Augen vor dem Tränengas der Polizei zu schützen.
Die Gewalt, die James als »gerecht« empfindet, trifft allerdings andere Minderheiten und viele Unbeteiligte. Isa Pérez steht vor den Trümmern ihrer Existenz. Obwohl die aus Mexiko stammende Kleinunternehmerin die Schaufensterscheibe ihres Tattoostudios verbarrikadiert hatte, konnten die Aufständischen einbrechen. Sie rissen die Bretter weg und schlugen die Scheibe ein, überall liegen Scherben. All ihre teuren Geräte und wertvoller Körperschmuck wurden gestohlen. Eine Versicherung hat Isa nicht. Die hatte sie kürzlich erst gekündigt, um während der Corona-Krise Geld zu sparen. In der Eskalation der Proteste sieht sie ein Versagen des Staates. »Hierher kommt keine Polizei. Sie haben Angst, in diese Gegend zu kommen«, sagt sie und ist den Tränen nah. Isa versteht die Welt und ihre Stadt nicht mehr. »Ich hatte dieses Geschäft seit sechzehn Jahren und hatte nie Probleme mit irgendjemandem. Ich bin so unglaublich traurig.«
Einige Straßenblocks weiter löscht die Feuerwehr eine Tankstelle, die von Demonstranten in Brand gesetzt wurde. Soldaten der Nationalgarde sichern die Gefahrenstelle. Es herrscht Explosionsgefahr. Amerika macht mir Angst. Das spüre ich zum ersten Mal in dieser Nacht in Minneapolis. Denn die Bilder, die wir hier Ende Mai 2020 drehen, lassen mich unweigerlich an einen Bürgerkrieg denken. Wie unter einem Brennglas sehe ich, in welch schwerer Krise Amerika sich befindet. Hier entlädt sich mehr als nur die Wut über den Tod von George Floyd. Bei dessen Verhaftung hatte sich ein Polizist 9 Minuten und 29 Sekunden lang auf seinen Nacken gekniet. »Ich kann nicht atmen«, hatte Floyd immer wieder gesagt. So zeigt es das Video, das ein Passant mit dem Handy aufgenommen hat. Irgendwann ruft Floyd, ein Baum von einem Mann, verzweifelt nach seiner Mutter. Dann verliert er das Bewusstsein. Die Beamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.
Knapp ein Jahr später wird ein Gericht den weißen Polizisten Derek Chauvin des Mordes ohne Vorsatz für schuldig befinden und ihn zu einer Haftstrafe verurteilen. Ein Urteil mit Seltenheitswert. Denn in der Vergangenheit entgingen viele Polizeibeamte nach Fehlverhalten der Strafverfolgung, weil interne Untersuchungen ausblieben. Nach dem Tod von George Floyd ist die Debatte über eine Polizeireform neu entbrannt. »Es war ein Mord am helllichten Tag. Und er hat die Scheuklappen weggerissen, sodass die ganze Welt den systemischen Rassismus sehen konnte, der die Seele unserer Nation befleckt. Das Knie auf dem Hals der Gerechtigkeit für schwarze Amerikaner, die tiefe Angst und das Trauma, den Schmerz und die Erschöpfung, die schwarze Amerikaner jeden einzelnen Tag erleben.« Mit diesen Worten kommentiert Präsident Joe Biden das Urteil gegen Chauvin. »Der Mord an George Floyd hat einen Sommer des Protests ausgelöst, wie wir ihn seit der Ära der Bürgerrechte in den 1960er-Jahren nicht mehr gesehen haben – Proteste, die Menschen aller Rassen und Generationen in Frieden und mit dem Ziel vereinten, zu sagen: ›Genug. Genug. Genug der sinnlosen Morde.‹« Tatsächlich ist der Tod von Georg Floyd kein Einzelfall, sondern eines von vielen Beispielen für strukturelle Polizeigewalt gegen Schwarze. Afroamerikaner werden laut Erhebungen der vergangenen fünf Jahre doppelt so häufig von Polizisten getötet wie Weiße.
Doch Bidens Vorgänger Donald Trump hatte nach den Ereignissen von Minneapolis mit seiner Rhetorik sogar noch Öl ins Feuer gegossen, etwa mit seiner Aussage: »Wenn das Plündern beginnt, wird geschossen.« Diese Formulierung (»When the looting starts, the shooting starts«) stammt von dem weißen Polizeichef von Miami und löste 1967 eine Kontroverse aus. Außerdem drohte Trump damit, das Militär gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, und sagte wörtlich, er werde mit »bösartigen Hunden« und »unheilbringenden Waffen« gegen Demonstranten vorgehen, wenn sie den Zaun des Weißen Hauses überwinden würden. Trumps Angst war nicht unbegründet. Die Proteste nach dem Tod von George Floyd breiteten sich von Minneapolis in viele Großstädte aus – auch nach Washington. Die Straßen rund um das Weiße Haus wurden mit Straßensperren abgeriegelt und von Panzerwagen überwacht, die Fenster von Bürogebäuden, Hotels und Restaurants in der Innenstadt verbarrikadiert. In unserer Nachbarschaft wurden ein Weingeschäft und eine Apotheke geplündert. Nachts kreiste ein Militärhubschrauber des Typs Blackhawk über den Dächern, so laut, dass die Kinder kaum schlafen konnten. Besonders bedauerlich aber war, dass die eskalierende Gewalt von den vielen friedlichen Protesten ablenkte, die nach dem Tod von George Floyd auf Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam machen wollten.
Trump hatte gar nicht erst versucht, die Gesellschaft zu einen. Wie wohl kein Präsident vor ihm setzte er nicht auf Versöhnung, sondern auf Spaltung. Nicht nur bei mir persönlich, sondern bei vielen Deutschen lösten die Entwicklungen in den USA Angst aus. Forscher befragten 2400 Männer und Frauen ab vierzehn Jahren nach ihren größten politischen, wirtschaftlichen, persönlichen und ökologischen Ängsten. Das Ergebnis der Umfrage: Die größte Angst von mehr als zwei Dritteln der Bundesbürger war, dass Trump die Welt gefährlicher machte. Damit fürchtete die deutsche Bevölkerung Trump mehr als den Zuzug von Flüchtlingen, Terrorismus oder Naturkatastrophen.
Die Umfrage fand 2020 statt, vor der Wahl, doch trotz seiner Abwahl sind die Geister, die Trump rief, längst nicht verschwunden. Von seinem politischen Exil, dem Golfclub Mar-a-Lago, in Florida aus schürt er weiterhin die Ängste vieler Amerikaner vor schwarzen Demonstranten, Einwanderern aus Mexiko, Atombomben aus Nordkorea und Iran, Viren aus China und sogar Autos aus Deutschland. Trump macht seinen Unterstützern systematisch Angst vor dem Verlust von amerikanischen Arbeitsplätzen und nationaler Identität – um möglicherweise im Wahlkampf 2024 als Heilsbringer zu erscheinen. Mit dieser Strategie hatte er schließlich bei seinem ersten Anlauf auf das Weiße Haus schon einmal Erfolg: 70 Prozent der weißen Trump-Fans sagten, die Sorge um die amerikanische Identität sei 2016 der wichtigste Faktor für ihre Wahlentscheidung gewesen. Trump setzt auf die Macht der Angst, das hat er sogar freimütig eingeräumt. »Echte Macht ist, und ich will das Wort fast nicht gebrauchen: Angst.« Bei seinen Anhängern schürt er also weiter die Ängste vor Chaos und Anarchie, um sich selbst als »Law and Order«-Politiker inszenieren zu können, als Mann, der Recht und Ordnung schafft. So gewann schon Richard Nixon den Präsidentschaftswahlkampf 1968, als nach der Ermordung von Martin Luther King Unruhen das Land erschütterten.
Angst als Mittel zur Manipulation der Massen hat in den USA eine lange Tradition. Unter dem Eindruck der Oktoberrevolution in Russland und des Ersten Weltkriegs schürten US-Politiker Ängste vor einem kommunistischen Umschwung in den USA. Die kapitalistische Grundordnung und der liberale Lebensstil seien in akuter Gefahr. Damals wurde eine Reihe von Gesetzen beschlossen, die es zum Beispiel unter Strafe stellten, öffentliche Kritik an Regierung und Militär zu üben. Viele Unternehmen nutzen dies, um gewerkschaftliche Aktivitäten einzudämmen. Außerdem wurde anarchistisch gesinnten Ausländern die Einreise ins Land untersagt und die Deportation von illegal eingewanderten Anarchisten erlaubt. Amerika ist »der Schuttabladeplatz für den Abschaum aller Nationen«, bedroht von Bürgern, »die das Gift der Illoyalität direkt in die Blutbahnen unseres nationalen Lebens injiziert haben. (…) Diese von Leidenschaft, Untreue und Gesetzlosigkeit getriebenen Charaktere müssen durch und durch ausgeschaltet werden«, polterte 1915 der damalige US-Präsident Woodrow Wilson. Der Begriff »Rote Angst« war geboren.
Der Ku-Klux-Klan nutzte in den 1920er-Jahren nicht nur Rassismus zum Rekrutieren von Mitgliedern, sondern auch die Ängste der Menschen vor technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Ganz im Gegensatz dazu warnte Präsident Franklin D. Roosevelt seine Landsleute vor der Angst, als er 1933 mitten in der Großen Depression seine Amtseinführungsrede hielt: »Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Die namenlose, blinde, sinnlose Angst, die die Anstrengungen lähmt, deren es bedarf, um den Rückzug in einen Vormarsch umzuwandeln.« Roosevelt gelang es, die USA aus der Wirtschaftskrise und im Zweiten Weltkrieg auf die Siegerstraße zu führen. Doch selbst der Vorzeigeoptimist Roosevelt machte teilweise mit Angst Politik, indem er zwischen 1942 und 1946 rund 117 000 japanischstämmige Amerikaner internierte. Auch sein Nachfolger, Präsident Harry S. Truman, erhielt in den frühen Tagen des Kalten Krieges von einem befreundeten Senator einen wörtlich überlieferten Rat zum Umgang mit dem amerikanischen Volk: »Erschrecke sie höllisch, Harry!«
Später blies der berühmt-berüchtigte Senator Joseph McCarthy zur Jagd auf vermeintliche Kommunisten. Besonders die Machtübernahme der Kommunisten in China nährte in den USA die Angst, dass Staaten einer nach dem anderen wie Dominosteine »umkippen« könnten. In jüngerer Zeit nutzte Präsident George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die Angst seiner Landsleute vor weiteren Anschlägen, um die Kriege in Afghanistan und im Irak zu rechtfertigen und ein schier übermächtiges Überwachungssystem zu etablieren. Seine Nachfolger Obama und Trump machten keine Anstalten, die weitreichende Überwachung auch unverdächtiger Bürger zu begrenzen. Dabei ist die Angst doch eigentlich ein Widerspruch zum Selbstverständnis der Weltmacht. Einerseits protzen die Amerikaner gerne mit ihrer wirtschaftlichen und militärischen Stärke, im Privatleben stellen sie gerne große Trucks und schwere Waffen zur Schau. Auf der anderen Seite ist das Land nachweislich ängstlicher als andere Nationen. Eine Studie machte die USA als das ängstlichste unter vierzehn untersuchten Ländern aus – mit einem klinisch signifikant höheren Angstniveau als etwa in Nigeria oder dem Libanon. Wie die New York Times berichtete, haben die Angststörungen die Volkskrankheit Depression inzwischen abgehängt. Insgesamt wird bei etwa vierzig Millionen Amerikanern pro Jahr eine Angststörung diagnostiziert. Laut National Institute of Mental Health leiden sogar schon Jugendliche unter Angststörungen: 38 Prozent aller Mädchen und 26 Prozent aller Jungen. Mit starken Beruhigungsmitteln wie Xanax oder Paxil werden in den USA jährlich Milliarden umgesetzt. Die Angst treibt nicht nur die Profite der Pharma-, sondern auch die der Fernsehindustrie in die Höhe. Die Berichterstattung über Kriminalität und Gewalt garantiert hohe Einschaltquoten und damit attraktive Werbeeinnahmen. »When it bleeds, it leads«, lautet ein altes Sprichwort unter TV- und Radiojournalisten in den USA. Wenn es blutig wird, gehen die Einschaltquoten in die Höhe. Durch diese Medienlogik entstand bei vielen Amerikanern das Gefühl, dass ihre Städte unsicher sind. Das Magazin Time widmete dem »Zeitalter der Angst« im Januar 2020 sogar eine Sonderausgabe. Verschärft wurde der emotionale Notstand durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Existenzängste, als über vierzig Millionen Amerikaner zwischenzeitlich ihren Job verloren.
In seiner wechselvollen Geschichte ist Amerika schon oft die Wiederauferstehung gelungen. Mit der Spanischen Grippe von 1918 haben die USA schon einmal eine verheerende Pandemie überstanden. Der Großen Depression in den 1930er-Jahren folgten Phasen großen Wohlstands. Landesweite, teilweise gewalttätige Proteste entbrannten nach der Ermordung Martin Luther Kings, doch die Bürgerrechtsbewegung erzielte auch große Erfolge. Vielleicht gelingt auch dieses Mal eine Wende. Doch bei allem Zweckoptimismus empfiehlt sich ein Blick auf die historische Einzigartigkeit der aktuellen Situation: Noch nie in der Geschichte der USA ereigneten sich eine Gesundheitskrise, eine Wirtschaftskrise und ein Kulturkampf zeitgleich. Die Corona-Krise wirkt sich wie ein Brandbeschleuniger auf die gesellschaftlichen Konflikte aus.
In der Seele Amerikas tobe seit jeher ein Kampf zwischen Angst und Hoffnung, schreibt der Historiker Jon Meacham. »Angst füttert Sorgen und produziert Wut. Hoffnung, besonders in einem politischen Sinne, nährt Optimismus und Wohlbefinden. Angst dreht sich um Grenzen, Hoffnung um Wachstum. (…) Angst spaltet, Hoffnung vereint.« Spätestens seitdem ich den Brandstiftern von Minneapolis begegnet bin, treibt mich immer wieder die Frage um, ob in Amerika die Hoffnung triumphieren wird oder die Angst. Der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 hat meine Zweifel verstärkt. Besitzt die amerikanische Demokratie die Widerstandskraft, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu überleben? Ist Amerika immer noch das Land, in dem man seine Kinder aufwachsen lassen möchte? War Donald Trump nur ein »Unfall der Geschichte« oder die logische Konsequenz einer Entwicklung, die schon vor Jahrzehnten eingesetzt hat? Wird dem Angstmacher Trump ein politisches Comeback gelingen, oder kann Präsident Biden sein Versprechen einlösen, die »Seele Amerikas zu heilen«?
Um Antworten auf all diese Fragen zu finden, reise ich quer durch die USA. In Tulsa, Oklahoma versuche ich, den Wurzeln des Rassismus und den Ursachen für strukturelle Polizeigewalt gegen Schwarze auf den Grund zu gehen. Die »Black Wall Street« von Tulsa war 1921 Schauplatz eines Massakers durch einen weißen Mob an der schwarzen Bevölkerung. Und die Geschichte scheint sich zu wiederholen – wie ich von einem Geistlichen erfahre, der seinen Sohn durch eine Polizeikugel verloren hat.
Waffengewalt ist in Amerika allgegenwärtig – und auch sie offenbart Ängste, die tief in der amerikanischen Gesellschaft verwurzelt sind. Besonders das ländliche Amerika fühlt sich permanent bedroht und pocht auf das verfassungsmäßige Recht auf Waffenbesitz. In Texas erlebe ich, welch monströse Taten durch die laxen Gesetze ermöglicht werden. Ich lerne aber auch die mutigen Überlebenden des Amoklaufs an der Highschool von Parkland in Florida kennen, die sich gegen die mächtige Waffenlobby NRA auflehnen.
Wie groß der Einfluss von Lobbyisten auf die Politik in Washington ist, wird bei einem Blick hinter die Kulissen des Kapitols deutlich. Ein Lobbyist wird mir überraschend offen erklären, wie er davon lebt, Politiker im Sinne seiner Klienten zu beeinflussen. Kein Wunder, dass drei Viertel der Amerikaner laut einer Umfrage Angst vor Korruption von Regierungsangehörigen äußern. Präsident Trump war mit dem Versprechen angetreten, den »Sumpf« auszutrocknen. Joe Biden zog mit ähnlichen Ankündigungen in den Wahlkampf. Ich will herausfinden, ob immer noch das große Geld entscheidet, wer in der Hauptstadt für wen Politik macht.
Nicht nur Geld, auch Gott spielt für die Mächtigen in Washington eine zentrale Rolle. Eine geheime Gruppe christlicher Fundamentalisten, die sich »die Familie« nennt, beeinflusst die amerikanische Politik. Mitglieder der »Familie« treffen sich regelmäßig im US-Kongress, im Verteidigungsministerium und anderen mächtigen Institutionen zu geheimen Gebetskreisen. Die geheimnisvolle Gemeinschaft kämpft zum Beispiel gegen die Homo-Ehe und gegen das Recht auf Abtreibung. All das berichtet mir ein Aussteiger. Um der Sache auf den Grund zu gehen, treffe ich das Oberhaupt der »Familie« zu einem höchst seltenen Interview.
Eine weitere besondere Begegnung erwartet mich mit dem Koch des Weißen Hauses. Andre Rush war für das leibliche Wohl aller Präsidenten von George W. Bush bis Donald Trump zuständig. Es war ausgerechnet die Angst, die ihn an den Herd getrieben hat. Das Kochen half dem Veteranen, mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung umzugehen. Seine Geschichte verrät viel über den Krieg der USA in Afghanistan, der offiziell beendet ist, dessen Schrecken aber für Soldaten wie Andre Rush niemals endet.
Um Über die Demokratie in Amerika zu schreiben, nahm der französische Publizist, Historiker und Politiker Alexis de Tocqueville 1831 das amerikanische Gefängnissystem unter die Lupe. Das erscheint mir heute wieder als ein vielversprechender Ansatz, denn nirgendwo auf der Welt sitzen so viele Menschen im Gefängnis wie in den USA. Mehr als 2,1 Millionen sind inhaftiert. Meine nächste Reise führt mich deshalb hinter die Gitter des legendären San Quentin State Prison in Kalifornien, wo Johnny Cash 1969 sein erfolgreichstes Livealbum aufnahm.
In Kalifornien kann beziehungsweise muss ich auch die Auswirkungen des Klimawandels beobachten. Die verheerenden Waldbrände dort haben allein im Jahr 2020 eine Fläche in der Größe von Rheinland-Pfalz vernichtet und eine neue politische Diskussion entfacht. Weil Donald Trump schlechtes Forstmanagement für die Feuer verantwortlich machte, nannte Joe Biden ihn einen »Klima-Brandstifter«. Biden vollzog eine radikale Abkehr vom Kurs seines Vorgängers und will in den kommenden Jahren gigantische Summen in eine »saubere Energiewende« investieren. Um für sein grünes Programm zu werben, bedient sich Biden allerdings auch eines altbewährten Mittels – der Angst.
Doch selbst gegen die Angst vor dem Tod scheint das Silicon Valley eine Technik entwickelt zu haben. Ich lerne einen modernen »Dr. Frankenstein« kennen, der Tote einfriert – in der Hoffnung, deren unheilbare Krankheiten in Zukunft bekämpfen und sie dann einfach wieder auftauen zu können. Außerdem treffe ich Forscherinnen und Forscher, die Alterungsprozesse verlangsamen und Krankheiten bekämpfen wollen, bevor sie Schaden anrichten. Und wer reich genug ist, soll Ersatzorgane aus dem 3-D-Drucker bekommen.
Während das Silicon Valley an der Zukunftsvision vom Triumph über den Tod arbeitet, sehnt man sich andernorts nach der Simplizität der Industriegesellschaft der 1950er-Jahre zurück. Zum Beispiel in West Virginia, das zu den ärmsten US-Bundesstaaten gehört. Seitdem unzählige Kohleminen geschlossen wurden, ist die Arbeitslosigkeit hoch und die Angst vor dem Abstieg groß. Es gibt viele Schmerzmittel- und Drogenabhängige. Im Rest des Landes werden die Bewohner West Virginias oft als »Hillbillys« (Hinterwäldler) verspottet, doch einmal im Jahr bietet sich für die Männer dort die Gelegenheit, sich ihren Stolz zurückzuholen und im Boxring für ein besseres Leben zu kämpfen.
Die Fäuste fliegen auch bei den »Proud Boys«. Nach außen geben sie sich als harmlose Patrioten. Doch Bürgerrechtsorganisationen stufen die rechte Bruderschaft als hasserfüllt und rassistisch ein. Am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 waren einige ihrer Mitglieder maßgeblich beteiligt. Noch kurz vor der Wahl statte ich ihnen in St. Louis einen Besuch ab, der seltene Einblicke ins Innenleben der gefährlichen Gruppe ermöglicht und das Phänomen des Rechtsextremismus in den USA konkret werden lässt.
Mit seinem Versprechen, die gesellschaftlichen Gräben zu überwinden, hat Joe Biden 2020 die Präsidentschaftswahl nur knapp gewonnen. Ein Besuch in seinem Heimatort Wilmington im US-Bundesstaat Delaware zeigt, warum ihm so viele Amerikaner tatsächlich zutrauen, das gespaltene Land zu einen. Ich treffe alte Weggefährten und überzeugte Anhänger wie den Kellner seines Lieblingsrestaurants. Aber selbst in Bidens Nachbarschaft gibt es kritische Stimmen, die Zweifel daran aufwerfen, ob Biden das tief gespaltene Land wirklich versöhnen kann.
Auf all meinen Stationen ist das Ringen zwischen Angst und Hoffnung allgegenwärtig – und das Ende offen. Vielen Deutschen ist das einstige Sehnsuchtsland Amerika, das wir so gut zu kennen glaubten, fremd geworden. Amerika macht vielen Deutschen manchmal sogar Angst. Um zu verstehen, warum, begleiten Sie mich auf dieser Reise durch ein Land im emotionalen Ausnahmezustand.
Die Anderen
Rassismus und Polizeigewalt im Alltag
Nur zögerlich nähere ich mich dem Geisterhaus in Tulsa, Oklahoma. Bedrohlich bäumen sich vier Säulen vor mir auf, die ein Dach aus verwitterndem Holz tragen. Die Fassade aus grauen Backsteinen ist so unsauber gemauert, als hätte ein ungeduldiges Kind sie errichtet. Gegen Blicke in ihr Innenleben wehrt sich die Südstaatenvilla mit geschlossenen Jalousien auf allen drei Stockwerken. Der Zierbrunnen vor dem Haupteingang hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Ich frage mich, ob der Anblick dieses Hauses schon immer Beklemmungen bei seinen Besuchern auslöste. Vielleicht hat der einstige Besitzer es sogar darauf angelegt, sein Haus nicht nur hochherrschaftlich anmuten, sondern auch Feindseligkeit ausstrahlen zu lassen. Vor dem großen Balkon im zweiten Stock hat sich eine schwarze Laterne dem Wind ergeben. Ich stelle mir vor, wie Wyatt Tate Brady in seinem Dreiteiler auf den Balkon tritt, den Scheitel wie immer streng gekämmt. Seine kalten Augen mustern den Besucher. Brady war einer der Gründerväter der Stadt Tulsa und ein leidenschaftliches Mitglied des Ku-Klux-Klans. Der rassistische Geheimbund schrieb maßgeblich an dem dunkelsten Kapitel der Geschichte Tulsas mit. Trotzdem ist noch heute das ganze Stadtviertel nach Brady benannt. »Brady Heights Historic District«, steht auf einem Straßenschild.
»Hey, Kumpel, willst du nicht reinkommen?«, höre ich plötzlich eine Stimme rufen. Dort, wo ich gerade noch den Geist des Ku-Klux-Klan-Mitglieds Brady wähnte, steht jetzt ein junger, schwarzer Mann. Steph Simon trägt Baseballkappe, T-Shirt und Turnschuhe, die Arbeitskleidung eines Rappers. Im Nebenberuf ist er eine Art Geisterjäger. Denn es ist natürlich kein Zufall, dass Steph ausgerechnet in der Brady-Villa sein Tonstudio eingerichtet hat. Der Musiker, der Anfang dreißig ist, holt mich an der Eingangstür ab und führt mich mit gemächlichen Schritten durch einen riesigen, unmöblierten Salon eine Treppe hinauf in einen Raum im zweiten Stock. Die Wände sind in Zartrosa gehalten. In der Ecke stehen zwei schwere Ledersessel, an der Wand ein riesiges Mischpult, Lautsprecher und ein Computer. Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, bitte ich Steph um eine musikalische Kostprobe aus seinem Album »Born on Black Wall Street«. Mit leiser Stimme willigt er ein, fast schüchtern. Doch sobald er vor dem Mikrofon steht, schießen die Worte laut und entschlossen aus seinem Mund. Seine Reime erzählen lange verheimlichte Dramen über seine Heimatstadt, die viel über Amerika verraten.
»Ich bin Dicky Rowland«, rappt Steph Simon und schlüpft damit in sein Alter Ego. Es gab Dicky Rowland wirklich. Die Verhaftung des neunzehnjährigen Schuhputzers löste 1921 in Tulsa eine Kette von unheilvollen Ereignissen aus. Nach heutigem Kenntnisstand stolpert der schwarze Rowland beim Betreten eines Aufzugs und hält sich an einem siebzehnjährigen weißen Mädchen fest. Das Mädchen schreit vor Schreck, ein Passant hört dies und ruft die Polizei. Er gibt eine versuchte Belästigung zu Protokoll. Am nächsten Tag behauptet die Lokalzeitung Tulsa Tribune in einem Artikel, Rowland habe dem Mädchen die Kleidung vom Leib gerissen. Vor dem Gerichtsgebäude, in dem Rowland inhaftiert ist, versammelt sich eine Gruppe von wütenden Weißen. Gerüchte von Lynchjustiz machen die Runde. Teile der schwarzen Bevölkerung von Tulsa ziehen bewaffnet zum Gerichtsgebäude, um Rowland zu beschützen. Es fallen Schüsse, zehn Weiße und zwei Schwarze sterben. Daraufhin zieht ein weißer Mob in das vorwiegend von Schwarzen bewohnte Stadtviertel Greenwood. Die Hauptstraße dort wird im Volksmund »Black Wall Street« genannt, weil fast nirgendwo sonst in den USA so viele unternehmerisch erfolgreiche Schwarze leben. Der weiße Mob brennt große Teile des Viertels nieder, etwa 300 schwarze Bürger sterben. Mindestens 1256 Häuser werden zerstört. Laut Zeitzeugenberichten werfen sogar Flugzeuge Brandbomben ab, was eine Beteiligung von Polizei und Militär nahelegt. Auch der Ku-Klux-Klan von Wyatt Tate Brady war maßgeblich an dem Gewaltexzess beteiligt. Es ist eines der grausamsten Massaker, die in Amerika je an Schwarzen verübt wurden. Die schwarze Bevölkerung beantragt 1,8 Millionen Dollar bei der Gebäudehaftpflichtversicherung, was heute umgerechnet einer Summe von 26 Millionen Dollar entspricht. Doch die Versicherung zahlt nicht. Nur der weiße Besitzer eines Pfandhauses bekommt 3994,57 Dollar für Munition ersetzt, die während des Massakers entwendet worden war. Die Klage gegen Dicky Rowland wird abgewiesen. Das weiße Mädchen aus dem Aufzug erklärt schriftlich, dass es den Fall nicht verfolgt wissen will.
Als sein Album veröffentlicht wird, hat Steph Simon auf seiner Internetseite direkt unter seiner Biografie ein Foto von sich in einem Aufzug mit einer weißen jungen Frau platziert. »Wir werden die Black Wall Street wieder aufbauen«, rappt er. Der Wiederaufbau beginnt für ihn mit der Erinnerung. Denn jahrzehntelang hat niemand in Tulsa über das Massaker gesprochen. Auch in der Schule hatte der 1987 geborene Rapper nie etwas über das Schicksal des Stadtviertels gehört, an dessen Rand er aufwuchs. Erst 2012 verfügte das Landesparlament von Oklahoma, dass alle Highschools das Massaker von Tulsa in den Lehrplan aufnehmen müssen. Steph führt mich auf den Balkon und zeigt mit dem Finger in die Ferne. »Dort hinter dem Hügel liegt Greenwood. Von hier aus konnte man sehen, wie die Black Wall Street in Flammen aufgeht. Und heute wiederholt sich die Geschichte.«
»Was genau meinst du?«
»Da draußen sterben wieder Menschen. All die Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze sind keine Ausnahmen, sondern Ausdruck der Natur Amerikas«, sagt Steph. »Amerika ist auf der Grundlage von Kriegen erbaut worden. Denk an den Unabhängigkeitskrieg, an den Bürgerkrieg, den Kampf zwischen Cowboys und amerikanischen Ureinwohnern. Alles, was ich in der Schule gelernt habe, drehte sich darum. Immer gab es einen Krieg, und aus dem Chaos resultierte Wandel. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade wieder in solch einem Krieg, und wenn wir noch nicht mittendrin sind, dann stehen wir wohl kurz davor.«
Steph sagt das völlig unaufgeregt, leise, sachlich. Er rückt sich seine Brille zurecht, ein Modell mit runden Gläsern und dünnen goldenen Bügeln, die auch ein Geschichtsprofessor tragen könnte. Es sind noch wenige Monate bis zur Präsidentschaftswahl. »Joe Biden, der Kandidat der Demokraten, hat versprochen, die Seele Amerikas zu heilen. Glaubst du, ihm kann das gelingen?«, frage ich.
»Ich lege es nicht in die Hände eines Präsidenten oder eines weißen Mannes, uns zu retten. Genau das ist doch seit Generationen das Problem. Uns wurde beigebracht, dass irgendwer unser Retter sein würde. Aber für mich ist das nicht der Fall.«
Nüchtern berichtet Steph von dem Alltagsrassismus, mit dem er konfrontiert wird, seitdem er denken kann. »Leute verriegeln zum Beispiel die Autotür, wenn du vorbeiläufst. Ich war schon an einem Punkt angekommen, wo ich nur noch in meiner Blase blieb, den Kontakt zu Weißen vermied. Ich brauchte auch nicht mehr das Gerede von Gleichheit oder das Mitleid.« Dann machten die Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze das Thema Rassismus in den Köpfen vieler Amerikaner präsent. Auch in Tulsa. »Es fühlt sich komisch an, dass mich plötzlich Weiße auf der Straße grüßen, mich fragen, wie es mir geht, oder meinen Kindern winken. Ich bin das einfach nicht gewohnt.«
Zwar findet Steph, das Versprechen von Joe Biden, »Amerikas Seele zu heilen«, sei lächerlich. Trotzdem wird er Biden seine Stimme geben. Denn der sei immerhin das kleinere Übel im Vergleich zu Trump, der rein gar nichts für Schwarze tue. Schließlich hätte er als Präsident die Debatte über Reparationszahlungen für die Nachfahren der Opfer des Massakers in der Black Wall Street neu eröffnen können. Eine entsprechende Klage vor dem Obersten Gerichtshof war 2005 abgewiesen worden, weil die Ansprüche verjährt seien. Als Provokation empfindet Steph Simon, dass Trump sich für seinen ersten Wahlkampfauftritt nach monatelanger coronabedingter Pause im Frühsommer 2020 ausgerechnet Tulsa ausgesucht hat. »Ich denke, dass dieser Präsident ein Rassist ist. Ich glaube zwar nicht, dass jeder seiner Anhänger ein Rassist ist. Aber Trump stachelt zu Rassismus an, und es ist ihm egal, dass er das tut.« Auch der Zeitpunkt für Trumps Besuch sei kein Zufall, sondern geradezu maliziös ausgewählt. Denn der Präsident wollte am sogenannten »Juneteenth« auftreten, jenem 19. Juni, an dem man in den USA der Proklamation der Sklavenbefreiung in Texas 1865 gedenkt. Die Kritik an Trumps Terminwahl fiel landesweit so heftig aus, dass er seine Wahlkampfveranstaltung um einen Tag verschob. Die Berater des Präsidenten befürchteten dem Vernehmen nach Ausschreitungen in Tulsa. Wir stehen noch immer auf dem Balkon. Steph lässt seinen Blick über die Skyline der Stadt wandern. Dann zeigt er mit dem Finger auf eine silbern in der Sonne glänzende Multifunktionsarena. »Sollte dieses Ding in Flammen aufgehen, werde ich mir das von hier oben aus ansehen.« Er meint das Gebäude, in dem Präsident Trump sprechen wird.
Dort unten vor der Arena erwartet mich ein völlig anderer Sound. Die Schwestern Camille und Haley Harris stehen am Haupteingang und singen zu Gitarrenklängen ihr selbst geschriebenes Lied »Keep America Great«. Gott, Waffen, Freiheit. All das bewahre Trump für sie. »Es ist Zeit zu wählen, Zeit zu beten«, fordern sie ihre Zuhörer im Refrain auf, untermalt mit einem charmanten Lächeln im Gesicht. Die beiden sind Ende zwanzig, unter ihren roten Baseballkappen mit weißem »Trump«-Schriftzug kommen weizenblonde Pferdeschwänze zum Vorschein.
Wie Steph Simon sind die Schwestern in Tulsa aufgewachsen. Die Kritik am Besuch des Präsidenten in ihrer Heimatstadt können sie nicht nachvollziehen. Schließlich versöhne Trump durch seine Politik doch die gespaltene Gesellschaft, erklärt mir Camille. »Präsident Trump möchte jedem sozialen Aufstieg ermöglichen. Und wenn Menschen hart arbeiten, wenn sie ohne Sozialhilfe klarkommen, empfinden sie Würde. Dann brauchen sie nicht die Regierung wie eine Mutter. Präsident Trump geht es um die Wirtschaft und um Gott. Er betet für unser Land und hält die Bibel hoch – auch wenn er dafür kritisiert wird. Aber wenn man sich fragt, wo die Seele Amerikas geblieben ist, müssen wir zu Gott zurückkehren. Sonst verlieren wir unsere Seelen.« Camille betont, dass sie aus Respekt vor Donald Trump seinen Namen nie ohne den Titel »Präsident« verwendet. Und ihre Schwester Haley ergänzt: »Eigentlich ist es die Aufgabe Gottes, die Seele Amerikas zu heilen. Aber wenn dies einem Menschen gelingen kann, dann ist das Präsident Trump.« Die teilweise gewalttätigen Proteste gegen schwarze Polizeigewalt wie etwa in Minneapolis verurteilt Haley scharf. »Wenn Menschen Gebäude niederbrennen, die ihnen nicht gehören, können sie nicht zwischen Richtig und Falsch unterscheiden. Und wenn sie das nicht können, fehlt ihnen wohl ein Herz für Gott.«
Der Vater der singenden Schwestern hat unser Gespräch aufmerksam verfolgt. Gemeinsam mit seiner Frau und drei weiteren Töchtern bildet er den Hintergrundchor. »Wir sind so stolz auf unsere Mädchen, denn sie leben, was sie glauben. Genau so, wie du sie hier erlebst, sind sie auch zu Hause. Sie leben ihr ganzes Leben für Gott.« Die Botschaft der Familie verbreitet sich rasend schnell im Internet. Mehr als sechzehn Millionen Mal wird ein Video mit ihrer Hymne auf Trump allein bei Twitter abgerufen.
Die Verehrung des Präsidenten kennt keine Grenzen. Einige seiner Anhänger kampieren schon drei Tage vor seinem Auftritt vor der Arena, um einen Platz in der ersten Reihe ergattern zu können. Sie haben Zelte aufgebaut und Campingstühle mitgebracht. Zwei Frauen von beeindruckender physischer Präsenz haben sogar Kühlbehälter herbeigerollt und scheinen sich schlürfend einen Wettbewerb im Colatrinken zu liefern. An vielen Zelten sind kleine amerikanische Flaggen befestigt. Besonders ins Auge sticht mir eine riesige Fahne, die Trump mit bombastischem Bizeps und Maschinengewehr in der Hand als Rambo zeigt. Kathy Gennington ist extra aus Kalifornien nach Oklahoma geflogen, um ihren Helden live auf der Bühne zu erleben. Sie trägt einen Cowboyhut mit dem Muster des Sternenbanners. Die hitzig geführte Debatte über Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze empfindet sie wie viele hier als übertrieben.
»Es gab doch gar kein Problem, bis die Demokraten eines daraus gemacht haben. Sie benutzen Schwarze wie Bauern in einem Schachspiel – bei jeder Wahl. Die Demokraten haben nie etwas für Schwarze getan, Trump hingegen schon. Viele Schwarze wollen ihn wählen. Das macht die Demokraten verrückt«, meint Kathy. Unter Präsident Trump sei die Arbeitslosigkeit unter schwarzen Amerikanern im Jahr 2019 auf einen historischen Tiefstand gefallen. Auch innerhalb der hispanischen Bevölkerung sei die Arbeitslosenquote mit rund 4 Prozent so niedrig gewesen wie nie zuvor. »Trump war nur wenige Jahre im Amt und hat trotzdem mit seiner Wirtschaftspolitik wahnsinnig viel für die Minderheiten erreicht«, sagt Kathy. Ihre Stimme ist so rauchig, dass sie damit wunderbar Werbespots für Whiskey einsprechen könnte. »Und was hat Joe Biden, der seit mehr als vierzig Jahren in der Politik ist, für die Schwarzen getan? Einen Scheiß! Er wird auch in Zukunft nichts bewirken!«
Auch David Hanning hat sich einen Platz weit vorne in der Warteschlange vor der Arena gesichert. Der selbstständige Klempner hat seine vier erwachsenen Söhne dabei. Die landesweite Aufregung über das Thema Rassismus kann er nicht nachvollziehen. Bei Polizeigewalt gegen Schwarze handele es sich um bedauerliche Einzelfälle. Aber die USA seien keineswegs so gespalten, wie die Medien vermitteln würden. »Ich weiß nicht viel über die Spaltung zwischen Schwarzen und Weißen. Ich persönlich nehme das nicht wahr. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Aber ich sehe am Arbeitsplatz und in der Gemeinde ein freundliches Miteinander. Ich sehe viele verschiedene Ethnien, die sich gegenseitig helfen. Ich glaube, Menschlichkeit ist stark ausgeprägt in Amerika. Hier in Tulsa kann man mit jeder Gruppe von Menschen in Kontakt treten.«
In der Theorie mag David recht haben. Doch in Wirklichkeit ist die Trennung zwischen schwarzen und weißen Bürgern fast nirgendwo sonst in den USA so sichtbar zementiert wie in Tulsa. Die Autobahn Interstate 244 teilt Tulsa in zwei Welten. Im Süden der Stadt leben vor allem weiße, wohlhabende Amerikaner. Im Norden wohnen vor allem schwarze Bürger, von denen mehr als jeder dritte in Armut lebt. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist hier mit 70,7 Jahren um 5,8 Jahre niedriger als im weißen Teil der Stadt. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ist die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens einmal verhaftet zu werden, für schwarze Bürger 2,3-mal so hoch wie für Weiße. Wie Ironie wirkt da der offizielle Beiname der Interstate 244: Martin Luther King Jr. Memorial Expressway.
Als ich über die symbolträchtige Autobahn fahre, höre ich die Musik von Steph Simon. Mir wird klar, dass der Rapper nicht nur die verdrängte Geschichte seiner Stadt zum Leben erweckt. Seine Reime ringen auch mit der schmerzhaften Gegenwart. »Ruhe in Frieden, Terence Crutcher!«, heißt es in einem Song. »Niemand wird meine Mission stoppen. Keine Betty wird mich fangen« (»Ain’t nobody gonna stop my mission. Ain’t no Betty’s gonna catch me slippin’«). Die Rede ist von Terence Crutcher und Betty Shelby, deren unheilvolles Aufeinandertreffen am 16. September 2016 noch heute die Seelen der Menschen in Tulsa in Aufruhr versetzt und die Stadt in zwei unversöhnliche Lager spaltet. Auf zwei Polizeivideos, die im Internet veröffentlicht wurden, sind die letzten Minuten im Leben des Terence Crutcher zu sehen. Das eine Video wurde von der Kamera eines Polizeiautos aufgenommen, einer sogenannten Dashcam. Wegen Crutchers mitten auf der Straße abgestellten Wagens waren die Beamten gerufen worden. Der vierzigjährige, schwarze Crutcher bewegt sich mit erhobenen Händen langsam auf sein stehendes Auto zu. Von hinten nähern sich ihm vier Polizisten mit gezogenen Waffen. Dann fällt Crutcher zu Boden. Der Polizeichef von Tulsa erklärt später, die Beamtin Betty Shelby habe ein Mal mit ihrer scharfen Waffe auf den Mann geschossen und ein weiterer Beamter mit einer Elektroschockpistole. Weder am Körper des Erschossenen noch in seinem Auto sei eine Waffe gefunden worden. Die Schützin habe angegeben, der Verdächtige habe nicht kooperiert. Das zweite Video wurde aus der Luft von einem Polizeihelikopter aufgenommen, in dem zwei Polizisten saßen. Einer davon war zufällig Shelbys Ehemann. »Dieser Kerl läuft immer noch«, kommentiert einer der beiden Beamten das Geschehen am Boden. Offensichtlich folgt Crutcher nicht der Aufforderung, stehen zu bleiben. »Der sieht auch wie ein böser Kerl aus«, sagt der andere Polizist. Crutcher ist groß, kräftig und schwarz. Mehr kann man vom Hubschrauber aus nicht erkennen. Dann fällt der Schuss. Crutcher bleibt etwa zwei Minuten allein auf dem Boden liegen, bevor einer der Beamten sich Handschuhe überzieht und ihn versorgt. Vergeblich.
Die Szenen sind unerträglich. Trotzdem sehe ich sie mir mehrfach an, auf der Suche nach einer Erklärung für den Schuss. Als Laie kann ich keinen Auslöser für Shelbys Handeln erkennen. Auch die Justiz scheint das zunächst so zu sehen. Wenige Tage nach dem Todesschuss auf den unbewaffneten Crutcher wird Shelby beurlaubt und wegen Totschlags angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr mindestens vier Jahre Haft. Außerdem leitet das US-Justizministerium wegen einer möglichen Verletzung von Bürgerrechten eigenständige Ermittlungen ein. Doch Shelbys Anwalt argumentiert, sie habe den Schuss abgegeben, als Crutcher sich zum Fenster seines Wagens gebeugt habe. Ein Geschworenengericht spricht die Polizistin frei. Heute arbeitet Betty Shelby immer noch für die Polizei von Tulsa. Sie lehrt in Seminaren, wie man Konfliktsituationen deeskaliert. Das ist kein Scherz.
Die Augen von Crutchers Vater können die ungezählten Tränen nicht verbergen, die sie vergossen haben. Joey Crutcher ist Pfarrer, doch in den vergangenen Jahren hat er oft an Gott gezweifelt. Von seinen vier Söhnen sitzt der jüngste im Gefängnis, weil er Crack verkaufte. Zwei Söhne hatte er schon durch Krankheiten verloren. Dann wurde Terence erschossen. Seine Stimme fehlt dem Vater jeden Sonntag im Gospelchor. »Er war mein Hauptsolist«, sagt Pfarrer Crutcher über Terence. »Er liebte es, zu singen.« Nicht nur, wenn der Pfarrer am Klavier sitzt, denkt er an seinen Sohn. »Jedes Mal, wenn ein schwarzer junger Mann von der Polizei getötet wird, kommen all die Erinnerungen zurück. Ich durchlebe alles noch einmal.«
Crutcher hat mich in den Garten seines Mietshauses in einem gutbürgerlichen Viertel auf der »schwarzen Seite« von Tulsa eingeladen. Zur Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir Interviews angesehen, die der Pfarrer kurz nach dem Todesschuss auf seinen Sohn gegeben hatte. Damals wirkte er gefasst, sprach mit breiter Brust. Er verteidigte das christliche Prinzip der Vergebung. Seine Priesterweihe verpflichte ihn, selbst Betty Shelby zu lieben. Er vergebe der Polizistin, er bete für sie. Der Pfarrer musste damals an die Ermordung von Martin Luther King denken. »Ich diente meinem Land in Vietnam, als er erschossen wurde. Meine Großmutter und meine Mutter hatten ihn nicht gemocht. Sie sagten: Er ist ein Unruhestifter. Er sollte besser den Mund halten.«
Pfarrer Crutcher wollte kein Unruhestifter sein, als sein Sohn erschossen wurde. Viele junge Schwarze kamen zu ihm und fragten: Pfarrer, was sollen wir tun? Er rief die Jugend zur Besonnenheit auf. »Betet für Terence und für Tulsa. Macht nur um Gottes willen keinen Aufstand.« Aber Crutcher sagte damals auch diesen Satz: »Ich will Gerechtigkeit für meinen Sohn. Und die Polizistin hat ein Verbrechen begangen.« Dann kam der Freispruch.
Heute spricht Pfarrer Crutcher viel leiser als auf dem Video, sein Oberkörper hat die aufrechte Haltung aufgegeben. Vor mir sitzt ein gebrochener Mann.
»Gegen Betty Shelby lagen schon Beschwerden vor, noch bevor sie überhaupt Polizistin wurde. Wäre sie schwarz gewesen, wäre sie mit ihrer Akte niemals eingestellt worden.« Shelby sei freigesprochen worden, weil ihre Anwälte Terence als gefährlich dargestellt hätten. Er hatte Drogenprobleme, hatte auch zum Zeitpunkt seines Todes Substanzen im Blut. Das machte ihn in den Augen der Geschworenen zur Gefahr für Shelby, obwohl seine Hände auf dem Autodach lagen. »Ich hatte Terence sogar immer eingetrichtert, dass er die Hände auf das Dach legen soll, falls er mit der Polizei in Kontakt kommt«, sagt Pfarrer Crutcher. »Wahrscheinlich ist er deshalb auch einfach weiter zum Auto gelaufen, als die Polizei ihn aufforderte, stehen zu bleiben. Er tat, was ich ihm gesagt hatte, und wurde deshalb erschossen.« Betrachtet er die Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze als systemisches Problem? »Ich glaube nicht, dass die Polizisten morgens mit der Absicht aufwachen, einen schwarzen Mann zu töten. Ich glaube auch nicht, dass jeder Polizist ein Rassist ist. Und trotzdem gibt es ein systemisches Problem.«
Nun versucht Pfarrer Crutcher, seinen Enkel vor dem System zu beschützen. Auch ihm hat er gesagt, wie er sich verhalten soll, wenn er mit der Polizei in Berührung kommt. Dieses Gespräch führen Millionen schwarze Eltern in den USA mit ihren Kindern – es wird »The Talk« genannt. Terence Junior ist acht Jahre alt und dreht auf seinem Fahrrad Runden in der Garageneinfahrt. Der Junge sehe genauso aus wie sein Vater, sagt der Pfarrer. »Es ist, als ob ich ihn noch einmal großzöge. Irgendwann wird wohl diese Wut in ihm hochkommen. Davor versuche ich ihn zu bewahren.«
»Glauben Sie nicht, dass Ihr Enkel noch mehr von seiner Zukunft erwarten kann, als nicht von der Polizei erschossen zu werden? Glauben Sie, dass Joe Biden die Seele Amerikas heilen kann, so wie er es verspricht?«, frage ich.
»Ich glaube nicht mehr an dieses Land. Egal, wer der Präsident ist. Alles ist scheinheilig. Das ganze Gerede von der Unabhängigkeitserklärung. Wir sollen immer noch daran glauben, was alte weiße Männer vor so vielen Jahren geschrieben haben, unsere Gründerväter. Und noch immer haben wir Schwarzen keine richtige Macht. Es ist die Welt des weißen Mannes.«
In fast jeder Lebenssituation spüre er Rassismus. Sein weißer Vermieter weigere sich, Reparaturen am Haus vorzunehmen, die 1500 Dollar kosten würden. »Wenn ich auch weiß wäre, hätte der Vermieter die Dinge schon längst geregelt.« Für Schwarze sei es auch viel schwieriger, einen Kredit zu bekommen. An der Situation der Schwarzen habe sich im Kern nichts geändert, noch immer würden sie entmenschlicht. »Es begann damit, wie wir auf Sklavenschiffen von der Westküste Afrikas hierhergebracht wurden. Wenn jemand starb, wurde er einfach ins Wasser geschmissen. Schwarze Haut zählt nicht. Inzwischen haben die Menschen Flugzeuge und Handys erfunden, aber die Menschlichkeit haben sie immer noch nicht entdeckt.«
Eine Weile sitzen wir da und schweigen. In Joey Crutchers Leben scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Es ist egal, ob es Montag ist oder Donnerstag, ob 2017 oder 2025. Es wird nie sein, wie es mal war. Es wird sich nie etwas ändern.
In seinen Predigten ruft Joey nicht mehr zur Versöhnung auf, sondern bereitet die Gemeinde auf Gewalt vor. »Im Matthäusevangelium heißt es: ›Ihr werdet von Kriegen hören, und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Es wird Gewalt geben.‹ All das passiert jetzt.« Noch lange hallen die Worte aus dem Matthäusevangelium in meinem Kopf nach. Es macht mir Angst, dass selbst ein Pfarrer die Gewalt für unabwendbar hält.
Die Luft ist heiß und drückend, als ich mich auf den Weg zur Black Wall Street mache. Kleine Gedenktafeln im Boden erinnern an die Schicksale der Menschen, die hier ihre Leben und ihre Lebenswerke verloren. »In Gedenken an den Rechtsanwalt B. C. Franklin«, heißt es auf einem Stein. »In Erinnerung an das Stradford Hotel«, steht auf einem anderen. 600 Firmen, 30 Lebensmittelgeschäfte, 21 Kirchen, 21 Restaurants, zwei Kinos, ein Krankenhaus und eine Bank gab es in dem florierenden Viertel. Fast alles wurde bei dem Massaker 1921 zerstört, fast nichts davon wiederaufgebaut. Wie offene Wunden klaffen Lücken zwischen den Häusern. In den schmucklosen Backsteinbauten werden keine Millionen mehr umgesetzt wie damals. Auf den ersten Blick haben zwei Klamottenläden am meisten Kundschaft und eine Firma, die Kredite für Kautionen vergibt.
»Mich schmerzt besonders, dass die Polizei damals an dem Massaker beteiligt war und dass niemals jemand verurteilt wurde«, sagt Drew Diamond. Er ist einer von wenigen weißen Bürgern von Tulsa, die heute die Black Wall Street besuchen. Drew war selbst 22 Jahre lang Polizist mit Leib und Seele, vier Jahre sogar Polizeichef von Tulsa. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt, hat er ein Konzept entwickelt, um rassistisches Verhalten von Polizisten zu vermeiden. »Die meisten Polizisten sehen sich als Krieger, nicht als Beschützer. So lernen sie es. Wie im Film sitzen sie schwer bewaffnet in ihrem Wagen und warten geradezu darauf, dass ein böser Mann kommt, auf den sie schießen können«, erklärt Drew. Er ist Anfang siebzig, aber noch in bemerkenswert guter Form. Strammen Schrittes führt er mich durch das Viertel. Lachfältchen betonen seine spitzbübischen braunen Augen. Auch sein gut getrimmter grauer Schnurrbart verleiht ihm eher die Aura eines gutmütigen Bewährungshelfers als die eines knallharten Cops.
Ende der Leseprobe