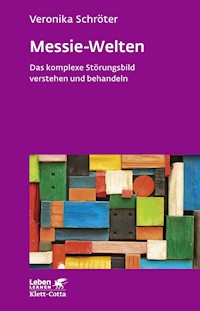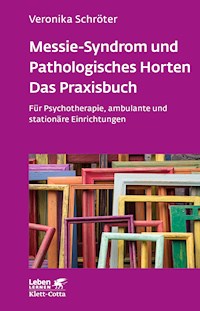
Messie-Syndrom und Pathologisches Horten – Das Praxisbuch (Leben Lernen, Bd. 332) E-Book
Veronika Schröter
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Praxisbuch für Messie-Berater Autorin ist führende Messie-Expertin im deutschsprachigen Raum »Pathologisches Horten« neu in der ICD-11 aufgenommen Erklärung der psychologischen Hintergründe und des praktischen Vorgehens Auch von Fachleuten wird oft übersehen, dass das Verhalten von Messies durch psychische Störungen ausgelöst wird. Messies können sich nicht »endlich mal zusammenreißen« und ihre Wohnung entmüllen. Die Autorin, führende Messie-Expertin im deutschsprachigen Raum, erklärt in diesem Buch anschaulich, wie sich die verschiedenen Ausprägungen: Vermüllung, Verwahrlosung und das als neue Diagnose aufgenommene »Pathologische Horten« voneinander unterscheiden und welche Grunderkrankungen jeweils zugrunde liegen. Diese differenzierte Betrachtung ist die Basis einer erfolgreichen Begleitung und Therapie, die hier in allen psychologischen und betreuerischen Aspekten dargestellt wird. Psychologische Fachkräfte und Helfer können sich so an klaren Konzepten und professionellen Standards orientieren und Schritt für Schritt gesichert vorgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Ähnliche
Veronika Schröter
Messie-Syndrom und Pathologisches Horten – Das Praxisbuch
Für Psychotherapie, ambulante und stationäre Einrichtungen
Klett-Cotta
Zu diesem Buch
Auch von Fachleuten wird oft übersehen, dass das Verhalten von Messies durch psychische Störungen ausgelöst wird. Messies können sich nicht »endlich mal zusammenreißen« und ihre Wohnung entmüllen. Die Autorin, führende Messie-Expertin im deutschsprachigen Raum, erklärt in diesem Buch anschaulich, wie sich die verschiedenen Ausprägungen: Vermüllung, Verwahrlosung und das als neue Diagnose aufgenommene »Pathologische Horten« voneinander unterscheiden und welche Grunderkrankungen jeweils zugrunde liegen. Diese differenzierte Betrachtung ist die Basis einer erfolgreichen Begleitung, die hier in allen psychologischen und betreuerischen Aspekten dargestellt wird. Psychologische Fachkräfte und Helfer können sich so an klaren Konzepten und professionellen Standards orientieren.
Die Reihe »Leben Lernen« stellt auf wissenschaftlicher Grundlage Ansätze und Erfahrungen moderner Psychotherapien und Beratungsformen vor; sie wendet sich an die Fachleute aus den helfenden Berufen, an psychologisch Interessierte und an alle nach Lösung ihrer Probleme Suchenden.
Alle Bücher aus der Reihe ›Leben Lernen‹ finden Sie unter: www.klett-cotta.de/lebenlernen
Impressum
Leben Lernen 332
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von Jessica Ruscello on Unsplash
Konzeptionsberatung der Autorin: Dr. Bettina Burchardt
www.bettina-burchardt.de
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Altusried Krugzell
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-89280-2
E-Book ISBN 978-3-608-11879-7
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20558-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorworte
Teil 1
Einführung in die Messie-Thematik
Kapitel 1
Woran leiden desorganisierte Menschen?
1.1 Das pathologische Horten
1.1.1 Die Betroffenen
1.1.2 Die Wohnung
1.1.3 Auswirkungen des pathologischen Hortens auf das soziale Umfeld
1.1.4 Gefahren durch das pathologische Horten
1.1.5 Langfristige Folgen des pathologischen Hortens
1.2 Das Vermüllungssyndrom
1.2.1 Die Betroffenen
1.2.2 Die Wohnung
1.2.3 Auswirkungen der Vermüllung auf das soziale Umfeld
1.2.4 Gesundheitliche Gefahren durch die Vermüllung
1.2.5 Langfristige Folgen des Vermüllungssyndroms
1.3 Das Verwahrlosungssyndrom
1.3.1 Die Betroffenen
1.3.2 Die Wohnung
1.3.3 Auswirkungen der Verwahrlosung auf das soziale Umfeld
1.3.4 Gesundheitliche Gefahren durch Verwahrlosung
1.3.5 Langfristige Folgen des Verwahrlosungssyndroms
1.4 Überschneidungen zwischen den drei Formen des Messie-Syndroms
1. 5 Fazit
Kapitel 2
Messies verstehen – Die große Bedeutung der Bindungsstörungen
2.1 Emotionale Bindung – Die Basis einer gesunden Entwicklung
2.1.1 Die positive Bindungsentwicklung bei Kindern
2.1.2 Die Ausbildung der Identität
2.1.3 Bindungstraumata ab dem frühesten Kindesalter
2.1.4 Spätere Bindungstraumata
2.1.5 Die Nachwirkungen von Kriegserlebnissen
2.1.6 Die fehlende Heimat im eigenen Inneren
2.2 Bindungsstile und Bindungsstörungen
2.3 Ursachen und Folgen des pathologischen Hortens
2.3.1 Das Selbstbild der Menschen, die pathologisch horten, und seine Folgen
2.3.2 Der Perfektionismus der Menschen, die pathologisch horten
2.4 Fazit
Kapitel 3
Symptome und Auswirkungen der relevanten Komorbiditäten
3.1 Die Anamnese
3.2 Klassifikation der psychischen Krankheiten
3.3 Krankheiten, die ein Messie-Syndrom begleiten können
3.3.1 Organische psychische Störungen
3.3.2 Abhängigkeit und Sucht
3.3.3 Affektive Störungen
3.3.4 Persönlichkeitsstörungen
3.3.5 Schizophrenie
3.3.6 Entwicklungsstörungen
3.3.7 Neurotische Störungen
3.3.8 Suizidalität
3.4 Checkliste Komorbiditäten
Teil 2
Begleitende und therapeutische Hilfestellungen für Messies
Kapitel 4
Der Weg zurück zur Würde
4.1 Die Bedeutung der Würde im Heilungsprozess
4.1.1 Der Zusammenhang von Würde und Entscheidungsfähigkeit
4.1.2 Non-direktives und direktives Vorgehen in der Betreuung von Messies
4.2 Vertrauen – Dreh- und Angelpunkt der Fallarbeit
4.2.1 Sprache als Schlüssel für Vertrauen
4.2.2 Wertschätzende Kommunikation
4.3 Die Bedeutung des sozialen Umfeldes
4.3.1 Konfliktpotenziale zwischen Messies und ihrem sozialen Umfeld
4.3.2 Die Kooperation des sozialen Umfeldes sichern
4.4 Fazit
Kapitel 5
Möglichkeiten und Grenzen der Fachkräfte
5.1 Wertvolle Kompetenzen im Umgang mit Messies
5.2 Besondere Herausforderungen der Fachkräfte
5.2.1 Der Umgang mit Frustrationen
5.2.2 Der Umgang mit zu hohen Erwartungen
5.2.3 Der Umgang mit Konflikten
5.2.4 Der Umgang mit knappen Ressourcen
5.2.5 Der Umgang mit unangenehmen Gerüchen
5.3 Selbstschutz durch Psychohygiene
5.3.1 Selbstwahrnehmung
5.3.2 Abgrenzung vom Klienten
5.3.3 Unterstützung suchen und annehmen
5.3.4 Supervision
Kapitel 6
Die Identitätsbildende Integrative Messie-Therapie® nach Veronika Schröter
6.1 Die Ebenen der Identitätsbildenden Integrativen Messie-Therapie
6.1.1 Neue Bindungserfahrungen ermöglichen
6.1.2 Die Messie-Symptome als positive Absicht erkennen und würdigen
6.1.3 Die Bedeutung hinter den Dingen entschlüsseln
6.1.4 Den Auslöser beziehungsweise das Symptom in das Leben des Klienten integrieren
6.1.5 Die Willenskraft des Klienten stärken
6.1.6 Freude und Lebendigkeit im Leben des Klienten integrieren
6.2 Grundbausteine der Identitätsbildenden Integrativen Messie-Therapie
6.2.1 Gestalttherapie
6.2.2 Systemische Therapie
6.2.3 Hypnotherapie
6.2.4 Körpertherapie
6.2.5 Gruppentherapie
6.3 Prägungsarbeit – Das Herzstück der Identitätsbildenden Integrativen Messie-Therapie
6.3.1 Die Lebenswunde des Klienten identifizieren
6.3.2 Die Lebenswunde therapeutisch versorgen und heilen
6.3.3 Veränderungen im Wohnraum einleiten
6.4 Wege der Selbstermächtigung – Therapeutische Übungen
6.4.1 Wie Klienten lernen, sich besser wahrzunehmen
6.4.2 Wie Klienten lernen, sich besser zu verstehen
6.4.3 Wie Klienten lernen, sich besser zu regulieren
6.4.4 Wie Klienten lernen, sich als selbstwirksam wahrzunehmen
Teil 3
Professionelle Fallarbeit mit Messies – Erfolg durch klare Konzepte und standardisiertes Arbeiten
Kapitel 7
Leitfaden für die Fallarbeit mit Messies
7.1 Methodischer Ablauf der Fallarbeit
7.1.1 Den Auftrag klären
7.1.2 Das Krankheitsbild definieren
7.1.3 Das Problem definieren
7.1.4 Die Ressourcen des Klienten erkennen
7.1.5 Fernziele festlegen
7.1.6 Nahziele festlegen
7.1.7 Maßnahmen durchführen
7.2 Praktischer Ablauf der Fallarbeit
7.2.1 Der Erstkontakt am Telefon
7.2.2 Das erste persönliche Treffen an einem neutralen Ort
7.2.3 Der Besuch im Wohnumfeld Ihres Klienten
7.2.4 Gefährdungen des Kindeswohls erkennen
7.2.5 Die weiteren Schritte
7.3 Checkliste Fallarbeit
Kapitel 8
Konzeptentwicklung und prozessorientiertes Vorgehen
8.1 Konzept und Konzeption
8.2 Konzeptentwicklung
8.3 Mehr Wirksamkeit durch klare Regeln
8.3.1 Klare Regeln im stationären Dienst
8.3.2 Klare Regeln im ambulanten Dienst
8.4 Standardisiertes Vorgehen bei allen drei Ausprägungsgraden
8.4.1 Die Vorbereitung: Strukturieren und in die Wege leiten
8.4.2 Die konkreten Handlungsschritte: Der Dreistufen-Plan zur Durchführung der Maßnahme
8.4.3 Evaluation: Nachbesprechung und Chancen zur Verbesserung
Kapitel 9
Der Aufbau eines Kompetenznetzwerks
9.1 Die Helferkonferenz
9.1.1 Die gemeinsamen Ziele formulieren
9.1.2 Die Zuständigkeiten und Gestaltungsspielräume definieren
9.1.3 Die finanzielle Situation umfassend klären
9.1.4 Die Abläufe sinnvoll strukturieren
9.1.5 Kurze Wege in der Kommunikation etablieren
9.1.6 Die optimale Besetzung des Helferteams gewährleisten
9.2 Der Einsatz ausgebildeter Messie-Fachkräfte
9.3 Checklisten möglicher Kooperationspartner
9.4 Der Idealzustand der Fallarbeit mit Messies – Drei Fallbeispiele
9.4.1 Aus dem Alltag des Jugendamtes: Mobbing in der Schule
9.4.2 Aus dem Alltag einer stationären Einrichtung: Ein Inselbegabter findet seinen Platz
9.4.3 Therapeutischer Erfolg bei pathologischem Horten: Versöhnung mit der Familiengeschichte
Danksagung
Literatur
Bindung, Bindungstheorie und deren Folgen
Messie-Syndrom und Pathologisches Horten
Trauma
Gestalttherapie
Vorworte
Das komplexe Thema verdient gleich drei Vorworte – drei Menschen haben mir die Freude gemacht, ihre Eindrücke zu dem vorliegenden Buch in einige Worte zu fassen: eine Diplom-Psychologin, die etliche meiner Klienten betreut, ein Sozialarbeiter, der tagein, tagaus direkt im Wohnumfeld der Messies wirkt, sowie ein Psychiater an der Freiburger Universitätsklinik.
***
Ich bin voll tiefer Dankbarkeit, dass Sie das »Stiefkind« Messiesyndrom aufgegriffen, mit so viel Engagement, Liebe und Verstand jahrelang durchdrungen und es für Patienten und Therapeuten »erhellt« haben. Sie helfen uns allen damit ein großes Stück heraus aus Unverständnis, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Mit der Messie-Therapie geben Sie uns ein integratives Werkzeug an die Hand, welches nicht allein durch die Technik, sondern durch die innewohnende würdevolle, entdeckungsfreudige und kreative Haltung seine Heilwirkung entfaltet.
Die Therapie ist verbunden mit hoher Achtung und Wertschätzung gegenüber den Patienten. Sie werden aus dem dunklen Stigma des Versagens, des »unmöglichen Menschen, wie kann er/sie nur …«, des Nichtverstanden-Werdens herausgehoben ins würdigende Licht, das seinem Verhalten Sinn und Bedeutung gibt und ihn in seiner Fähigkeit, Lebenswunden und Prägungen zu überleben, anerkennt.
Als Quereinsteigerin gelingt es Frau Schröter, das oft einengende therapeutische Schulrichtungsdenken zu verlassen und ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Patienten und seines Umfeldes, die Edelsteine verschiedener therapeutischer Verfahren herauszulesen und ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das prägende Biografie, die Gegenwart im Hier und Jetzt, Gestaltungskraft, Arbeit mit Körper und Bildern, Gruppen und Familie und vieles mehr umfasst.
Schon beim Lesen wird die Ganzheitlichkeit, der Reichtum und die Heilkraft des Therapiekonzeptes erlebbar. Durch die lebensnahe, anschauliche, gleichzeitig strukturierte und analytische Schreibweise kommt der Leser in Kontakt mit sich selber. Man gerät ins Nachdenken über eigene Prägungen, erlebt durch die Worte liebevolles Angenommen-und-verstanden-Werden, bekommt Zugang zu eigenen Gefühlen, Körpererleben, der Bilderwelt und Kreativität. Eigene Haltungen zu »Messies« werden bewusst, es findet eine Sensibilisierung für Bedeutungen und Hintergründe des »Hortens« statt.
Mit der Identitätsbildenden Integrativen Messie-Therapie steht ein wunderbares integratives Ausbildungs- und Therapiemanual für Betroffene, Angehörige und Therapeuten zu Verfügung.
Sabine Maacks-Plesch, Bad Krozingen,
seit 35 Jahren als psychologische Psychotherapeutin
sowie Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapeutin tätig.
***
Dieses mutige, umfassende Werk ist als Praxishandbuch für die wohnraumbezogene soziale Arbeit mit betroffenen Menschen vor Ort konzipiert und zugleich als analytisch wie methodisch anregende und ermutigende Lektüre zu empfehlen. Das gilt vor allem für Fachleute, die im Wohnraum mit den KlientInnen die Dinge in die Hand nehmen müssen; wo nichts am angestammten Ort bleibt; mit dem Ziel, die Wohnraumsituation zu verbessern und damit den Wohnungserhalt zu sichern.
Dazu bietet dieses detailliert durchgearbeitete Buch treffende Analysen und Methodenvorschläge, gemeinsam mit den Betroffenen ins kommunikative, habhafte Handeln zu kommen. Positiv ist dabei, dass die Autorin die unterschiedlichen Problemkategorien zu beschreiben weiß und sie gleichzeitig voneinander abgrenzt, ohne an einer starren Ausschließlichkeit festzuhalten. Denn die Kategorien Sammeln und Horten/Vermüllung/Verwahrlosung überlagern und durchdringen sich gerne in der wirklichen Problemlage; und die SozialarbeiterInnen wissen manchmal nicht, in welcher Sphäre sie praktisch anfangen sollen; und dann sind da auch noch die Betroffenen mit ihren eigenen Vorstellungen. Hier gibt das Buch gute Vorgehenshilfen zum Beispiel in punkto Auftragsklärung.
Freilich ist es hilfreich, im Zusammenhang mit den betroffenen Persönlichkeiten Erkenntnisse über Hintergründe und Ursachen zu haben, die ihr entgleistes Wohnraumverhalten antreiben und befeuern. Im vorliegenden Werk wird gerade gezeigt, dass Wohnraumarbeit vorderhand eben nicht bedeutet, einfach die Ärmel hochzukrempeln, in die Hände zu spucken – und dann wird mal zügig aufgeräumt und ausgemistet (Situationskommentar: »Wie siehts denn hier aus? Alles muss raus!«); zumal dann, wenn die betroffene Person noch gar nicht innerlich bereit dazu ist.
Erforderlich ist geduldiges, beharrliches wie rückfallerprobtes Herangehen, bei dem der betroffene Mensch ermutigt wird, im Handlungsverlauf mitzugehen, indem er sich in den Arbeitsprozess eingebunden fühlt und ihn idealerweise mitbestimmt, da es um seinen Wohnraum als Verantwortungsort geht. So erschließen sich in der Lektüre dieses Buches die einzelnen Schritte des Vorgehens, als Leitfaden pragmatischer Sozialarbeit in vertrauensbildender Beziehung zum Menschen und seiner Wohnumgebung – wie sie sich eingangs darstellt und wohin sie entwickelt werden kann; in Hinblick auf Wohnraumsicherung sowie auf Wohlbefinden.
Der Autorin gelingt mit diesem Werk die Verbindung von analytischer Tiefenschärfe mit praxisbezogener Handlungsanleitung, ohne sich in die Gefahr des Methodenzwangs oder der Grenzverletzung zu begeben. Sie weiß aus Erfahrung, wie die »Grammatik der Dinge« vor ihrem je eigenen Horizont gelesen werden soll: Indem der Wohnraumarbeitende fähig wird, die Perspektive zu wechseln, um sein Gegenüber inmitten der vielfältigen Dinge, in der vermeintlichen Unübersichtlichkeit ihrer Ordnung sein lassen zu können. Denn im Spektrum der Leidenschaften des Sammelns gilt das Bonmot von Manfred Sommer – hier abgewandelt:
»Sammeln, das schließlich mit dem Verschwinden im Gesammelten endet, das nenne ich – allzu menschlich!«
Jürgen Thomas
Diplom-Sozialarbeiter im HERA-Team (Helfen und Räumen)
des Caritasverbandes für Stuttgart e. V.
***
Frau Veronika Schröter hat mit »Messie-Welten« bereits ein Buch vorgelegt, in dem sie ihre jahrzehntelange Erfahrung mit dem von der Schulmedizin lange vernachlässigten Messie-Syndrom in ein diagnostisches und therapeutisches Konzept einbringen konnte. Das vorliegende Buch ist die konsequente Weiterentwicklung, auch angesichts der anstehenden Neuerungen in Diagnose- und Abrechnungssystemen durch ICD-11. Mit dem »Horten« wird nämlich zumindest eine Facette der »Messie-Welten« Eingang finden in das offizielle medizinische Denken. Frau Schröter gelingt es, die Verbindung zwischen neuer Diagnose und bewährten Konzepten herzustellen und sie kann zeigen, wie das »Messie-Syndrom« in der ICD-11 integriert und als Diagnose etabliert sein wird. Der Leser bekommt damit nicht nur einen diagnostischen Leitfaden für dieses immer häufiger zu berücksichtigende Syndrom an die Hand, er erhält auch ein Therapiemanual, mit dem er Erfahrungen mit dieser zwar altbekannten, jetzt aber doch auf andere Art neuen Patientengruppe sammeln kann.
Ich wünsche dieses Buch vielen Betroffenen als Ratgeber und vielen Behandlern als Begleiter in Therapie und Diagnostik.
Prof. Dr. Dieter Ebert
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Leiter der psychiatrischen Institutsambulanz
des Universitätsklinikums Freiburg
Teil 1
Einführung in die Messie-Thematik
Hier ein erster Überblick: Der erste Teil macht die Welt der Betroffenen zugänglich.
Kapitel 1 nennt die drei Ausprägungen der Messie-Symptomatik, unter denen desorganisierte Menschen leiden: pathologisches Horten, Vermüllung und Verwahrlosung. Jedes dieser drei Messie-Syndrome hat ganz eigene Ursachen und Symptombilder. Wer sie nicht kennt und klar voneinander unterscheiden kann, wird an dem Versuch scheitern, angemessen auf Klient beziehungsweise Patient einzugehen. Dass es auch Überschneidungen zwischen diesen drei grundlegenden Formen gibt, macht die Arbeit mit Messies nur noch komplexer.
Kapitel 2 erläutert die große Bedeutung der Bindungserfahrungen und Störungen, die sich aus Bindungsverletzungen entwickeln können; in vielen Fällen stehen sie am Anfang der Krankheitsgeschichte eines Messies. Vor allem bei Menschen, die pathologisch horten, finden sich frühe Erfahrungen von Zwang, emotionaler Verlassenheit oder Überbehütung. Die Folgen sind existenzielle Verunsicherung sowie mangelnde Ausbildung einer eigenen Identität und eines eigenen Willens. Im Umgang mit dieser Klientel muss besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse gerichtet werden, die aus den bisherigen Bindungserfahrungen der Klienten erwachsen.
Kapitel 3 nennt die Symptome und Auswirkungen der relevanten Komorbiditäten. Fast immer werden die drei Messie-Syndrome von weiteren Krankheiten begleitet; nur das pathologische Horten steht in etwa 24 Prozent der Fälle als Krankheitsbild für sich allein. Bei Vermüllung und Verwahrlosung dagegen sind immer Komorbiditäten vorhanden; am häufigsten finden sich Depressionen, Suchterkrankungen, psychiatrische Krankheitsbilder und Demenz. Von besonderer Bedeutung – auch bei Menschen, die pathologisch horten – ist die relativ häufig auftretende Suizidalität.
Kapitel 1
Woran leiden desorganisierte Menschen?
Menschen, die beruflich mit sogenannten Messies zu tun haben, stehen den Symptomen der Betroffenen häufig hilflos gegenüber. Gefühle der inneren Abwehr und Verurteilungen können den Weg zu einer Lösung versperren. Dazu kommt, dass sie von den beauftragenden Institutionen oft keine angemessene Unterstützung erfahren, um den Betroffenen nachhaltig zu helfen. Denn lange Zeit wurden weniger die Nöte der Messies gesehen, der Fokus lag – und liegt in vielen Fällen heute immer noch – nur auf den sichtbaren Auswirkungen dieser Nöte:
Desorganisierten Menschen gelingt es nicht, in ihrem privaten Umfeld so weit Ordnung zu halten, dass sie dort angenehm und entspannt leben können. Der Zustand ihrer Wohnungen und Häuser stößt auf Unverständnis.
Die Unordnung kann die Lebensqualität von Partnern, Familienmitgliedern und Nachbarn gravierend beeinträchtigen; Vermieter fürchten um die Bausubstanz ihrer Immobilie. Kontakte zwischen Messies und ihrem sozialen Umfeld sind meist von Hoffnungslosigkeit und Ängsten gekennzeichnet.
Konfliktpotenzial entsteht auch dadurch, dass es vielen Messies nicht möglich ist, sich an gesellschaftliche Regeln zu halten. Die darauf folgende Ausgrenzung macht es nur noch schwerer, die Betroffenen wieder an ein unterstützendes soziales Umfeld anzubinden.
Meist lautete das Ziel, die unwürdige Wohnsituation der Messies so schnell wie möglich zu beenden. »Wenn jemand nicht selbst Ordnung halten kann, dann machen wir das eben für ihn«, war die Devise. Doch wenn nur die äußere Unordnung entfernt, nicht aber die innere Verletzung bzw. die Erkrankung gesehen und behandelt wird, müssen solche Vorstöße scheitern. Die Wohnungen von Messies – fast immer gegen ihren Willen – zu leeren und den »Müll« zu entsorgen war eine Sisyphos-Arbeit, die den Status quo nur noch weiter verschlimmerte:
Helfer und Fachkräfte arbeiteten sich am Symptom ab, denn ohne weitere Betreuung der Betroffenen sah die Wohnung nach kurzer Zeit so aus wie zuvor.
Die ohnehin schon angeschlagene Würde der Messies litt unter der aufgezwungenen Hilfe, ihre Symptome verstärkten und festigten sich zunehmend.
Das Vertrauensverhältnis zwischen professionellen Helfern und Messies wurde sehr belastet.
Oft wird übersehen, dass das Verhalten von Messies durch Krankheiten ausgelöst wird. Betroffene können sich nicht »endlich mal zusammenreißen«, um an ihrer Wohnsituation etwas zu ändern. Genauso könnte man von Menschen mit Diabetes oder einem Bandscheibenvorfall erwarten, dass sie ihre gesundheitlichen Einschränkungen kraft ihres Willens überwinden sollen.
Gut gemeinte Räumkommandos entstehen aus dem Missverständnis, dass sich die Probleme damit lösen ließen. Es wird nicht nach den Ursachen der Desorganisation gefragt, sondern es werden deren Folgen bekämpft. Um Messies zu helfen, müssen wir die Ursachen ihrer Krankheit und auch die Krankheit selbst verstehen.
Auch ein zweites Missverständnis war in den vergangenen Jahrzehnten die Ursache dafür, dass an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei agiert wurde: Es gibt nicht »den« Messie, sondern verschiedene Ursachen führen zu völlig unterschiedlichen Erscheinungsformen. Hier eine erste Übersicht über die drei wesentlichen Ausprägungen:
Pathologisches Horten. Die Betroffenen sammeln und horten aufgrund meist frühkindlicher psychischer Traumatisierungen gezielt Unmengen an Gegenständen. Obwohl sie sehr gut wahrnehmen, dass ihre Sammeltätigkeit ihre Lebensmöglichkeiten massiv einengt, gelingt es ihnen weder, das Sammeln zu unterlassen, noch sich von gehorteten Dingen zu trennen.
Vermüllungssyndrom. Wenn Lebensmittel und andere Dinge mit hohem Feuchtigkeitsgehalt gezielt gehortet werden oder sich ansammeln, kommt es zu Geruchsbildung und Schädlingsbefall. Auslöser des Vermüllungssyndroms sind psychische und hirnorganische Erkrankungen wie zum Beispiel Süchte, Schizophrenie, Wahnvorstellungen, Demenz und Alzheimer. Aufgrund ihrer Erkrankung ist die Wahrnehmung der Klienten oft so verändert, dass sie nicht erkennen können, dass die hygienischen Bedingungen in ihrer Wohnung nicht tolerierbar sind.
Die vier Kennzeichen der Vermüllung sind: Geruchsbildung, Feuchtigkeit, Schimmel und Ungeziefer. Bei starkem Ungezieferbefall muss in einem ersten Schritt der Kammerjäger beauftragt werden. Ansonsten beginnt die Unterstützung der Betroffenen damit, den Geruchsherd aufzuspüren und zu eliminieren.
Verwahrlosungssyndrom. Auch hier liegen gravierende psychische beziehungsweise hirnorganische Erkrankungen vor. Der Zustand der Wohnung ist deshalb gesundheitsgefährdend, weil vieles kaputt ist und eine hohe Verletzungsgefahr besteht. Vor allem aber fällt die extreme Selbstvernachlässigung der Betroffenen auf. Motivation zur eigenen Körperhygiene ist kaum mehr vorhanden.
Pathologisches Horten, Vermüllungs- und Verwahrlosungssyndrom haben also völlig unterschiedliche Ursachen und auch Auswirkungen. Trotzdem werden im allgemeinen Sprachgebrauch alle Menschen, die in Unordnung leben, über einen Kamm geschoren und – oft abwertend – als »Messies« tituliert. Dieser Begriff leitet sich vom englischen Wort mess ab, das »Unordnung« oder auch »Durcheinander« bedeutet. Weil er auch von den Betroffenen selbst verwendet wird, hat er sich in der Fachwelt durchsetzen können.
Messie: In Fachkreisen wurde diese Bezeichnung lange allein auf Menschen mit Vermüllungs- oder Verwahrlosungssyndrom angewendet. Heute zählt auch das pathologische Horten zum Formenkreis des Messie-Syndroms.
Erst seit einigen Jahren beginnen wir zu verstehen, welche Ursachen und Ausprägungen sich hinter dem Messie-Syndrom verbergen. Heute sind wir für die Bedürfnisse unserer Klienten sensibilisiert und schauen genau hin, welche Ausprägung des Messie-Syndroms wir erkennen, und arbeiten an den Ursachen und Auslösern, die zu den besonderen Wohnverhältnissen geführt haben. Solange wir das Krankheitsbild nicht klar zuordnen und benennen können, gibt es keine Heilung beziehungsweise nachhaltige Verbesserung der Situation.
Hinter der sichtbaren Unordnung des Messie-Syndroms liegt immer eine psychische oder eine hirnorganische Krankheit als Ursache. Nur wenn klar ist, um welche Ausprägung es sich handelt und welche Erkrankung das Verhalten der Betroffenen auslöst, können diese adäquat begleitet und unterstützt werden.
1.1 Das pathologische Horten
Das pathologische Horten wurde erstmals 2022 mit der Neuauflage der International Classification of Diseases (ICD-11) im Katalog der weltweit anerkannten Krankheiten aufgeführt. Dies bedeutet nicht nur die überfällige Würdigung der Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, auch ganz praktisch wirkt sich die Nennung des pathologischen Hortens im ICD-11 positiv aus: Die Behandlungskosten können über die Krankenkassen abgerechnet werden. Einen Wermutstropfen enthält diese Entwicklung: Die Krankheit wird irrtümlich (noch) den Krankheitsbildern Zwangsstörung oder auch Suchterkrankung zugeordnet. Dabei hat eine Studie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ergeben, dass eine Zwangsstörung das pathologische Horten zwar begleiten kann, die Krankheit selbst aber keinesfalls als Zwang zu betrachten ist. Das pathologische Horten ist auch keinesfalls als Persönlichkeitsstörung anzusehen. Eher handelt es sich um eine Anpassungsstörung infolge (frühkindlicher) Traumatisierungen. Die WHO ist in dieser Frage noch zu keinem Schluss gekommen.
Pathologisches Horten: Die Betroffenen sammeln und horten Dinge aus begrenzten Sammelgebieten, die für bestimmte Fehlstellen in ihrer Biografie stehen. Während sie zu Hause ihren Lebensraum einengen, sind sie außerhalb ihrer Wohnung meist überdurchschnittlich organisiert und beruflich erfolgreich.
1.1.1 Die Betroffenen
Menschen, die an pathologischem Horten erkrankt sind, finden sich in allen Teilen der Gesellschaft. Sie können jung oder alt, weniger gut oder sehr gut gebildet sein. Manche sind vermögend, andere leben in prekären Verhältnissen. Sie leben sehr zurückgezogen oder sind als Angestellte beziehungsweise Selbstständige berufstätig. Sie leben als Single, in Paarbeziehungen oder im Familienverbund – jeweils mit oder ohne Kinder. Einige leiden an psychischen Vorerkrankungen oder sind chronisch körperlich erkrankt, andere nicht.
So unterschiedlich ihre Lebenswege auch sind, eines haben sie gemeinsam: Ihr Alltag wird vom Sammeln und Horten bestimmt. Die Gegenstände können nicht bewusst losgelassen werden, weil
… sonst die Erinnerung an die mit ihnen verbundenen Situationen verloren gehen könnte.
… sie vielleicht noch einmal gebraucht werden könnten – so unwahrscheinlich dies auch sein mag.
Dass die Betroffenen nicht autonom entscheiden können, was sie wirklich in ihrer Wohnung haben wollen, geht einher mit einer starken Selbstwertproblematik und dem Empfinden tiefer innerer Verlorenheit. (Mehr zu den Ursachen des pathologischen Hortens lesen Sie in Kapitel 2.)
Der Unterschied zwischen Sammlern, die aus Freude und Interesse sich einem bestimmten Sammelgebiet zuwenden, und Menschen, die an pathologischem Horten erkrankt sind, lässt sich klar an drei Faktoren ablesen:
Es besteht keine Wahlmöglichkeit. Betroffene können nicht frei entscheiden zwischen »Diesen Gegenstand möchte ich haben und behalten.« und »Ich brauche ihn nicht und kann ihn weggeben«. Diese sogenannte Wertbeimessungsstörung ist ein charakteristisches Symptom des pathologischen Hortens.
Ich kenne viele begeisterte Sammler. Wenn sie mir voll Stolz von einem besonderen Fund erzählen – ein erworbenes Automodell, ein seltener Teppich, kostbares Porzellan – leuchten ihre Augen. Auch bei ihnen können Teile ihrer Wohnung mit dem gesammelten Material zugestellt sein, und in der Partnerschaft kann es wegen hoher Ausgaben oder wegen des Platzbedarfs Reibereien und Streit geben. Doch im Gegensatz zu Menschen, die an pathologischem Horten erkrankt sind, können Sammler bewusst entscheiden, ob sie etwas ihrer Sammlung hinzufügen oder etwas aus ihr verkaufen wollen. Sie sind stolz auf ihre Sammlung, dagegen schämen sich Menschen, die pathologisch horten, oft abgrundtief.
Die Gegenstände werden zur Belastung. Die Betroffenen können sich an dem Gesammelten nicht erfreuen, sondern geraten unter Dauerstress und finden in den eigenen vier Wänden keine Erholung. Weil sie von den Gegenständen beherrscht werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich mit all den Einschränkungen zu arrangieren, die das Horten mit sich bringt.
Die Lebensqualität ist massiv eingeschränkt. Die wachsenden Stapel und Berge engen den Lebensraum der Betroffenen immer weiter ein. Die Räume der Wohnung verlieren ihre Funktion – in der Küche kann nicht mehr gekocht, im Bad nicht mehr geduscht werden usw. In manchen Fällen lassen die gehorteten Gegenstände den Menschen nur noch enge Gänge, durch die sie sich bewegen können.
Schlafzimmer können mit Kisten, Türmen und Stapeln so zugestellt sein, dass die Betten unter den Bergen nicht mehr erkennbar, geschweige denn benutzbar sind. Die Bewohner der Wohnung – darunter auch Kinder – suchen sich dann abends einen möglichst bequemen Platz auf oder zwischen den Haufen, an dem sie sich ein wenig ausstrecken können. Einige meiner Klienten gestehen sich noch nicht einmal diesen Platz zu, sie schlafen halb im Sitzen auf einem zur Hälfte freigeräumten Stuhl oder Sessel.
Menschen, die pathologisch horten, bringen es nicht übers Herz, Dinge, die in ihr Sammelschema passen, abzulehnen oder gar wegzuschmeißen. Sie können nicht anders, als sie um sich herum anzuhäufen. So müssen sie immer mehr Wohnraum an die gehorteten Dinge abgeben.
Die meisten an pathologischem Horten erkrankten Menschen sind auffallend empathisch, leistungsorientiert, organisiert, zielstrebig und penibel. Genau diese Eigenschaften machen sie im Beruf erfolgreich.
Klienten, die pathologisch horten, sind sehr engagiert in ihrem Beruf. Für ihre Kollegen sind sie ein Fels in der Brandung, weil sie der Arbeit nicht aus dem Weg gehen. Zusätzlich übernehmen sie neben ihrem Beruf oft auch noch ehrenamtliche Tätigkeiten. Ihr Engagement bringt ihnen viel Anerkennung. Leider bezieht sich die Wertschätzung nicht so sehr auf ihre Person, sondern eher auf ihren nimmermüden Einsatz für andere.
Viele Menschen, die pathologisch horten, sind berufstätig und erzielen in der Regel auch ein gutes Einkommen. Nicht selten leisten sie sich dann die Anmietung von Lagerräumen oder sogar einer zweiten Wohnung. So können sie über lange Zeit ihr Sammeln und Horten kaschieren. Der berufliche Erfolg kann ihre private Lebenssituation in gewissem Maße kompensieren.
In der Regel erkennen die Betroffenen ihre Situation sehr klar: Sie sehnen sich nach einer präsentablen Wohnung, wissen aber aus Erfahrung, dass sie sich hoffnungslos in Details verlieren, sobald sie darüber entscheiden wollen (oder sollen), sich von bestimmten Dingen zu trennen. Dazu kommen viele weitere Stressfaktoren:
Die Betroffenen können ihre Wohnsituation objektiv einschätzen und leiden darunter, dass sie nicht so leben, wie sie es gerne würden. Nur selten führt eine weitere psychische oder hirnorganische Erkrankung, die das pathologische Horten überlagert, zu einer Wahrnehmungsstörung.
Sie leiden unter einem hohen Stresspegel, wenn sich vertraute Situationen verändern, können nicht gut Prioritäten setzen, verlieren sich in Details, fühlen sich ambivalent und zerrissen. Angesichts der vielen unerledigten Arbeiten in der Wohnung finden sie keine Erholung.
Neben diffusen, lähmenden Ängsten leiden sie an konkreten Ängsten vor Wohnungs- oder Arbeitsplatzverlust und vor einer Räumung. Jedes Klingeln an der Türe löst bei ihnen großen Schrecken aus.
Aufgrund ihrer schwach ausgeprägten Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse neigen sie dazu, sich selbst zu überfordern. Auch dies erzeugt Stress, der auf medizinischem Wege nur unzulänglich behandelt werden kann.
Trotz ihrer beruflichen Leistungen schätzen sie sich insgesamt als inkompetent ein, denn jeder Blick auf die Stapel und Türme daheim erinnert sie an ihre Unfähigkeit, Ordnung zu schaffen.
Sie schämen sich, dass sie diesen Aspekt ihres Lebens nicht in den Griff bekommen. Ihr Fokus liegt auf ihren Schwächen, nicht auf ihren Stärken.
Sie wissen, dass ihr Sammeltrieb bei anderen Menschen auf Unverständnis stößt und ihr Verhalten negativ bewertet wird. Nicht sie selbst als Menschen werden gesehen, sondern nur ihr Unvermögen – »Das ist doch die Chaotin aus dem ersten Stock!«
Die Entfaltung ihrer Persönlichkeit ist blockiert.
Sie leiden darunter, dass sie ihre Kontaktfreude nur wenig ausleben können und ihr soziales Netz immer weiter ausdünnt. Denn um sich vor Kritik zu schützen und Übergriffigkeiten von Nachbarn, Freunden und Familienmitgliedern nicht ertragen zu müssen, lassen sie niemanden in ihre Wohnung. So werden Beziehungen zum Balanceakt.
Sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn die Flut der Dinge auch die Kinderzimmer überschwemmt. Ihre Kinder dürfen oder wollen keine Freunde mit nach Hause bringen und geraten ebenfalls in Isolierung.
Stress bedeutet im Englischen »Druck« oder »Anspannung«. Es handelt sich um eine belastende körperliche und psychische Reaktion auf eine Situation, die als nicht bewältigbar wahrgenommen wird. Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes GBE definiert Stress als einen »Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt«.
Der Stress, die Zerrissenheit, die Frustrationen, der Aufwand, den Schein nach außen zu wahren – dies alles fordert den Betroffenen viel Kraft ab.
Menschen, die krankhaft horten, leiden oft unter einer großen Erschöpfung. Sie führen ein Leben unter Dauerstress. Zu Hause, wo andere Menschen sich erholen können, sind sie unaufhörlich mit einer Überforderung konfrontiert. Deshalb vermeiden sie es unbewusst, sich dort aufzuhalten. Überstunden im Beruf und Ehrenämter schenken ihnen zwar Zeit außerhalb ihrer Wohnung, doch sie vermehren nur die Belastung und die tiefe Müdigkeit.
Menschen, die pathologisch horten, stehen unter ungeheurem Stress. Sie wissen sehr gut, was eigentlich zu tun wäre, aber es gelingt ihnen nicht, einen Anfang zu finden. In ihrer Wohnung herrschen sie nicht als Könige, stattdessen ist diese eine Quelle ständiger Überforderung.
1.1.2 Die Wohnung
Auffallend sind die aufgetürmten Stapel und aufgehäuften Berge aus gehortetem Material. Werden Bücher und andere gut stapelbare Dinge gesammelt, finden wir senkrechte Wände vor, die kunstvoll bis unter die Decke aufgebaut wurden. Lose Wäsche dagegen lässt sich nur flächig im Raum aufschichten. Es ist erstaunlich, mit wieviel Mühe und Erfindungsgeist Klienten die Statik riesiger Materialtürme bewältigen, sodass sie nicht umkippen.
Bei ausschließlichem pathologischen Horten sammeln die Klienten gezielt Dinge eines bestimmten Themenbereichs. Diese Fokussierung auf eine bestimmte Kategorie ist ihnen oft nicht bewusst. Gesammelt werden unter anderem:
Papier, Zeitungen, Bücher und/oder Kataloge
Hefte, Kladden und/oder Blanko-Bücher
Wäsche, Kleidung, Tischdecken und/oder Handtücher
Behältnisse aller Art, von Taschen und Koffern bis zu ausgespülten Joghurtbechern
Leere Ordner, Sammelboxen und/oder Kistchen
Kinderkleidung, Spielsachen, Kinderbücher und/oder Puppen
CDs, Schallplatten, teilweise die gleichen Tonträger in vielfacher Zahl
Werkzeug, Gartengeräte
Bildschirme, Radios, Fernseher, Elektroschrott
Möbel, Kleinmöbel
Wenn es keine Präferenz für bestimmte Dinge gibt und sich ein heilloses Sammelsurium an Dingen in der Wohnung auftürmt, handelt es sich nicht um reines pathologisches Horten und es muss eine weitere psychische oder hirnorganische Krankheit an dieser Ausprägung beteiligt sein. Von dieser Regel gibt es eine Ausnahme: das Jagen nach Sonderangeboten aller Art.
An dieser Stelle möchte ich klarstellen, dass es sich beim pathologischen Horten keinesfalls um eine Kaufsucht handelt. Zwar bleibt in beiden Fällen die Ware meist ungenutzt in der Originalverpackung und wird weggeräumt. Doch bei einer Kaufsucht geht es um den Kick des Moments, wenn die Ware in die Einkaufstasche gesteckt wird oder der Postbote das Paket bringt. Dieser Glücksmoment ist schnell vorbei und der Gegenstand wird nicht weiter beachtet und weggelegt. Für Menschen, die krankhaft horten, sind die gehorteten Dinge dagegen existenziell wichtig.
Menschen, die pathologisch horten, definieren sich über die gesammelten Gegenstände. So lassen sich Kaufsucht und Schnäppchenjagd aufgrund pathologischen Hortens sicher und schnell voneinander unterscheiden: Eine Kaufsucht wird verheimlicht. Wer jedoch aufgrund des pathologischen Hortens auf Schnäppchenjagd geht, teilt das Ergebnis seiner Recherchen gerne mit – »Schauen Sie, Frau Schröter! Nächste Woche gibt es bei Lidl Arbeitshandschuhe viel günstiger als diese Woche bei Aldi!«
Fast immer haben Menschen, die krankhaft horten, ein hervorragendes Gedächtnis. Sie wissen sehr genau, was sie besitzen und wo sie es deponiert haben. Bis sie das Gesuchte aus dem Stapel ziehen können, vergeht allerdings einige Zeit, denn die schiere Masse der Dinge ist so groß, dass auch ein komplexes Ordnungssystem nicht hilft.
Der Versuch von Verwandten oder Freunden, heimlich Dinge aus der Wohnung zu schaffen, scheitert fast immer. Denn Menschen, die an pathologischem Horten erkrankt sind, merken schnell, wenn etwas fehlt. Für sie ist ja jedes einzelne Teil bedeutsam.
Die Stapel und Berge aus dem gesammelten Material sind meist systematisch geordnet, auch wenn dies für Außenstehende nicht erkennbar ist.
Manchmal wird nur ein einziges Zimmer so sehr mit Dingen angefüllt, dass es kaum noch betreten werden kann. In anderen Fällen wachsen in der gesamten Wohnung die Stapel in die Höhe beziehungsweise die Berge in die Breite. Unter Umständen verlieren die Räume ihre Funktion – in der Küche können keine Mahlzeiten mehr zubereitet und zu sich genommen werden, die Treppe, die in das Obergeschoss des eigenen Hauses führt, ist so dicht zugestellt, dass der Weg nach oben versperrt ist.
Wenn keine weiteren Erkrankungen vorliegen, gelingt es den Menschen, die pathologisch horten, stets auffallend gepflegt und adrett gekleidet aufzutreten. Auch wenn sie eher sitzend als liegend die Nacht verbringen, weil ihr Schlafzimmer nicht mehr benutzbar ist, sehen sie bei unseren Treffen »wie aus dem Ei gepellt« aus. Sogar wenn Bad und Toilette nicht mehr zugänglich sind, finden sie Lösungen. Diese unglaubliche Überlebenskunst verdient eine große Wertschätzung.
Je mehr die Dinge überhandnehmen, desto eingeschränkter sind die Funktionen der Wohnung. Mit viel Kreativität schaffen es die an pathologischem Horten erkrankten Menschen, dass ihre Wohnsituation nicht an ihrem äußeren Erscheinungsbild abzulesen ist.
1.1.3 Auswirkungen des pathologischen Hortens auf das soziale Umfeld
Menschen, die an pathologischem Horten erkrankt sind, verstehen es in der Regel sehr gut, die Fassade zu wahren. In vielen Fällen wissen nur Familienmitglieder und enge Freunde von den Zuständen in der Wohnung. Das stellt für sie eine große Belastung dar, denn sie wollen ja gerne helfen, wissen aber nicht, wie. Ihre Hilfsangebote werden von den Betroffenen fast immer abgelehnt.
Der Leidensdruck muss sehr groß werden, bis Betroffene Hilfe zulassen. Sie möchten so weit wie möglich selbstständig bleiben und nicht zuletzt sich selbst zeigen, dass sie gut allein zurechtkommen.
Im Grunde gibt es für Laien zwei Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen:
Weil das Thema »Aufräumen in der Wohnung« explosiver Gesprächsstoff ist, einigt man sich stillschweigend darauf, dass es nicht angeschnitten wird.
Man arbeitet sich an dem Thema ab. Immer wieder werden Lösungsvorschläge vorgebracht, mit dem Effekt, dass beide Seiten unter Stress stehen und frustriert sind.
In beiden Fällen bleibt das Problem ungelöst. Scham schleicht sich in die Beziehungen ein – »Wir sind doch eine ordentliche Familie!«
Partnerschaft. Oft leben Menschen, die pathologisch horten, und Menschen ohne diese Störung zusammen. Gerade in der Anfangszeit ihrer Beziehung, als das Krankheitsbild vielleicht noch wenig ausgeprägt war, gefielen ihnen die Eigenschaften ihres jeweiligen Gegenübers. Doch mit der Zeit wächst das Konfliktpotenzial zwischen den beiden Polen »kreative Eigenwilligkeit« und »strukturierte Ordnung«.
Manchmal überdauert eine Paarbeziehung nur deshalb, weil der Partner beziehungsweise die Partnerin eines Messies noch nie in dessen Wohnung zu Besuch war. In manchen Fällen sind sie sich sogar im Unklaren darüber, warum ihnen der Zutritt verweigert wird. Ein solcher Vertrauens-Notstand wirft langfristig einen unüberbrückbaren Schatten auf die Beziehung.
Nachbarn und Vermieter. Sie werden oft erst dann auf das pathologische Horten aufmerksam, wenn in der Wohnung der Betroffenen aller Platz belegt ist und diese damit beginnen, Kisten und Regale auf den Balkon oder in Gemeinschaftsräume wie Waschkeller und Hausflur auszulagern. Sind die Wohnverhältnisse erst einmal bekannt geworden, ändert sich die Beziehung zwischen den Mietparteien. Wer an pathologischem Horten erkrankt ist, muss damit rechnen, geschnitten oder sogar gemobbt zu werden. Auch für die Nachbarn ändert sich die Situation zum Schlechten: Sie fühlen sich unwohl und bedroht. Die Vermieter machen sich Sorgen um ihre Wohnung.
Arbeitskollegen. Nur in seltenen Fällen weiß man am Arbeitsplatz von der häuslichen Situation der Betroffenen. Die Menschen sind es zwar gewohnt, dass Ihre Kollegen in die Bresche springen, wenn zusätzliche Arbeit getan werden muss, doch ein persönliches Verhältnis entwickelt sich nur selten. Deshalb sind sie auch nicht irritiert, wenn sie von Betroffenen nie nach Hause eingeladen werden.
Dem Umfeld sind die besonderen Wohnverhältnisse der Menschen, die pathologisch horten, oft unbekannt. Wenn die Lebensrealität zum Vorschein kommt, spüren Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn und Kollegen Irritation und Ablehnung.
1.1.4 Gefahren durch das pathologische Horten
Die Wohnungen der Betroffenen sind nicht schmutzig. Nur dort, wo Besen, Putzlappen und Staubsauer nicht hinkommen, sammelt sich Staub an. Bad und Toiletten – soweit sie nicht unter Materialbergen verschwunden sind, sind weitestgehend sauber.
Wenn keine weiteren psychischen oder hirnorganischen Erkrankungen beteiligt sind, gibt es in den Wohnungen von Betroffenen keine Geruchsbildung. Sogar nach vielen Jahrzehnten Sammeltätigkeit riecht es höchstens ein wenig muffig nach ungelüfteter Wäsche oder so wie in Antiquariaten: staubig und nach altem Papier. Eventuell auftretende Schädlinge sind eine Gefahr für die gehorteten Dinge (Kleidermotten, Larven des Bücherwurms usw.) und nicht für den Menschen.
Der hygienische Zustand der Wohnung birgt also keine gesundheitlichen Gefahren für die Bewohner, Nachbarn und Besucher.
In extremen Fällen kann jedoch die schiere Menge an Dingen Grund zur Sorge liefern. Viele Tonnen angesammelten Materials können die Statik einer Wohnung an ihre Grenzen bringen. Schwachstellen sind vor allem Balkone, die über das erlaubte Maß hinaus belastet werden. Wenn Papier gesammelt wird, muss unter Umständen die Entfernung des brennbaren Materials aus Gründen des Feuerschutzes gerichtlich angeordnet werden.
Es besteht die Möglichkeit, dass ein Stapel umfällt und jemanden unter sich begräbt. Es gab tatsächlich Fälle mit Todesfolge. Vor allem dann, wenn Dinge in Originalverpackungen aus glatten Plastikhüllen aufbewahrt werden, geraten Berge schnell ins Rutschen.
Von den gehorteten Dingen eines Menschen, der pathologisch hortet, geht in hygienischer Hinsicht keine Gefahr aus. Problematisch sind überbelastete Balkone und instabile Stapel, die umfallen und Menschen verletzen können.
1.1.5 Langfristige Folgen des pathologischen Hortens
Das pathologische Horten kompensiert Bindungsstörungen und -traumata (siehe Kapitel 2). Doch wir können nur eine Zeitlang vor den ungelösten Fehlstellen in unserer Biografie davonlaufen. Früher oder später holt uns ein, was in unserem Leben gelöst und geheilt werden will.
Es ist eine anerkennenswerte Leistung der Betroffenen, dass sie sich trotz ihrer unverarbeiteten Lebenswunden eine Existenz aufgebauten und zu starken Mitgliedern unserer Gesellschaft wurden.
Menschen, die pathologisch horten, machen lange Zeit alles mit sich allein aus. Auf der Suche nach der Erlaubnis, atmen und leben zu dürfen, übersehen sie ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Fast alle meine Klienten betonen, wie sehr es sie belastet, zwischen zwei völlig unterschiedlichen Welten hin und her wechseln zu müssen: In ihrer Wohnung nehmen sie sich als unfähig wahr, die Ordnung zu schaffen, die sie gerne hätten, und in der Welt draußen strengen sie sich über die Maßen an, um anerkannt zu werden. Mit der Zeit fordert diese Zerrissenheit ihren Tribut. Die Erschöpfung wird immer größer, die Isolation nimmt zu.
Ständiger Stress und Frustrationen bergen die große Gefahr in sich, dass sich chronische Erkrankungen ausbilden. Nicht selten entwickeln sich Angststörungen oder eine Depression. Deshalb ist es so wichtig, dass das pathologische Horten seit Anfang 2022 als Krankheit anerkannt ist und die Krankenkassen die Behandlung unterstützen.
Vor allem dann, wenn die Verrentung oder Pensionierung naht, ist die Gesundheit in Gefahr. Den Betroffenen bricht ihr Leben im Außen weg, die Aussicht, mehr zu Hause sein zu müssen, ängstigt sie sehr. Ihre Befürchtungen bewahrheiten sich, denn nun gibt es kein tägliches Entkommen mehr aus der angefüllten Wohnung. Schon oft habe ich von Klienten, die erst einige Wochen im Ruhestand waren, gehört: »Ich halte das nicht aus! Ich drehe durch!«
Neben psychischen Krankheiten wie den genannten Angststörungen und Depressionen entwickeln die Betroffenen oft folgende Beschwerden:
Erkrankungen des Bewegungsapparats: Rücken- und Nackenschmerzen, Verspannungen
Erkrankungen des Bronchialtrakts: Asthma, chronischer Husten (nicht zuletzt durch eine Staubbelastung)
Magen-Darm-Störungen: Verdauungsprobleme, Magenkrämpfe, Magengeschwüre
Hauterkrankungen: Ausschläge, Neurodermitis.
Die Beziehungen werden immer angespannter. Damit sind nicht nur die Paarbeziehungen gemeint. Sehr oft erzählen mir meine Klienten von ihrem großen Kummer, dass ihre Enkel sie nicht besuchen dürfen. Ihre Söhne und Töchter haben ihre ganze Kindheit hindurch zu ihnen gehalten und sich mit den Wohn- und Lebensbedingungen arrangiert. Doch nun haben sie sich ihr eigenes Leben aufgebaut. Sie schämen sich für ihre Eltern und wollen ihre eigenen Kinder vor dem Kontakt mit ihnen bewahren.
Zu den langfristigen Folgen gehören auch finanzielle Probleme. Menschen, die krankhaft horten, schieben vieles, was mit ihrem Privatleben zusammenhängt, so weit wie möglich hinaus. Dazu kann auch der Gang zum Briefkasten gehören. Wenn er wieder einmal überquillt, wird die Post ungeöffnet in eine Schublade gesteckt. So kommt es, dass Rechnungen nicht bezahlt werden, obwohl das Konto gut gefüllt ist. Überall brechen Krisenherde auf. Das Finanzamt mahnt die Steuererklärung an, ein Inkasso-Mitarbeiter steht vor der Tür, das Telefon wird abgeschaltet.
Ich arbeite mit einer Schuldnerberaterin zusammen, die ich über die Besonderheiten der Messie-Klientel aufgeklärt habe. Sie weiß, welche Klippen zu umschiffen sind, und stellt mit viel Einfühlungsvermögen ein Vertrauensverhältnis zu ihren ganz besonderen Klienten her. Nach kurzer Zeit sind die Finanzen so weit geregelt, dass die Betroffenen wieder ruhig schlafen können.
Das pathologische Horten kompensiert Leerstellen in der Lebensgeschichte. Doch früher oder später funktioniert diese Verschleierung nicht mehr. Das Kartenhaus bricht zusammen und die eigentliche Lebenswunde wirkt sich auf seelischer, körperlicher und ganz praktischer Ebene aus.
1.2 Das Vermüllungssyndrom
Der Psychiater Peter Dettmering, der Mitte der Achtzigerjahre als Leiter eines sozialpsychiatrischen Dienstes oft Zeuge von Zwangsräumungen war, prägte den Begriff des Vermüllungssyndroms. Es handelt sich um ein Krankheitsbild mit völlig anderen Ursachen und Ausprägungen als denen des pathologischen Hortens.
Vermüllungssyndrom: Aufgrund einer oder mehrerer psychischen beziehungsweise hirnorganischen Erkrankungen häufen die Betroffenen feuchten und verderblichen Abfall in ihren Wohnungen an. Den damit einhergehenden Schädlingsbefall und die schlechten Gerüche nehmen sie nur eingeschränkt wahr.
1.2.1 Die Betroffenen
Klienten, die an pathologischem Horten erkrankt sind, führen außerhalb ihrer Wohnungen ein an gesellschaftliche Standards angepasstes Leben und legen viel Wert auf ein gepflegtes Auftreten. Beim Vermüllungssyndrom gibt es diese Zweiteilung des Lebens nicht, es betrifft alle Lebensfacetten der Betroffenen. Auslöser des Syndroms sind zum Beispiel:
Suchterkrankungen
psychiatrische Krankheitsbilder wie Schizophrenie, bipolare Störungen und Wahnvorstellungen
hirnorganisches Psychosyndrom wie Alzheimer und Demenz
Intelligenzminderung
Autismus
ADHS und ADS im Erwachsenenalter
neuropsychiatrische Syndrome, die zum Beispiel nach Verletzungen und Schlaganfällen auftreten können.
Durch ihre jeweilige psychische Erkrankung verfügen die Betroffenen über eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit und merken nicht, dass ihre Wohnung vermüllt. Dies führt nicht zuletzt dazu, dass sie von anderen Menschen stark unterschätzt werden. Dabei handelt es sich oft um Klienten, die sich sehr gut integrieren können, sehr engagiert und begeisterungsfähig sind und als gebildete Menschen ihrem Thema zugewandt bleiben.
Eine junge Ingenieurin bildete eine bipolare Störung aus. Die Lebensverhältnisse in ihrer Wohnung und ihr gesundheitlicher Zustand waren desolat, doch die Gespräche mit ihr erlebte ich als außerordentlich anregend. Sie war politisch sehr interessiert, informierte sich täglich aus der Presse und machte sich sehr klare, eigenständige Gedanken über die aktuellen Entwicklungen.
Die Erkrankungen der Klienten führen oft dazu, dass ihre Gefühlswelt von negativen und beunruhigenden Emotionen geprägt ist:
Hoffnungslosigkeit und mangelndes Selbstwertgefühl
häufig: Scham
Angst vor Zwangsentrümpelung und Wohnungsverlust
bei Psychosen: verschiedene Ängste
bei Süchten: Angst, dass die Sucht nicht befriedigt werden kann
bei Demenz und Alzheimer: Verwirrung.
Die eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit kann auch dazu führen, dass die Betroffenen ihre Körperpflege vernachlässigen. Man darf es ruhig deutlich sagen: Viele Menschen mit Vermüllungssyndrom fallen durch ihr Äußeres auf. Ihre fettigen Haare und oft sichtbar schadhaften Zähne, ihre wahllos zusammengestellte, ungepflegte oder sogar zerrissene Kleidung, die ausgetretenen Schuhe und viele andere ins Auge fallende Merkmale stoßen fast immer auf sofortige Ablehnung.
Manchen Betroffenen ist es immer noch ein Anliegen, von ihrem Äußeren her nicht aufzufallen, wenn sie sich unter Menschen begeben. In diesem Bemühen können sie sehr erfolgreich sein. Doch spätestens, wenn sie ihrem Gegenüber näher kommen, macht der durchdringende Geruch, den sie mit ihrer Kleidung aus ihrer Wohnung nach draußen tragen, alle Anstrengungen zunichte. Fast immer wenden sich die Menschen von ihnen ab.
Ich habe mehrere Klienten kennenlernen dürfen, die zwar mit Haushalt und Körperpflege überfordert waren, es aber trotzdem geschafft hatten, berufstätig zu sein. Oft handelt es sich um Berufe, die an der frischen Luft ausgeübt werden – Straßenmusiker, Hundeausführer, Zeitungsausträger. Ein Klient war in seinem Beruf sogar so erfolgreich und unersetzlich, dass sein Arbeitgeber ihm ein eigenes Büro einrichtete, damit er weiter für ihn tätig sein konnte.
Menschen mit Vermüllungssyndrom zeigen aufgrund einer schwerwiegenden psychischen oder hirnorganischen Erkrankung ein verändertes Verhalten, mit dem sie aus den gesellschaftlich geltenden Normen herausfallen.
1.2.2 Die Wohnung
Zwei Gründe können dazu führen, dass sich in den Wohnungen von Menschen mit Vermüllungssyndrom Material ansammelt:
Den Betroffenen gelingt es nicht, Nassmüll und Unrat wegzuräumen. Überall in der Wohnung verteilt finden sich verdorbene Lebensmittelreste, Leergut mit Flüssigkeitsresten, benutzte Binden, Tierkot, Fäkalien, durchfeuchtetes Papier, feuchte, zu Haufen aufgeschichtete Wäsche und so weiter.
Sie sammeln zielgerichtet oder auch ohne erkennbare Systematik. Oft sind es verderbliche Lebensmittel, die überall in der Wohnung deponiert oder versteckt werden und schon nach kurzer Zeit schimmeln und sich zersetzen.
Die Feuchtigkeit und der Geruch des Mülls dringen tief in Wände, Vorhänge, Möbel, Teppiche und andere Bodenbeläge ein. Die Bausubstanz nimmt Schaden. Feuchte und stockfleckige Wände, abblätternder Putz und ein über allem liegender Grauschleier sind unmissverständliche Anzeichen für ein Vermüllungssyndrom.
Nicht selten bin ich in vermüllten Wohnzimmern auf benutzte und zu losen Haufen aufgetürmte Windeln von Säuglingen und Kleinkindern gestoßen. Die Eltern sind so in ihrer eigenen Welt gefangen, dass sie nicht mehr wahrnehmen, was ihre Kinder brauchen.
Dass der Grad der Vermüllung auch von Kleinigkeiten abhängig sein kann, zeigt das Beispiel Inkontinenz. Einem Baby eine Windel anzulegen, ist eine einfache Angelegenheit. Doch es ist schwierig und mühsam, sich selbst eine Inkontinenzwindel anzuziehen. Es braucht eine große Fertigkeit und Körperbeherrschung, das im Stehen hinzubekommen. Selbst zu zweit, wenn ich einem Klienten helfen möchte, ist es eine aufwändige Aktion. Auch die erhältlichen riesigen Einlagen sind nicht einfach in der Anwendung. Meist haben die Klienten auch keine Unterhosen ausreichender Größe, die über die Windel passen. Die Erkrankung der Betroffenen erlaubt es ihnen oft nicht, um Hilfe zu bitten. Sie mühen sich mit schief sitzenden Windeln und viel zu kleiner Unterwäsche ab und merken nicht, wenn etwas danebengeht.
Der sich zersetzende nasse Müll verursacht ekelerregende Gerüche und lockt Schädlinge an. Weil fast nie gelüftet wird, intensiviert sich die Geruchsbildung.
Dass Fenster und Vorhänge in vermüllten Wohnungen oft verschlossen bleiben, ist nicht immer auf eine Paranoia und einer damit verbundenen Angst vor Beobachtern zurückzuführen. Es gibt dafür auch andere Gründe:
Bei manchen Betroffenen ist die Wahrnehmungsfähigkeit noch so weit vorhanden, dass Scham eine Rolle spielt. Sie wollen verhindern, dass der Zustand ihrer Wohnung bekannt wird.
Wenn Kinder im Haushalt leben, kann die Angst vor dem Jugendamt dazu führen, dass die ganze Familie bei ständig geschlossenen Vorhängen im permanenten Halbdunkel lebt.
In einer abgedunkelten Wohnung sehen die Betroffenen nicht so sehr, wie es um sie herum aussieht. Wird Licht gemacht, zucken sie zusammen und wissen gar nicht, wo sie hinschauen sollen.
Die Feuchtigkeit des gehorteten beziehungsweise nicht entsorgten Materials bringt unangenehme Gerüche, Schimmel und Schädlingsbefall mit sich. Wenn Helfer nicht intervenieren, führt Vermüllung zur Unbewohnbarkeit der Räume und zur Schädigung der Bausubstanz.
1.2.3 Auswirkungen der Vermüllung auf das soziale Umfeld
Die mit der Vermüllung einhergehende Geruchsbildung sowie die mangelnde Hygiene der Person selbst fordern den Widerstand und die Ablehnung des sozialen Umfeldes heraus. Wenn die Betroffenen ihre Wohnung verlassen, tragen sie ihr Stigma mit sich herum.