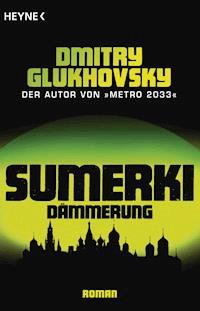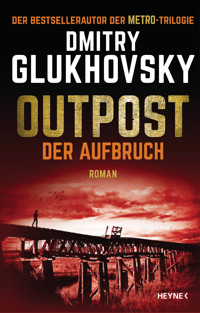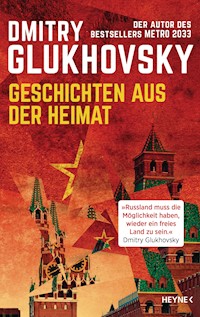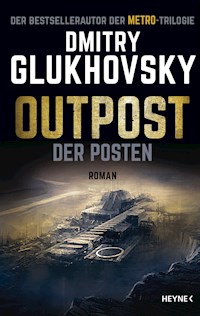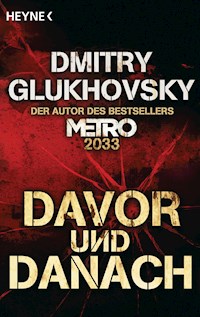Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Kapitel 1 – DIE VERTEIDIGUNG DER SEWASTOPOLSKAJA
Kapitel 2 – RÜCKKEHR
Kapitel 3 – NACH DEM LEBEN
Kapitel 4 – VERFLECHTUNGEN
Kapitel 5 – ERINNERUNGEN
Kapitel 6 – VON DER ANDEREN SEITE
Kapitel 7 – GRENZEN
Kapitel 8 – MASKEN
Kapitel 9 – LUFT
Kapitel 10 – NACH DEM TOD
Kapitel 11 – GESCHENKE
Kapitel 12 – ZEICHEN
Kapitel 13 – EINE GESCHICHTE
Kapitel 14 – WAS NOCH?
Kapitel 15 – ZU ZWEIT?
Kapitel 16 – IN DER ZELLE
Kapitel 17 – WER SPRICHT?
Kapitel 18 – ERLÖSUNG
EPILOG
ANMERKUNGEN
Copyright
PROLOG
Es ist das Jahr 2034. Die Welt liegt in Trümmern. Die Menschheit ist fast vollkommen vernichtet. Strahlung hat die zerstörten Städte unbewohnbar gemacht. Außerhalb ihrer Grenzen, so erzählt man sich, erstrecken sich endloses, ausgebranntes Ödland sowie zu undurchdringlichem Dickicht mutierte Wälder. Doch keiner weiß genau, was sich dort befindet. Die Zivilisation erlischt. Und die Erinnerungen an die ehemalige Größe des Menschen werden allmählich von Märchen und Legenden überwuchert.
Über zwanzig Jahre ist es her, seit das letzte Flugzeug gestartet ist. Verrostete Eisenbahnschienen führen ins Nichts. Und wenn die Funker zum millionsten Mal die Frequenzen abhören, auf denen früher New York, Paris, Tokio und Buenos Aires sendeten, so hören sie noch immer nichts als ein einsames Heulen.
Über zwanzig Jahre sind seit damals vergangen. Doch der Mensch hat die Herrschaft über die Erde bereits anderen Arten überlassen. Geschöpfe der Strahlung, die viel besser angepasst sind an das Leben in dieser neuen Welt.
Die Ära des Menschen ist vorbei.
Aber die Überlebenden wollen es nicht wahrhaben. Einige Zehntausende Menschen sind übrig geblieben, und sie wissen nicht, ob außer ihnen noch irgendwo Menschen leben – oder ob sie die letzten auf dieser Welt sind.
Sie bewohnen die Moskauer Metro, den größten Atombunker, der jemals von Menschenhand geschaffen wurde. Den letzten Zufluchtsort der Menschheit.
Fast alle Überlebenden befanden sich an jenem Tag in der Metro. Und das rettete ihnen das Leben. Die hermetischen Sicherheitstore der Stationen schützen sie vor der Strahlung und den furchtbaren Kreaturen an der Oberfläche. Alte Filter reinigen Luft und Wasser. Von findigen Tüftlern konstruierte Dynamomaschinen erzeugen Strom. In unterirdischen Farmen züchten die Menschen Champignons und Schweine. Die Ärmeren schrecken auch vor Rattenfleisch nicht zurück.
Eine zentrale Verwaltung gibt es schon lange nicht mehr. Die Stationen haben sich in Zwergstaaten verwandelt, wo Menschen sich um Ideologien, Religionen und Wasserfilter scharen. Oder sich einfach nur zusammenschließen, um feindliche Angriffe abzuwehren.
Es ist eine Welt ohne Morgen. Träume, Pläne, Hoffnungen – all das hat hier keinen Ort. Gefühle sind Instinkten gewichen, und der wichtigste davon ist der Wille zu überleben. Um jeden Preis.
Die Vorgeschichte zu den Ereignissen dieses Buches wird in dem Roman »Metro 2033« erzählt.
1
DIE VERTEIDIGUNG DER SEWASTOPOLSKAJA
Sie waren nicht zurückgekehrt, weder am Dienstag noch am Mittwoch, noch am Donnerstag – dem letzten vereinbarten Termin. Der Außenposten war rund um die Uhr besetzt, und hätten die Wachen auch nur das Echo eines Hilferufs gehört oder den schwachen Widerschein einer Lampe an den feuchten, dunklen Tunnelwänden gesehen, dort, wo es zum Nachimowski prospekt ging, so wäre unverzüglich ein Stoßtrupp losgeschickt worden.
Die Anspannung wuchs mit jeder Stunde. Die Wachen – hervorragend ausgerüstete und eigens für solche Einsätze trainierte Soldaten – schlossen nicht eine Sekunde lang die Augen. Der Stapel Spielkarten, mit dem sie sich sonst die Zeit zwischen den Alarmeinsätzen vertrieben, staubte schon seit zwei Tagen in der Schublade der Wachstube vor sich hin. Ihre zwanglosen Unterhaltungen waren erst kurzen, nervösen Absprachen gewichen, und jetzt herrschte nur noch unheilvolles Schweigen. Jeder hoffte, als Erster die hallenden Schritte der zurückkehrenden Karawane zu hören. Es hing einfach zu viel davon ab.
Alle Bewohner der Sewastopolskaja, ob fünfjähriger Knabe oder alter Greis, verstanden es, mit Waffen umzugehen. Sie hatten ihre Station in eine uneinnehmbare Bastion verwandelt. Doch obwohl sie sich hinter MG-Nestern, Stacheldraht, ja sogar Panzersperren aus verschweißten Schienen eingeigelt hatte, drohte diese scheinbar unverwundbare Festung jeden Augenblick zu fallen. Ihre Achillesferse war der Mangel an Munition.
Wäre den Bewohnern anderer Stationen das widerfahren, was die Sewastopolskaja täglich auszuhalten hatte, sie hätten keinen Gedanken daran verschwendet, sich zu verteidigen, sondern wären geflohen wie die Ratten aus einem überfluteten Tunnel. Selbst die mächtige Hanse, der Zusammenschluss der Stationen auf der Ringlinie, hätte im Ernstfall wohl kaum zusätzliche Streitkräfte zum Schutz dieser einen Station abgeordnet – aus Kostengründen. Sicher, die strategische Bedeutung der Sewastopolskaja war enorm. Doch der Preis war zu hoch.
Hoch war auch der Preis für Elektrizität. So hoch, dass die Sewastopoler, die eines der größten Wasserkraftwerke der Metro errichtet hatten, sich für ihre Stromlieferungen von der Hanse mit Munition versorgen lassen und dabei sogar noch Gewinn machen konnten. Aber viele von ihnen bezahlten dies nicht nur mit Patronen, sondern mit einem verkrüppelten, kurzen Leben.
Das Grundwasser war zugleich Segen und Fluch der Sewastopolskaja. Wie die Fluten des Styx die morsche Barke des Charon umströmten, so war die Station von allen Seiten von Wasser umgeben. Das Grundwasser schenkte ihr und einem guten Drittel der Ringlinie Licht und Wärme, denn es setzte die Schaufeln Dutzender von Wassermühlen in Bewegung. Diese hatten geschickte Konstrukteure der Station nach eigenen Plänen in Tunneln, Grotten, unterirdischen Wasserläufen, kurz: an jedem Ort, der sich für diese Zwecke erschließen ließ, errichtet.
Zugleich jedoch nagte das Wasser unablässig an den Pfeilern, löste allmählich den Zement aus den Fugen, während es ganz nah, hinter den Wänden der Station vorbeigluckerte, wie um die Bewohner einzulullen. Das Grundwasser hinderte sie daran, überflüssige, nicht genutzte Streckenabschnitte zu sprengen. Und genau durch diese Tunnel bewegten sich Horden alptraumhafter Kreaturen auf die Sewastopolskaja zu, wie ein endloser giftiger Tausendfüßler, der in einen Fleischwolf kriecht.
Die Bewohner der Station kamen sich vor wie die Mannschaft eines Geisterschiffs auf dem Weg durch die Hölle. Ständig waren sie dazu verdammt, neue Löcher zu finden und zu flicken, denn ihre Fregatte war schon vor langer Zeit Leck geschlagen. Und ein Hafen, in dem sie Schutz und Ruhe finden könnten, war nicht in Sicht.
Gleichzeitig mussten sie eine Attacke nach der anderen abwehren, denn von der Tschertanowskaja im Süden und vom Nachimowski prospekt nördlich ihrer Station kamen Monster durch Lüftungsschächte gekrochen, tauchten aus der trüben Brühe der Abwasserleitungen auf oder stürmten aus den Tunneln heran. Die ganze Welt schien sich gegen die Sewastopoler verschworen zu haben und keine Mühen zu scheuen, um ihre Heimstatt von der Metrokarte zu tilgen. Doch sie verteidigten ihre Station mit Klauen und Zähnen, als wäre sie die letzte Zuflucht im gesamten Universum.
So geschickt allerdings ihre Ingenieure auch sein mochten, so hart und gnadenlos die Ausbildung ihrer Kämpfer auch war – ohne Patronen, ohne Glühbirnen für die Scheinwerfer, ohne Antibiotika und Verbandszeug würden sie die Station nicht halten können. Freilich, sie lieferten Strom, und die Hanse zahlte dafür einen guten Preis. Doch die Ringlinie hatte noch andere Lieferanten und eigene Quellen; die Sewastopoler dagegen würden ohne Versorgung von außen nicht einen Monat lang überleben. Und ihr Vorrat an Patronen neigte sich bedrohlich dem Ende.
Jede Woche wurden bewachte Karawanen zur Serpuchowskaja geschickt, um für den Kredit, den man bei den Kaufleuten der Hanse eröffnet hatte, alles Notwendige zu beschaffen und sogleich wieder zurückzukehren. Solange sich die Erde drehte, solange die unterirdischen Ströme flossen und die von den Metrobauern errichteten Gewölbe hielten, würde sich daran nichts ändern.
Diesmal aber verzögerte sich die Rückkehr der Karawane. Und zwar so sehr, dass nur ein Schluss möglich war: Etwas Unvorhergesehenes musste geschehen sein, etwas Furchtbares, das weder die schwer bewaffneten, kampferprobten Begleitsoldaten noch die jahrelang gepflegten Beziehungen zur Führung der Hanse hatten verhindern können.
Die Sache wäre weniger beunruhigend gewesen, wenn man wenigstens hätte kommunizieren können. Doch mit der Telefonleitung zur Ringlinie war etwas nicht in Ordnung, die Verbindung war bereits am Montag abgebrochen, und der Trupp, den man auf die Suche nach der defekten Stelle geschickt hatte, war ohne Ergebnis zurückgekehrt.
Die Lampe mit dem breiten grünen Schirm hing tief über dem runden Tisch. Sie beleuchtete einige vergilbte Blätter, auf denen mit Bleistift Grafiken und Diagramme eingezeichnet waren. Es war eine schwache Birne, höchstens vierzig Watt, aber nicht weil man Strom sparen musste – das war an der Sewastopolskaja wirklich kein Problem -, sondern weil der Besitzer dieses Büros grelles Licht nicht mochte. Der Aschenbecher quoll über von ausgedrückten Kippen – alles Selbstgedrehte von schlechter Qualität. Ätzender, blaugrauer Rauch hing in trägen Schwaden unter der niedrigen Decke.
Der Stationsvorsteher Wladimir Iwanowitsch Istomin wischte sich über die Stirn, hob die Hand und blickte mit seinem einzigen Auge auf die Uhr – zum fünften Mal innerhalb der letzten halben Stunde. Dann knackste er mit den Fingern und erhob sich mühsam. »Eine Entscheidung muss her. Wir dürfen nicht länger zögern.«
Auf der anderen Seite des Tisches saß der ältere, aber kräftig gebaute Mann mit der wattierten Tarnjacke und dem abgewetzten blauen Barett. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, bekam jedoch einen Hustenanfall. Mürrisch kniff er die Augen zusammen und verscheuchte den Rauch mit der Hand. Dann sagte er: »Na schön, Wladimir Iwanowitsch, ich sage es noch einmal: Aus dem Südtunnel können wir niemanden abziehen. Der Druck auf die Wachen dort ist gewaltig – sie können sich schon jetzt kaum halten. In der letzten Woche allein drei Verletzte, einer davon schwer, und das trotz der Befestigungen. Ich werde es nicht zulassen, dass du den Süden weiter schwächst. Zumal dort ständig zwei mal drei Aufklärer in den Schächten und im Verbindungstunnel patrouillieren müssen. Und im Norden müssen wir die eintreffenden Karawanen absichern, da können wir keinen einzigen Kämpfer entbehren. Tut mir leid, aber da musst du dich schon selber umschauen.«
»Du bist Kommandeur der Außenposten, also such du gefälligst!«, knurrte der Vorsteher. »Ich kümmere mich um meinen Kram. In einer Stunde muss eine Gruppe los. Wir beide denken einfach in unterschiedlichen Kategorien. Es geht doch nicht nur um unsere Probleme hier und jetzt! Was, wenn etwas Schlimmes passiert ist?«
»Und ich finde, Wladimir Iwanowitsch, du machst unnötigen Wirbel. Wir haben noch zwei ungeöffnete Kisten Kaliber 5.45 im Arsenal, die reichen noch anderthalb Wochen. Und dann hab ich noch was zu Hause unterm Kissen liegen.« Der Oberst grinste, so dass seine großen, gelben Zähne sichtbar wurden. »Eine Kiste bekomm ich da sicher noch zusammen. Nicht die Patronen sind unser Problem, sondern die Leute.«
»Und jetzt sag ich dir mal, was unser Problem ist. Wenn wir keine Lieferungen mehr kriegen, werden wir in zwei Wochen die Tore nach Süden schließen müssen, denn ohne Munition können wir die Tunnel dort sowieso nicht halten. Das bedeutet, dass wir zwei Drittel unserer Mühlen nicht mehr instand halten können. Schon nach einer Woche werden die ersten kaputtgehen, und Ausfälle bei den Stromlieferungen hat die Hanse gar nicht gern. Wenn sie Glück haben, finden sie ruckzuck einfach einen anderen Versorger. Wenn nicht … Aber was interessiert mich der Strom! Seit fast fünf Tagen ist der Tunnel mausetot, und kein Schwein zu sehen. Was, wenn dort was eingestürzt ist? Oder durchgebrochen? Was, wenn wir jetzt abgeschnitten sind?«
»Halt die Luft an. Die Stromkabel sind in Ordnung. Die Zähler laufen, also scheint die Hanse ihren Strom zu bekommen. Einen Einsturz hätten wir doch sofort mitbekommen. Und wenn es Sabotage wäre, wäre nicht das Telefon, sondern die Stromleitungen gekappt. Und was die Tunnel angeht – wovor fürchtest du dich denn? Selbst in den besten Zeiten hat sich doch niemand hierher verirrt. Allein schon der Nachimowski prospekt: Ohne Begleitung kommst du da nicht durch. Fremde Händler wagen sich doch längst nicht mehr zu uns. Und die Banditen wissen inzwischen auch Bescheid – schließlich haben wir jedes Mal einen von ihnen lebend gehen lassen. Also keine Panik.«
»Du hast gut reden«, brummte Wladimir Iwanowitsch, hob die Binde über der leeren Augenhöhle und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Ich geb dir drei Mann«, sagte der Oberst, nun etwas milder. »Mehr geht beim besten Willen nicht. Und hör auf zu rauchen. Du weißt doch, dass ich das nicht einatmen darf, außerdem vergiftest du dich selber! Ein Tee wäre mir ehrlich gesagt lieber …«
»Aber bitte, immer gerne.« Der Vorsteher rieb sich die Hände, nahm den Telefonhörer ab und blaffte: »Istomin hier. Tee für mich und den Oberst.«
»Lass den diensthabenden Offizier kommen«, bat der Kommandeur der Außenposten und nahm sein Barett ab. »Dann regle ich das gleich mit dem Suchtrupp.«
Tee gab es bei Istomin immer einen besonderen, von der WDNCh, eine Auslese. Kaum jemand konnte sich so etwas noch leisten, denn auf dem Weg vom anderen Ende der Metro hierher schlug die Hanse auf den Lieblingstee des Stationsvorstehers ganze drei Mal ihre Zölle auf. Das machte ihn so teuer, dass Istomin sich diese Schwäche wohl nie erlaubt hätte, wären da nicht seine guten Verbindungen an der Dobryninskaja gewesen. Mit irgendwem war er dort gemeinsam im Krieg gewesen, und so hatten die Karawanenführer, wenn sie von der Hanse zurückkamen, jedes Mal ein schmuckes Paket dabei, das Istomin stets persönlich in Empfang nahm.
Vor einem Jahr allerdings hatte es erste Lieferausfälle gegeben, und alarmierende Gerüchte waren bis zur Sewastopolskaja gedrungen: Die WDNCh werde von einer neuen, furchtbaren Gefahr heimgesucht, die womöglich die gesamte orangene Linie bedrohte – anscheinend unbekannte Mutanten von der Oberfläche. Diese seien fast unsichtbar, praktisch unverwundbar und könnten Gedanken lesen. Es hieß, die Station sei gefallen, und die Hanse habe aus Angst vor einer Invasion die Tunnel jenseits des Prospekt Mira gesprengt. Die Teepreise schossen damals in die Höhe, eine Zeit lang war gar keiner mehr zu bekommen, und Istomin machte sich bereits ernsthaft Sorgen. Doch einige Wochen später hatten sich die Wogen geglättet, und die Karawanen brachten neben Patronen und Glühbirnen auch wieder den berühmten Tee zur Sewastopolskaja. War das nicht die Hauptsache?
Während Istomin dem Kommandeur Tee in eine Porzellantasse mit abgeblättertem Goldrand goss, genoss er für einen Moment mit geschlossenem Auge den aromatischen Dampf. Dann schenkte er sich selbst ein, sank schwer in seinen Stuhl und begann mit einem Silberlöffelchen klingelnd eine Saccharintablette umzurühren.
Die Männer schwiegen, und eine Minute lang war das melancholische Klingeln das einzige Geräusch in dem halbdunklen, mit Tabakrauch vernebelten Büro. Plötzlich wurde es von einem schrillen Glockenläuten übertönt, das – fast im gleichen Takt – aus dem Tunnel heranflog: »Alarm!«
Der Kommandeur der Außenposten sprang überraschend behende von seinem Platz auf und rannte aus dem Zimmer. In der Ferne knallte erst ein einsamer Gewehrschuss, dann setzten Kalaschnikows ein – eine, zwei, drei. Beschlagene Soldatenstiefel hämmerten über den Bahnsteig, und man hörte die kräftige Bassstimme des Obersts, wie sie – bereits aus einiger Entfernung – die ersten Befehle erteilte.
Istomin streckte die Hand nach der glänzenden Miliz-MP aus, die an seinem Schrank hing, doch dann griff er sich ans Kreuz, stöhnte, winkte ab, setzte sich wieder an den Tisch und nahm noch einen Schluck Tee. Ihm gegenüber dampfte einsam die Tasse des Obersts, und daneben lag dessen Barett – er hatte es in der Eile liegen gelassen. Der Stationsvorsteher zog eine Grimasse und begann erneut, diesmal halblaut, mit dem jetzt abwesenden Kommandeur zu streiten. Es ging noch immer um das gleiche Thema – doch nun brachte er neue Argumente vor, die ihm zuvor im Eifer des Gefechts nicht eingefallen waren.
An der Sewastopolskaja kursierte so mancher düstere Witz darüber, warum die benachbarte Station ausgerechnet Tschertanowskaja hieß; zu deutlich ließ sich aus ihrem Namen das Wort »Tschort« – Teufel – herauslesen. Die Mühlen des Wasserkraftwerks erstreckten sich ziemlich weit in ihre Richtung, doch obwohl sie als verlassen galt, dachte niemand auch nur im Entferntesten daran, sie einfach zu besetzen und zu erschließen – wie sie es zuvor mit der Kachowskaja getan hatten. Die technischen Teams, die unter Begleitschutz die äußersten Generatoren montiert hatten und nun von Zeit zu Zeit warten mussten, sahen sich vor, der Tschertanowskaja höchstens auf hundert Meter nahe zu kommen. Fast jeder, dem eine solche Expedition bevorstand und der kein fanatischer Atheist war, bekreuzigte sich heimlich, und manche nahmen sogar für alle Fälle von ihren Familien Abschied.
Die Tschertanowskaja war eine üble Station, das spürte jeder, der sich ihr auch nur auf einen halben Kilometer näherte. In ihrer Naivität hatten die Sewastopoler in der Anfangszeit schwer bewaffnete Stoßtrupps losgeschickt, um ihren Einflussbereich zu erweitern. Zurück kamen diese, wenn überhaupt, schwer angeschlagen und mindestens um die Hälfte dezimiert. Dann saßen die gestandenen Haudegen am Feuer, stotternd und sabbernd, und obwohl man sie so nah hingesetzt hatte, dass ihre Kleidung zu schmoren begann, zitterten sie in einem fort. Nur mit Mühe erinnerten sie sich daran, was sie erlebt hatten – und nie glich ein Bericht dem anderen.
Es hieß, dass irgendwo jenseits der Tschertanowskaja Seitenzweige des Haupttunnels tief hinabtauchten und sich zu einem enormen Labyrinth natürlicher Höhlen vernetzten, in dem es angeblich von Ungeheuern nur so wimmelte. Dieser Ort wurde an der Sewastopolskaja »das Tor« genannt – ein willkürlicher Begriff, denn niemand der lebenden Bewohner hatte diesen Teil der Metro je betreten. Allerdings erzählte man sich eine Geschichte aus der Zeit, als die Linie noch nicht erschlossen war. Eine große Aufklärungseinheit war damals angeblich bis hinter die Tschertanowskaja gekommen und hatte das »Tor« entdeckt. Über einen Sender – eine Art Kabeltelefon – hatte der Funker mitgeteilt, sie stünden am Eingang eines schmalen Korridors, der fast senkrecht hinabführte. Weiter kam er nicht. In den folgenden Minuten vernahmen die Chefs der Sewastopolskaja gellende Schreie voller Entsetzen und Schmerz. Seltsamerweise versuchten die Aufklärer nicht zu schießen – vielleicht begriffen sie, dass gewöhnliche Waffen sie nicht schützen würden. Als Letzter verstummte der Kommandeur der Gruppe, ein gewissenloser Söldner von der Station Kitai-gorod, der seinen Gegnern, nachdem er sie besiegt hatte, stets den kleinen Finger abschnitt. Er schien sich in einiger Entfernung von dem Mikrofon zu befinden, das dem Funker entglitten war, denn seine Worte waren schlecht zu verstehen. Doch bei genauerem Hinhören verstand der Stationsvorsteher, was der Mann im Todeskampf vor sich hinschluchzte: ein Gebet. Eines dieser einfachen, naiven Gebete, die kleine Kinder von ihren gläubigen Eltern lernen. Dann brach die Leitung ab.
Nach diesem Vorfall wurden alle weiteren Versuche, bis zur Tschertanowskaja vorzudringen, eingestellt. Ja, es hatte sogar Pläne gegeben, auch die Sewastopolskaja aufzugeben und sich bis zur Hanse zurückzuziehen. Doch die verfluchte Station schien jener Grenzposten zu sein, der das Ende der menschlichen Herrschaft in der Metro markierte. Die Kreaturen, die diese Grenze bedrängten, machten den Bewohnern der Sewastopolskaja eine Menge Ärger, aber sie waren nicht unverwundbar, und bei einer gut organisierten Verteidigung ließen sich diese Angriffe relativ leicht und fast ohne eigene Verluste zurückschlagen – solange die Munition ausreichte. Einige dieser Monster ließen sich zwar nur mit Explosivgeschossen oder Hochspannungsfallen aufhalten. Doch in den meisten Fällen hatten es die Wachen mit nicht ganz so furchteinflößenden – wenn auch extrem gefährlichen – Wesen zu tun.
»Da, noch einer! Oben, im dritten Rohr!«
Der obere Scheinwerfer war aus seiner Halterung gebrochen, baumelte zuckend wie ein Gehenkter an einem Kabel und verstreute sein hartes Licht über die Szenerie vor den Befestigungsanlagen: Mal griff er sich gebückte Gestalten anschleichender Mutanten heraus, mal verbarg er sie wieder in der Dunkelheit, mal blendete sein grelles Licht die Wachen. Verräterische Schatten rasten umher, zogen sich zusammen und dehnten sich wieder aus, verzerrten sich zu hässlichen Fratzen, so dass man nicht mehr zwischen Mensch und Bestie unterscheiden konnte.
Der Posten lag günstig, denn an dieser Stelle liefen zwei Tunnel zusammen. Kurz vor der Apokalypse hatte die Metrostroi hier mit Reparaturarbeiten begonnen, die jedoch nie vollendet wurden. Die Sewastopoler hatten an diesem Knotenpunkt eine Festung errichtet: zwei MG-Stellungen, eineinhalb Meter dicke Schutzwälle aus Sandsäcken, Panzersperren und Schranken auf den Gleisen, Hochspannungsfallen in näherer und weiterer Entfernung sowie ein sorgfältig durchdachtes Warnsystem. Doch wenn die Mutanten in Wellen kamen, wie an diesem Tag, schien selbst diese Verteidigungsanlage zu wanken.
Der MG-Schütze lallte monoton vor sich hin. Blutige Blasen schlugen aus seinen Nasenlöchern, und er betrachtete verwundert seine feuchten, glänzend roten Handflächen. Die Luft rund um seinen Petscheneg flimmerte vor Hitze, doch jetzt klemmte das verfluchte Ding. Der Schütze gab ein kurzes Grunzen von sich, lehnte sich gegen die Schulter seines Nachbarn, eines hünenhaften Kämpfers mit geschlossenem Titanhelm, und verstummte. In der nächsten Sekunde ertönte ein markerschütterndes Kreischen: Die Bestie griff an.
Der Mann im Helm schob den blutverschmierten MG-Schützen zur Seite, stand auf, riss seine Kalaschnikow hoch und gab einen kurzen Feuerstoß ab. Das widerliche, sehnige, von mattgrauer Haut umspannte Tier war bereits losgesprungen, hatte die knotigen Vorderklauen ausgebreitet und segelte auf seinen Flughäuten von oben herab. Der Bleihagel setzte dem Kreischen ein Ende, doch das tote Tier flog noch ein Stück weiter. Dann rammte der 150-Kilo-Rumpf gegen die Sandsäcke, so dass eine dichte Staubwolke hochwirbelte.
»Das war’s wohl.«
Der scheinbar endlose Ansturm der Kreaturen, der vor ein paar Minuten aus den riesigen abgesägten Rohren an der Tunneldecke losgebrochen war, schien tatsächlich versiegt. Vorsichtig verließen die Wachleute ihre Deckung.
»Eine Trage hierher! Einen Arzt! Schnell, bringt ihn zur Station!«
Der Hüne, der das letzte Tier getötet hatte, befestigte ein Bajonett auf seinem Sturmgewehr und näherte sich ohne Hast all den toten und verletzten Kreaturen, die in der Kampfzone herumlagen. Er drückte mit dem Stiefel das zähnestarrende Maul des jeweiligen Tiers zu Boden und stieß mit dem Bajonett kurz und gezielt in dessen Auge. Schließlich lehnte er sich erschöpft gegen die Sandsäcke, blickte in den Tunnel, hob endlich das Visier seines Helms und nahm einen Schluck aus seiner Feldflasche.
Die Verstärkung von der Station traf ein, als alles bereits entschieden war. Auch der Kommandeur der Außenposten kam schließlich angehumpelt, schwer atmend und seine diversen Gebrechen verfluchend, die Tarnjacke aufgeknöpft. »Wo bekomme ich jetzt drei Mann her? Soll ich sie mir vielleicht aus dem Fleisch schneiden?«
»Was meinen Sie damit, Denis Michailowitsch?«, fragte einer der Wachleute.
»Istomin will, dass wir sofort einen Aufklärungstrupp zur Serpuchowskaja schicken. Er hat Schiss wegen der Karawane. Nur wo krieg ich drei Leute her? Ausgerechnet jetzt …«
»Noch immer nichts Neues?«, fragte der Mann mit der Feldflasche, ohne sich umzudrehen.
»Nichts«, bestätigte der Alte. »Aber viel Zeit ist ja auch nicht vergangen. Was bitte ist gefährlicher? Wenn wir jetzt unsere Stellungen im Süden schwächen, ist in einer Woche vielleicht keiner mehr da, um die Karawane zu empfangen!«
Der andere schüttelte den Kopf und schwieg. Er rührte sich auch nicht, als der Kommandeur endlich aufhörte zu murren und die Wachleute fragte, ob jemand sich für einen Drei-Mann-Trupp melden wolle.
Freiwillige gab es genug. Die meisten Wachen hatten genug vom Herumsitzen an der Station und vermochten sich einfach nicht vorzustellen, dass etwas gefährlicher sein könnte als die Verteidigung des Südtunnels.
Von den sechs Leuten, die sich bereit erklärten, wählte der Oberst diejenigen aus, auf die er am besten glaubte verzichten zu können. Ein vernünftiger Gedanke: Keiner der drei sollte jemals wieder zur Station zurückkehren.
Drei Tage waren vergangen, seit man die Troika losgeschickt hatte. Dem Kommandeur schien es, dass die Leute hinter seinem Rücken flüsterten und ihm misstrauische Blicke zuwarfen. Selbst die intensivsten Gespräche verstummten, wenn er sich näherte, und in dem angespannten Schweigen, das dann folgte, glaubte er eine unausgesprochene Forderung zu vernehmen: Erkläre es uns, rechtfertige dich.
Dabei tat er nur seine Arbeit – er sorgte für die Sicherheit der Außenposten an der Sewastopolskaja. Er war Taktiker, kein Stratege. Es gab ohnehin zu wenig Soldaten. Welches Recht hatte er, sie einfach so zu verheizen, indem er sie auf irgendwelche zweifelhaften, wenn nicht gar völlig sinnlosen Expeditionen schickte?
Vor drei Tagen war er davon noch absolut überzeugt gewesen. Doch jetzt, da jeder verängstigte, missbilligende, zweifelnde Blick seine Gewissheit aushöhlte, begann er zu schwanken. Ein Aufklärerteam mit leichter Bewaffnung benötigte für den ganzen Weg von der Hanse und zurück nicht einmal einen Tag – selbst wenn man mögliche Kampfhandlungen und Verzögerungen an den Grenzen der unabhängigen Stationen berücksichtigte.
Der Kommandeur befahl, niemanden einzulassen, schloss sich in seinem kleinen Büro ein, presste die heiße Stirn gegen die Wand und begann vor sich hin zu murmeln. Zum hundertsten Mal ging er alle Möglichkeiten durch. Was war mit den Händlern passiert? Was mit dem Spähtrupp?
Vor Menschen hatte man an der Sewastopolskaja keine Angst – höchstens vielleicht vor der Armee der Hanse. Der schlechte Ruf der Station, die übertriebenen Erzählungen der wenigen Augenzeugen darüber, welch hohen Preis die Stationsbewohner für das eigene Überleben zahlten – all das war von den Händlern aufgenommen und per Mundpropaganda in der Metro verbreitet worden. Und es hatte bald Wirkung gezeigt. Die Stationsleitung begriff schnell, welche Vorteile eine solche Reputation mit sich brachte, und nahm deren Festigung fortan selbst in die Hand. Informanten, Kaufleute, Reisende und Diplomaten durften von nun an mit offizieller Genehmigung die schrecklichsten Lügenmärchen über die Sewastopolskaja und den gesamten Abschnitt jenseits der Serpuchowskaja erzählen.
Nur wenige vermochten hinter diesem Vorhang aus Schall und Rauch die Attraktivität und wahre Bedeutung der Station zu erkennen. Vereinzelt hatten in den letzten Jahren ahnungslose Banden versucht, die Außenposten zu durchbrechen, doch die Kriegsmaschinerie der Sewastopolskaja, angeführt von ehemaligen Offizieren, zermalmte sie ohne weitere Probleme.
Die Aufklärungstroika hatte jedenfalls genaue Instruktionen erhalten: Wenn sie auf eine Bedrohung trafen, sollten sie jegliche Konfrontation vermeiden und schnellstmöglich wieder zurückkehren.
Natürlich gab es auf der Strecke noch die Nagornaja – kein so furchtbarer Ort wie die Tschertanowskaja, aber dennoch gefährlich und unheilvoll. Und den Nachimowski prospekt, dessen Tore zur Oberfläche klemmten, weshalb er vor Eindringlingen von oben nicht ganz gefeit war. Die Ausgänge zu sprengen kam für die Sewastopolskaja nicht infrage, da die Stalker den Ausstieg am Nachimowski prospekt für ihre Expeditionen nutzten. Alleine wagte niemand die Station zu passieren, doch bisher war noch jede Troika mit den Kreaturen, die dort gelegentlich lauerten, fertig geworden.
Ein Einsturz? Das Grundwasser? Ein Sabotageakt? Ein plötzlicher Überfall der Hanse? Es war der Oberst, nicht der Stationsvorsteher Istomin, der den Frauen der vermissten Aufklärer jetzt eine Antwort geben musste, während diese ihm unruhig und fragend in die Augen blickten, in der Hoffnung, dort ein Versprechen, einen Trost zu finden. Er musste es den Soldaten der Garnison erklären. Zum Glück stellten die keine überflüssigen Fragen und waren ihm – noch – treu ergeben. Und schließlich musste er all die besorgten Leute beruhigen, die sich nach Feierabend an der Stationsuhr trafen, um nachzusehen, wie lange die Karawane schon unterwegs war.
Istomin hatte erzählt, er sei in den letzten Tagen mehrfach gefragt worden, warum das Licht an der Station heruntergedreht worden sei. Einige Male hätten sie ihn sogar aufgefordert, die Lampen wieder auf die alte Leistung zu bringen. Dabei hatte niemand auch nur daran gedacht, den Strom herunterzufahren: Die Beleuchtung lief auf vollen Touren. Nein, es war nicht die Station selbst, sondern es waren die Herzen der Menschen, in denen die Finsternis zunahm, und nicht einmal die hellsten Quecksilberlampen kamen dagegen an.
Die Telefonleitung zur Serpuchowskaja war noch immer tot. Was dem Oberst ein sehr wichtiges, weil für die Bewohner der Metro seltenes Gefühl nahm: das Gefühl der Nähe zu anderen Menschen. Solange die Kommunikation funktionierte, solange die Karawanen regelmäßig unterwegs waren und die Reise bis zur Hanse weniger als einen Tag dauerte, war jeder der Bewohner frei zu gehen oder zu bleiben. Jeder wusste, dass nur fünf Tunnel weiter die eigentliche Metro begann, die Zivilisation – die Menschheit.
Ähnlich hatten sich früher wahrscheinlich die Polarforscher im arktischen Eis gefühlt, wenn sie sich – sei es aus wissenschaftlichem Interesse oder wegen der hohen Löhne – auf einen monatelangen Kampf gegen Kälte und Einsamkeit einließen. Sie waren Tausende von Kilometern vom Festland entfernt, und doch blieb es immer in ihrer Nähe, denn das Radio funktionierte, und einmal im Monat hörten sie das Dröhnen des Flugzeugs, wenn es wieder einige Kisten mit Dosenfleisch über ihnen abwarf.
Die Eisscholle jedoch, auf der sich die Sewastopolskaja befand, war losgebrochen, und mit jeder Stunde trieb sie weiter fort – in einen Eissturm, einen schwarzen Ozean, in Leere und Ungewissheit.
Das Warten zog sich hin, und die vage Sorge des Obersts wurde allmählich zu einer düsteren Gewissheit: Die drei Aufklärer, die er zur Serpuchowskaja geschickt hatte, würde er nicht wiedersehen. Nun noch drei weitere Kämpfer von den Außenposten abzuziehen, um sie ebenfalls dieser unbekannten Gefahr auszusetzen, war völlig ausgeschlossen. Ihren sicheren Tod, der doch keinen Ausweg aus der Lage bot, konnte er sich einfach nicht leisten. Dennoch schien es ihm verfrüht, die hermetischen Tore herabzulassen, die Südtunnel zu schließen und einen großen Stoßtrupp zu bilden. Warum musste ausgerechnet er diese Entscheidung treffen? Eine Entscheidung, die in jedem Fall die falsche war.
Der Kommandeur der Außenposten seufzte, öffnete die Tür leicht, sah sich hastig um und rief den Posten zu sich. »Hast du eine Zigarette für mich? Das ist aber die allerletzte, das nächste Mal gib mir keine mehr, egal wie sehr ich dich darum bitte. Und sag es niemandem.«
Als Nadja, ein stämmiges, gesprächiges Tantchen mit löchrigem Daunenschal und verschmierter Schürze, den Topf mit Fleisch und Gemüse brachte, lebten die Wachleute auf. Kartoffeln, Gurken und Tomaten galten als absolute Delikatessen, und außer an der Sewastopolskaja boten höchstens noch einige Kabaks an der Ringlinie oder in der Polis Derartiges an. Das lag nicht nur an den komplexen Hydrokulturen, die zum Anbau der eingelagerten Samen notwendig waren, sondern auch daran, dass es sich kaum jemand in der Metro leisten konnte, kilowattweise Strom zu verpulvern, nur um die Speisekarte der Soldaten etwas aufzulockern.
Selbst die Stationsleitung bekam lediglich an Feiertagen Gemüse auf den Tisch, denn es wurde vor allem für die Kinder gezüchtet. Istomin hatte erst heftig mit den Köchen streiten müssen, um sie davon zu überzeugen, dass sie zu dem Schweinefleisch, das es an ungeraden Tagen immer gab, noch je hundert Gramm gekochte Kartoffeln und eine Tomate dazulegten – um die Moral zu heben.
Und tatsächlich: Als Nadja ihr Sturmgewehr etwas ungeschickt ablegte und den Topfdeckel anhob, glätteten sich die Falten auf den Gesichtern der Wachleute augenblicklich. Keiner von ihnen hätte jetzt noch über die vermisste Karawane oder die verschollene Aufklärertruppe reden wollen – es hätte ihnen nur den Appetit verdorben.
Ein etwas älterer Mann in einer Wattejacke mit schmalen Metro-Abzeichen rührte lächelnd die Kartoffeln in seiner Schüssel um und sagte: »Heute muss ich den ganzen Tag schon an die Komsomolskaja denken. Die würde ich gern mal wieder sehen. Diese Mosaiken! Die schönste Station in ganz Moskau, finde ich.«
»Ach, hör auf, Homer«, entgegnete ein unrasierter Dicker mit Ohrenklappenmütze. »Du hast da eben gelebt, klar, dass du sie immer noch magst. Aber was ist mit den Glasmalereien an der Nowoslobodskaja? Und den herrlichen Säulen und Deckenfresken an der Majakowskaja?«
»Mir hat die Ploschtschad Rewoljuzii immer gefallen«, gestand schüchtern ein ernster, nicht mehr ganz junger Mann, der als Scharfschütze eingeteilt war. »Ich weiß, es ist blöd, aber all diese finsteren Matrosen und Piloten, die Grenzsoldaten mit ihren Hunden … das fand ich schon als Kind so toll.«
»Also ich finde das gar nicht blöd«, pflichtete ihm Nadja bei, während sie die Reste im Topf zusammenkratzte. »Besonders unter den männlichen Statuen gibt es ein paar sehr gutaussehende Typen. He, Brigadier! Halt dich ran, sonst gehst du noch leer aus!«
Der großgewachsene, breitschultrige Kämpfer, der abseits gesessen war, näherte sich mit gemächlichen Schritten dem Lagerfeuer, nahm seine Portion und kehrte an seinen Platz zurück – möglichst nah am Tunnel, möglichst weit weg von den Menschen.
Der Dicke deutete mit dem Kopf auf den breiten Rücken des Mannes, der wieder ins Halbdunkel abgetaucht war, und fragte flüsternd: »Lässt der sich eigentlich auch mal an der Station blicken?«
»Nein, er sitzt schon über eine Woche hier«, antwortete der Scharfschütze ebenso leise. »Er übernachtet im Schlafsack. Wie er das bloß aushält … Vielleicht braucht er das ja. Vor drei Tagen, als die Bestien beinahe Rinat aufgefressen hätten, hat er danach jede einzelne kaltgemacht. Eigenhändig. Eine Viertelstunde lang. Als er zurückkam, waren seine Stiefel voller Blut, und sein Gewehr auch. Richtig zufrieden sah er aus.«
»Das ist kein Mensch, sondern eine Maschine«, bemerkte ein hagerer MG-Schütze. »Ich würde lieber nicht in seiner Nähe schlafen wollen. Hast du gesehen, was mit seinem Gesicht passiert ist?«
Der Alte, den sie Homer nannten, zuckte mit den Schultern und sagte: »Komisch, ich fühl mich nur mit ihm wirklich sicher. Was wollt ihr denn von ihm? Der Typ ist in Ordnung, hat eben was abgekriegt. Wozu brauchen wir hier Schönheit, das ist was für die Stationen. Und weil wir gerade dabei sind: Deine Nowoslobodskaja ist für mich der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Diese Glasfenster kann ich mir nicht mal nüchtern anschauen … Glasfenster, dass ich nicht lache!«
»Und ein Kolchosen-Mosaik über die halbe Decke ist vielleicht keine Geschmacklosigkeit?«
»Wo bitte hast du so was denn an der Komsomolskaja gesehen?«
Jetzt geriet der Dicke in Fahrt. »Die ganze verdammte Sowjetkunst hat doch nur ein Thema: das Leben auf der Kolchose und unsere heldenhaften Piloten!«
»Serjoscha, lass die Piloten aus dem Spiel«, warnte ihn der Scharfschütze.
Plötzlich ertönte eine dumpfe, tiefe Stimme: »Die Komsomolskaja ist Scheiße, und die Nowoslobodskaja auch.«
Vor lauter Überraschung blieb dem Dicken seine Tirade im Hals stecken, und er starrte erschrocken ins Halbdunkel zu dem Brigadier hinüber. Auch die anderen verstummten. Der Fremde nahm so gut wie nie an ihren Gesprächen teil. Selbst wenn man ihn etwas fragte, antwortete er, wenn überhaupt, nur einsilbig.
Er saß noch immer mit dem Rücken zu ihnen, die Augen unentwegt in den Schlund des Tunnels gerichtet. »An der Komsomolskaja sind die Decken viel zu hoch und die Säulen zu dünn, da liegt der ganze Bahnsteig wie auf dem Präsentierteller. Außerdem lassen sich die Übergänge schlecht verbarrikadieren. Und an der Nowoslobodskaja sind die Wände voller Risse, egal wie oft die da was drüberschmieren. Mit einer Granate kannst du die komplette Station begraben. Und deine Glasfenster sind schon längst zersplittert. Viel zu spröde.«
Über diese Art von Kriterien hätte man trefflich streiten können, doch niemand wagte Einspruch zu erheben. Der Brigadier schwieg eine Weile, dann sagte er wie beiläufig: »Ich gehe zur Station. Homer kommt mit. Ablösung ist in einer Stunde. Artur übernimmt so lange das Kommando.«
Der Scharfschütze stand hastig auf und nickte, obwohl der Brigadier das gar nicht sehen konnte. Auch der Alte erhob sich und begann seine umherliegenden Habseligkeiten einzupacken, obgleich er noch gar nicht fertig gegessen hatte. Als der Kämpfer ans Feuer zurückkehrte, trug er bereits die komplette Montur, samt Helm und voluminösem Rucksack.
»Viel Glück!«, sagte der Scharfschütze.
Während sich die beiden ungleichen Gestalten – der hünenhafte Brigadier und der hagere Homer – in dem noch beleuchteten Teil des Tunnels allmählich entfernten, folgte ihnen der Scharfschütze mit dem Blick. Dann rieb er sich fröstelnd die Hände und schüttelte sich. »Irgendwie ist mir kalt. Legt noch ein paar Kohlen drauf.«
Unterwegs verlor der Brigadier kein einziges Wort. Er erkundigte sich nur, ob Homer tatsächlich einmal als Hilfszugführer und davor als einfacher Streckenwärter gearbeitet hatte. Der Alte blickte ihn erst misstrauisch an, doch dann nickte er. An der Sewastopolskaja hatte er stets behauptet, er habe es bis zum Zugführer gebracht, und seine Arbeit als Streckenwärter hatte er stets unterschlagen, da ihm das ein wenig peinlich war.
Der Brigadier entbot den Wachleuten einen kurzen militärischen Gruß. Diese machten ihm Platz, und er betrat das Büro des Stationsvorstehers ohne anzuklopfen. Istomin und der Oberst erhoben sich überrascht von ihren Stühlen und gingen ihm entgegen. Beide sahen irgendwie zerzaust, müde und verloren aus.
Während Homer schüchtern am Eingang stehenblieb und von einem Bein aufs andere trat, zog der Brigadier den Helm vom Kopf, legte ihn mitten auf Istomins Papiere und fuhr sich mit der Hand über den glattrasierten Schädel. Im Licht der Lampe war erneut zu sehen, wie furchtbar entstellt sein Gesicht war: Die linke Wange war zusammengezogen wie nach einer Brandverletzung, das Auge darüber war nur noch ein enger Spalt, und eine riesige violette Narbe kroch in Windungen vom Mundwinkel bis zum Ohr. Obwohl Homer diesen Anblick schon zu kennen glaubte, lief es ihm erneut eiskalt über den Rücken, als sähe er es zum ersten Mal.
»Ich gehe selbst zum Ring«, stieß der Brigadier hervor. Er hatte nicht mal gegrüßt.
Es folgte tiefes Schweigen. Homer wusste bereits, dass dieser Mann ein außergewöhnlicher Kämpfer war und daher bei der Stationsleitung in besonderem Ansehen stand. Doch erst jetzt begann er zu begreifen, dass der Brigadier im Unterschied zu allen anderen Sewastopolern überhaupt keinem Befehl unterstand. Er erwartete offenbar keinerlei Genehmigung von den beiden alten und erschöpften Herren, im Gegenteil: Eher schien er ihnen einen Befehl erteilt zu haben, den sie auszuführen hatten. Und wieder – zum wievielten Mal? – fragte sich Homer: Wer war dieser Mann?
Der Kommandeur der Außenposten warf dem Stationsvorsteher einen Blick zu. Sein Gesicht verfinsterte sich, als wolle er Einspruch erheben, doch dann winkte er ab. »Wie du willst, Hunter«, sagte er. »Dir kann man sowieso nichts ausreden.«
2
RÜCKKEHR
Homer horchte auf. Hunter. Diesen Namen hatte er an der Sewastopolskaja noch nie gehört. Es klang wie ein Spitzname – wie sein eigener, denn natürlich hieß er nicht Homer, sondern Nikolai Iwanowitsch. Nach dem Schöpfer der griechischen Heldenepen hatte man ihn erst hier, an dieser Station benannt, denn er liebte Geschichten und Gerüchte aller Art.
»Euer neuer Brigadier«, hatte der Oberst den Wachleuten im Südtunnel zwei Monate zuvor erklärt. Sie musterten den breitschultrigen Mann mit dem Kevlaranzug und dem schweren Helm mit einem Gemisch aus Misstrauen und Neugier. Der wiederum wandte sich gleichgültig von ihnen ab; der Tunnel und die Befestigungsanlagen interessierten ihn offenbar weit mehr als die ihm anvertrauten Leute. Denjenigen, die zu ihm kamen, um sich vorzustellen, drückte er die Hand, jedoch ohne ein Wort zu sagen. Schweigend nickte er, prägte sich ihre Namen ein und paffte ihnen blauen Papirossa-Dunst ins Gesicht, als wolle er sie auf Abstand halten. Im Schatten seines hochgeklappten Visiers schimmerte trübe das von der tiefen Scharte entstellte, leblose Auge. Weder damals noch später wagten die Wachleute nach seinem Namen zu fragen, und so blieb er für sie einfach nur »der Brigadier«. Offenbar hatte die Station einen jener teuren Söldner angeheuert, die keinen eigenen Namen benötigten.
Hunter.
Während Homer unschlüssig am Eingang von Istomins Büro stand, formte er dieses seltsame Wort lautlos mit den Lippen. Es passte nicht zu einem Menschen – eher zu einem mittelasiatischen Schäferhund. Er konnte ein Lächeln nicht unterdrücken: Tatsächlich, früher hatte es einmal solche Hunde gegeben. Wie kam das alles bloß in seinen Kopf? Eine kämpferische Rasse, mit gestutztem Schwanz und direkt am Schädel kupierten Ohren – nichts Überflüssiges.
Doch je öfter er sich den Namen vorsagte, desto bekannter erschien er ihm. Wo hatte er ihn schon einmal gehört? Vermutlich war er irgendwann einmal in jenem unendlichen Strom aus Legenden und Geschwätz an ihm hängengeblieben und bis auf den Grund seines Gedächtnisses gesunken. In der Zwischenzeit hatte sich darüber eine dicke Schlammschicht aus Namen, Fakten, Gerüchten und Zahlen gebildet – all diese unnützen Daten über das Leben anderer Menschen, denen Homer so begierig lauschte und die er sich so gewissenhaft zu merken versuchte.
Hunter … Ein Schwerverbrecher, auf dessen Kopf die Hanse eine Belohnung ausgesetzt hatte? Homer warf einen Stein in den trüben Teich seines Gedächtnisses und lauschte. Nein. Ein Stalker? Passte nicht zu seinem Äußeren. Ein Feldkommandeur? Schon eher. Und, wie es schien, ein legendärer noch dazu …
Homer musterte noch einmal verstohlen das ausdruckslose, gleichsam gelähmte Gesicht des Brigadiers. Der Hundename passte erstaunlich gut zu ihm.
»Ich brauche noch zwei Mann. Homer kommt mit, er kennt die Tunnel hier.« Der Brigadier bat den Alten nicht um sein Einverständnis, ja er wandte sich ihm nicht einmal zu. »Den anderen könnt ihr auswählen. Einen Läufer, einen Kurier. Ich gehe noch heute los.«
Istomin nickte hastig, doch dann besann er sich und sah den Oberst fragend an. Dieser murmelte finster sein Einverständnis, obwohl er all diese Tage so verzweifelt mit dem Stationsvorsteher um jeden Mann gerungen hatte. Homers Meinung schien niemanden zu interessieren, aber er dachte auch nicht im Entferntesten daran zu protestieren. Trotz seines Alters hatte er sich noch nie geweigert, derartige Aufträge auszuführen. Er hatte seine Gründe.
Der Brigadier nahm seinen Helm vom Tisch und ging auf den Ausgang zu. Einen Augenblick lang hielt er in der Tür inne, dann sagte er in Homers Richtung: »Verabschiede dich von deiner Familie. Rüste dich für einen langen Marsch. Nimm keine Patronen mit, du bekommst sie von mir.« Dann verschwand er.
Homer lief ihm nach, um wenigstens ungefähr zu erfahren, was ihm bei dieser Expedition bevorstand. Doch als er auf den Bahnsteig kam, sah er, dass Hunter sich bereits mit riesigen Schritten entfernt hatte. Es war aussichtslos ihn einzuholen. Kopfschüttelnd blickte Homer ihm nach.
Entgegen seiner Gewohnheit hatte der Brigadier seinen Helm nicht aufgesetzt. Vielleicht war er einfach in Gedanken versunken, oder er brauchte mehr Luft. Er kam an ein paar jungen Mädchen vorbei, die träge auf dem Bahnsteig herumsaßen. Es waren Schweinehüterinnen, die gerade Mittagspause hatten. Plötzlich flüsterte eine von ihnen ihm hinterher: »Schaut mal, Mädels, was für ein Zombie!«
»Wo hast du denn den ausgegraben?«, fragte Istomin. Erleichtert sank er auf seinem Stuhl zusammen und streckte seine dicken Finger nach einer Packung Papirossapapier aus.
Das Kraut, das an dieser Station mit Genuss geraucht wurde, hatten angeblich Stalker an der Oberfläche unweit des Bitzewski-Parks gefunden. Einmal hatte der Oberst zum Spaß einen Geigerzähler an ein Päckchen »Tabak« gehalten, und dieser hatte tatsächlich unheilvoll zu ticken begonnen. Er entschloss sich umgehend mit dem Rauchen aufzuhören, und der Husten, der ihn bis dahin immer nachts heimgesucht und mit der Vorstellung von Lungenkrebs gequält hatte, ließ etwas nach. Istomin dagegen weigerte sich, der Geschichte mit der Radioaktivität zu viel Bedeutung beizumessen. Und er hatte nicht ganz unrecht – in der Metro gab es so gut wie nichts, das nicht mehr oder weniger »strahlte«.
»Wir kennen uns schon ewig«, erwiderte der Oberst unwillig. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Früher war er anders. Irgendetwas ist mit ihm passiert.«
»Seinem Gesicht nach zu urteilen, ist ganz sicher was mit ihm passiert.« Der Stationsvorsteher hüstelte und blickte nervös zum Eingang hinüber, als befürchte er, Hunter könne seine Worte hören.
Der Kommandeur der Außenposten wollte sich keineswegs darüber beschweren, dass der Brigadier so plötzlich aus dem Nebel der Vergangenheit aufgetaucht war; schließlich hatte sich dieser in kürzester Zeit zur wichtigsten Stütze des südlichen Außenpostens entwickelt. Doch konnte Denis Michailowitsch die Rückkehr seines alten Bekannten noch immer nicht ganz glauben.
Die Nachricht von Hunters furchtbarem und zugleich seltsamem Tod hatte sich ein Jahr zuvor wie ein Tunnelecho in der Metro verbreitet. Als er dann vor zwei Monaten plötzlich vor der Tür des Oberst erschien, hatte sich dieser hastig bekreuzigt. Die Leichtigkeit, mit der der Auferstandene die Wachposten passiert hatte – als wäre er durch die Kämpfer hindurchgegangen -, schürten bei Denis Michailowitsch Zweifel daran, ob alles mit rechten Dingen zuging.
Das Profil, das er durch den beschlagenen Türspion erblickte, kam ihm irgendwie bekannt vor: der Stiernacken, der glänzende Schädel, die leicht eingedrückte Nase. Doch der nächtliche Gast verharrte aus irgendeinem Grund halb abgewandt, hielt den Kopf gesenkt und machte keine Anstalten, die angespannte Stille aufzulösen. Der Oberst warf einen bedauernden Blick auf die geöffnete Flasche Süßwein auf seinem Tisch, seufzte tief und schob den Riegel am Türschloss beiseite. Der Kodex verpflichtete ihn, den eigenen Leuten zu helfen – ungeachtet, ob sie lebten oder nicht.
Hunter hob den Blick erst, als sich die Tür öffnete. Nun wurde klar, warum er die andere Seite seines Gesichts abgewandt hatte. Er hatte wohl befürchtet, der Oberst würde ihn sonst nicht erkennen. Zwar hatte Denis Michailowitsch schon so manches gesehen, und das Garnisonskommando an der Sewastopolskaja kam ihm – im Vergleich zu seinen wilden Jahren – wie eine Ehrenpension vor, doch nun verzog er schmerzvoll das Gesicht, als habe er sich verbrannt. Dann lachte er unsicher, wie um sich für sein undiszipliniertes Verhalten zu entschuldigen.
Der Gast zeigte nicht einmal die Andeutung eines Lächelns. In dieser Nacht lächelte er kein einziges Mal. Während der vergangenen Monate waren die furchterregenden Narben, die sein Gesicht entstellten, zwar etwas verheilt, doch hatte dieser Mensch kaum noch etwas mit jenem Hunter gemein, an den sich Denis Michailowitsch erinnerte.
Über seine wundersame Rettung und die lange Abwesenheit sprach er kein Wort, und die erstaunten Fragen des Oberst schien er gar nicht zu hören. Vielmehr bat er Denis Michailowitsch, niemandem von seiner Rückkehr zu berichten. Wäre der Oberst dem gesunden Menschenverstand gefolgt, er hätte unverzüglich die Ältesten informiert – aber es gab da eine alte Schuld, die er bei Hunter zu begleichen hatte, und so ließ er ihn in Ruhe.
Dennoch stellte Denis Michailowitsch insgeheim Nachforschungen an. Tatsächlich hielt man seinen Gast überall für tot. Er war weder in Straftaten verwickelt gewesen, noch wurde er gesucht. Man hatte Hunters Leiche zwar nie gefunden, doch – das galt als ganz sicher – hätte Hunter andernfalls sicher ein Lebenszeichen von sich gegeben. Jaja, nickte der Oberst.
Dafür tauchte Hunter, besser gesagt: sein verschwommenes und – wie in solchen Fällen üblich – geschöntes Abbild in einem guten Dutzend halbwahrer Mythen und Erzählungen auf. Offenbar war ihm diese Rolle durchaus recht, und er beließ seine Kameraden in dem Glauben, so dass diese ihn lebendig zu Grabe trugen.
Denis Michailowitsch dachte an seine alte Schuld und zog die einzig richtige Konsequenz: Er beruhigte sich und spielte das Spiel mit. Waren Dritte anwesend, sprach er Hunter nicht mit seinem Namen an. Nur Istomin weihte er ein, ohne jedoch allzu sehr ins Detail zu gehen.
Den kümmerte das nicht viel, denn der Brigadier hatte sich seine tägliche Portion Suppe bald mehr als verdient. Tag und Nacht hielt er am Außenposten im Südtunnel die Stellung; an der Station tauchte er höchstens einmal pro Woche auf – am Badetag. Und selbst wenn er hier, in dieser Hölle, nur untergetaucht war, um sich vor irgendwelchen Verfolgern zu verstecken, so störte dies Istomin keineswegs. Die Dienste von Legionären mit dunkler Biographie wusste er durchaus zu schätzen – kämpfen war das Einzige, was er von ihnen verlangte, und in dieser Hinsicht war an dem Mann wirklich nichts auszusetzen.
Die Wachleute, die sich zuerst über die herablassende Art ihres neuen Brigadiers beschwert hatten, verstummten nach dem ersten Kampf. Als sie sahen, wie methodisch und berechnend, in einer Art unmenschlichem, kaltem Rausch dieser alles vernichtete, was zu vernichten war, zog jeder von ihnen seine eigenen Schlüsse. Mit ihm Freundschaft zu schließen versuchte keiner, doch gehorchten sie ihm widerspruchslos, so dass er seine dumpfe, gebrochene Stimme niemals erheben musste. In dieser Stimme lag etwas von dem hypnotischen Zischen einer Schlange, und selbst der Stationsvorsteher nickte stets gehorsam, wenn Hunter zu ihm sprach – noch bevor dieser zu Ende gesprochen hatte, einfach so, für alle Fälle.
Zum ersten Mal seit Längerem war die Luft in Istomins Büro leichter geworden – als wäre darin soeben ein lautloses Gewitter niedergegangen, das die lang ersehnte Entspannung gebracht hatte. Es gab keinen Grund mehr zu streiten, denn einen besseren Kämpfer als Hunter gab es nicht. Allerdings: Wenn auch er im Tunnel umkam, blieb den Sewastopolern nur noch eines …
»Soll ich anordnen, dass die Operation vorbereitet wird?«, fragte Denis Michailowitsch.
»Du hast drei Tage. Das muss genügen.« Istomin schnalzte mit dem Feuerzeug und kniff die Augen zusammen. »Länger können wir nicht auf sie warten. Wie viele Leute benötigen wir?«
»Ein Stoßtrupp steht schon bereit. Ich kümmere mich um einen weiteren, das sind nochmal etwa zwanzig Mann. Wenn von denen übermorgen noch nichts zu hören ist« – der Oberst deutete mit dem Kopf zum Ausgang – »musst du die allgemeine Mobilmachung bekanntgeben. Dann versuchen wir einen Durchbruch.«
Istomin hob die Augenbrauen, doch entgegnete er nichts, sondern zog nur lange an der leise knisternden Selbstgedrehten, während Denis Michailowitsch nach ein paar vollgekritzelten Blättern auf dem Tisch griff und nach einem nur ihm verständlichen System Kreise um verschiedene Namen zu ziehen begann.
Einen Durchbruch? Der Stationsvorsteher blickte über den grauen Nacken des Oberst hinweg durch den schwimmenden Tabakdunst auf die Metrokarte, die an der Wand hing. Gelb, speckig und übersät mit kleinen Zeichen war dieser Plan eine Art Chronik des vergangenen Jahrzehnts: Pfeile standen für Aufklärungsmärsche, Kreise für Belagerungen, Sterne für Wachposten und Ausrufezeichen für verbotene Zonen. Zehn Jahre waren darin dokumentiert, zehn Jahre, von denen kein Tag ohne Blutvergießen vergangen war.
Unterhalb der Sewastopolskaja, gleich hinter der Station Juschnaja hörten die Markierungen auf. Soweit sich Istomin erinnern konnte, war noch nie jemand von dort zurückgekehrt. Wie ein langer, verzweigter Wurzelstock kroch die Linie nach unten, jungfräulich rein wie die weißen Flecken auf den Karten der spanischen Eroberer, die zum ersten Mal an der Küste Westindiens anlegten. Doch eine Conquista der gesamten Linie war für die Sewastopoler eine Nummer zu groß – keine noch so große Anstrengung dieser von der Strahlenkrankheit geschwächten Menschen hätte dazu gereicht.
Und nun verhüllte der bleiche Nebel der Ungewissheit auch noch jenen Stumpf ihrer gottverlassenen Linie, der nach oben wies, zur Hanse, zu den Menschen. Wenn der Oberst seinen Leuten in Kürze befehlen würde, sich zum Kampf zu rüsten, würde sich niemand weigern. An der Sewastopolskaja war der Krieg um die Vernichtung des Menschen, der vor über zwei Jahrzehnten begonnen hatte, niemals auch nur für eine Minute abgebrochen, und wenn man jahrelang im Angesicht des Todes lebt, weicht die Angst einem gleichgültigen Fatalismus, Aberglauben, Talismänner und tierische Instinkte nehmen überhand. Aber wer wusste denn, was sie erwartete, dort zwischen dem Nachimowski prospekt und der Serpuchowskaja? Wer wusste, ob man dieses rätselhafte Hindernis überhaupt durchbrechen konnte und ob es dahinter noch etwas gab, was den Kampf lohnte?
ENDE DER LESEPROBE
Titel der russischen Originalausgabe METPO 2034
Verlagsgruppe Random House FSC-DEU-0100
Deutsche Erstausgabe 11/2009 Redaktion: Maria Peeck Lektorat: Sascha Mamczak
Copyright © 2009 by Dmitry Glukhovsky unter Vermittlung der Nibbe & Wiedling Literary Agency Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
www.heyne.deKarten: Herbert Ahnen
eISBN : 978-3-641-03774-3
www.randomhouse.de