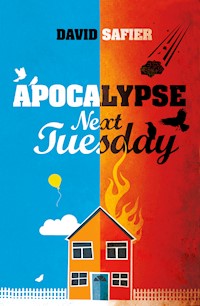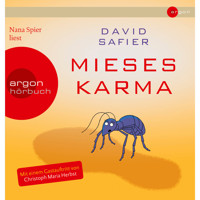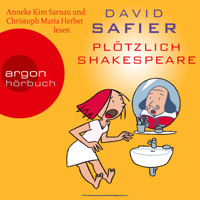9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Moderatorin Kim Lange hält endlich den heißersehnten Fernsehpreis in den Händen. Schade, dass sie noch am selben Abend von den Trümmern einer Raumstation erschlagen wird. Im Jenseits erfährt Kim, dass sie in ihrem Leben sehr viel Mieses Karma gesammelt hat. Zur Strafe findet sie sich mit sechs Beinen und Fühlern in einem Erdloch wieder: Sie ist eine Ameise! Da hilft nur eins: Gutes Karma muss her! «Eine irre Idee, gespickt mit kuriosen Einfällen.» (Brigitte) «Ungemein witzig, elegant geschrieben und dabei hinreißend albern.» (Max) «Ein wirklich überraschendes und witziges Buch!» (NDR) «Höchst amüsant!» (Hamburger Morgenpost)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Ähnliche
David Safier
Mieses Karma
Roman
Über dieses Buch
Moderatorin Kim Lange hält endlich den heißersehnten Fernsehpreis in den Händen. Schade, dass sie noch am selben Abend von den Trümmern einer Raumstation erschlagen wird. Im Jenseits erfährt Kim, dass sie in ihrem Leben sehr viel mieses Karma gesammelt hat. Zur Strafe findet sie sich mit sechs Beinen und Fühlern in einem Erdloch wieder: Sie ist eine Ameise! Da hilft nur eins: Gutes Karma muss her!
«Eine irre Idee, gespickt mit kuriosen Einfällen.» (Brigitte)
«Ungemein witzig, elegant geschrieben und dabei hinreißend albern.» (Max)
«Ein wirklich überraschendes und witziges Buch!» (NDR)
«Höchst amüsant!» (Hamburger Morgenpost)
Vita
David Safier, 1966 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Autoren der letzten Jahre. Seine Romane, darunter «Mieses Karma», «Jesus liebt mich», «Happy Family» und «MUH!» erreichten Millionenauflagen im In- und Ausland. Der erste Band seiner Krimireihe rund um die Ex-Kanzlerin gehört zu den bestverkauften Büchern des Jahres 2021. Als Drehbuchautor wurde David Safier unter anderem mit dem Grimme-Preis sowie dem International Emmy ausgezeichnet. Er lebt und arbeitet in Bremen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2010
Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Ulf K.
ISBN 978-3-644-30261-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marion, Ben und Daniel – ihr seid mein Nirwana
1. Kapitel
Der Tag, an dem ich starb, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und das lag nicht nur an meinem Tod. Um genau zu sein: Der schaffte es gerade so mit Ach und Krach auf Platz sechs der miesesten Momente des Tages. Auf Platz fünf landete der Augenblick, in dem Lilly mich aus verschlafenen Augen ansah und fragte: «Warum bleibst du heute nicht zu Hause, Mama? Es ist doch mein Geburtstag!»
Auf diese Frage schoss mir folgende Antwort durch den Kopf: «Hätte ich vor fünf Jahren gewusst, dass dein Geburtstag und die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises mal auf einen Tag fallen würden, hätte ich dafür gesorgt, dass du früher zur Welt gekommen wärst. Mit Kaiserschnitt!»
Stattdessen sagte ich nur leise zu ihr: «Es tut mir leid, mein Schatz.» Lilly knabberte traurig am Ärmel ihres Pumuckl-Pyjamas, und da ich diesen Anblick nicht länger ertragen konnte, fügte ich schnell den magischen Satz hinzu, der jedes traurige Kindergesicht wieder zum Lächeln bringt: «Willst du dein Geburtstagsgeschenk sehen?»
Ich hatte es selbst noch nicht gesehen. Alex musste es besorgen, da ich vor lauter Arbeit in der Redaktion schon seit Monaten nicht mehr irgendwo einkaufen war. Ich vermisste das auch nicht. Für mich gab es kaum etwas Nervigeres als in der Supermarktschlange wertvolle Lebenszeit zu vergeuden. Und für all die schönen Dinge des Lebens, von Kleidung über Schuhe bis hin zu Kosmetika, musste ich nicht einkaufen gehen. Die bekam ich dankenswerterweise als Kim Lange, Moderatorin von Deutschlands wichtigster Polit-Talkshow, von den nobelsten Firmen gestellt. Die «Gala» zählte mich dementsprechend zu den «bestangezogenen Frauen um die dreißig», während eine andere große Boulevardzeitung mich weniger schmeichelhaft als «leicht stämmige Brünette mit deutlich zu dicken Schenkeln» bezeichnete. Ich lag mit der Zeitung im Clinch, weil ich verboten hatte, Fotos von meiner Familie abzudrucken.
«Hier ist eine kleine, wunderschöne Frau, die will ihr Geschenk haben», rief ich durchs Haus. Und aus dem Garten tönte es zurück: «Dann soll diese wunderschöne kleine Frau mal herauskommen!» Ich nahm meine aufgeregte Tochter an die Hand und sagte zu ihr: «Zieh dir aber deine Hausschühchen an.»
«Ich will die nicht anziehen», motzte Lilly.
«Du erkältest dich sonst!», warnte ich. Aber sie antwortete nur: «Ich hab mich gestern auch nicht erkältet. Und da hatte ich auch keine Hausschuhe an.»
Und eh ich ein vernünftiges Gegenargument für diese abstruse, aber in sich geschlossene Kinderlogik gefunden hatte, lief Lilly auch schon barfuß in den vom Morgentau glänzenden Garten.
Geschlagen folgte ich ihr und atmete tief ein. Es roch nach «bald ist Frühling», und ich freute mich zum tausendsten Mal mit einer Mischung aus Verblüffung und Stolz darüber, dass ich meiner Tochter so ein tolles Potsdamer Haus mit einem Riesengarten bieten konnte, war ich doch selbst in einem Berliner Plattenbau aufgewachsen. Unser Garten dort hatte lediglich aus drei Blumenkästen bestanden, bepflanzt mit Geranien, Stiefmütterchen und Zigarettenkippen.
Alex erwartete Lilly an einem von ihm selbst zusammengezimmerten Meerschweinchenkäfig. Er sah mit seinen dreiunddreißig Jahren immer noch verdammt gut aus – wie eine jüngere Version von Brad Pitt, nur dankenswerterweise ohne dessen langweiligen Schlafzimmerblick. Ich wäre wohl von seinem Aussehen hin und weg gewesen, wenn noch alles okay zwischen uns gewesen wäre. Doch leider war unsere Beziehung zu diesem Zeitpunkt so stabil wie die Sowjetunion 1989. Und sie hatte ähnlich viel Zukunft.
Alex kam nicht damit klar, mit einer erfolgreichen Frau verheiratet zu sein, und ich nicht damit, mit einem frustrierten Hausmann zusammenzuleben, den es von Tag zu Tag fertiger machte, dass er sich auf dem Spielplatz von anderen Müttern anhören musste: «Es ist ja sooo toll, wenn ein Mann sich um die Kinder kümmert, anstatt dem Erfolg hinterherzujagen.»
Entsprechend begannen Gespräche zwischen uns oft mit «Deine Arbeit ist dir wichtiger als wir» und endeten noch häufiger mit «Wehe, du wirfst jetzt den Teller, Kim!».
Früher folgte darauf wenigstens noch Versöhnungssex. Jetzt hatten wir schon seit drei Monaten keinen mehr. Was schade war, denn unser Sex war ordentlich bis großartig, je nach Tagesform. Und das will was heißen, denn mit all den Männern, die ich vor Alex hatte, war Sex nicht gerade ein Anlass gewesen, die innere La-Ola-Welle zu machen.
«Hier ist dein Geschenk, wunderschönes Mädchen», sagte Alex lächelnd und zeigte auf das mümmelnde Meerschweinchen im Stall. Lilly rief begeistert: «Ein Meerschweinchen!» Und ich ergänzte entsetzt in Gedanken: «Ein verdammt schwangeres Meerschweinchen!»
Während Lilly ihr neues Haustier voller Freude betrachtete, packte ich Alex an der Schulter und zog ihn zur Seite.
«Das Vieh ist kurz davor, sich zu vermehren», sagte ich zu ihm.
«Nein, Kim, es ist nur etwas dick», wiegelte er ab.
«Wo hast du es denn her?»
«Von einer gemeinnützigen Tierfarm», kam die pampige Antwort.
«Warum hast du es denn nicht in einem Zooladen gekauft?»
«Weil die Tiere da genauso am Rad drehen wie deine Fernsehtypen.»
Peng! Das sollte mich treffen, und das tat es auch. Ich atmete durch, schaute auf die Uhr und sagte mit gepresster Stimme: «Keine dreißig Sekunden.»
«Wie ‹keine dreißig Sekunden›?», fragte Alex irritiert.
«Du hast keine dreißig Sekunden mit mir geredet, ohne mir Vorwürfe zu machen, dass ich heute zu der Verleihung gehe.»
«Ich mach dir keine Vorwürfe, Kim. Ich stell nur deine Prioritäten in Frage», erwiderte er.
Das alles regte mich wahnsinnig auf, denn eigentlich hätte ich mir doch gewünscht, dass er mit zu der Fernsehpreis-Verleihung kommen würde. Schließlich sollte das der größte Moment in meinem Berufsleben werden. Und da hätte mein Mann verdammt nochmal an meine Seite gehört! Aber ich konnte ja schlecht seine Prioritäten in Frage stellen, denn die bestanden ja darin, Lillys Kindergeburtstag auszurichten.
Und so sagte ich sauer: «Und das blöde Meerschweinchen ist doch schwanger!»
Alex erwiderte trocken: «Mach doch einen Schwangerschaftstest», und ging zum Käfig. Ich blickte ihm wütend nach, während er das Meerschweinchen rausholte und es der überglücklichen Lilly in die Arme legte. Die beiden fütterten es mit Löwenzahn. Und ich stand daneben. Gewissermaßen im Abseits, das mehr und mehr zu meinem Stammplatz in unserer kleinen Familie wurde. Kein schöner Ort.
Und hier im Abseits musste ich an meinen eigenen Schwangerschaftstest zurückdenken. Als meine Regel damals ausblieb, schaffte ich es sechs Tage lang mit fast übermenschlicher Verdrängungskraft, diese Tatsache zu ignorieren. Am siebten sprintete ich gleich morgens mit einem «Scheiße, Scheiße, Scheiße» auf den Lippen in die Apotheke, kaufte einen Schwangerschaftstest, sprintete zurück nach Hause, ließ den Test vor lauter Nervosität ins Klo fallen, rannte wieder zur Apotheke, kaufte einen neuen Test, rannte erneut zurück, pinkelte auf das Stäbchen und musste eine Minute warten.
Es war die längste Minute meines Lebens.
Eine Minute beim Zahnarzt ist ja schon lang. Eine Minute Musikantenstadl ist noch länger. Aber die Minute, die so ein blöder Schwangerschaftstest braucht, um sich zu entscheiden, ob er nun einen zweiten Strich haben wird oder nicht, ist die härteste Geduldsprobe der Welt.
Noch härter war es aber für mich, den zweiten Strich zu sehen.
Ich überlegte abzutreiben, aber ich konnte den Gedanken daran kaum ertragen. Ich hatte gesehen, wie meine beste Freundin Nina das mit neunzehn Jahren nach unserem Italienurlaub tun musste und wie sehr sie dabei gelitten hatte. Mir war durchaus klar, dass ich bei aller Härte, die ich mir als Talkshow-Moderatorin angewöhnt hatte, mit diesen Gewissensqualen viel schlechter klarkommen würde als Nina.
Es folgten also neun Monate, die mich sehr verunsicherten: Während ich Panik schob, kümmerte sich Alex extrem lieb um mich und freute sich unglaublich auf das Kind. Das machte mich irgendwie wütend, fühlte ich mich dadurch doch umso mehr als Rabenschwangere.
Überhaupt war für mich der ganze Schwangerschaftsprozess unheimlich abstrakt. Ich sah Ultraschallaufnahmen und fühlte Tritte gegen die Bauchwand. Aber dass da ein kleiner Mensch in mir wuchs, konnte ich nur in ganz wenigen, kurzen Momenten des Glücks begreifen.
Die meiste Zeit war ich damit beschäftigt, mich mit Übelkeiten und Hormonschwankungen herumzuschlagen. Und mit Schwangerschaftskursen, in denen man «seinen Uterus abspüren» sollte.
Sechs Wochen vor der Geburt hörte ich auf zu arbeiten und bekam auf unserem Sofa einen Eindruck davon, wie sich gestrandete Wale fühlen mussten. Die Tage waren zäh, und als meine Fruchtblase platzte, wäre ich vielleicht sogar erleichtert gewesen, dass es endlich losging, hätte ich nicht gerade in der Kassenschlange im Supermarkt gestanden.
Ich legte mich, wie von meinem Arzt für einen solchen Fall angeordnet, sofort auf den kalten Boden. Die umstehenden Kunden kommentierten das mit Sätzen wie: «Ist das nicht Kim Lange, die olle Moderatorin?», «Mir egal, Hauptsache, die machen noch ’ne zweite Kasse auf!» und «Bin ich froh, dass ich den Schweinkram nicht wegwischen muss.»
Der Krankenwagen kam erst nach dreiundvierzig Minuten, in denen ich ein paar Autogramme gab und der Kassiererin erklären musste, dass sie ein falsches Bild von männlichen Nachrichtensprechern hatte. («Nein, die sind nicht alle schwul.»)
Im Kreißsaal angekommen, begann eine fünfundzwanzigstündige Geburt. Die Hebamme spornte mich zwischen den fürchterlichen Wehen ständig an: «Sei positiv. Heiß jede Wehe willkommen!» Und ich dachte mir im Schmerzenswahn: «Wenn ich das hier überleb, bring ich dich um, du blöde Schnepfe!»
Ich glaubte, ich müsste sterben. Ohne Alex und seine beruhigende Art hätte ich es wohl kaum durchgestanden. Er wiederholte immer wieder mit fester Stimme: «Ich bin bei dir. Immer!» Und ich quetschte seine Hand dabei so fest, dass er sie noch Wochen später nicht richtig bewegen konnte. (Die Schwestern verrieten mir nachher, dass sie immer Noten vergeben, wie liebevoll Männer sich in den Stressstunden der Geburt gegenüber ihren Frauen verhalten. Alex erreichte eine sensationelle 9,7. Der allgemeine Notendurchschnitt lag bei 2,73.)
Als die Ärzte mir nach all der Qual die kleine – von der Geburt ganz zerknautschte – Lilly auf den Bauch legten, waren alle Schmerzen vergessen. Ich konnte sie nicht sehen, da mich die Ärzte noch versorgten. Aber ich spürte ihre weiche, faltige Haut. Und dieser Augenblick war der glücklichste in meinem ganzen Leben.
Nun, fünf Jahre später, stand Lilly im Garten vor mir, und ich konnte ihren Geburtstag nicht mitfeiern, weil ich zu der Fernsehpreis-Verleihung nach Köln musste.
Ich schluckte und ging schweren Herzens zu meiner Kleinen, die sich gerade einen Namen für das Meerschweinchen ausdachte («Entweder heißt es Pipi, Püpschen oder Barbara»). Ich gab ihr ein Küsschen und versprach: «Ich verbringe morgen den ganzen Tag mit dir.»
Alex kommentierte das abfällig: «Wenn du deinen Preis gewinnst, gibst du doch morgen die ganze Zeit Interviews.»
«Dann verbring ich eben den Montag mit Lilly», erwiderte ich angefressen.
«Da hast du Redaktionssitzung», konterte Alex.
«Dann lass ich die eben sausen.»
«Sehr wahrscheinlich», sagte er mit einem sarkastischen Grinsen, das bei mir den tiefen Wunsch auslöste, ihm eine Dynamitstange in den Mund zu stopfen. Er krönte das Ganze mit: «Du hast nie Zeit für die Kleine.»
Als Lilly das hörte, sagten ihre traurigen Augen: «Papa hat recht.» Das traf mich bis ins Mark. So sehr, dass ich zitterte.
Verunsichert streichelte ich Lilly über die Haare und sagte: «Ich schwör dir hoch und heilig, wir werden uns bald einen ganz tollen Tag machen.»
Sie lächelte schwach. Alex wollte etwas sagen, aber ich blickte ihn so durchdringend an, dass er sich das schlauerweise anders überlegte. Höchstwahrscheinlich konnte er die Dynamitstangen-Phantasie in meinen Augen lesen. Ich drückte Lilly nochmal fest an mich, ging über die Terrasse[*] ins Haus, atmete einmal kräftig durch und bestellte mir ein Taxi zum Flughafen.
Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, wie schwer es werden würde, meinen Schwur gegenüber Lilly zu erfüllen.
2. Kapitel
Auf Platz vier der miesesten Momente des Tages landete mein Blick in den Spiegel der Flughafentoilette. Der Moment war nicht etwa mies, weil ich wieder mal feststellte, dass ich für eine Zweiunddreißigjährige enorm viele Falten um die Augen hatte. Auch nicht, weil meine strohigen Haare sich standhaft weigerten, vernünftig zu liegen – für all das würde ich zwei Stunden vor der Verleihung des Fernsehpreises einen Termin bei meiner Stylistin Lorelei haben. Es war ein schlimmer Augenblick, weil ich mich bei der Frage ertappte, ob ich für Daniel Kohn attraktiv sein würde.
Daniel war ebenfalls in der Kategorie «Beste Moderation Informationssendung» nominiert und seines Zeichens ein geradezu obszön gutaussehender, dunkelhaariger Mann, der im Gegensatz zu den meisten Moderatoren in unserem Lande auf natürliche Art und Weise charmant war. Daniel wusste um seine Wirkung auf Frauen und nutzte sie auch mit großer Freude aus. Und jedes Mal, wenn er mich auf irgendwelchen Medienpartys traf, blickte er mir tief in die Augen und sagte: «Ich würde auf alle diese Frauen verzichten, wenn du mich erhörst.»
Natürlich hatte der Satz ähnlich viel Wahrheitsgehalt wie die Aussage: «Am Südpol gibt es rosa Elefanten.»
Aber ein Teil von mir wünschte sich, dass es doch stimmte. Und ein weiterer Teil von mir träumte davon, den Fernsehpreis zu gewinnen, anschließend souverän und mit leicht triumphalem Grinsen an Daniels Tisch vorbeizuschlendern und nachts mit ihm im Hotel wildesten Sex zu haben. Stundenlang. Bis die Hotelleitung an die Tür hämmert, weil sich eine Rockband nebenan über den Lärm beschwert.
Der größte Teil von mir aber hasste mich für die Gedanken der ersten beiden Teile. Würde ich mit Daniel im Bett landen, würde die Presse von so einer Affäre garantiert Wind bekommen, Alex würde sich scheiden lassen, und ich hätte als Rabenmutter meiner kleinen Lilly endgültig das Herz gebrochen. Mein Wunsch, mit Daniel zu schlafen, bereitete mir daher ein so schlechtes Gewissen, dass ich das Gesicht im Spiegel die nächsten zwanzig Jahre nicht mehr sehen wollte.
Ich wusch mir schnell die Hände, verließ die Flughafentoilette und ging zum Gate. Dort begrüßte mich Benedikt Carstens mit einem überschwänglichen «Das wird unser Tag, Süße!» und kniff mir kräftig in die Wange.
Der stets im feinsten Zwirn gekleidete Carstens war mein Chefredakteur und mein Mentor. Quasi mein persönlicher Meister Yoda, nur mit deutlich besserem Satzbau. Er hatte mich in der Berliner Radiostation entdeckt, in der ich nach dem Studium gearbeitet hatte. Ich war dort anfangs nur eine kleine Redakteurin. Doch eines Sonntagmorgens erschien der Moderator nicht zum Dienst. Er hatte bei einer Discotour in der Nacht zuvor gegenüber einem türkischen Türsteher die Theorie geäußert, dass es sich bei dessen Mutter um eine räudige Hündin handle.
Ich musste spontan für den nachhaltig indisponierten Mann «On Air» gehen und sagte das erste Mal in meinem Leben: «Es ist sechs Uhr, guten Morgen.» Von diesem Augenblick an war ich süchtig. Ich liebte den Adrenalinrausch bei Rot-Licht. Ich hatte meine Bestimmung gefunden!
Carstens verfolgte meine Arbeit ein paar Monate, suchte mich schließlich auf, sagte: «Sie haben die beste Stimme, die ich je gehört habe», und gab mir einen Job in Deutschlands aufregendstem Fernsehsender. Er brachte mir bei, wie man sich vor der Kamera am besten präsentiert. Und er zeigte mir das Allerwichtigste in diesem Geschäft: wie man seine Kollegen aussticht. In letzterer Disziplin reifte ich dank seiner Führung zu einer Großmeisterin und erhielt in der Redaktion den Beinamen: «Die, die über Leichen geht und dabei auch noch nachtritt». Aber wenn das der Preis war, um meine Bestimmung zu leben, zahlte ich ihn gerne.
«Ja, das wird unser Tag», sagte ich mit einem gequälten Lächeln zu Carstens. Er blickte mich an und fragte: «Ist was mit dir, Süße?» Da ich schlecht antworten konnte: «Ja, ich will mit Daniel Kohn von der Konkurrenz schlafen», sagte ich nur: «Nein, alles in Ordnung.»
«Du musst dich nicht verstellen. Ich weiß genau, was los ist», erwiderte er.
Panik schoss in mir hoch: Wusste er von mir und Daniel Kohn? Hatte er gesehen, wie Daniel mich auf dem Medienempfang im Kanzleramt angeflirtet hatte? Und dass ich dabei rot wurde wie eine Frau, die von Robbie Williams auf die Konzertbühne geholt wird?
Carstens lächelte: «Ich wär an deiner Stelle auch aufgeregt. Man ist nicht alle Tage für den Fernsehpreis nominiert.» Für eine Sekunde war ich erleichtert: Es ging nicht um Kohn. Doch gleich darauf musste ich schlucken. Ich war tatsächlich tierisch nervös, hatte es nur wegen meines schlechten Gewissens gegenüber Lilly den ganzen Morgen komplett verdrängt. Aber nun war die Aufregung wieder mit voller Kraft da: Würde ich heute Abend den Preis gewinnen? Würden alle Kameras mein strahlendes Siegerlächeln einfangen? Oder bin ich in der morgigen Sonntagszeitung nur «die leicht stämmige Verliererin mit deutlich zu dicken Schenkeln»?
Meine Finger näherten sich nervös dem Mund, und ich konnte meine Zähne gerade noch in letzter Sekunde davon abbringen, meine Nägel zu kauen.
In Köln angekommen, checkten wir im Hyatt ein, dem Nobelhotel, in dem alle Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis untergebracht waren. Ich warf mich in meinem Zimmer aufs weiche Bett, zappte im Zehntel-Sekunden-Rhythmus durch die Fernsehprogramme, landete dabei beim Pay-TV und fragte mich: Wer zum Teufel gibt zweiundzwanzig Euro aus für einen Pornofilm mit dem Titel «Ich tanze für Sperma»?
Ich beschloss, auf dem Altar dieser Frage nicht allzu viele graue Zellen zu opfern und in die Hotellobby zu gehen, um einen dieser chinesischen Beruhigungstees zu trinken, die leicht nach Fischsuppe schmecken.
In der Lobby spielte ein Pianist so nervtötend Balladen von Richard Clayderman, dass ich mir ausmalte, wie er und ich uns in einem Wild-West-Saloon befanden: er seine Weisen spielend, ich einen Lynchmob organisierend.
Und als ich in Gedanken gerade mit meinen Jungs beim Hufschmied von Dodge City Teer und Federn organisierte, sah ich plötzlich … Daniel Kohn.
Er checkte an der Rezeption ein, und mein Puls begann zu rasen. Ein Teil von mir hoffte, dass Kohn mich sieht. Ein weiterer Teil betete darum, dass er sich sogar zu mir setzt. Doch der größte Teil von mir fragte sich, wie er die beiden anderen blöden, nervigen, mein Leben durcheinanderbringenden Teile endlich zum Schweigen bringen konnte.
Tatsächlich sah mich Daniel und lächelte mir zu. Der Teil von mir, der sich das gewünscht hatte, verfiel in einen enthemmten Freudentaumel und schrie – wie weiland Fred Feuerstein: «Yapadapaduh!»
Daniel kam auf mich zu und setzte sich mit einem netten «Hi, Kim» an den Tisch. Der Teil, der darum gebetet hatte, schnappte sich daraufhin Teil eins und sang nun gemeinsam mit ihm: «Oh Happy Day!»
Als Teil drei Protest einlegen wollte, schnappten sich ihn die beiden anderen Teile, knebelten ihn und zischten ihm zu: «Halt endlich dein Maul, du olle Spaßbremse!»
«Schon aufgeregt wegen heute Abend?», fragte Daniel, und ich bemühte mich, meine Nervosität zu überspielen und eine möglichst schlagfertige Antwort zu bringen. Nach langen Sekunden erwiderte ich «Nein» und musste feststellen, dass diese Antwort in Sachen Schlagfertigkeit doch etwas zu wünschen übrigließ.
Daniel blieb gelassen: «Musst du auch nicht, denn du gewinnst garantiert.» Er sagte es so charmant, ich hätte ihm beinahe geglaubt, dass er es aufrichtig meint. Aber natürlich war er felsenfest davon überzeugt, selbst zu gewinnen.
«Und wenn du gewonnen hast, müssen wir darauf anstoßen», sagte er.
«Das müssen wir», entgegnete ich. Diese Antwort war zwar auch nicht gerade brillant, aber immerhin hatte ich drei Worte sinnvoll aneinandergereiht. Das war schon ein kleiner Fortschritt in Sachen Souveränität.
«Stoßen wir auch an, wenn ich gewinne?», fragte Daniel nach.
«Natürlich tun wir das», erwiderte ich mit leichtem Zittern in der Stimme.
«Dann wird es in jedem Fall ein schöner Abend.»
Daniel stand sichtlich zufrieden auf – er hatte, was er wollte – und sagte: «Sorry, ich muss los. Ich muss mich frisch machen.»
Ich schaute ihm nach, sah seinen tollen Hintern und phantasierte, wie der wohl unter der Dusche aussah. Und bei diesem Gedanken knabberte ich nun doch an meinen Fingernägeln.
«Was ist denn mit deinen Nägeln passiert, die sehen ja aus wie nach einer Hungersnot?», fragte Lorelei, meine Stylistin, als ich mich von ihr im Friseursalon des Hotels aufpeppen ließ. Neben mir war die geballte Weiblichkeit der Branche versammelt: Schauspielerinnen, Moderatorinnen, Dekoschnecken von Prominenten. Keine von ihnen war für irgendeinen Preis nominiert, es ging ihnen nur darum, beim «Sehen und Gesehenwerden» die Konkurrenz auszustechen. Sie wünschten mir alle viel Glück und meinten es natürlich nicht ernst. Genauso wenig, wie ich es ernst meinte, wenn ich sagte: «Du siehst wunderbar aus», oder: «Deine Figur ist großartig», oder: «Du übertreibst, deine Nase hat nicht das Zeug zum Hubschrauberlandeplatz.»
So plapperten wir alle heuchlerisch durcheinander. Bis Sandra Kölling den Salon betrat.
Sandra sah aus wie die Viertplatzierte bei einem «Sabine Christiansen Look Alike»-Wettbewerb und war meine Vorgängerin als Moderatorin des «Late Talk». Ich hatte ihren Job bekommen, weil ich besser war als sie. Und weil ich fleißiger war. Und weil ich die Chefetage dezent darauf hingewiesen hatte, dass sie ein kleines Kokainproblem hatte.
Jeder in dem Salon wusste, dass Sandra und ich seitdem eine Feindschaft pflegten, wie man sie sonst nur aus amerikanischen Soaps kennt. Entsprechend hörten alle Frauen in dem Salon auf zu plappern und blickten uns an. Sie erwarteten den erbitterten Verbalkampf zweier hasserfüllter Hyänen. Und freuten sich darauf.
Sandra fauchte mich an: «Du bist das Letzte.»
Ich antwortete nichts. Stattdessen fixierte ich ihre Augen. Lange. Hart. Eiskalt. Die Raumtemperatur sank um mindestens fünfzehn Grad.
Sandra begann zu frösteln. Ich starrte sie weiter an. Bis sie es nicht mehr ertragen konnte und den Salon verließ.
Die Frauen begannen wieder zu plappern. Lorelei stylte mir wieder die Haare. Und mein Spiegelbild lächelte mir zufrieden zu.
Als Lorelei ihr Werk vollendet hatte, lagen meine Haare perfekt, und nur Archäologen hätten unter der Schminke meine Augenfalten finden können. Selbst meine abgeknabberten Fingernägel wurden unter künstlichen Nägeln versteckt. Jetzt fehlte nur noch das Kleid, das mir gleich aufs Zimmer geliefert werden sollte. Von Versace! Ich freute mich wie irre auf den Fummel, der mehr kostete als ein Kleinwagen und den Versace mir für die Verleihung natürlich kostenlos anfertigte. Ich hatte in einer Berliner Boutique bereits die Anprobe gemacht und war der festen Überzeugung, an diesem Abend das beste Kleid der Welt zu tragen: Es hatte ein wunderschönes Rot, lag sanft auf der Haut, ließ meine Brüste größer aussehen und kaschierte meine Schenkel – was will eine Frau mehr von einem Kleid?
Ich saß voller Vorfreude in meinem Hotelzimmer und dachte stolz daran, dass ich einen weiten Weg gekommen bin: vom Kind in der Plattenbausiedlung, in der man Versace wahrscheinlich für einen italienischen Fußballer gehalten hätte, bis hin zur erfolgreichen Polit-Talkerin, die vielleicht in zwei Stunden den Deutschen Fernsehpreis gewinnen würde, umhüllt von einem traumhaften Versace-Kleid, das ihr Daniel Kohn in der Nacht vom Leib reißen würde, um dann wilden Sex mit ihr zu haben …
In diesem Augenblick klingelte mein Handy. Es war Lilly. Ein Tsunami des schlechten Gewissens überrollte mich: Lilly hatte Sehnsucht nach mir. Und ich dachte daran, meinen Mann – ihren Vater – zu betrügen!
Die Geburtstagsparty war in vollem Gange, und Lilly plapperte fröhlich drauflos: «Erst haben wir Sackhüpfen gemacht, dann Eierlaufen und dann eine Tortenschlacht ohne Torten.»
«Tortenschlacht ohne Torten?», fragte ich verwirrt nach.
«Wir haben uns mit Ketchup bespritzt … und mit Mayo … und mit Spaghetti Bolognese geworfen», erklärte sie. Ich stellte mir lächelnd die mäßige Begeisterung der anderen Mütter vor, wenn sie ihre Kinder abholen würden.
«Oma hat angerufen und mir auch gratuliert», sagte Lilly dann, und das Lächeln fiel mir aus dem Gesicht. Seit Jahren ließ ich nichts unversucht, meine kaputten Eltern aus unserem Familienleben herauszuhalten.
Mein nichtsnutziger Vater hatte uns für eine seiner vielen Eroberungen verlassen, als ich so alt war wie Lilly jetzt. Seitdem steigerte meine Mutter den Alkoholumsatz in dem Quick-Shop ihrer Plattenbausiedlung um jährlich circa zwölf Prozent. Wenn sie einen auf «liebe Oma» machte, tat sie das in der Regel nur, um noch mehr Geld herauszuschinden, als ich ihr ohnehin schon monatlich überwies.
«Wie war Oma denn drauf?», fragte ich vorsichtig, hatte ich doch Angst, dass sie schon besoffen war, als sie mit Lilly sprach.
«Sie hat gelallt», antwortete Lilly mit dem gelassenen Tonfall eines Kindes, das seine Oma nie anders erlebt hat. Ich suchte nach den richtigen Worten, um das Lallen zu erklären. Doch bevor ich auch nur ein einziges gefunden hatte, schrie Lilly plötzlich: «Oh, nein!»
Ich zuckte zusammen. «Was ist?», fragte ich hektisch, und tausend Katastrophenszenarien schossen mir gleichzeitig durch den Kopf.
«Der blöde Nils brennt die Ameisen mit einer Lupe nieder!»[*]
Lilly legte hastig auf, und ich atmete durch, nichts Schlimmes war passiert.
Wehmütig dachte ich an die Kleine, und mir war eins klar: Heute Abend durfte es auf gar keinen Fall ein «Versace-Kleid-vom-Leib-Reißen» für Daniel Kohn geben.
Ich überlegte, ob ich Alex anrufen sollte, um ihm zu danken, dass er Lilly so einen schönen Geburtstag ausrichtete. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass wir uns garantiert wieder streiten würden.
Kaum zu glauben, dass wir beide einmal glücklich miteinander waren.
Alex und ich hatten uns bei meiner Nach-Abi-Reise durch Europa kennengelernt. Er war Rucksacktourist, ich war Rucksacktouristin. Er liebte es, durch die Welt zu reisen, ich tat es nur meiner Freundin Nina zuliebe. Er liebte Venedig, ich fand die sommerliche Hitze, den Gestank der Kanäle und die Mückenplage von geradezu biblischem Ausmaß unerträglich.
An meinem ersten Abend in Venedig tat Nina am Strandufer das, was sie am besten konnte: Italienern mit ihren blonden Engelslocken den Kopf verdrehen. Ich tötete indessen Mücken im Akkord und fragte mich, wie man so blöd sein konnte, eine Stadt halb ins Wasser zu bauen. Zwischendrin wehrte ich hormondurchtränkte Italiener ab, die Nina ganz selbstverständlich gleich für mich mit aufriss. Einer von ihnen hieß Salvatore. Er hatte nur die untersten zwei Knöpfe seines weißen Hemdes zugeknöpft, roch nach billigstem Aftershave und hielt mein «Non, non!» für eine Aufforderung, mir unter die Bluse zu greifen. Ich wehrte mich mit einer Ohrfeige und einem «Stronzo!». Ich wusste zwar nicht, was das heißt, und hatte es nur von einem fluchenden Gondoliere aufgeschnappt, aber es machte Salvatore unglaublich wütend. Er drohte mir Schläge an, wenn ich nicht den Mund hielte.
Ich sagte nichts mehr.
Er griff mir in die Bluse. Panik und Ekel stiegen in mir auf. Aber ich konnte nichts tun. Ich war vor Angst wie gelähmt.
Gerade als seine Hand sich auf meine Brust legen wollte, hielt ihn Alex auf. Er kam aus dem Nichts. Wie ein Ritter aus einem Liebesmärchen, an die ich dank meines Vaters eigentlich gar nicht mehr glaubte. Salvatore baute sich mit einem Messer vor ihm auf. Er faselte dabei etwas auf Italienisch, und auch wenn ich kein Wort verstand, war der Tenor klar: Wenn Alex nicht sofort abzieht, wird er der Star in seiner ganz eigenen Version von «Wenn die Gondeln Trauer tragen». Alex, der jahrelang Jiu-Jitsu trainiert hatte, trat Salvatore das Messer aus der Hand. So hart, dass Salvatore beschloss, den Schwanz einzuziehen – im wahrsten Sinne des Wortes.
Während Nina die Nacht damit verbrachte, ihre Unschuld zu verlieren, saßen Alex und ich an der Lagune und redeten und redeten. Wir mochten die gleichen Filme («Manche mögen’s heiß», «Die nackte Kanone», «Star Wars»), wir mochten die gleichen Bücher («Der Herr der Ringe», «Der kleine König», «Calvin und Hobbes»), und wir hassten die gleichen Dinge (Lehrer).
Als die Sonne über Venedig wieder aufging, sagte ich zu ihm: «Ich glaub, wir sind seelenverwandt», und Alex antwortete: «Ich glaub das nicht nur, ich weiß es.»
Mann, haben wir uns geirrt!
Ich legte mein Handy wieder in meine Tasche und fühlte mich plötzlich ganz allein in meinem weichen Bett im Luxus-Hotelzimmer. Fürchterlich allein. Es sollte doch mein großer Tag werden, aber Alex teilte ihn nicht mit mir. Und ich mochte ihn nicht einmal anrufen.
Mir wurde endgültig klar: Wir liebten uns nicht mehr. Kein bisschen.
Und dieser Augenblick schaffte es auf Platz drei der miesesten Momente des Tages.
3. Kapitel
Nach fünf Minuten, in denen ich benommen dasaß, klopfte es an der Tür: Der Bote lieferte das Versace-Kleid. Der große Moment war gekommen: Ich packte es vorsichtig aus der Folie, mit der festen Absicht, vor Freude in die Luft zu springen. Doch meine Beine blieben fest im Boden verwurzelt. Ich war zu geschockt. Das Kleid war blau! Es sollte aber verdammt nochmal nicht blau sein! Und auch nicht trägerlos! Die Idioten hatten mir das falsche Kleid geschickt!
Ich rief sofort bei dem Botendienst an: «Hier ist Kim Lange. Ich habe das falsche Kleid bekommen.»
«Wieso?», fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung.
«Das frag ich Sie!», erwiderte ich, meine Stimme eindeutig im oberen Frequenzbereich.
«Hmm … », kam es zurück, und ich wartete darauf, dass sich dem Laut noch ein paar Worte anschließen würden. Sie taten es nicht.
«Vielleicht sollten Sie mal in Ihren Unterlagen nachsehen?», schlug ich vor. Mit meiner Stimme hätte man Glas zerschneiden können.
«Gut. Mach ich», kam es in gelangweiltem Tonfall zurück. Diesem Mann waren gerade andere Dinge wichtiger: Buchhaltung, Fernsehen, Nasepopeln.
«Ich muss in einer Stunde zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises», drängelte ich.
«Deutscher Fernsehpreis, nie von gehört», erwiderte er.
«Hören Sie, Ihre intellektuellen Lücken interessieren mich nicht. Entweder Sie schauen jetzt nach, wo mein Kleid abgeblieben ist, oder ich werde dafür sorgen, dass Ihr Laden nie wieder einen Auftrag aus der Fernsehbranche bekommt.»
«Kein Grund, sich so aufzuregen. Ich ruf gleich zurück», sagte er und legte auf.
«Gleich» war fünfundzwanzig Minuten später.
«Tut mir furchtbar leid, Ihr Kleid ist in Monte Carlo.»
«Monte Carlo!!», kiekste ich hysterisch.
«Monte Carlo», erwiderte er ohne jegliche Gemütsregung.
Der Mann erklärte mir, dass das Kleid in meinen Händen eigentlich für die Begleitung (höfliche Umschreibung für Callgirl) eines Software-Unternehmers bestimmt war. Sie hatte jetzt mein Kleid. In Monte Carlo. Es gab also keine Chance, es rechtzeitig wiederzubekommen. Der Mann bot mir als Entschädigung einen Gutschein an, der mir auch nicht sonderlich weiterhalf. Ich knallte den Hörer auf die Gabel und belegte den Kerl und all seine Nachfahren mit einem Durchfall-Fluch.
Ich probierte aus lauter Verzweiflung das blaue Kleid an und stellte zu meinem Leidwesen fest: Die junge «Begleitung» hatte eine wesentlich schlankere Figur als ich.
Ich betrachtete mich im Spiegel und sah, dass das enge Kleid meine Brüste prall hervorhob, ebenso meinen Po. Und ehrlich gesagt, das hatte was. Ich sah sexy aus wie noch nie, und das Kleid kaschierte meine Schenkel sogar noch besser als das ursprünglich geplante. Da ich als Alternative nur meine Jeans und einen Rollkragenpulli hatte, dessen Kragen dank Loreleis Haarschnitt voller kleiner kratziger Haarenden war, beschloss ich, das Kleid zur Verleihung zu tragen. Mit der beiliegenden schwarzen Stola würde es schon gehen. Ich durfte mich nur nicht zu heftig bewegen.
So angezogen, fuhr ich im Fahrstuhl nach unten in die Hotellobby, und die Wirkung war nicht übel: Alle Männer starrten mich an. Und keiner von ihnen verschwendete auch nur eine Sekunde damit, mein Gesicht anzuschauen.
Am Hoteleingang wartete Carstens und war schwer beeindruckt: «Mann, Süße, dieses Kleid verschlägt mir den Atem.» Ich fühlte, wie das Kleid mir den Brustkorb abschnürte, und keuchte: «Mir auch.»
Eine schwarze BMW-Limousine fuhr vor. Der Fahrer öffnete die Tür für mich und hielt sie dann die vollen zweieinhalb Minuten auf, die ich brauchte, um mich und das Kleid so im Fond des Wagens zu verstauen, dass Letzteres nicht durch eine ungelenke Bewegung riss.
Im abendlichen Regen fuhren wir durch das Gewerbegebiet Köln-Ossendorf, dem der Charme einer postatomaren Endzeitwelt anhaftete und in dem der Fernsehpreis-Veranstaltungsort Coloneum lag. Ich blickte auf verlassene Hallen mit zerstörten Fenstern. Und dabei durchströmte mich wieder die Einsamkeit.
Um gegen sie anzukämpfen, schnappte ich mir mein Handy und rief zu Hause an, aber niemand ging ran. Höchstwahrscheinlich wirbelte die Kindergeburtstagshorde gerade ein letztes Mal durch unser Haus wie ein Tornado. Alex würde sie mit seiner guten Laune befeuern. Und alle hätten Spaß. Und ich war nicht dabei. Mir ging es elend. Hundeelend.
Erst als unsere Limo durch drei Absperrungen gewunken wurde und an dem roten Teppich hielt, verscheuchte das aufkommende Adrenalin meine trüben Gedanken, denn hier standen über zweihundert Fotografen.
Der Fahrer öffnete mir die Tür, ich kämpfte mich in dem engen Kleid so schnell wie möglich (also ungelenk und in Zeitlupe) aus der Limousine und stand in dem gleißendsten Blitzlichtgewitter meines Lebens. Die Fotografen schrien: «Hierher, Kim!», «Schau zu mir!», «So ist’s sexy!» Es war irre. Es war aufregend. Es war ein Rausch!
Bis hinter mir die nächste Limousine vorfuhr. Die zweihundert Objektive wandten sich wie auf Kommando von mir ab und fotografierten nun Verona Pooth. Ich war abgemeldet und hörte: «Hierher, Verona!», «Schau zu mir!», «So ist’s sexy!»
Carstens und ich setzten uns auf unsere Plätze. Die Veranstaltung begann, und ich musste mir jede Menge geheuchelter Dankesreden anhören, bis Ulrich Wickert die Kategorie «Beste Moderation Informationssendung» ankündigte. Endlich! Es ging los! Mein Herz begann heftig zu pochen. Ungefähr so müssen sich Jetpiloten fühlen. Wenn sie die Schallgrenze durchbrechen. Und dabei per Schleudersitz aus dem Flugzeug katapultiert werden. Und feststellen, dass sie den Fallschirm vergessen haben.
Nach einer kurzen Ansprache, von der ich vor lauter Aufregung kein Wort mitbekam, verlas Wickert die Namen der Nominierten: «Daniel Kohn», «Sandra Maischberger» und «Kim Lange». Auf den Leinwänden im Saal sah man uns alle drei im Großformat, jeder um ein gelassenes Lächeln bemüht. Doch der Einzige, dem das überzeugend gelang, war Daniel.
Wickert hob an: «Und der Gewinner in der Kategorie ‹Beste Moderation Nachrichtensendung› ist … » Er öffnete den Umschlag und machte eine Kunstpause. Mein Herz raste noch mehr. Im Rekordtempo. In Richtung Herzstillstand. Es war nicht auszuhalten.
Schließlich beendete Wickert die Kunstpause und sagte: «Kim Lange!»
Es war, als hätte mich ein riesiger Hammer getroffen, nur ohne Schmerzen. Voller Euphorie stand ich auf und umarmte Carstens, der mir mal wieder in die Wange kniff.
Ich gab mich dem Applaus hin.
Das hätte ich nicht tun sollen.
Vielleicht hätte ich dann das «Krittsschhh» gehört.
Oder ich hätte mich gewundert, dass meine Intimfeindin Sandra Kölling lächelte. Dabei hätte doch eigentlich Tollwutschaum aus ihrem Mund blubbern müssen.
Ich wurde aber erst stutzig, als ich auf dem Weg zur Bühne das erste Kichern hörte. Dann das zweite. Und das dritte. Immer mehr Leute kicherten. Und nach und nach schwoll all das Gekicher zu einem ausgewachsenen Gelächter an.
Auf der ersten Treppenstufe zum Podium hielt ich inne und realisierte, dass sich etwas anders anfühlte. Irgendwie luftig. Und auch hintenrum nicht so kneifend. Ich tastete vorsichtig mit der Hand an meinen Po. Das Kleid war gerissen!
Und das war noch nicht alles: Um in das Kleid zu passen, hatte ich keine Unterhose angezogen.
Ich zeigte also gerade tausendfünfhundert Prominenten meinen nackten Hintern!
Und dreiunddreißig Fernsehkameras!
Und damit sechs Millionen Zuschauern vor dem Fernseher!
4. Kapitel
In diesem zweitmiesesten Moment des Tages hätte ich eigentlich cool auf die Bühne gehen müssen. Dort hätte ich einen guten Scherz über mein Malheur machen, etwa: «Anders kommt man heutzutage nicht auf Seite eins», und anschließend meinen Fernsehpreis genießen sollen.
Leider fiel mir dieser Plan erst ein, als ich mich in meinem Hotelzimmer eingeschlossen hatte.
Heulend warf ich mein andauernd klingelndes Handy ins Klo. Gefolgt von dem ständig bimmelnden Zimmertelefon. Ich war einfach nicht in der Lage, mit Journalisten zu reden. Oder mit Alex. Selbst Lilly wollte ich nicht sprechen, sie schämte sich bestimmt gerade höllisch wegen ihrer Mutter. Und ich schämte mich noch mehr, weil sie sich schämen musste.
Und es würde garantiert noch schlimmer werden in den nächsten Tagen. Ich sah schon die Schlagzeilen vor mir: «Deutscher Po-Preis für Kim Lange!», «Sind Unterhosen out?» oder «Auch Stars haben Orangenhaut!».
Da klopfte es an der Tür. Ich hielt inne. Wenn es ein Journalist war, würde ich ihn ebenfalls ins Klo werfen. Oder mich.
«Ich bin’s, Daniel.»
Ich schluckte.
«Kim, ich weiß, dass du da drin bist!»
«Bin ich nicht», erwiderte ich.
«Nicht sehr überzeugend», antwortete Daniel.
«Stimmt aber», sagte ich.
«Komm schon, mach auf.»
Ich zögerte: «Bist du allein?»
«Natürlich.»
Ich überlegte, ging schließlich zur Tür und öffnete sie. Daniel hielt eine Flasche Champagner und zwei Gläser in den Händen. Er lächelte mich an, als hätte es mein Po-Waterloo nie gegeben. Und das tat mir gut.
«Wir wollten doch anstoßen», sagte er und blickte mir dabei in meine verheulten Augen. Ich brachte keinen Ton heraus, und er strich mir eine Träne von der Wange.
Ich lächelte. Er betrat das Zimmer. Und wir schafften es nicht mal mehr, den Champagner zu öffnen.
5. Kapitel
Es war der beste Sex, den ich seit Jahren gehabt hatte. Es war wunderbar, phantastisch, supercalifragilistischexpialigetisch!