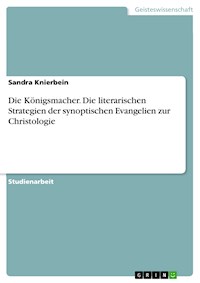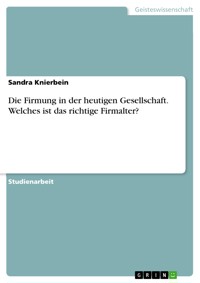Migration und Integration bei Jugendlichen. Wie die Offene Jugendarbeit Jugendliche mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft integriert E-Book
Sandra Knierbein
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Deutschland hat als Einwanderungsland eine lange Geschichte. Migration und Integration sind deshalb Ereignisse, die in der Mitte unserer Gesellschaft stattfinden. Damit das Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen funktioniert, müssen sie sich gegenseitig begegnen und respektieren. Vor allem für Jugendliche ist es wichtig, dass sie in unserer Gesellschaft ankommen und attraktive Zukunftschancen sehen. Sandra Knierbein zeigt, wie die Offene Jugendarbeit die Integration von Heranwachsenden unterstützen kann. Viele Kinder und Jugendliche kommen nach Deutschland, nachdem sie unvermittelt aus ihrer bisherigen Lebenswelt gerissen wurden. Sie haben es oft schwer, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Knierbein erklärt, unter welchen Bedingungen die Integration in die deutsche Gesellschaft gelingt. Aus dem Inhalt: - Migrationshintergrund; - Soziale Arbeit; - Chancengleichheit; - Kinder und Jugendliche; - Diskriminierung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2019
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ausgangslage
1.2 Fragestellung, Ziel und Aufbau der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen zu Migration und Integration
2.1 Migration
2.1.1 Definition, Formen und Motive von Migration
2.1.2 Definitionen und Abgrenzungen personenbezogener Fachbegriffe
2.1.3 Daten und Fakten über die Bevölkerung in Deutschland
2.2 Integration
2.2.1 Begriffsklärung: Integration
2.2.2 Begriffsabgrenzung: Assimilation
3 Vorstellung der zugrunde liegenden Rahmenbedingungen
3.1 Offene Jugendarbeit
3.2 Jugendliche mit Migrationshintergrund als Adressat*innen der Offenen Jugendarbeit
4 Barrieren, Bedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft durch die Offene Jugendarbeit
4.1 Barrieren der Integration
4.1.1 Diskriminierung
4.1.2 Vorurteile
4.1.3 Sprache
4.2 Bedingungen für gelingende Integrationsprozesse
4.3Unterstützungsmöglichkeiten für die Integration
4.3.1 Niederschwelligkeit
4.3.2 Lebensweltorientierung
4.3.3 Interkulturelle Öffnung
4.3.4 Sozialräumliche Orientierung
4.3.5 (Politische) Bildung
4.3.6 Konkrete Maßnahmen gegen die Barrieren der Integration
5 Diskussion und Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Literatur
Internetquellen
Gesetze
Anhang
Anhang 1: Pull- und Push-Faktoren
Anhang 2: „Bevölkerung 2017 in Privathaushalten nach Migrationsstatus“
Anhang 3: „Schutzsuchende nach Schutzstatus“
Anhang 4: „Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Jahr 2014“
Anhang 5: „Migranten [...] in den Stadtbezirken am 31.12.2015“
Anhang 6: „Bevölkerung in Privathaushalten 2017 nach Migrationshintergrund“
Anhang 7: § 11 KJHG/SGB VIII Abs. 1
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wird die Ausgangslage der zugrunde liegenden Thematik formuliert sowie die Fragestellung vorgestellt, das Ziel benannt und ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben.
1.1 Ausgangslage
Migration ist ein Ereignis, das inmitten der Menschheit schon immer stattfindet. Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart gab und gibt es aufgrund unterschiedlicher Motive vielzählige Einwanderungen nach Deutschland. Demzufolge weist Deutschland bereits eine lange Geschichte als Einwanderungsland auf – auch wenn „vor allem die konservative Politik in Deutschland lange Zeit versucht [hat], den Status Deutschlands als Einwanderungsland zu negieren.“ (Ottersbach 2015, S. 71). Aktuell prägt das Thema Migration unsere Gesellschaft insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen Flüchtlingskrise. Zentrale gesellschaftliche Folgen, die die Individuen betreffen, sind Vielfalt, Differenz und Fremdheit in unterschiedlichen Bereichen, Lebensführungen, Normen und Werten. Aus diesem Grund ist es für ein friedliches Miteinander und einen gesellschaftlichen Zusammenhalt notwendig, dass Menschen sich arrangieren, begegnen, respektieren und tolerieren.
Viele Kinder und Jugendliche kommen nach Deutschland und werden aus ihrer bisherigen Lebenswelt gerissen, müssen sich in neuen Umgebungen und Systemen sowie inmitten eines fremden sozialen Umfeldes zurechtfinden oder leben häufig dauerhaft zwischen zwei Welten und gelten als „Ausländer*innen“, auch wenn sie bereits seit längerer Zeit in Deutschland leben oder der zweiten oder dritten Generation von Migrantenfamilien angehören. Vor diesem Hintergrund ist ein gesonderter Blick auf sie als Heranwachsende in der deutschen Gesellschaft, auf ihre Lebensführungen und Zukunftschancen zu richten. Um genau diesen Blickwinkel handelt es sich in der vorliegenden Arbeit. Hierzu wird sich auf das Arbeitsfeld der Offenen Jugendarbeit konzentriert.
In diesem Zusammenhang ist die Integration der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft das zentrale Thema dieser Arbeit. Ebenso wie Migration nimmt auch das Thema Integration als Grundlage für positive Alltags- und Lebenserfahrungen sowie Chancengleichheit einen substanziellen Stellenwert in unter anderem der Gesellschaft, der Politik und der Sozialen Arbeit ein. Dies wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass im Jahr 2016 ein Integrationsgesetz eingeführt wurde oder dass Integrationskurse existieren. Hervorzuheben ist zudem die Verabschiedung des UN-Migrationspaktes im Dezember 2018, dessen Ziele auch die Integration umfassen.
Als das wesentliche vom Staat ausgehende Integrationsangebot in Deutschland ist es das Ziel der Integrationskurse, zugewanderten Menschen sowohl Sprach- als auch Orientierungswissen zu vermitteln, um ihre Integration in die Aufnahmegesellschaft zu unterstützen. Neben Kursen für Eltern und Frauen werden auch Jugendintegrationskurse angeboten, in denen Sprachkenntnisse durch jugendrelevante Themen vermittelt werden. Zur Zielgruppe gehören erstrangig neuzugewanderte Personen mit einer längerfristigen Aufenthaltsperspektive (vgl. BAMF 2017, S. 115 ff.). Die Ausrichtung dieser Arbeit auf die Offene Jugendarbeit soll deshalb auch eine Möglichkeit darstellen, auch Jugendliche, die bereits länger oder von Geburt an in Deutschland leben, einzubeziehen. Nur durch eine gelingende Integration in die Gesellschaft können Gefühle des Willkommenseins und von Beheimatung sowie Chancengleichheit erreicht werden.
1.2 Fragestellung, Ziel und Aufbau der Arbeit
Auf Grundlage der Einwanderungssituation in Deutschland und der Notwendigkeit der Integration junger Menschen in die Gesellschaft wird für die vorliegende Arbeit folgende Fragestellung formuliert: „Inwieweit kann die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft durch die Offene Jugendarbeit unterstützt werden und wie kann dies praktisch aussehen?“ Ziel ist es, diese Fragestellung mit Hilfe von existierender Fachliteratur zu den Themen Migration, Integration und Offene Jugendarbeit auf Grundlage einer Diskussion zu beantworten.
Die zugrunde liegende Fragestellung ist in das Arbeitsfeld der Migrationsforschung einzuordnen. Über die Ursachen und Verläufe von Migration hinaus beschäftigt diese sich mit den Folgen sowohl für die Einwanderungs- als auch Aufnahmegesellschaft. Konkret handelt es sich um die Frage der Integration. Der Blick wird darauf gerichtet, wie die Migrant*innen Teil der Aufnahmegesellschaft werden (können) (vgl. Hans 2004, S. 24).
Um eine thematische Annäherung sowie eine Basis für alle Auseinandersetzungen und Überlegungen zu schaffen, werden im zweiten Kapitel themenbezogene theoretische Grundlagen, (statistische) Daten und Hintergründe erläutert.
Im dritten Kapitel werden die Rahmenbedingungen für die Fragestellung, die aus der beziehungsweise für die Praxis der Offenen Jugendarbeit resultieren, erläutert. In diesem Kontext wird zunächst zu dem Praxisfeld selbst und anschließend zu dessen und den hier fokussierten Adressat*innen Bezug genommen.
In Kapitel 4 wird einerseits der Frage nachgegangen, was für die Integration der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft förderlich ist und was nachteilig ist. Andererseits findet eine Auseinandersetzung mit den Unterstützungsmöglichkeiten der Offenen Jugendarbeit statt.
2 Theoretische Grundlagen zu Migration und Integration
Für die Beschäftigung mit dem Thema der Integration von Migrant*innen ist ein grundlegendes Verständnis dieser beiden Phänomene notwendig. Aufgrund eines engen Zusammenhangs wird in dieser Arbeit ein grundlegendes Wissen über Migrationsprozesse als Voraussetzung für das Verständnis der Integration betrachtet. Im ersten Teil dieses Kapitels werden deshalb relevante Inhalte zur Migration, im zweiten Teil zur Integration thematisiert.
2.1 Migration
Bei Betrachtung der Fachliteratur zum Thema Migration wird erkenntlich, dass viele verschiedene Termini in diesem Zusammenhang verwendet werden. Dies trifft sowohl auf die Formen und Motive der Migration sowie auf die Bezeichnung von Personen (-gruppen) zu. Für ein einheitliches Verständnis und um im weiteren Verlauf der Arbeit auf die Bezeichnungen mit ihren entsprechenden Bedeutungen zurückzugreifen, werden diese im Folgenden thematisiert. Im Anschluss werden Daten und Fakten zur Migration in Deutschland aufgegriffen, um das Ausmaß der Migration darzustellen und die Relevanz der Integration einschätzen zu können.
2.1.1 Definition, Formen und Motive von Migration
Aus der Fachliteratur wird ersichtlich, dass keine einheitliche Begriffsbestimmung von Migration existiert. Generell kann Migration nach Hillmann als Ortsveränderung im räumlichen und sozialen Kontext verstanden werden (vgl. Hillmann 2016, S. 17).
Migration allgemein ist ein Phänomen, dass seit der Menschheitsgeschichte existiert. Speziell die internationale Migration in Verbindung mit kontrollierenden Ämtern und Regularien ist jedoch im Rahmen der Entwicklung von modernen Nationalstaaten zu verorten (vgl. Heckmann 2015, S. 22).
Zu beachten ist, dass Migration verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zuzuordnen ist. Hierzu gehören die Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft, Demographie, Geographie, Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, (Sozial-)Philosophie, Ethnographie und Kulturanthropologie, (Sozial-)Psychologie, Soziologie sowie die Erziehungswissenschaft (vgl. Treibel 2011, S. 17 f.). Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf Teilbereichen der Erziehungswissenschaft und der Soziologie. Die Erziehungswissenschaft betreffend ist vor allem die interkulturelle Erziehung von Bedeutung und darüber hinaus dieschulische Situation insofern, dass diese neben anderen Aspekten durch die Offene Jugendarbeit bis zu einem gewissen Grad unterstützt werden kann. Im Rahmen der Soziologie liegt das Interesse auf den Folgen und Veränderungen für die Individuen und bedingt für die Gesellschaft, die sich durch die Migration ergeben (vgl. ebd., S. 18). Fokussiert wird in diesem Blickwinkel der Integrationsprozess in die Aufnahmegesellschaft. Allgemein gefasst sind die Notwendigkeit der Integration und die damit in Verbindung stehenden Prozesse sowie Barrieren die zentralen Folgen.
Weitere Bereiche der aufgeführten wissenschaftlichen Disziplinen spiegeln sich wieder, wenn der Blick auf die Klassifizierungen oder Typologien der Migration gerichtet wird. Diese thematisieren sowohl Hillmann und Treibel als auch andere Autor*innen in ihren Werken. Im Folgenden wird sich an den sehr ähnlichen Ausführungen von Hillmann und Treibel orientiert und die wesentlichen Aspekte dargestellt.
Gängig ist zunächst das Heranziehen von räumlichen sowie zeitlichen Kriterien, um Wanderungsprozesse zu klassifizieren. Beide Autorinnen betonen in diesem Zusammenhang die Aspekte der Distanz und Richtung sowie der Dauer von Migration (vgl. Hillmann 2016, S. 18; Treibel 2011, S. 20). Im Kontext der Distanz und Richtung ist im Rahmen dieser Arbeit die internationale Migration und der Personenkreis der Immigrant*innen sowie der nachkommenden Generationen von Interesse.
„Bei der internationalen Migration werden Ländergrenzen überschritten. Sie wird deshalb in Immigration (=Einwanderung), Emigration (=Auswanderung) sowie Transmigration (=vorübergehende, weiterziehende Wanderung) unterteilt.“ (Hillmann 2016, S. 18).
Dem hingegen kann aus kommunaler Sicht bereits bei der Überschreitung von Gemeindegrenzen von Außenwanderung gesprochen werden. Mit Blick auf die Dauer differenziert die UN-Definition zwischen long-term migrants (der Wohnsitz wird mindestens ein Jahr in das Ausland verlegt) und short-term migrants (der Wohnsitz wird zwischen drei und zwölf Monaten in das Ausland verlegt) (vgl. ebd.).
Eine weitere Klassifizierungsmöglichkeit stellt der Umfang der jeweiligen Migrationsbewegungen dar. Hiermit sind auf der einen Seite Kollektiv-/Gruppen-/Massenwanderungen und auf der anderen Seite Einzelwanderungen und Pionierwanderungen gemeint. Ebenso kann im Kontext der Wanderungsentscheidung/-ursache eine Abstufung der (Un-)Freiwilligkeit erfolgen. Diese reicht von freiwilliger Altenwanderung oder Arbeitsmigration bis hin zu Fluchtmigration oder Vertreibung (vgl. Hillmann 2016, S. 17; Treibel 2011, S. 20). Weitere Migrationsformen können zum Beispiel Familienmigration, Bildungsmigration oder Investorenmigration sein (vgl. Heckmann 2015, S. 25 ff.). Treibel beschreibt die Unterscheidungen nach freiwilliger und erzwungener Migration sowie nach dem Umfang als kritisch, da die Übergänge häufig fließend seien und nicht immer eindeutig zu differenzieren sind (vgl. Treibel 2011, S. 20).
Hillmann geht darüber hinaus auf die Typisierung der Migrant*innen über ihren rechtlichen Status, der legal oder illegal sein kann, sowie auf die Faktoren, die die Migration auslösen als Unterscheidungsmöglichkeit ein. Bei diesen Faktoren handelt es sich um die angenommenen Migrationsgründe, welche unter anderem ökonomisch, politisch, religiös, sozial oder kulturell sein können. Ebenso können charakteristische Eigenschaften der Migranten wie Alter, Geschlecht, Bildungsgrad oder soziale Schicht Typisierungsgrundlage sein und unter dem Begriff der Selektivität der Migration zusammengefasst werden (vgl. Hillmann 2016, S. 16 ff.). Diese Klassifizierungsaspekte verweisen auf die Vielfältigkeit der Migrationsthematik und stehen in engem Zusammenhang mit der Definition des Migrationshintergrundes, welcher in den folgenden Kapiteln definiert und fokussiert wird.
Nach Seifert verhindern die Vielfalt und Komplexität der Migrationsprozesse eine Migrationstheorie allgemeiner Gültigkeit, die die Entstehungsbedingungen von Migrationsprozessen umfassend darlegt. Eine Vielzahl von Migrationstheorien basiert auf der Annahme, dass die Strukturen des Herkunfts- sowie Aufnahmelandes Indikatoren für Migration sind (vgl. Seifert 2000, S. 24). In der Migrationsforschung wird in dieser Hinsicht von Pull- und Push-Faktoren gesprochen. Konkret geht es dabei um Anziehungsfaktoren im jeweiligen Aufnahmeland und um Abstoßungsfaktoren im Herkunftsland (vgl. Hillmann 2016, S. 54). Die im Anhang beigefügte Darstellung gibt einen Überblick über unterschiedliche Faktoren (s. Anhang 1).
2.1.2 Definitionen und Abgrenzungen personenbezogener Fachbegriffe
Allgemein kann die Bezeichnung von Migrant*innen vom Begriff der Migration abgeleitet werden. Nach Treibel handelt es sich demzufolge um wandernde Personen, die ihr Herkunftsland verlassen und ihren Lebensmittelpunkt in ein anderes Land verlegen. Dadurch verfügen diese Personen über eine individuelle Migrationserfahrung (vgl. Treibel 2008, S. 298). Bei dieser Definition handelt es sich um die hier relevante internationale Migration (s. Kapitel 2.1.1, S. 8).
Der genauere Blick auf die personenbezogenen Bezeichnungen zeigt, dass diese in der Literatur zur Migrationsforschung diffus sind. Im Folgenden werden deshalb auf der Basis von öffentlichen Definitionen die wichtigsten und gängigsten Bezeichnungen erläutert und voneinander abgegrenzt.
Häufig synonym wird der Begriff der Zuwanderin/des Zuwanderers (auch Einwanderer/-in oder Immigrant*in) zu dem der Migrant*innen verwendet. Solche
„sind zunächst einmal alle Menschen, die nach Deutschland kommen – unabhängig von der Dauer und dem Zweck ihres Aufenthalts. Sie können aus verschiedenen Gründen zugewandert sein, etwa als (Saison-)Arbeiter, Flüchtlinge, für ein Studium oder eine Ausbildung. Von Einwanderung ist in der offiziellen Amtssprache dagegen die Rede, ‚wenn Einreise und Aufenthalt von vornherein auf Dauer geplant und zugelassen werden‘“ (BReg; zit. nach Mediendienst Integration 2018, S. 3).
Die Vereinten Nationen betiteln auch Flüchtlinge sowie Asylbewerber*innen als Mi-grant*innen, bei denen die Aufenthaltsdauer unbestimmt ist. Zugleich vermischen sich hier die Begriffe Migration und Flucht aus dem Grund, dass in der Praxis die Freiwilligkeit nur schwierig einzuschätzen ist und häufig Indikatoren zur Definition der individuellen Migration bzw. Flucht fehlen (vgl. Hillmann 2016, S. 18). Generell besteht jedoch die Orientierung des Flüchtlingsbegriffs an der GFK aus dem Jahr 1951. Diese definiert Personen als Flüchtlinge (häufig auch Schutzsuchende oder Asylsuchende), die
„aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.“ (GFK 1951 Art. 1 Abs. 2).
Im Bereich des Asyls auf Grundlage von Art. 16a des Grundgesetzes existieren folgende Unterscheidungen: Asylsuchend ist eine Person, wenn sie nach Deutschland kommt und Asyl sucht. Durch Beantragung des Asyls beim BAMF werden diese Personen als Asylbewerber*innen bezeichnet. Nach Genehmigung des Asyls ist die Person Asylberechtigte*r (vgl. BReg 2018).
Abzugrenzen vom Begriff der Migrant*in oder der Zuwanderin/des Zuwanderers ist der Begriff der Ausländerin/des Ausländers. Als diese gelten
„alle Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind, d.h. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dazu zählen auch die Staatenlosen und die Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen, zählen nicht zur ausländischen Bevölkerung. Die Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte sowie der diplomatischen und konsularischen Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland unterliegen mit ihren Familien nicht den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes und werden nicht statistisch erfasst.“ (Destatis 2018a, S. 7).
Der grundlegende Unterschied ist demzufolge, dass Migrant*innen nach ihrer Immi-gration (=Einwanderung) in Deutschland durch Antragstellung die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können und dann nicht mehr der Gruppe der Ausländer*innen angehören.
Die hier erläuterten Bezeichnungen schließt der allgemein gefasste, von der Staatsbürgerschaft unabhängige, Ausdruck „Menschen mit Migrationshintergrund“ ein. Von einer Person mit Migrationshintergrund wird gesprochen, wenn diese
„selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist. Zu den Personen mit Migrationshintergrund gehören im Einzelnen alle Ausländer, (Spät-) Aussiedler und Eingebürgerten. Ebenso dazu gehören Personen, die zwar mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind, bei denen aber mindestens ein Elternteil Ausländer, (Spät-)Aussiedler oder eingebürgert ist.“ (Destatis 2018b, S. 17).
Eine eigene Migrationserfahrung wie bei den Migrant*innen/Zuwander*innen setzt diese Definition damit nicht voraus. Sie umfasst zudem die Vielfalt der Formen und Klassifizierungen von Migration.
Als (Spät-)Aussiedler*innen gelten Personen deutscher Abstammung aus der damaligen Sowjetunion und weiteren osteuropäischen Staaten, welche durch ein spezielles Verfahren ihren Verbleib in Deutschland legitimierten (vgl. BAMF 2018a).
Bereits anhand der unterschiedlichen Begriffe wird die Komplexität der Termini im Kontext der Migrationsthematik deutlich. Verschärfend hierauf wirkt sich die teilweise unterschiedliche Verwendung der Begriffe in der Literatur aus. Die weiteren Ausführungen in dieser Arbeit basieren auf den hier benannten Definitionen.
2.1.3 Daten und Fakten über die Bevölkerung in Deutschland
Statistische Daten dienen als Informationsinstrument moderner Wissensgesellschaften. Sie informieren über politische, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Entwicklungen. Durch die erhobenen Daten werden Zusammenhänge und Verläufe sichtbar und es können Rückschlüsse auf bestimmte Sachverhalte gezogen werden. Sie bilden sowohl die Grundlage als auch das Kontrollinstrument für getroffene Entscheidungen (vgl. BAMF 2018b). Die Daten im Rahmen der Migrationsforschung stellen vor allem allgemeine Informationen zur Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland, zu den dadurch bedingten Veränderungen der Gesellschaft in Deutschland sowie zur Situation der Menschen mit Migrationshintergrund dar. Durch letzteres sind teilweise Rückschlüsse auf die Integration der Personen mit Migrationshintergrund möglich.
Auf der Grundlage des Mikrozensus[1] veröffentlicht Destatis Zahlen über die Bevölkerung in Deutschland. Für das Jahr 2017 wurde für Deutschland eine Gesamtbevölkerung von ungefähr 82 Millionen Menschen verzeichnet. Davon hatten knapp 19,3 Millionen einen Migrationshintergrund. Diese Zahl ist damit 2017 um 4,4% gegenüber 2016 gestiegen. 13,2 Millionen von ihnen sind selbst zugewandert. Das häufigste Motiv hierfür waren familiäre Gründe. Von den 19,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sind rund 51% Deutsche und 49% Ausländer*innen. Diese 49% belegen ebenfalls eine Steigung – beispielsweise 2011 lag diese bei 42%. Der größte Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland hat mit 14% einen türkischen Migrationshintergrund. Darauf folgen Menschen mit polnischem (11%), russischem (7%), kasachischem (6%) und rumänischem (4%) Migrationshintergrund (vgl. Destatis 2018c). Der angehängten Tabelle sind weitere erfasste Daten über Zuwanderungen und Geburten nach beziehungsweise in Deutschland sowie Veränderungen der Zahlen im Vergleich zum Vorjahr zu entnehmen (s. Anhang 2).
Hervorzuheben ist die Flüchtlingskrise ab 2015, da diese zu einem starken Anstieg der Anteile der Flüchtlinge und Migrant*innen in Deutschland geführt hat und führt. Mit Blick auf Schutzsuchende wurde für das Jahr 2016 eine Personenzahl von 1,6 Millionen konstatiert (16% der ausländischen Bevölkerung). Diese Zahl stieg seit Ende 2014 um 113%, das sind 851.000 Schutzsuchende, an. Ungefähr die Hälfte aller Schutzsuchenden kamen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Als Datenbasis dient das AZR (vgl. Destatis 2017a).
Die bisherigen Daten und Fakten legen dar, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland – grundsätzlich gilt dies auch für weitere Länder –, unter anderem auch angesichts der Flüchtlingskrise, stetig zunimmt. Vor diesem Hintergrund wird die Aussage, dass die Themen Migration und Integration aktuell von großer Bedeutung sind (s. Kapitel 1.1, S. 5) bestärkt. Erkennbar ist, dass die Zuwanderung aus dem nordafrikanischem und asiatischem Raum am häufigsten