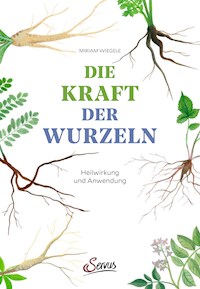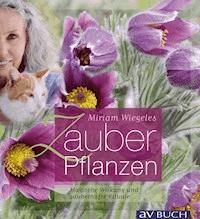
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cadmos Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Grüne Traumwelten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zauberpflanzen – da denkt man an Pflanzen, die als Liebeszauber wirken, helfen Schaden abzuwehren oder reich machen sollen. Da Heilen in früheren Zeiten auch immer als magischer Vorgang gesehen wurde, trennte man nicht zwischen heilenden Pflanzen und Zauberpflanzen. Dieses Buch versucht zu vermitteln, welche Pflanzen als Zauberpflanzen betrachtet wurden und welche magischen Wirkungen man ihnen zusprach. Es erzählt über die Verwendung der Zauberpflanzen zu Heilzwecken, über volksmagische Bräuche und verhilft dazu, aus einem Garten ein privates Zauberreich zu gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wer sie nicht kennte, die Elemente, ihre Kraft und Eigenschaft, wäre kein Meister über die Geister.“
Aus „Faust“, Teil 1, von Johann Wolfgang von Goethe
(Foto: Pavel Bortell/fotolia.com)
(Foto: Svenja98/fotolia.com)
Inhaltsverzeichnis
(Foto: Phototribe/fotolia.com)
Vorwort zur Neuauflage
Sagenhafte Zauberpflanzen
Was ist Zauberei?
Was sind Zauberpflanzen?
Die geheimnisvollen Unbekannten
Die klassischen Zauberpflanzen
Von der „Krafft und Würckung“ der Zauberpflanzen
Signaturen der Pflanzen
Planetensignaturen und ihre Wirkungsbereiche
Magische Pflanzenzeiten
Im Jahresrhythmus eingebettet
Die Johanniskräuter
Die Frauendreißiger
Immergrüne Pflanzen
Wie man kräuterkundig wird
Zauberhafte Ratschläge zum Kräutersammeln
„Sprechende“ Blumen und Liebeskräuter
Blumensprache
Die Blumennamen
Zauberhafte Gartenbeete – Romantische Blumenrabatte
Zauberhafte Gartenbeete – Elfenbeet
Zauberhafte Gartenbeete – König Artus’ Tafelrunde
Amors Zauberkräuter
Was Männer stark und Frauen schwach macht
Zauberhafte Gartenbeete – Mondscheingärtchen
Zauberhafte Gartenbeete – Venuspflanzenbeet
Sprechende Blumen und Liebeskräuter im Überblick
Von der Wiege bis zur Bahre
Zauberpflanzen für Brautleute
Zauberhafte Gartenbeete – Ehegärtchen
Fruchtbarkeitszauber und Niederkunft
Pflanzenzauber in der Kinderwelt
Pflanzen der Trauer und des Todes
Zauberhafte Gartenbeete – Erinnerungsgärtchen
Sympathiezauber gegen Krankheiten
Pflanzenzauber gegen Schadenszauber
Kräuter gegen allerlei Schaden
Dornensträucher und Wacholder
Zauberkräuter
Zauberhafte Gartenbeete – Aporopäischer Blumentopf
Zauberhafte Gartenbeete – Energiespirale
Allerlei Pflanzenzauber
Glücksbringende Pflanzen
Zauberhafte Gartenbeete – Glücksgärtchen
Zauberpflanzen für die Hellsichtigkeit
Pflanzenzauber für Haus und Hof
Zauberhafte Gartenbeete – Hauswurztreppe
Pflanzliche Wetterpropheten
Zauberhafte Gartenbeete – Wetterprognosebeet
Orakelpflanzen für langfristige Wetterprognosen
Zauberpflanzen: Von der Wiege bis zur Bahre im Überblick
Zauberpflanzen für Eingeweihte
Giftpflanzen
Der Blick durchs verbotene Fenster
Die Hexe – Giftmischerin oder Heilkundige?
Können Hexen fliegen?
Magische Giftpflanzen
Zauberhafte Gartenbeete – Hexengarten
Zauberpflanzen für das Hexengärtchen im Überblick
Der wahre Zaubergarten – eine Betrachtung über den Zauber der Gärten
Maßnahmen bei Vergiftungen
Literaturquellen und weiterführende Literatur
Bezugsquellen
Vorwort zur
Neuauflage
(Foto: Anton Petrus/shutterstock.com)
Es ist nun über zehn Jahre her, dass dieses Buch über Zauberpflanzen erschien. Vielleicht ist es auch diesmal kein Zufall, dass die Nachfrage nach dem Buch kontinuierlich da war, sodass der Verlag sich zu einer neuen Auflage entschloss. Vor zehn Jahren war das Thema Hexen und Übernatürliches groß. Die Geschichten um Harry Potter wurden von Groß und Klein verschlungen, gewöhnliche Kräuter wurden zu Zauberpflanzen und die Ringelblumensalbe zu einer Hexenringelblumensalbe. Und überhaupt nannten sich fast alle Kräuterfrauen Kräuterhexen. Die gibt es zwar auch heute noch, aber Kräuterfrau sein hat mittlerweile einen seriösen Status bekommen. Es gibt heute mehr zertifizierte Kräuterpädagoginnen, Kräuterspezialistinnen und Kräuterbäuerinnen. Kräuterfrau zu sein ist zu einem Broterwerb geworden, Kräuter werden angebaut, um sie zu verarbeiten und auf Kräutermärkten zu verkaufen. Dagegen spricht grundsätzlich nichts, es ist gut, dass das Interesse an der Anwendung von Heilpflanzen so groß geworden ist. Doch überall dort, wo der Kommerz zu dominieren beginnt, geht vielleicht der Zauber der Kräuter verloren.
Daher denke ich, dass es wieder an der Zeit ist, die Leser zu dem Zauber hinzuführen, den alle unsere Pflanzen ausstrahlen, zu den Geschichten, die uns die Pflanzen über ihre Kräfte und ihre Anwendungen erzählen können und sie so wieder zu Zauberpflanzen werden lassen.
Miriam Wiegele,September 2015
Sagenhafte
Zauberpflanzen
(Foto: Svenja98/fotolia.com)
Um Zauberkräfte nutzen zu können, muss man Wissen erwerben, das Wissen um die inneren Zusammenhänge der Dinge, um die verborgenen Kräfte des Universums. Wer diese Zusammenhänge kennt, kann auch die in den Dingen verborgenen Zauberkräfte erkennen und nutzen. Erst durch Wissen und Ritual wird eine Pflanze zu einer Zauberpflanze. Damit können Zauberpflanzen zum Nutzen oder Schaden der Menschen eingesetzt werden.
Was ist Zauberei?
Als Zauberei im weitesten Sinn werden üblicherweise alle Praktiken und Techniken bezeichnet, die dazu dienen, den Verlauf von Ereignissen auf übernatürliche Weise zu beeinflussen. Unsere Welt ist eine Einheit, die aus zwei Polen besteht, und ihr Zusammenwirken erschafft alle Erscheinungen, die wir kennen. Man nennt diese Pole Gut und Böse, Licht und Dunkel, Tag und Nacht, Himmel und Hölle sowie Gott und Teufel. Der Mensch möchte in einer heilen Welt leben, möchte gesund, erfolgreich und glücklich sein. Doch das Universum zeigt sich oft noch von einer anderen Seite. Ist der Mensch mit seiner Wirklichkeit nicht zufrieden, versucht er, sie zu verändern.
Entweder vertraut er einem göttlichen Ordnungsprinzip, das alles von selbst zum Besten reguliert, nimmt das „Schicksal“ zur Kenntnis oder versucht, Veränderung durch übernatürliche Manipulation zu erzwingen, durch Zauberei.
Die Samenstände der Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris) nennt man Teufelsbart. (Foto: Gucio 55/fotolia.com)
Zauberei und Magie
In jeder menschlichen Gemeinschaft gibt es Geschichten von Zauberern, von Menschen, die sich für gewöhnlich unsichtbare Kräfte zu eigen machen, um der Gemeinschaft zu nützen, indem sie Kranke heilen, Verzweifelten helfen, Nöte abwenden, Fruchtbarkeit bewirken und die dunkle Seite des Universums bannen. Man bezeichnet es auch als weiße Magie, wenn damit ein positives Ereignis heraufbeschworen oder ein negatives verhindert werden soll.
Schwarze Magie zielt dagegen auf negative Wirkungen ab oder will positive Wirkungen vermeiden. Es gibt also ebenso Geschichten von Zauberern, die der Gemeinschaft schaden, indem sie Krankheiten und Tod schicken, Unglück säen, die Fruchtbarkeit zum Erliegen bringen und die helle Seite des Universums trüben.
Überall, wo es guten Zauber gibt, kennt man auch den bösen Zauber. Guter Zauber und böser Zauber sind aber wieder die Pole einer Einheit, sie spiegeln das Drama der Welt wider. Und wer zaubern kann, der kann beides: Gutes und Böses bewirken.
Werkzeug und Ritual
Um Zauberkräfte nutzen zu können, muss man Wissen erwerben, das Wissen um die inneren Zusammenhänge der Dinge, um die verborgenen Kräfte des Universums. Um Zauber zu erwirken, bedarf es aber nicht nur des notwendigen Wissens, es bedarf eines entsprechenden Rituals und eines geeigneten Werkzeugs: Der Zauber wird durch das Ritual aktiviert und durch das Werkzeug geleitet. Wer diese inneren Zusammenhänge kennt, kann auch die in den Dingen verborgenen Zauberkräfte erkennen und nutzen. Erst durch Wissen und Ritual wird eine Pflanze zu einer Zauberpflanze. Damit können Zauberpflanzen zum Nutzen oder Schaden der Menschen eingesetzt werden.
Wenn wir nun all diese Betrachtungen zusammenfassen, können wir zu folgendem Schluss kommen: Ein Zauberer oder eine Zauberin ist ein Mensch, der sich besonderer Kräfte bedient, deren Anwendung nicht jedem Menschen möglich ist.
Zauberzeichen und Sprache
Zauberei und Magie können also je nach Betrachtung positiven oder negativen Beiklang haben. Das Wort „Zauber“ selbst wird etymologisch vom germanischen Wort „taufra, taubra“ abgeleitet, das wiederum auf das angelsächsische Wort „teafor“ für Roteisenstein oder Rötel zurückzuführen sein soll. Mit diesem roten Ocker wurden die Runen eingerieben, sodass Zauber ursprünglich wohl „zauberkräftige Geheimschrift“ bedeutete, denn das altgermanische Wort Rune war nicht nur ein Name für einen Buchstaben, sondern bedeutete zugleich Zauberzeichen.
Auch das englische Wort „spell“ bedeutet heute noch buchstabieren und zugleich Zauber. Die Verbindung von Magie und Sprache wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass das englische Wort „glamour“, das nicht nur Glanz, sondern auch Zauber bedeutet, wortgeschichtlich eine verwandte Form von „grammar“ ist: Grammatik und Zauberei entspringen also der gleichen Wurzel.
Weise Magier
Die Wurzel des Wortes Magie soll dagegen aus dem Persischen stammen. „Magoi“ wurden bei den Medern und Persern die Priester der Zarathustra-Religion genannt. Die Magier waren daher ursprünglich die Theologen und Wissenschaftler – beides zugleich. Ihr Beruf war der eines Priestergelehrten, denn es gab noch keine gedankliche Trennung zwischen dem erlangten Wissen von und über die Welt und der Weltanschauung, der Religion.
Was sind Zauberpflanzen?
„In den Kräutern ist die ganze Kraft der Welt. Derjenige, der ihre geheimen Fähigkeiten kennt, der ist allmächtig“, heißt es in einer altindischen Hymnensammlung. In früheren Zeiten, als die Menschen ihr intuitives Fühlen noch nicht verloren hatten, konnten sie die „Krafft der Tugenden der Kräuter und allerhandt Erdtgewächse“ einfach erahnen.
Naturwissenschaftlich denkende Menschen nehmen an, dass in den Urzeiten der Menschheitsgeschichte nährende, heilende und giftige Pflanzen durch ein „Trial and Error“-System gefunden wurden, also durch Ausprobieren beziehungsweise durch Zufallsentdeckungen. Bei Naturvölkern findet man auch heute noch sensitiv veranlagte Menschen, die man als Schamanen bezeichnet. Hexen waren solche Schamaninnen und ihre wichtigsten Zauberwerkzeuge waren Pflanzen.
Da Heilen auch immer als magischer Vorgang gesehen wurde, trennte man nicht zwischen heilenden Pflanzen und solchen mit Zauberkräften.
Psychoaktive Wirkung
Eine besondere Rolle spielten die Pflanzen, denen wir heute psychoaktive Wirkung zuschreiben: Pflanzen, die halfen, zu „dissoziieren“, in Trance zu fallen und damit aus der Alltäglichkeit zu treten. „Hagezusse“, „Zaunreiterin“ nannte man daher auch die Hexen aufgrund ihrer Fähigkeit, mit einem Fuß in der Realität zu bleiben und mit dem anderen in der Traumwelt, der Welt der Visionen und Imaginationen, zu stehen. Mithilfe solcher Pflanzen konnten Hexen auf Seelenflug gehen und ihre besonderen Kenntnisse vermitteln. Sie verhalfen ihnen zu heilen, Liebestränke herzustellen, Unglück und bösen Zauber abzuwehren und Glück zu bringen.
An sich verdienen alle Kräuter die Bezeichnung „Zauberkräuter“, denn jede Pflanze hat ihren eigenen Zauber und ihr eigenes Wesen. Trotzdem war die Zahl der Pflanzen, die als besonders zauberkräftig betrachtet wurden, beschränkt.
Auffällige Blütenformen
Solche Zauberkriterien waren auffällige Blütenformen. Das Löwenmaul (Antirrhinum majus) ist ein Beispiel dafür, ebenso wie Arnika (Arnica montana) mit ihrem an die Sonne erinnernden Blütenkranz. Die blutrote Farbe der Klatschmohnblüten erweckte genauso das Interesse wie das Kornblumenblau. Einer Pflanze wie der Wegwarte (Cichorium intybus), die mit ihren himmelblauen Blüten immer nach Osten schaut und diese gegen Mittag schließt, wurden ebenso Zauberkräfte zugeschrieben wie der Eberwurz (Carlina acaulis), deren Blüten fast ohne sichtbaren Stängel am Boden liegen und deren Blütenköpfe sich schließen, wenn schlechtes Wetter naht. Die Königskerze (Verbascum bombyciferum) erinnert mit ihrem Blütenstand tatsächlich an ein Licht, das von oben kommt, was sich auch in ihrem noch immer gebräuchlichen Namen „Himmelsbrand“ ausdrückt. Im Gegensatz dazu sieht man der düsteren Blütenfarbe und der Zeichnung der Blüten des Schwarzen Bilsenkrautes (Hyoscyamus niger) ihre Giftigkeit und daraus resultierend ihre magische Funktion regelrecht an.
Besondere Wurzeln
Auch auffällige Wurzeln konnten zauberkräftige Eigenschaften signalisieren. Die menschenähnlich gestaltete Wurzel der Alraune (Mandragora officinarum) musste den Glauben wecken, dass man damit Menschen verzaubern kann. Die an Hoden erinnernden Wurzelknollen mancher Knabenkräuter (Orchis spec.) assoziierte man mit Liebeszauber. Das Salomonssiegel (Polygonatum spec.), das in den Abschnitten des Wurzelstockes siegelähnliche Eindrücke aufweist, soll seinen Namen daher haben, dass König Salomon damit Felsen gesprengt hat, die beim Bau seines Tempels im Wege standen. Das Salomonssiegel wurde so zu einer Zauberpflanze, mit der man Türen und Schlösser sprengen konnte, um zu verborgenen Schätzen zu gelangen.
Geruch und andere Besonderheiten
Biologische Besonderheiten konnten Pflanzen ebenfalls in „zauberischen“ Ruf bringen, wie etwa die der Mistel (Viscum album): Sie meidet die Erde und wächst auf Bäumen. Farnkräuter beschäftigten die Fantasie der Menschen vor allem deshalb, weil sie sich vermehren, ohne Blüten und Samen zu bilden, was zu vielen Vermutungen führte.
Pflanzen, deren jahreszeitlicher Wuchsrhythmus aus der Norm war, schrieb man auch Zauberkräfte zu, wie etwa der Christrose (Helleborus niger), deren „Blum uff die Christnacht sich uffthuit und blüet“ oder der Herbstzeitlose (Colchicum autumnale), die schon 1485 im Hortus Sanitatis als „zytloiß“ beschrieben wurde, als „eyn krut und bluet an dem ende desz herbstmonets“.
Auch Pflanzen mit auffallendem Geruch mussten eine zauberkräftige Wirkung haben, so der aromatische Wohlgeruch der meisten Würzkräuter wie Dill und Dost. Man sagte, dass Hexen diesen Duft nicht ausstehen können und man sich damit gegen ihren Zauber schützen könne. Narkotische Blütendüfte wie die mancher Lilien oder der eigenartige Geruch des Baldrianwurzelstockes (Valeriana officinalis), der Katzen wie magisch anlocken kann, sollten ebenfalls helfen, sich gegen Verzauberung zu schützen.
Die Zaubernamen
Vielfach erzählen uns die Namen, die den Pflanzen gegeben wurden, von den Zauberwirkungen, die man ihnen zuschrieb. Der Teufelsabbiss (Succisa pratensis) hat einen Wurzelstock, der wie abgebissen aussieht. Denn man sagte, dass „der Teufel die Nutzung oder besondere Krafft dieser Wurtzeln dem Menschen mißguenne und … beisse sie deswegen in der Erde ab“.
Wie das Hexenkraut (Circaea lutetiana) zu seinem Namen kam, ist leider unbekannt. Diese absolut unauffällige und unscheinbare Pflanze steht auch keineswegs im Ruf der Giftigkeit. Trotzdem wurde sie offenbar in solcher Nähe zu Hexen gesehen, dass ihr Carl von Linné mit dem botanischen Namen einen Hinweis auf die berühmte Zauberin der Antike, Circe, gab.
Teufelsabiss (Succisa pratensis) (Foto: Laux)
Das Hexenkraut
Das Wissen um die Zauberkraft dieser Pflanze ist leider verloren gegangen, doch manche Geschichten erzählen, dass früher Frauen glaubten, wenn sie ein Blatt des Hexenkrautes am Körper trügen, sie eine solche Ausstrahlung bekämen, dass sie alle Männer bezirzen könnten. Da die Pflanze sicher nicht giftig ist, könnten Kräuterhexen ja einen Versuch wagen.
Die geheimnisvollen Unbekannten
Groß ist die Zahl der als magisch bekannten Pflanzen, und doch wird man so manche vergeblich in den Lehrbüchern der Botanik suchen. Teils, weil ihren Beschreibungen und Namen zu wenige Hinweise auf reale Pflanzen zu entnehmen sind, teils, weil diese Pflanzen vielleicht auch lediglich in der Fantasie- und Wunschwelt existierten.
Moly und die Odyssee
Die berühmteste Zauberpflanze des klassischen Altertums war „Moly“. In Homers Heldenepos Odyssee taucht sie erstmals auf: Es wird erzählt, wie Odysseus mit ihrer Hilfe seine Gefährten, die von der Zauberin Kirke in Schweine verwandelt worden waren, erlöste. Weiße Blüte und schwarze Wurzel – für eine Pflanzenbestimmung ist das nicht gerade viel, und schon im Altertum hat man gerätselt, um welche Pflanze es sich bei Moly wohl handeln könnte. Theophrast, ein Schüler des Aristoteles, meinte, dass es ein Zwiebelgewächs sei, das der Meerzwiebel (Drimia maritima), einer äußerst giftigen Pflanze, sehr ähnlich sein müsse.
Soma, eine Gottheit
In den altindischen vedischen Schriften wird die heilige Pflanze „Soma“ gepriesen, die zur Gottheit und „Stütze des Himmels“ erhoben wurde. Angeblich wuchs sie auf einem hohen Berg und der erste Mensch bereitete sich aus ihr einen Trank und weihte ihn Indra, dem Schöpfergott. Das Wissen um die botanische Identität dieser Pflanze ist ebenfalls verloren gegangen, aber sie soll berauschend, euphorisierend und aphrodisierend gewirkt haben. Ethnobotaniker vermuten, dass es sich bei der Somapflanze um den Fliegenpilz (Amanita muscaria) oder eine andere psychoaktive Pflanze gehandelt haben könnte.
Meerzwiebel (Drimia maritima) (Foto: leospek/shutterstock.com)
Suche nach der Wunderblume
Im Volksglauben tauchten immer wieder sogenannte „Wunderblumen“ auf. Geschichten wie die einer Frau, die unterwegs war, um für ihr krankes Kind Medizin zu holen und eine wunderschöne Blume fand, gibt es unendlich viele. Viele haben daraufhin nach der Wunderblume gesucht, aber niemand hat sie je gefunden.
Die klassischen Zauberpflanzen
Manchen Pflanzen wird sehr konkrete Zauberwirkung zugeschrieben, zum Beispiel den Liebeszauberpflanzen. Die klassischen Zauberpflanzen aber waren Pflanzen, von denen man meinte, dass sie Schlösser sprengen, zu Schätzen und Reichtum verhelfen, vor Hexenwesen und Spuk schützen und sogar unsichtbar machen können – Pflanzen also, die dem Menschen alles, was er sich an Zauberwirkungen nur wünschen konnte, vermitteln sollten.
Schwarzes Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) (Foto: hjschneider/Fotolia.com)
Die Alraune
Die berühmteste aller Zauberpflanzen war seit frühesten Zeiten die Alraune (Mandragora officinarum) aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). „Alruna“ ist die althochdeutsche Bezeichnung für mystische Wesen wie Elfen, aber auch für Alben, Kobolde und andere Gestalten, die mit Zauberfähigkeiten begabt sind und im Geheimen wirken. Später wurde dieser Name dann auf die Wurzel der Mandragora übertragen, einer Pflanze, die bei uns nicht heimisch ist, deren getrocknete Wurzeln aber als Zaubermittel seit alters her ein geschätztes Handelsobjekt waren.
WAS IST EINE ALRAUNE?
Die Mandragora ist nahe verwandt mit Pflanzen wie Tollkirsche, Bilsenkraut und Stechapfel und ebenso giftig. Ihr Aussehen und Wuchsverhalten unterscheiden sich aber sehr von ihren botanischen Verwandten und erfüllen mit ihrer Eigenart alle Kriterien einer Zauberpflanze. Ihre Heimat ist der Mittelmeerraum. Dort wächst sie vor allem auf Ödland und Schuttplätzen. Im Frühling bildet sich eine Blattrosette, aus der gestielte weiß-bläuliche Blüten erscheinen, die sich zu gelblichen Früchten, die kleinen Äpfeln gleichen, entwickeln. Noch während der Blüte beginnen die Blätter gelb zu werden und ziehen dann bald ein, sodass von der Alraune bis zum nächsten Frühjahr nichts mehr zu sehen ist. Noch auffälliger aber ist ihre Pfahlwurzel, die meist gespalten ist und daher in der Fantasie der Menschen mit Menschenbeinen verglichen wurde.
Alraune (Mandragora officinarum) (Foto: Phototribe/fotolia.com)
ZAUBER DER ALRAUNE
In alten Zeiten unterschied man die Alraunen je nach ihrer Wurzelform in „Männlein“ und „Weiblein“, wobei den Ersteren die stärkere Wirkung zukam. Es war verständlich, dass jeder den Wunsch hatte, eine Alraune zu erwerben. Der Besitz der Wurzel bedeutete Hausglück, Gesundheit, Kindersegen, Reichtum und Ehre.
Der Alraun verdoppelte in der Nacht neben ihn gelegtes Geld, schützte den Wein vor dem Verderben und das Vieh vor dem Verhexen. Er verhalf zu günstigem Prozessausgang, ja, es gab nichts, zu dem der Alraun nicht imstande war. Daher kleideten die stolzen Besitzer die Wurzeln häufig wie Puppen in Samt und Seide und legten sie in kostbar ausgeschlagene Schächtelchen. Und oft wurde für dieses universelle Zaubermittel eine eigene Ecke eingerichtet, ähnlich einem „Herrgottswinkel“.
Der Allermannsharnisch
Der Allermannsharnisch (Allium victorialis) aus der Familie der Liliengewächse (Liliaceae) ist eine sehr dekorative Pflanze, die auf Matten und Wiesen in den Alpen wächst.
Oft wurde der Allermannsharnisch als „Alraun der kleinen Leute“ bezeichnet. Als solche wurde die Zwiebel dieser Pflanze auf den Märkten angeboten. Als Schutz gegen Behexungen hängten die Bewohner die Zwiebel in Hütten und Häusern auf oder vergruben sie unter der Türschwelle.
ZAUBER DES ALLERMANNSHARNISCH
Den Namen hat die Pflanze vor allem daher, dass ihre Zwiebel von Fasern umgeben ist, die an einen kettenhemdartigen Harnisch erinnern. Daher war der Allermannsharnisch bei Rittern und Knappen als Amulett besonders begehrt. Er sollte sie hieb-, stich- und kugelfest machen und zusätzlich noch „Neunmalkraft“ verleihen. Möglicherweise heißt der Allermannsharnisch daher auch Siegwurz. Auch Bergknappen schützten sich mit der Wurzel vor den Poltergeistern und Kobolden im Berg.
Allermannsharnisch (Allium victorialis) (Foto: Eberhard Morell/OKAPIA)
Wider den Teufel
Auch den Teufel konnte der Allermannsharnisch vertreiben. Als der Teufel einmal ein junges Mädchen verführen wollte, hielt ihm diese eine Wurzel des Allermannsharnisch entgegen. Da floh der Böse mit den Worten: „Allermannsharnisch, du böses Kraut, hast mir genommen meine junge Braut.“
Die Mistel
Als Zauberkraut ebenso berühmt wie die Alraune ist die geheimnisvoll auf Bäumen schmarotzende Mistel (Viscum album) aus der Familie der Mistelgewächse (Viscaceae). Heilsam und Böses abwehrend, so bezeichneten schon die keltischen Druiden die Mistel. Sie nannten sie „Alles Heilende“ und glaubten, dass die Zweige der Mistel direkt vom Himmel auf die Bäume gefallen seien.
Die Heilwirkung der Mistel kannte man auch im Mittelalter. Eine Pflanze, die auf Bäumen wächst und „darum nicht auf die Erde fallen kann“, wurde als unfehlbares Mittel gegen die „Fallsucht“, die Epilepsie, gerühmt.
WAS IST EINE MISTEL?
Die Misteln bilden eine eigene Familie der Mistelgewächse. Man unterscheidet zwischen Laubholz-Misteln (Viscum album), die auf Laubhölzern, vor allem Pappeln, Apfel- und Birnbäumen, seltener auf Eschen und extrem selten auf Eichen wachsen können, und Nadelholz-Misteln (Viscum laxum), die wiederum in die Unterarten Tannen-Mistel (Viscum laxum subsp. abietes) und Föhren-Mistel (Viscum laxum subsp. laxum) untergliedert werden. Viscum-Arten sind primär in Mitteleuropa heimisch. Die Mistel ist ein Halbschmarotzer, der sich mithilfe von Senkern, die tief in das Holz der Wirtspflanze getrieben werden, die Nährstoffe holt. Misteln behalten auch im Winter ihr ledriges, grünes Blattwerk und verhalten sich überhaupt so, als ob die Jahreszeiten sie nichts angingen. Die Mistel hatte daher für die Menschen immer etwas Unheimliches an sich.
BRAUCHTUM
Fand ein Mädchen eine Mistel auf einem Apfelbaum, war eine baldige Heirat in Aussicht. So galt die Pflanze als Glücksbringer und Fruchtbarkeitssymbol. Das drückt sich auch in vielen Bräuchen aus. Vor allem in England ist es heute noch Brauch, Mistelzweige an die Decke zu hängen und sich darunter gegenseitig Glück zu wünschen. Besonders viel Glück bringt es Mädchen, von einem Mann unter solchen Mistelzweigen überrascht zu werden. Der Mann hat dann nämlich das Recht, das Mädchen zu küssen, und so etwas soll ja manchmal der Beginn einer glücklichen Ehe sein.
Mistel (Viscum album) (Foto: LianeM/Fotolia.com)
Gegen den bösen Blick
Im Volksglauben wurde die Mistel als Zauberpflanze schlechthin betrachtet. Eine Mistelbeere, in Silber gefasst, machte gegen jede Verhexung immun. Mistelamulette hat man in ländlichen Gegenden bis in die heutige Zeit getragen „wider die Berufung und den bösen Blick“.
Beispiele
für klassische Zauberpflanzen
Von der „Krafft und Würckung“ der
Zauberpflanzen
(Foto: Elena Kovaleva/fotolia.com)
Das Bemühen, Krankheiten, Gebrechen und Beschwerden zu verhüten und zu heilen, ist so alt wie die Menschheit. Immer waren es auch die Pflanzen, die sich dafür mit den in ihnen schlummernden Wirkstoffen anboten. Der wahre Meister der Signaturkunde war Paracelsus, der lieber von den Kräuterfrauen und Wurzelgrabern lernte als in den Studierstuben der Universitäten:„Alles, was die Natur gebiert, das formt sie nach dem Wesen seiner Tugend und nichts ist, was die Natur nicht gezeichnet habe, und durch die Zeichen kann man erkennen, was im Gezeichneten verborgen ist.“
Signaturen der Pflanzen
Nomen est omen? Pflanzennamen sind oft die Essenz jahrhundertealter Erfahrungen. Namenssignaturen wie Augentrost (Euphrasia spec.), Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), Magenwurz (Acorus calamus) oder Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium) erzählen uns ganz deutlich, welche heilenden Kräfte man den Pflanzen zusprach. Paracelsus hat solche Namen sehr ernst genommen und empfahl sie als Anregung zu tiefer gehenden Studien.
Organsignaturen