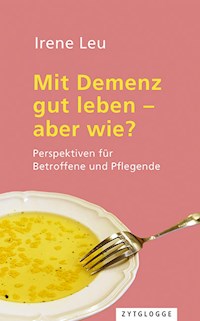
24,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Immer mehr Menschen erkranken an Demenz. Und immer mehr Menschen sind in unterschiedlichsten Rollen betroffen: als Demenzkranke, als Angehöriger, als Nachbarin, als Hausarzt, als Therapeutin, als Forscherin, als Verkäufer, als Vermieter. Der grösste Wunsch der meisten Betroffenen: Die Demenz zum Verschwinden bringen. Es ist an der Zeit, mit Demenz leben zu lernen – als Einzelne und als Gesellschaft. Irene Leu, Pionierin beim Aufbau einer Demenzstation in Basel, heute Dozentin und Coach für Pflegestationen, die sich auf personenzentrierte Betreuung ausrichten möchten, erzählt aus dem Alltag in der Pflege Demenzerkrankter, der Betreuung von Angehörigen und der Begleitung von Fachpersonen. Sie zeigt, wie oft mit Wenigem viel getan werden kann, und hinterfragt gängige Herangehensweisen und Konzepte. Sie erläutert, wie es möglich ist, zu einem Verständnis zu gelangen, das die Person mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Werten in den Mittelpunkt der Betreuung stellt. Aus dem Inhalt: – Pflege zu Hause – Übergang ins Heim – Leben im Heim – Serviceteil für D, A, CH
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Ähnliche
IRENE LEUMit Demenz gut leben – aber wie?
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2019 Zytglogge Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Angela Fessler
e-Book: mbassador GmbH, Basel
ISBN epub: 978-3-7296-2280-7
ISBN mobi: 978-3-7296-2281-4
www.zytglogge.ch
Irene Leu
Mit Demenzgut leben – aber wie?
Perspektiven fürBetroffene und Pflegende
Für Sabine und Hansjörg Duschmalé. Dankbar.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
TEIL 1 – DEMENZ DAHEIM
1.Wirklich? Der «schwierige» Angehörige
2.Getrieben? Der bewegungsfreudige CEO
3.Dumm? Die anpassungsfähige Ehefrau
4.Einsam? Der alleinstehende Mann und seine Demenz
5.Ausgeliefert? Der liebende Partner
6.Machbar? Der organisierende Sohn
7.Kapiert? Das weiterführende Wissen
TEIL 2 – ZWISCHENSTÜCK: DEMENZ UND DER ÜBERGANG INS HEIM
TEIL 3 – DEMENZ IM HEIM
1.Welche Angehörigenarbeit ist notwendig?
2.Was heißt gute Körperpflege?
3.Welche Aktivierung macht Sinn?
4.Wie macht Essen Freude?
5.Kommunikation und Interaktion – was kommt an?
6.Was sagt herausforderndes Verhalten aus und was kann deeskalierend wirken?
7.Selbstbestimmung und Fürsorge – immer ein Dilemma?
Schlussworte
Im Buch zitierte Bücher
Lesetipps und Kontaktadressen
Mein Dank
Vorwort
Demenz ist eine schreckliche Krankheit. Die Alzheimerkrankheit – als wichtigste, weil häufigste Ursache einer Demenz – beginnt damit, dass Patienten Schwierigkeiten haben, sich neue Dinge zu merken. Diese Gedächtnisprobleme schreiten unerbittlich voran und führen bald auch im Alltag zu Defiziten. Es kommen Orientierungsstörungen und Sprachprobleme dazu, die den Umgang mit anderen Menschen weiter erschweren. Bald sind auch diejenigen Leistungen, die auf ein gut funktionierendes Frontalhirn angewiesen sind, betroffen: abstraktes Denken, Problemlösen oder Strategien nutzen werden fehlerhaft bis fast unmöglich. Wir denken, dass die Betroffenen in der ersten Phase, in der sie noch in der Lage sind, diese Fehler zu erkennen, am meisten leiden. Später, wenn die Hirnleistungsstörungen so schwerwiegend geworden sind, dass ein selbstständiges Leben zu Hause nicht mehr möglich ist, scheint das (wahrnehmbare) Leiden zu schwinden. Die Angehörigen sind es, die weiterhin leiden und ihr liebes Familienmitglied vermissen. Dieser schreckliche duale Leidensweg ist umso schlimmer, wenn nie eine sorgfältige Diagnostik stattgefunden hat und damit auch keine menschliche Begleitung auf dieser traumatischen Reise initiiert werden konnte.
Auch wenn wir typische Verläufe der verschiedenen bekannten etwa 20 häufigsten Demenzen kennen und diese in den Lehrbüchern nachlesen können, sind die individuellen Wege unterschiedlich. Es muss also darum gehen, bei jedem Menschen, dem Patienten, den Angehörigen und den Pflegenden, genau hinzusehen und zu versuchen, der jeweiligen Individualität Rechnung zu tragen.
Ich lernte Irene Leu im Jahr 1989 kennen. Ich war zu dieser Zeit Doktorand und sie kam als erfahrene Psychiatrie-Krankenschwester in die drei Jahre zuvor neu geschaffene Memory Clinic, es war die erste solche Klinik in Kontinentaleuropa. An der Memory Clinic wurden Menschen mit neuen Instrumenten so frühzeitig wie möglich diagnostiziert. Den Patienten und Angehörigen wurden in Form von Gedächtnistrainings und Angehörigenberatung innovative Programme zur Begleitung angeboten und auch evaluiert. Irene Leu konnte in der Memory Clinic viel neues Wissen erwerben und bei der neu gegründeten Alzheimervereinigung beider Basel wichtige Erfahrungen sammeln. Sie visitierte diese Gedächtnistrainings und begleitete Angehörige. Auch erste Schulungen für Interessierte gehörten zu ihrem Aufgabenfeld. Irene erkannte aber schnell, dass diese Angebote zwar willkommen sind, jedoch nicht immer sinnvoll waren. Vor allem die enorm schwierige Zeit nach der ersten Phase von Hirnleistungsstörungen (und Diagnose) und vor dem Eintritt in eine Pflegeeinrichtung war komplex und die Not der Menschen mit Demenz, ihrer Angehörigen, aber auch der professionell Pflegenden war groß. 1999 konnte Irene – mit einem großen Rucksack an Wissen und Erfahrung – ihre Idee einer kleinen Demenzstation für Menschen mit Demenz und mit Programmen für die Angehörigen umsetzen. Mit der Stiftung Basler Wirrgarten rief sie das ATRIUM ins Leben. Die Pionierleistung, die Irene Leu mit dem ATRIUM geleistet hat, kann unmöglich genügend gewürdigt werden.
Das, was Irene Leu mit ihrer Haltung und Arbeit mit Menschen mit Demenz, die im ATRIUM liebevoll als Gäste bezeichnet werden, praktizierte, hat der britische Psychologe Tom Kitwood die Person-zentrierte Pflege genannt. Diese Pflege stellt die Einzigartigkeit der Person in den Mittelpunkt. Kitwood postuliert, dass eine positive, Person-zentrierte Arbeit und Beziehung den Demenzprozess positiv beeinflussen kann. Es geht darum, die Arbeit nach den grundlegenden physiologischen und sozialen menschlichen Bedürfnissen auszurichten. Die zwingende Voraussetzung hierbei ist, die Notwendigkeit, die innere Welt der Menschen mit Demenz, ihre Wahrnehmung, ihr Erleben und ihr Denken zu verstehen. Eine Coaching- Methode, mit welcher dieses Person-zentrierte Hinsehen erlernt werden kann, ist das «Dementia Care Mapping» (DCM). Irene Leu war die erste und ist bislang die einzige DCM-Trainerin der Schweiz und dabei eine außerordentliche Lehrerin. Es ist zu wünschen, dass diese Methode breiten Eingang in den Pflegealltag findet.
Mit diesem Buch von Irene Leu werden uns die Erfahrungen von 30 Jahren Arbeit mit Menschen mit Demenz, mit Angehörigen und Pflegenden offenbart.
Liebe Irene, ich danke dir dafür!
Prof. Dr. phil. Andreas U. Monsch
Leiter Memory Clinic
Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER, Basel
Einleitung
Es ist lange her, dass sich Bruno Kaufmann zum ersten Beratungsgespräch meldete. Sein Vater hatte eine Demenz und seine Mutter, die ihren Mann pflegte, war überlastet und überfordert. Die Eltern waren beide über 80-jährig, sie waren seit Jahrzehnten verheiratet und der Sohn erzählte, dass sie ein gutes Leben und eine schöne Ehe hatten. Nun häuften sich aber die Konflikte, es kam zu Streitereien und verbalen Aggressionen des Vaters gegenüber der Mutter, manchmal auch gegenüber dem Sohn.
Es kam in der Folge zu einigen Begegnungen mit Herrn Kaufmann und seiner Mutter, bei denen wir jeweils Situationen aus dem Alltag besprachen. Sie erhielten Tipps, wie sie anders mit dem demenzbetroffenen Partner und Vater umgehen können. Beide Angehörigen waren lernfähig und es wurde – mit einigen Entlastungsmöglichkeiten für Frau Kaufmann – möglich, Herrn Kaufmann bis zu seinem Lebensende zu Hause zu betreuen.
Als ich die Anzeige über den Hinschied des Vaters erhielt, war ein Briefchen des Sohnes beigefügt; der letzte Satz darin lautete: «Bitte schreiben Sie ein Buch darüber, was während dieser ganzen Geschichten sinnvoll und was weniger sinnvoll ist. Ihre praktischen Tipps und Ihre pragmatische Arbeitsweise waren für uns sehr hilfreich, davon sollen auch andere profitieren! Wissen Sie, Theorie ist genügend da, doch uns haben die lebensnahen Tipps geholfen, um gute Situationen zu schaffen.»
Dies wurde im Lauf meiner Arbeit noch mehrere Male gewünscht: Schreiben Sie doch ein Buch! Das habe ich nun getan. Mein Anliegen mit diesem Buch ist es, mittels wahrer Geschichten aufzuzeigen, wie Arbeit mit Menschen mit Demenz und wie Unterstützung der An- und Zugehörigen der Demenzbetroffenen aussehen kann. Ebenso möchte ich mit vielen Beispielen zeigen, was es in den Institutionen braucht, um die Pflegenden in ihrer anspruchsvollen Aufgabe besser zu unterstützen. Mit dem Ziel: weg von der funktionalen Arbeitsweise, hin zur individuellen, bedürfnisorientierten und Person-zentrierten Pflege.
Die funktionale Pflege ist tätigkeitsorientiert und streng arbeitsteilig. Die Pflegenden führen, je nach Qualifikation, die ärztlichen und pflegerischen Anordnungen aus, für die sie sich verantwortlich zeichnen. Sie haben nicht die Gesamtverantwortung und auch die Befugnis für den Pflegeprozess obliegt ihnen nicht. Die funktionale Arbeitsweise orientiert sich stark an den vorgegebenen Betriebsabläufen der Institutionen.
Der Person-zentrierte Ansatz in der Pflege von Menschen mit Demenz geht davon aus, dass die Person in ihrer Individualität und mit ihren Bedürfnissen im Zentrum steht. Die Pflegeumgebung passt sich dem Erleben der Demenzbetroffenen an. Damit steht die Person im Mittelpunkt, nicht die Demenz. Die Mitarbeitenden haben die Verantwortung für den Pflegeprozess. Mit dieser Arbeitsweise ist denkbar, dass Strukturen und Abläufe angepasst werden.
Ich schreibe im Buch von Pflege, nicht von Pflege und Betreuung, weil ich diese Unterscheidung als konstruiert empfinde und sie ablehne. Menschen mit Demenz sollen als Ganzheit angenommen werden; so ist Pflege auch Beziehungspflege, Kommunikation und Aktivitäten sind Alltagspflege für Menschen mit Demenz und natürlich schließt dieser Ansatz auch Grund- und Behandlungspflege mit ein.
Ich möchte sowohl die Angehörigen wie die Pflegenden mit praxisnahen Geschichten und Beispielen ermuntern, ihren Weg mutig und selbstbewusst zu gestalten. Ich liefere keine Rezepte, keine akademischen Ratschläge, keine illusorischen Himmelsflüge, sondern erzähle Geschichten aus dem vollen Leben.
Es geht im Buch immer wieder um «praktischen Support» und um «Praxisbezug». Damit möchte ich auf keinen Fall suggerieren, dass theoretische Aspekte, also Wissenschaft, nicht nötig seien. Es braucht beide, die Theoretiker und die Praktikerinnen. Praxis ohne jegliche Selbstreflexion kann zu verkürzten Lösungen führen, die nicht nachhaltig sind. Es kann nur darum gehen, von beidem das richtige Maß zu finden, denn «Theorie ohne Praxis ist leer, Praxis ohne Theorie ist blind» (Immanuel Kant).
Die Person-zentrierte Arbeitsweise war mir Leitfaden bei der Gründung des ATRIUM der Stiftung Basler Wirrgarten – das Demenzzentrum, das ich fast zwanzig Jahre geleitet habe. Ich erzähle Geschichten über Menschen, die ich begleitet habe, und ich erzähle von erlebten Situationen. Ich beschreibe die Rückschlüsse, die ich jeweils daraus gezogen habe, und stelle Fragen. Es sind Ausschnitte aus dreißig Jahren Arbeit in der «Demenzszene».
Irene Leu
Juli 2019
Das ATRIUM
Das ATRIUM ist das kleine Demenzzentrum, das von der Stiftung Basler Wirrgarten seit dem Jahr 2000 betrieben wird. Die Angebote sind:
-Beratungsstelle für An- und Zugehörige und andere vom Thema Betroffene. Die Beratung ist zugehend und kostenlos.
-Tagesstätte für Menschen mit Demenz, mit zwölf Plätzen. Die Tagesgäste sind mobil. Sie sind in ihrer Persönlichkeit oft stark verändert. Sie kommen zwischen einem und fünf Tagen pro Woche in die Stätte.
-Wandergruppe für Menschen mit Demenz, die nicht die Tagesstätte im ATRIUM besuchen. Einmal wöchentlich einen Nachmittag.
-Ausdrucksmalen für Menschen mit Demenz, die nicht die Tagesstätte im ATRIUM besuchen. Einmal wöchentlich einen Nachmittag, Kleingruppe von bis zu drei Personen.
-«zuhause unterwegs» – Freiwillige betreuen Menschen mit Demenz zu Hause. Die Freiwilligen werden geschult, durchlaufen ein Praktikum in der Tagesstätte im ATRIUM, bekommen ein regelmäßiges Coaching und werden in Einzelgesprächen begleitet.
-Soziokulturelle Angebote wie das monatliche Thé dansant, ca. viermal jährlich Konzerte am Samstagabend, Referate und Lesungen, öffentlich. Diese Angebote sind angepasst für Menschen mit Demenz, auch in einem späteren Stadium der Demenz, sowie für ihre Angehörigen. Anschließender Apéro.
-Schulungen für Angehörige und professionell Tätige, Öffentlichkeitsarbeit.
Personenschutz
Alle Namen und Orte sind erfunden, die wahren Geschichten so verändert, dass die Personen nicht erkenntlich sind.
Gender
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit verwende ich jeweils das Geschlecht, das in der benannten Gruppe häufiger vorkommt, wenn es möglich ist die neutrale Form.
TEIL 1
DEMENZ DAHEIM
1.
Wirklich? Der «schwierige» Angehörige
Manfred Lutz, 66-jährig, und Margrit Lutz, 63-jährig, kannten sich seit ihrer Kindheit in Hinterlauchringen. Sie gingen im gleichen Schulhaus zur Schule und waren früh befreundet, machten zusammen Hausaufgaben und heckten miteinander Streiche aus. Manfred Lutz wusste schon als Bub, dass er das Gritli einmal heiraten würde, und das haben sie jung auch getan. Sie hatten drei Kinder, Zwillingstöchter und einen Sohn. Manfred Lutz war Schreiner mit eigenem Betrieb. Er hatte zwei Angestellte. Margrit Lutz war Haus- und Familienfrau, im Betrieb erledigte sie die Buchhaltung und alle administrativen Aufgaben. Ungelernt, alles «learning by doing». Sie wohnten im eigenen Haus, hatten einen großen Garten, waren Selbstversorger «mit Grünfutter», wie der Schreinermeister mit einem Augenzwinkern erzählte.
Frau Lutz hatte seit circa drei Jahren zunehmende Gedächtnisstörungen, so genau ließ sich nicht mehr feststellen, wann es begonnen hatte, die Angaben dazu waren unterschiedlich. Neuerdings hatte sie auch Probleme mit der Wortfindung, und nicht immer sei klar, ob sie verstehe, was mit ihr gesprochen wurde, sagte Manfred Lutz. Sie brauchte bis zu fünf Gänge ins Dorf, bis sie alle Einkäufe beisammenhatte. Dorfbewohnerinnen erzählten immer häufiger, dass sie nicht grüße. Was denn los sei?, fragten sie. Die Körperhaltung von Margrit Lutz hatte sich verändert, sie ging vornübergebeugt, den Blick meistens dem Boden zugewandt.
Ihr Mann war lange Jahre Gemeinderat gewesen, Ressort Umwelt; sie war engagiert in der örtlichen Museumskommission und im Frauenturnverein. Sie hätten einige gute Freunde und Freundinnen und seien gerne unter Leuten gewesen, auch an Dorf- oder Tanzfesten. Margrit Lutz gefiele das aber zunehmend weniger, erzählte der Ehemann. Die beiden Töchter wohnten etwas entfernt, waren beide in einer Partnerschaft, beide berufstätig, beide bisher kinderlos. Der Sohn war Pflegefachmann HF (Höhere Fachschule) und Berufsbildner in der Langzeitpflege. Er war es, dem die sich verändernde Mutter Sorgen bereitet hatte. Gespräche mit dem Vater darüber hatten regelmäßig mit Streit geendet, obwohl ihr Verhältnis sonst ein freundschaftliches war. Der Sohn wandte sich an den Hausarzt der Eltern, der einer Abklärung (Verdacht auf Demenz) der Mutter zustimmte.
Herr Lutz wurde von der ambulanten Demenz-Abklärungsstelle zur Beratung empfohlen. Die Ärztin, die dort arbeitete, berichtete, dass die Diagnose «Demenz vom Typ Alzheimer» gestellt wurde. Herr Lutz weigere sich, die Diagnose anzunehmen. Die Neuropsychologin finde aber, dass er Beratung und Begleitung brauche. Ich bat um die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. Die erhielt ich ein paar Tage später, beigefügt ein A4-Blatt, versehen mit der Aufschrift «ACHTUNG! Schwieriger Angehöriger!». Alles dick und rot unterstrichen.
Der erste Termin
Herr Lutz kam pünktlich zur vereinbarten Zeit, ein großer, schlanker, gut aussehender Mann mit grau meliertem, dichtem Haar, blauen Augen. Er war leger gekleidet, in Jeans und dezent farbigem Hemd. Er wirkte angespannt. Ich bat ihn Platz zu nehmen, bot ihm einen Kaffee an, den er ablehnte. Ich erzählte ihm, wer ich bin und was das Ziel einer Beratung oder auch länger dauernden Begleitung sei. Er wollte nichts davon wissen.
«Meine Frau hat kein Alzheimer! Versuchen Sie nur nicht, mir das auch einreden zu wollen!»
«Was ist denn der Grund, weshalb Ihre Frau untersucht wurde?»
«Dummes Geschwätz des Hausarztes und meines Sohnes, das ist alles hinter meinem Rücken vereinbart worden.»
Das äußerte er einigermaßen gelassen, und weiter, dass er schlussendlich habe mitgehen müssen, er habe ja nicht gewollt, dass die da lauter Lügen erzählen würden.
«Unerträglich war das! Die vielen Fragen!»
Dann habe man seine Frau auch noch von ihm trennen wollen bei den Untersuchungen.
«Aber nicht mit mir! Mit mir nicht!»
Ich wartete zu, es fiel mir nichts ein, was ich in diesem Moment hätte sagen können. Ich schaute ihm einfach ins Gesicht, überlegte mir, was wohl in ihm vorging.
Plötzlich stand er auf und ging rastlos und aufgeregt im Büro auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Jetzt war ich erst recht ratlos. Was sollte ich nun tun? Ihn aufhalten? Mit ihm zu reden versuchen, während er hin- und herwanderte? Ich beschloss, mit ihm zu gehen, auf und ab, achtete darauf, neben ihm, nicht hinter ihm zu sein. Plötzlich blieb er stehen, baute sich vor mir auf und brüllte wutentbrannt:
«Was laufen Sie mir nach?!»
«Es fällt mir nichts anderes ein. Ich fühle mich grad ziemlich hilflos.»
«Ach so, hilflos! Sie gehören wohl nicht zu den Superschlauen von da drüben?!»
Mit «da drüben» meinte er die Leute, die die Abklärungen vornehmen, nahm ich an, die Station war nicht so weit entfernt von meinem Arbeitsplatz.
Er nahm sein Auf- und Abgehen wieder auf, ich auch. Plötzlich setzte er sich hin, stützte das Gesicht in seine Hände und begann zu weinen. Ganz leise weinte er. Ich war froh, jetzt nichts sagen zu müssen, mit meinem Kloß im Hals, den diese Situation verursacht hatte. Ich reichte ihm Taschentücher und wartete. Ich traute mich nicht, ihm über die Schultern oder den Arm zu streichen, was ich in anderen Situationen vielleicht getan hätte. Ich wartete einfach. Es dauerte fast zehn Minuten. Dann begann er leise zu erzählen:
«Ich kenne das Gritli seit der Primarschule und ich wusste immer, dass ich sie heiraten würde. Ich habe die beste Frau, die es gibt. Sie war immer fleißig. Sie ließ sich nichts zuschulden kommen. Sie war eine gute Mutter. Und eine Schöne war sie! So eine Schöne! Und so eine Liebe! Und jetzt der Sohn!»
Der «schwierige» Angehörige redete sich wieder in Rage.
«Der behauptet, dass seine Mutter dement ist! Der Sohn ist Pflegefachmann und glaubt, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben!»
Jetzt weinte Manfred Lutz wieder. Dann erzählte er, dass er diese Enttäuschung fast nicht schlucken könne. Wie der Sohn das dem Gritli antun könne. Die Töchter seien zurückhaltend, wollten mit der Situation lieber nichts zu tun haben, sich nicht in diesen Konflikt einmischen. Sie kämen jeweils am Sonntag zum Mittagessen, zusammen mit den Partnern. Der Sohn sei alleinstehend. Das Gritli koche immer noch gut. Ja sie vergesse manchmal etwas.
«Aber das geht uns doch allen so, wenn wir älter werden!»
Ich vermutete, dass hier rationale Erklärungen nichts bringen würden, und ließ ihn weitererzählen. Wie sie sich geweigert habe, dass er eine Sekretärin einstelle in der Schreinerei. Sie seien doch zusammen und würden auch alles zusammen machen. Und er habe nie Grund zu Tadel gehabt! Als die Kinder noch klein gewesen seien, habe sie am Abend oder am Sonntag im Büro gearbeitet, wenn er mit den Kleinen etwas unternommen habe.
Nie habe er andere Frauen im Kopf gehabt, obwohl die Gelegenheiten dazu da gewesen wären. Und auch Margrit habe immer zu ihm gehalten. Als er einen schweren Unfall gehabt und am Rücken habe operiert werden müssen, habe seine Frau dafür gesorgt, dass er baldmöglichst wieder aus dem Spital hätte austreten können, und sie habe überhaupt viel für ihn getan.
«Und jetzt, jetzt soll ich sie weggeben? Ihr Windeln anziehen? Die Spitex holen für Pflege? Sicher nicht!»
Ich wusste nicht, weshalb er jetzt von Weggeben, Spitex und Windeln sprach, vermutete aber, dass die Fachpersonen bei der Diagnose-Eröffnung viel zu viele Informationen ins Gespräch gepackt hatten, vielleicht auch unglückliche Begriffe wie «Windeln» benutzt hatten. Dass sie die üblichen Prognosen prophezeit hatten: noch sechs Jahre Lebenserwartung, davor Heimeintritt wegen Inkontinenz. Ich fragte ihn danach, als mir der Moment günstig erschien. Manfred Lutz bejahte, ja, er habe viel gehört und nichts verstanden und ein großes Couvert erhalten, da seien alle Informationen drin, die er benötige, sei ihm gesagt worden. Er habe es ungeöffnet entsorgt. Richtig so, dachte ich. Angehörige von Menschen mit Demenz sind überfordert mit Riesencouverts mit viel zu vielen Informationen. Sie brauchen Tipps für den Moment, wie er sich gerade präsentiert. Nachfolgend Beratung, Begleitung und Infos bei jedem weiteren Schritt, der ansteht.
Irgendwann stand Manfred Lutz auf und wollte sich verabschieden. Ich fragte ihn, ob wir wieder etwas abmachen können? Nein, er komme nicht mehr. Ob ich einmal nach ihm fragen dürfe? Nein, das sei nicht nötig.
Zugehende Beratung
Ich habe es dann trotzdem getan. Habe ihn nach einem Monat angerufen und ihn gefragt, wie es ihm gehe. Er war irritiert über mein Nachfragen. Ich habe ihm unterbreitet, dass ich ihn gerne treffen würde, um ihm ein paar Fragen zu stellen, falls er das erlaube. Er willigte ein – zu meiner Überraschung.
Als er dann hier war, fragte ich den im Moment gelassen wirkenden Angehörigen:
«Haben Sie mit den Töchtern und dem Sohn noch einmal gesprochen?»
«Nein.»
«Mit sonst jemandem?»
«Nein.»
«Mit dem Hausarzt?»
«Nein.»
«Sind die Kinder zu einem Gespräch auf der Abklärungsstation gewesen?»
«Nein.»
Ich bot ihm ein Familiengespräch an, erklärte ihm, dass ich mit meinem Wissen und meiner Erfahrung vielleicht auch seinen Kindern ein paar Antworten oder Tipps geben könne, wie mit der Situation umgegangen werden könnte. Ich sagte ihm aber auch, dass möglicherweise Konflikte beim Gespräch entstehen könnten. Garantierte ihm jedoch, dass ich die würde auflösen können (und hoffte, den Mund nicht zu voll genommen zu haben).
Auch auf diesen Vorschlag ging Manfred Lutz ein, wiederum zu meinem großen Erstaunen. Ansonsten vermied ich die Begriffe Demenz oder Alzheimer, ließ mir von ihm erzählen, wie der Alltag bei ihnen so aussah, ob es übliche Tage gebe, wie die Wochenenden verlaufen würden, ob sie an den Abenden etwas unternehmen oder wie sie diese verbringen würden. Ich erfuhr, dass er noch kleinere Schreinereiaufträge annehme. Dass seine Frau aber im Büro nichts mehr mache; sie solle sich jetzt ausruhen, sie habe ihr Leben lang genug gearbeitet. Ansonsten sei sie selbstständig und es würde ihr nichts fehlen, schon gar nicht im Kopf.
Das Familiengespräch
Das Familiengespräch fand einen Monat später statt. Die Töchter wirkten hilflos auf mich, der Sohn gewappnet mit Selbstbewusstsein und vielen Fachausdrücken, die ich laufend übersetzte, damit alle verstanden, wovon die Rede war. Eine Tochter war schwanger, würde in zwei Monaten heiraten.
«Das Kind kommt in einem halben Jahr», erzählte der werdende Großvater mit einem Strahlen im Gesicht. Die Tochter mache sich große Sorgen über die Erblichkeit der Demenz.
Ich nahm die Untersuchungsakten hervor und unterbreitete der Familie, dass ich mit ihnen Abschnitt für Abschnitt des Berichts besprechen möchte und auch nachfragen würde, ob sie ähnliche Erfahrungen mit der Ehefrau/der Mutter machen, wie sie hier beschrieben seien. Ich las die Sätze jeweils vor und übersetzte sie, wenn möglich, in Alltagssprache oder umschrieb die Fachbegriffe. Vieles wurde bestätigt, vom Ehemann jedoch sofort bagatellisiert.
«Das ist doch kein Alzheimer! Das passiert doch jedem! Mir auch!»
Manfred Lutz hatte, laut Bericht, beim Abklärungsgespräch kaum etwas über Fehlleistungen seiner Frau berichtet, auch mir erzählte er beim letzten Gespräch, dass das Gritli selbstständig sei. Jetzt hörte ich von den Töchtern und dem Sohn einiges anders. Sie erzählten, wie ihre Mutter im Garten Blumen nicht mehr immer von Unkraut unterscheiden könne, die Büsche falsch schneide, ganze Beete übersehen würde, andere dafür so radikal jäte, dass kaum mehr etwas wachse. Wie oft sie nach Wörtern suche, sie nicht finde und dann traurig sei. Körperpflege? Mangelhaft. Ihr Vater helfe, worauf der gleich wieder losdonnerte:
«Das ist doch keine Hilfe! Das ist normal! Wir haben immer alles zusammen gemacht!»
Mir wurde immer klarer, dass Herr Lutz die Diagnose als eine Demütigung erlebte, als persönliche Kränkung, als Stigma, dem er sich mit aller Kraft entgegensetzen musste. Warum? Ich wollte ihn nicht vor seinen Kindern danach fragen.
Sein Sohn drängte darauf, dass ich den uneinsichtigen Vater von Medikamenten, von Antidementiva, überzeuge. Das konnte ich aber nicht, weil ich von deren Wirkung, wie viele andere Fachleute auch, nicht überzeugt bin. Wenn jemand sie wünscht und an die Wirkung glaubt, sollen diese Medikamente auf jeden Fall verordnet werden. Wenn es Widerstand gibt, ist davon abzusehen; das war und ist meine klare Haltung.
Ich erfuhr, dass Margrit Lutz ihr Leben lang keine Medikamente genommen hatte, nicht einmal ein Aspirin bei Kopfschmerzen. Daher würde es ein eher sinnloses Unterfangen werden, sie von diesen Medikamenten überzeugen zu wollen, insbesondere wenn der Ehemann die verkörperte Verweigerung darstellte. Der Hausarzt würde die Medikamente auf Wunsch verschreiben, er bestehe aber nicht darauf, auch er sei eher skeptisch, sagte er mir später am Telefon.
Wir unterhielten uns dann über eine mögliche Zukunft. Ich konnte einiges entschärfen, was Manfred Lutz von den anderen Fachkräften meinte gehört zu haben. Es sei nicht abzusehen, wie groß die Lebenserwartung der Ehefrau und Mutter noch sei. Ich war auch ganz ehrlich und sagte, wie ungeschickt ich das finden würde, so etwas bei einem Diagnosegespräch überhaupt zu erwähnen. Es gehe nicht darum, jetzt einen Plan mit genauen Angaben zu entwerfen, wann was eintreffen würde: Nichts sei vorhersehbar.
«Wissen Sie, eine genaue Voraussage gibt es nicht. Jeder Krankheitsverlauf ist anders. Die Herausforderung ist es, einen Tag nach dem andern so anzunehmen, wie er sich präsentiert. Ich kann Ihnen anbieten, die Symptome, die festgestellt worden sind, alltagsbezogen zu beschreiben und in etwa vorauszusagen, wie sie sich entwickeln könnten. Wichtig ist es, bei weiteren Gesprächen jeweils über belastende Situationen im Alltag und im Zusammenleben zu erzählen, wie es gerade ist. Ich kann dann helfen einzuordnen, und miteinander können wir besprechen, wie Sie damit umgehen könnten. Jede Verschlechterung bedeutet für Sie wieder einen Abschied! Es ist sinnvoll, die Symptome einer Demenz zu kennen, um die Ehefrau und Mutter nicht ständig zu konfrontieren oder zu überfordern mit Sachen, die sie nicht mehr kann. Es geht in Zukunft vor allem um Beziehung, um das Wohlbefinden und darum, wie dieses hergestellt werden kann – für alle! Und es geht auch um Trauer, um das Verarbeiten der Erscheinungen einer schlimmen Krankheit.»
Erstaunlicherweise wurde Manfred Lutz nicht mehr laut, widersprach nicht. Er hörte aufmerksam zu. Am Ende der Sitzung bekräftigte er aber wieder, keine Beratung und Begleitung zu brauchen, er komme gut allein zurecht und Alzheimer sei das auch nicht.
Und Frau Lutz?
Ich fragte die Angehörigen, ob Margrit Lutz vielleicht einmal zu einem Gespräch mitkommen möchte?
«Spricht sie über ihren Zustand? Wie geht sie damit um? Ist sie traurig, verzweifelt oder wütend? Irritiert?»
Nein, ihre Fehlleistungen seien nie Thema, nie gewesen. Sie befasse sich nicht damit, sie verdränge es. Sie beschuldige aber auch niemanden und sie sei selten traurig, am ehesten, wenn sie Worte im Gespräch nicht finde. Sie sei meistens zufrieden, manchmal erstaunt, wenn jemand um sie herum irritiert auf sie reagiere oder sie auf ihre Defizite aufmerksam mache. Manchmal lache sie diese Personen auch aus, frage sie, ob bei ihnen im Kopf noch alles funktioniere.
Ich bezweifelte das Verdrängen. Vielleicht bemerkte sie die Fehlleistungen wirklich nicht. Ich habe in meinen 30 Jahren in der Demenzszene viele Demenzbetroffene kennengelernt. Es gibt Personen mit Demenz, die keinerlei Einsicht in ihren Zustand haben, es kommt ihnen nichts verkehrt vor, sie leiden nicht, sind nicht wütend, nicht verzweifelt. Es gibt keinen Grund, sie zu ihren Defiziten hinzuführen und sie damit zu beschämen. Angehörige hingegen verzweifeln sehr wohl, gerade auch, weil es so keine Auseinandersetzung geben kann mit einer Person, die ihnen nahe ist: kein gemeinsames Verarbeiten.
Aufgrund der Schilderungen der erwachsenen Kinder des Ehepaars Lutz nahm ich an, dass die Demenz doch schon fortgeschritten war. Der emotionale Aufwand, insbesondere des Ehemannes, war vermutlich erheblich. Und ich fragte mich, wohin er mit seiner Trauer, seiner Wut und mit seiner Verzweiflung ging.
Zugehende Beratung, bis auf Weiteres
Ich meldete mich in der Folge circa alle ein bis zwei Monate bei Manfred Lutz. Manchmal wiegelte er ab, er könne jetzt nicht weg, er habe viel zu tun und es gäbe nichts zu besprechen. Manchmal kam er bereits einen oder zwei Tage nach dem Telefonat zu mir in die Beratung. Ich bestellte ihn immer zu mir. Ich mochte mich nicht am Telefon mit ihm unterhalten. Ich wollte seine Körperhaltung, seine nonverbalen Signale wahrnehmen können. Ich wollte ihm ins Gesicht sehen, sehen, was ich darin lesen konnte, und ihn bestätigen oder berichtigen lassen, ob es dem entsprach, was er gerade empfand.
Es wurde mit der Zeit möglich, über vieles zu reden. Den Zeitplan gab Margrits Mann vor. Ich gab keine Ratschläge, außer wenn ich danach gefragt wurde, und auch dann blieb ich vorerst nur vage. Ich habe Fragen gestellt: Was hat Ihnen bisher geholfen, mit Schwerem fertigzuwerden? Welche diesbezüglichen Stärken und Fähigkeiten haben Sie? Sind Sie jemand, der Probleme eher mit sich selber ausmacht, oder reden Sie darüber? Mit wem? Oder wen würden Sie für Gespräche beiziehen wollen, auch wenn es unrealistisch erscheint? Wie gut können Sie mit Veränderungen umgehen? Was spricht für Sie dafür, was dagegen, einige vertraute Menschen, Verwandte, Freundinnen, Kollegen über die Erkrankung Ihrer Frau zu informieren? Auf solche und ähnliche Fragen gab der ehemalige Schreinermeister in der Regel Antworten, die ein Bild von ihm ergaben, dem er wohl gerne entsprochen hätte: Er werde mit allem selber fertig, brauche niemanden, spreche mit niemandem. Warum? Weil er seine Frau nicht vor anderen Leuten schlechtmachen möchte.
Unsere nächsten Gespräche drehten sich um das gesellschaftliche Stigma von Demenz. Da wird einer Person vieles zugeschrieben, das mit ihrem Person-sein nichts zu tun hat. Menschen mit Demenz werden meist reduziert auf ihre Defizite, das ist bekannt. Eine Person mit vielen Fähigkeiten, aber eben auch mit Defiziten zu sein, scheint nicht naheliegend. Das kann auch große Unsicherheit bei den nächsten Angehörigen hervorrufen, denn: Bisher haben sie meistens auch so gedacht. Mir wurde jetzt klarer, weshalb Manfred Lutz sich so vehement gegen die Diagnose «Alzheimer» gestemmt hatte. Er befürchtete, dass seine Frau abgeschrieben, ausgestoßen, missachtet werden könnte. Andere könnten denken, dass sie womöglich selbst schuld sei an der Krankheit. Aber warum, und was hätte diese Frau getan, was diese Schuld erklären würde? Weshalb sollte er schuld sein? Weil er früher zu oft weg war? Zu viel gearbeitet hatte?
Erklärungen für etwas zu geben, nach Ursachen zu suchen, das Kausalitätsbedürfnis, wie wir es nennen, ist weit verbreitet. Aber: Demenz ist ein Zustand, der schwer erträglich ist, kein Virus hat sie verursacht, kein Unfall, die Demenz kommt langsam und schleichend daher. Die Antworten, woher das demenzielle Geschehen kommt, sind unbefriedigend. Damit können Menschen in der Regel schlecht leben. Das übliche Vorgehen ist dann, die «Ursache» bei sich selber, den Nächsten oder bei den sogenannten Umständen (Narkose, Schicksalsschlag im Leben, vergangene Kränkungen) zu suchen.
Oft wird bei der Veröffentlichung von Studien der Mund sehr voll genommen, wenn Erkenntnisse oder Fortschritte zu Behandlung und Prävention publiziert werden. Wenn man die Studien genauer liest, geht es fast immer um wenig mehr als Nichts, zumindest nichts Alltagsrelevantes. Es wird sehr viel geforscht. Schließlich geht es bei der Medikamentenforschung um Milliardenbeträge und -gewinne. Doch keines der Medikamente, das auf dem Markt ist, hat wirklich den Durchbruch geschafft. Bewegung, mediterrane Kost als Prävention gegen Alzheimer? Klingt gut. Aber: Unsere Eltern, heute über 80-jährig, hatten täglich bis 2 Stunden und mehr Schulweg. Später hatten sie keine zwei bis drei Autos pro Familie für Einkäufe und Freizeit zur Verfügung, man ging am Sonntag wandern, die Einkäufe erledigte man zu Fuß oder mit dem Bus. Heute sind diese Menschen trotz ihres «bewegten Lebens» von Demenz betroffen. Und: In den ans Mittelmeer angrenzenden Ländern gibt es prozentual gleich viele Demenzbetroffene wie hier, wo unsere Eltern eher Bratwürste und Rösti genossen haben. Es scheint, dass dort Menschen mit Olivenöl dement werden, hier mit Butter und Würsten …
Nicht, dass ich gegen Bewegung und gesunde Kost wettern möchte, gar nicht. Gesichert ist, dass Bewegung und gesunde Ernährung durchblutungsbedingte Krankheiten und auch durchblutungsbedingte demenzielle Veränderungen, verzögern können. Doch es ist falsch, dies als Prävention gegen die Alzheimerkrankheit zu propagieren. Es ist nicht bewiesen und es schafft Schuldgefühle bei denjenigen, die ein Leben lang «ungesund» gegessen haben.
Vor ein paar Wochen erschienen in einigen Medien Berichte über den «wissenschaftlichen Beweis», dass Viren und Bakterien die Entstehung von Alzheimer begünstigen würden. Doch das hatten wir früher alles auch schon: Aluminium, Rheuma-Marker, mangelnde Bildung. Auch diese neue Studie wird nichts Bahnbrechendes bewegen. Wir müssen lernen, uns mit der Tatsache abzufinden, dass Demenz möglicherweise eine Art des Alterns ist. So, wie es auch andere Arten zu altern gibt. Und vor allem müssen wir lernen, mit Demenz zu leben, statt sie ständig wegmachen zu wollen!
Es gibt in meinem Berufsfeld Experten, die die Krankheiten als nicht gelungene Verarbeitung von Traumata erklären möchten. Böse, kalte Mutter? Inzest? Gewaltbereiter Ehemann? Solche Interpretationen können für die Menschen mit Demenz und für ihre Angehörigen zusätzlich beklemmend sein. Ich finde es sinnvoll, einfach zuzugeben, dass wir noch nicht viel wissen. Im Gegenzug können wir einiges dazu beitragen, wenn es um Lebensqualität und Wohlbefinden der Demenzbetroffenen und ihrer Angehörigen geht. Diese Dinge kann man erhalten oder verbessern. Das ist viel mehr als nichts.
Hier, in dieser Geschichte, rate ich den verunsicherten Angehörigen, dass sie nach außen informieren sollen, engere Freunde und Freundinnen, weitere Familienmitglieder und die nächsten Nachbarn einweihen sollen. Meine Erfahrung ist eindeutig diese: Angehörige, die offen informieren, erhalten viel Verständnis und öfters Hilfsangebote. Es werden Ressourcen freigelegt, die nicht offenbar werden, wenn niemand weiß, was eigentlich los ist. Wenn keine Aufklärung stattfindet, wird viel fantasiert oder aber es herrscht große Hilflosigkeit – beides verhindert einen echten Kontakt zu den Angehörigen, aber auch zu den Menschen mit Demenz.
Es wurde im Gespräch mit Manfred Lutz mit der Zeit möglich, die Diagnose zu benennen. Er nahm später mit dem Hausarzt Kontakt auf und erlaubte mir ebenfalls, mit dem Arzt in Kontakt zu treten. Dieser lernfähige Angehörige fühlte sich zu Beginn vom Hausarzt hintergangen, weil dieser auf das Begehren des Sohnes eingegangen war und die Ehefrau zur Abklärung angemeldet hatte. Diese subjektiv empfundene Kränkung konnte er später anders einordnen, und es war wieder möglich, ein vertrauensvolles Verhältnis mit dem Hausarzt zu pflegen. Ein Arztwechsel wäre fatal gewesen. Der Hausarzt kannte das Ehepaar gut und hat insbesondere mitbekommen, wie schwer sich Herr Lutz mit der Diagnose, ja schon mit dem Verdacht auf Demenz getan hatte. Nun konnte der Arzt ableiten, was Manfred Lutz in gewissen Situationen brauchte.
Ich schrieb nach dem ersten Gespräch mit Angehörigen jeweils einen kurzen Bericht an den jeweiligen Hausarzt, aber nur, wenn ich die Einwilligung der Angehörigen dazu hatte, immer in der Hoffnung auf eine kooperative Zusammenarbeit. Der Hausarzt der Familie Lutz war sehr kooperativ. Er nahm mehrere Male mit mir Kontakt auf, wenn es für den Ehemann wieder schwieriger wurde mit dem Annehmen einer Veränderung bei Margrit Lutz. Ich habe das sehr geschätzt. Mit der Zeit schien mir, dass wir ein «Netz» um Manfred Lutz geflochten hatten, was diesem ermöglichte, sich gewissermaßen auch fallen zu lassen, er konnte darauf vertrauen, aufgefangen zu werden.
Das ist leider nicht immer so. Die Ärzteschaft realisiert oft nicht, dass die Angehörigen spezifische Beratung und persönliche Begleitung durch Fachexpertinnen brauchen; sie empfehlen selten die entsprechenden Beratungsstellen. Das ist folgenschwer. Denn den Ärzten gelingt nicht immer die richtige Beratung der in Mitleidenschaft gezogenen Patienten und Angehörigen. Wenn die Ärztinnen und Ärzte die richtigen Worte und den richtigen Ton finden, ist es ein Glücksfall. Diese Schwierigkeiten gibt es auch bei anderen Krankheiten. Ein Medizinstudium befähigt diese Berufsgruppe nicht per se, mit den Betroffenen und ihren Angehörigen gut kommunizieren und sich empathisch einfühlen zu können. Dafür braucht es andere Voraussetzungen.
Sich nicht verstanden zu fühlen oder mit Fachausdrücken zugedeckt zu werden, sind häufige Frustrationen bei Angehörigen. Feststellungen wie «Da müssen Sie jetzt durch» oder «Jetzt müssen sie halt loslassen» oder Ähnliches sind ebenso wenig hilfreich. Das wissen die Angehörigen bereits selbst, dass sie «da durchmüssen». Sie wissen auch, dass sie «loslassen» müssen. Doch wie geht das? Jedenfalls wirken solch unbeholfene Ratschläge wie Schläge. Rat-Schläge.
Schwierig war manchmal der Kontakt zum Sohn des Ehepaars Lutz: Als Pflegefachmann und Bildungsverantwortlicher in einer Pflegeinstitution war er wenig empfänglich für Fragen oder Erklärungen von meiner Seite. Es ging lange, bis er wenigstens ansatzweise realisierte, dass es einen großen Unterschied macht, ob er die Situation einer Bewohnerin an seiner Arbeitsstelle oder die Situation der eigenen Mutter einschätzte und daraus Strategien ableitete. Er hatte außerdem die in manchen Pflegeheimen verbreitete funktionale Haltung zu Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz verinnerlicht: Hygienestandards, Sicherheitsstandards, ausgewogene Mahlzeiten usw. waren für ihn sehr wichtig. Sind sie auch! Doch noch wichtiger ist das Wohlbefinden und sind die psychischen und sozialen Bedürfnisse der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen. Es ist unerlässlich, diese Personen als Individuum anzunehmen und ihnen keine allgemein gültigen Konzepte überzustülpen.
Der Sohn meldete sich immer mal wieder telefonisch bei mir, immer dann, wenn er wieder von irgendeiner «Therapie» gehört hatte. Von sogenannten Therapien gibt es viele! So wollte er beispielsweise, dass sein Vater mit der Mutter ein Geh-Training nach einem bestimmten Schema absolviere.
«Nein, bitte nicht», antwortete ich. «Aber regelmäßig spazieren, das wäre fein! Und wenn es dem Vater selber nicht möglich ist oder er die Spaziergänge selber nicht genießt, könnte er sich auf die Suche nach jemandem machen, der oder die das übernehmen könnte.»
Das Ehepaar Lutz hatte einen großen Freundeskreis, vielleicht würde das gerne jemand übernehmen.
Dann sprach der beflissene Sohn auch immer wieder von Medikamenten: Vitamin sowieso und Vitamin dies und jenes und und und. Zum Glück war der Hausarzt ein verantwortungsvoller Berufsmann und hatte das alles im Griff.
Es gelang mir leider nicht, mit dem Sohn ein Verhältnis herzustellen, wie ich es mir vorgestellt und auch gewünscht hatte. Mein Ziel war: Die ganze Familie sollte als System eine tragende Haltung zur Demenzbetroffenen und ihrem Ehemann einnehmen, indem sie die gleiche oder zumindest eine ähnliche Haltung darüber bildeten, was für ihre Mutter und ihren Vater sinnvoll und wünschenswert wäre. Der Sohn jedoch blieb immer etwas außen vor. Es gibt meistens Gründe, weshalb man sich nicht ganz einlässt. Diese Gründe gehen mich aber nichts an; es wäre falsch, hier zu bohren, zu fantasieren oder welche festzusetzen, gar die Gründe, ohne sie zu kennen, zu bewerten. Es war mir wichtig, auch dem Sohn wertschätzend und einfühlsam zu begegnen. Er hat das getan und mitgetragen, was ihm möglich war. Es bleibt also, mit dem zu arbeiten, was ist, nicht mit dem, was fehlt und ideal wäre. Ich lernte zu benennen, mit welchen Strategien und Interaktionen der Sohn das Wohlbefinden seiner Mutter und seines Vaters fördern konnte.
Nach drei Jahren neue Schritte
Nach drei Jahren, während deren ich vor allem den Vater, gelegentlich auch die Töchter und telefonisch den Sohn begleitet hatte, drängten sich neue Schritte auf. Herr Lutz wirkte nämlich immer erschöpfter, gereizt auch und manchmal depressiv verstimmt. Er berichtete, nach langem Nachfragen erst, dass er nichts mehr ohne sein Gritli machen könne. Sie klebe an ihm, wohin auch immer er gehe, klebe an ihm in der Werkstatt, lasse ihn kaum allein zur Toilette gehen, abends könne er schon lange nicht mehr ausgehen; mal ein Bier mit Kollegen oder ein Fest im Dorf: vorbei. Mitnehmen könne er sie auch nicht, sie werde sofort unruhig, wolle nach Hause. Man verstehe kaum mehr, was sie rede, verstehen tue sie vermutlich schon länger nichts mehr.
Davor war an unseren letzten Gesprächen immer ‹Alles in Butter› gewesen. Es hat vermutlich eine Anhäufung verschiedener schwieriger Situationen gebraucht, bis Herr Lutz sich selbst eingestehen und mir erzählen konnte, was ihn umtrieb: Erschöpfung und Frustration. Noch immer wehrte er sich dagegen, irgendwelche Hilfe anzunehmen, außer von den Töchtern. Diese kamen abwechslungsweise einen Abend pro Woche, um bei ihrer Mutter zu sein, damit er sich die Füße vertreten oder sich mit Kollegen treffen konnte. Professionelle Hilfe durch häusliche Pflege (z.B. durch die Spitex) oder Entlastungsdienst kam für ihn nicht in Frage. Wobei: Spitex wäre möglich gewesen für morgendliche Körperpflege. Morgens heißt aber für die Spitex: irgendwann zwischen sieben Uhr und zehn Uhr. Frau Lutz stand aber wie früher jeweils um sechs Uhr in der Früh auf. Sie zog sich, schlecht und recht, selbstständig an; sich später wieder auszuziehen, um sich mit einer Spitex-Pflegerin ins Bad zu begeben, wäre nicht gegangen, das musste gar nicht erst versucht werden. Gritli hätte das nicht verstanden und es hätte für zusätzliche Verwirrung gesorgt. Und ihr Mann hätte das auch nicht verstanden. Entweder hätte die Spitex dann kommen müssen, wenn sein Gritli aufstand, oder gar nicht. Herr Lutz stand also auch um sechs Uhr auf, duschte seine Frau und überließ sie dann ihren Kleidern, während er das Frühstück machte. Gritli kochte schon länger nicht mehr. Sie habe sich anfangs heftig gewehrt, auch aggressiv, als er begonnen habe, sich in der Küche «breitzumachen». Mittlerweile sagten ihr aber die Gegenstände im Haushalt nichts mehr. Sie räume zwar dauernd irgendwas irgendwohin und wieder zurück, doch es ergebe keinen Sinn und schon gar keine Ordnung. Entlastungsdienst? Da gab es nichts, schon gar nicht so weit abgelegen auf dem Land.
«Wie steht es mit dem Schlaf bei Ihrer Frau?», fragte ich einmal.
Schlafen würde sie, lange, jeweils sogar neun bis zehn Stunden. Das sei früher anders gewesen. Sie gehe jetzt um acht oder neun abends ins Bett. Für ihn seien das willkommene Ruhestunden am Abend, er könne noch Nachrichten oder einen Film schauen oder ungestört telefonieren. Aber er habe stets ein schlechtes Gewissen dabei. Irgendetwas wollte mir an seinem Gesichtsausdruck nicht gefallen, als er über die Abende und Nächte erzählte. Doch weil mein Gefühl nur ein Gefühl war und ich nicht wusste, wie ich nachfragen könnte, machte ich mir lediglich eine Notiz, um es nicht zu vergessen, um vielleicht ein anderes Mal darauf zurückzukommen.
Ich fragte den geprüften Angehörigen nach Wünschen und Bedürfnissen, denen er nachkommen könnte, wenn sein Gritli nicht zu Hause wäre. Er begann sofort herumzubrüllen:
«Ich gebe sie nicht weg, das kommt überhaupt nicht infrage! Was glauben Sie eigentlich?! Sie kennen mich doch nun ein wenig?! Wie kommen Sie auf eine so hirnrissige Idee?!»
«Ja, ich kenne Sie nun ein wenig. Es ist sogar mehr als ein wenig. Und ich sehe, wie müde Sie sind, ich möchte fast sagen, wie ausgelaugt Sie auf mich wirken. Wenn Sie zusammenklappen, dann nützen Sie Ihrer Frau gar nichts mehr. Dann werden wir zwei Spitaleintritte haben. Das möchten Sie doch verhindern?»
«Ja! Das heißt nein! Ich gebe sie nicht weg!»
«Sie müssen Ihre Frau jetzt nicht weggeben. Und vor allem müssen Sie jetzt keine Entscheidung treffen.»
«Drücken Sie jetzt auf die Tränendrüse? Ich gebe sie nicht weg!»
«Ich drücke nicht auf die Tränendrüse, nein. Ich erachte es lediglich als meine Aufgabe, Sie auf Kommendes vorzubereiten. Und ich werde mir erlauben, Sie immer wieder darauf anzusprechen. Ich glaube nicht, dass es im Moment viel Sinn macht.»
«Und wie soll das gehen mit dem Weg? Der ist viel zu lang, von zuhause bis hierher!»
Ich musste für mich im Verborgenen schmunzeln. Denn schon sprach er ja von der Tagesstätte im ATRIUM. Die Tagesstätte im ATRIUM war damals weit und breit das einzige Tagesheim, das auf Menschen mit Demenz spezialisiert war. Der Weg vom Wohnort der Familie Lutz zu uns hätte eine Dreiviertelstunde Autofahrt bedeutet, ohne Stau. Trotzdem stimmte der «schwierige Angehörige» aber nach ein paar weiteren Gesprächen dieser Entlastungsmöglichkeit zu. Margrit Lutz kam also zu uns in die Tagesstätte, vorerst zwei Tage in der Woche. Ihr Mann konnte während dieser Zeit in der Werkstatt arbeiten oder bummeln, oder einfach auch gar nichts tun. So konnte er sich langsam daran gewöhnen, dass es irgendwann ganz so sein würde, ohne Gritli, nur er, sein Haus, sein Garten, sein Dorf. Doch darüber sprach ich mit ihm nicht, ich dachte, das sei (noch) zu schmerzlich.
Margrit Lutz gewöhnte sich schnell ein bei uns, soweit wir das überhaupt beurteilen konnten. Sie hatte ihre Sprache bereits weitgehend verloren. Wollte man sie irgendwo hinführen oder sie zu einer Aktivität einladen, waren nonverbale Signale nötig, insbesondere ein Hinführen und an der Hand nehmen.
Margrit Lutz trat viel zu spät in unsere Tagesstruktur ein. In der Regel ist es besser, früher zu kommen, dann, wenn noch Wünsche geäußert werden können, wenn die Dementen noch sagen können, was sie möchten oder wovon sie lieber absehen wollen. In der Dynamik mit diesem hilfe-ablehnenden Ehemann wäre es jedoch niemals möglich gewesen, ihn zu einem früheren Eintritt zu bewegen. Manfred Lutz hatte auch mit dieser späten Lösung seine liebe Mühe. Er hat jeweils sofort angerufen, kaum war er wieder zu Hause. Und wir mussten ihm versprechen, ihn nachmittags kurz zu kontaktieren, um ihm zu erzählen, wie es seiner Frau gehe. Das haben wir wochenlang so gehandhabt, bis er das Vertrauen hatte, dass es seiner Frau bei uns gut ging.
Mit der Zeit war ersichtlich, dass Margrit Lutz Unterschiede machte zwischen den Betreuenden; es konnte davon ausgegangen werden, dass sie nach und nach erkannte, dass sie schon einmal bei uns gewesen war, dass ihr manches bekannt vorkam. Insbesondere die männlichen Betreuenden hatten es ihr angetan, da konnte sie lächeln, schäkern, sich offensichtlich freuen. Sie war bei jedem Spaziergang dabei, hatte ein enormes Bedürfnis, sich zu bewegen. Im Haus war sie meistens auf den Beinen, hat Sachen von da nach dort getragen, Papiere ‹geordnet›, Schubladen ein- und wieder ausgeräumt. Sie war sehr umtriebig. Teilweise geriet sie in Stress, wenn sie lange mit etwas beschäftigt war; vermutlich erkannte sie, dass sie zu keinem Ergebnis kam, dass keine Ordnung hergestellt werden konnte. Dann galt es, sie umsichtig und liebevoll aus der Situation zu führen und etwas anderes mit ihr zu machen. Meistens entspannte sie sich bei einem Spaziergang. Die Betreuenden haben sich verständnisvoll um sie gekümmert, das war großartig! Es galt auch, die verwirrte Gritli immer wieder vor anderen Tagesgästen zu schützen, die kein Verständnis hatten fürs ‹Nusche› (suchend herumkramen und dadurch etwas erst recht in Unordnung bringen) und auch nicht dafür, dass sie auf Fragen an Margrit Lutz keine Antwort erhielten.
War der Ehemann nun entlastet? Er hatte pro Weg eine Dreiviertelstunde, wenn es auf der Straße gut und zügig lief. Das machte insgesamt drei Stunden täglich, morgens hin und zurück, abends hin und zurück. Das war keine erhebliche Entlastung! Eine Lösung mit Taxi wäre mit dieser sehr veränderten Frau teuer gewesen, die Verantwortung für den Fahrer wäre aufgrund der Unberechenbarkeit von Margrit Lutz zu groß gewesen. Wenn sie hätte aussteigen wollen, dann wäre es sehr schwierig gewesen, sie zum Bleiben zu motivieren; nur ein Fahrer, den sie nicht kennt, und Frau Lutz, das wäre nicht gegangen.
Im Dorf hatte sich herumgesprochen, dass Margrit Lutz nach Basel in eine Tagesstätte ging. Der Sohn eines Freundes von Herrn Lutz arbeitete in Basel, er hatte große Freiheiten, konnte sich die Arbeitszeit frei einrichten. So bot er dem belasteten Ehemann an, seine Frau abends jeweils abzuholen und nach Hause zu bringen. Zuerst lehnte das Manfred Lutz ab. Später hat er schließlich zugestimmt. Die ersten Male fuhr er mit dem Zug nach Basel und dann mit dem Bekannten und seiner Frau mit dem Auto zurück. Er wollte sich vergewissern, ob sie auch bleibe, im unbekannten Auto mit einem Fahrer, von dem der besorgte Angehörige nicht wusste, ob seine Frau ihn noch kennen würde. Mit der Zeit konnte er die beiden getrost fahren lassen – und hat die zusätzliche Ruhezeit genossen!
Die Nächte
Bei einem unserer Gespräche fragte ich Manfred Lutz, was es denn auf sich habe mit den Nächten. Mir sei nämlich aufgefallen, dass sein Gesichtsausdruck sich verändert habe, als er davon sprach, dass seine Frau so früh ins Bett gehe und dann lange schlafe.
«Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Sie erzählen, was Sie erzählen mögen.»
Manfred Lutz druckste herum. Ich hatte den Eindruck, dass er gleichzeitig reden und schweigen wollte. Ich ließ ihm Zeit. Wie so oft seit einiger Zeit begann er leise zu weinen. Er trauerte offensichtlich, aber vielleicht hatte er keinen Ort, das zu zeigen, außer hier, auf der Beratungsstelle? Er war ein angesehener Mann im Dorf, er war ein respektierter Vater, man kannte ihn gefasst, manchmal etwas laut, wenn er seine Anliegen vertrat, und sehr laut, wenn er sich gegen irgendetwas wehrte, was ihm ungerecht erschien. Jetzt erzählte er, dass seine Frau eben die beste Frau sei, die er habe bekommen können. Auch im Bett, also in der Sexualität, also in der Liebe. Er verhedderte sich total, war offenbar nicht gewohnt, über solch intime Belange zu reden.
«Also: Wir haben regelmäßig miteinander geschlafen!»
Ich lasse ihm Zeit, weiterzureden.
«Aber jetzt, ich gehe später als sie ins Bett, und immer später! Ich habe schon richtig Angst. Sie schmiegt sich an mich und macht mir sexuelle Avancen. So wie es auch früher war. Aber ich kann nicht! Verstehen Sie das?! Ich kann nicht! Gritli ist nicht mehr meine Ehefrau! Sie ist wie ein kleines, schutzbedürftiges Kind. Ich liebe sie immer noch. Aber anders. Und wenn ich jetzt etwas Sexuelles mit ihr machen würde, dann käme ich mir vor wie ein Vergewaltiger, ein Kinderschänder! Das geht nicht! Und darum schlafe ich kaum mehr, weil ich immer später ins Bett gehe, in der Hoffnung, dass sie dann im Tiefschlaf ist!»
Seine Not brach aus dem verantwortungsvollen Mann. Er erzählte, dass sein Gritli weine, wenn er sie abweise, obwohl er das so einfühlsam wie möglich mache. Er schiebe Kopfschmerzen vor. Oder Hüftschmerzen. Oder stehe wieder auf und sage, er habe Probleme mit der Firma.
«Manchmal ist sie dann ganz klar. Einmal antwortete sie, obwohl sie sonst kaum mehr spricht: ‹Du hast gar keine Firma mehr!›»
«Das ist schrecklich, so ein lichter Moment, nicht wahr? Brechen hier wieder alte Hoffnungen auf, es möge doch kein Alzheimer sein?»
«Ja, das ist furchtbar. Das ist schlimm, und auch, dass ich mich schuldig fühle, sie anzulügen.»
«Aber es blieb Ihnen nichts anderes übrig, Herr Lutz! Sie müssen sich schützen, weil solche Situationen Rollen-Konfusionen schaffen, die kaum aufzulösen sind. Ich empfinde Sie als einen sehr verantwortungsvollen Ehemann! Und Ihre Liebe zu Ihrer Frau ist immer spürbar. Auch jetzt, wo Sie von dieser kleinen Notlüge erzählt haben. Haben Sie eine Idee, wie Ihre Frau sich Ihnen vielleicht weniger nähern könnte?»
«Nein, es kommt mir nichts in den Sinn.»
«Darf ich Sie etwas Intimes fragen?»
«Ja.»
«Haben Sie früher bei Licht oder im Dunkeln Liebe gemacht?»
«Immer im Dunkeln, meine Frau ist diesbezüglich etwas schamhaft, obwohl sie gerne mit mir zusammen war, auch körperlich. Aber sie wollte nicht, dass ich sie ansehen kann.»
«Denken Sie, ein Nachtlicht könnte Ihre Frau zurückhalten? Weil es etwas Licht gibt. Irgendetwas, was ein warmes, nicht grelles Licht gibt? Vielleicht schieben Sie ein weiches Kissen zwischen sich, ein großes, woran sie sich festhalten, sich einkuscheln kann und vielleicht wieder einschläft?»
Das war dann die Lösung. So einfach! Ich schätzte es, dass Manfred Lutz sich mir anvertraut hatte. Sexualität im Alter ist ein großes, aber tabuisiertes Thema, erst recht in der Demenz. Die Integrität von Manfred Lutz wäre schwer beschädigt worden, hätte er seiner Frau nachgegeben. Und ich fand, dass er sich in seiner neuen Rolle als Betreuer/Vater/Vertrauter seiner verwirrten Frau großartig eingefunden hatte! Das sagte ich ihm auch. Am Anfang hatte er immer zu konservieren versucht, was die letzten 40 Jahre Gültigkeit gehabt hatte. Was für ein großer Schritt in seiner Verarbeitung!
Weitere Verschlechterung
Margrit Lutz war schon über drei Jahre bei uns in der Tagesstätte. Zu Beginn waren es zwei Tage pro Woche, später drei, dann vier. Meistens holte der junge Mann sie am Abend ab. Manfred Lutz schien sich mit der Situation abgefunden zu haben, er wurde gelassener. Er beanspruchte immer weniger Gespräche. Aber noch immer verursachte jede Verschlechterung des Zustands seiner Frau große Irritation, Abwehr und Trauer. Es war eine enorme Anpassungsleistung, die er vollbrachte! Ich habe ihn fast nie mehr herumpoltern hören, denn er hatte auch gelernt, sich anders mit seiner Wut und Trauer auseinanderzusetzen.





























