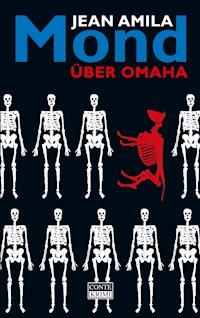Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
»Die Leiche ging augenblicklich unter. In der Nacht war es unmöglich, sie auf das Höllentor zutreiben zu sehen. Mitten auf dem Strom verharrten die beiden Frauen reglos. Es gab keinen Grund zu weinen. Sie hatten sich an den Händen gefasst, sie fühlten sich verbunden. Er hatte sie ›Ratten‹ genannt. Genau dasselbe war den beiden kleinen Bibern zwölf Jahre zuvor passiert. Die arbeitsamen kleinen Kerlchen wurden nur toleriert, weil man sie sowieso schon dazu verurteilt hatte, von Miraud zerfleischt oder mit einer Schrotflinte abgeknallt zu werden.« Die Lenfants sind eine normale Familie. Papa Lenfant montiert Autos bei Simca, Mama Lenfant versorgt den Haushalt, und Solange, ihre Tochter, geht noch zur Schule. Doch gemeinsam widmet sich die Familie einem nicht ganz alltäglichen Hobby: dem handwerklich korrekt durchgeführten Einbruchdiebstahl. Als Papa Lenfant dabei in tödliche Gefahr gerät, kommt die Hilfe aus der Tiefe der Nacht – ein politischer Auftragskiller. Der nistet sich bei den Lenfants ein, verführt die beiden Frauen und bringt Vater Lenfant in Schwierigkeiten. Ihre Welt gerät ins Wanken, denn der unerwartete Helfer und seine Kompagnons verachten das kleine Diebsgesindel. Die Frage der Moral stellt sich immer wieder aufs Neue – wer ist mehr wert, die »Ratten« oder die »Hunde«?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
Diese Nacht zum vierten August, in der der Mondaufgang erst für drei Uhr vierzehn vorhergesagt war, hatte er keineswegs mit Absicht gewählt.
Vorerst leuchteten nur die Sterne, und alles war wie mit einem matten Glanz überzogen.
Lenfant saß rittlings auf der offenen Dachluke. Lautlos wie eine Katze, mit geschmeidigen Muskeln und hellwachem Blick inspizierte er zunächst die Umgebung: Er befand sich in einer Welt aus Schornsteinen und Fernsehantennen, die sich gegen den Sternenhimmel abzeichneten. Gegen Norden hin, dort, wo der Große Wagen am Himmel stand, schimmerte die rötliche Dunstglocke über Paris: Sie nahm gut ein Viertel des Horizonts ein.
Nun nahm Lenfant das Seil und zog ruhig daran, Hand für Hand. Nicht das leiseste Geräusch war zu vernehmen. Das unförmige, schemenhafte Bündel kam langsam aus der Dachluke hervor. Es sah aus wie eine Reisetasche oder ein Packen aus zusammengerollten Decken.
Dann richtete er sich geschmeidig auf. Schon stand er auf den Dachziegeln, lud sich das Bündel auf den Rücken und kletterte langsam schräg hinab bis zum Dachrand.
Zu gleichlangen Schlaufen um seine Armbeuge gewickelt, schlackerte das Seil kaum hörbar gegen seinen Oberschenkel. Er trug seine Arbeitsjacke aus grauem Leinen mit Raglanärmeln, die von einem Feuerwehrgurt eng an seine Taille gepresst wurde; außerdem eine Reithose aus Cord mit Schnürbändern. An den Füßen trug er bloß grobe, schwarze Wollsocken.
Am Giebelrand stützte er sich am Schornstein ab und beugte sich leicht nach vorne. Ohne in die Tiefe zu sehen, schnalzte er mit der Zunge. Ein runder, voller Laut kam fast augenblicklich wie ein Echo zurück, doch in einer helleren Tonlage, ähnlich dem Quaken eines Frosches.
Lenfant ließ das Bündel, wiederum Hand für Hand, langsam hinab. Er blieb immer Herr der Lage und ließ das Seil auch nicht ein einziges Mal durchrutschen. Als er es gerade wieder mit einer Hand fassen wollte, schien es ihm plötzlich, als ob das Gewicht leichter geworden wäre, wie von unten angehoben, angenommen. Er ließ noch ein Stück Seil hinunter. Es hing einen Augenblick lang lose hinab, dann wurde zweimal sachte an ihm gezogen: Das war das Zeichen, das sie verabredet hatten. Lenfant zog das Seil, jetzt ohne Bündel, wieder herauf und wickelte es sorgfältig um seinen Ellenbogen. Kaum das Knistern des Leinenstoffes war zu hören.
Er musste lächeln. Wie sagte die Kleine, die jetzt aufs Gymnasium ging, doch immer: Man müsse die null Dezibel anpeilen. Der Dachziegel, der vorhin in die Regenrinne gerutscht war, hatte gewiss einige Dezibel Lärm verursacht; so hatte er einige Minuten lang reglos ausharren müssen. Aber davon abgesehen war alles ohne Probleme, in völliger Stille vor sich gegangen. Nach seiner ersten Einschätzung vor Ort, auf die er sich nach zwanzig Berufsjahren ziemlich gut verlassen konnte, hatte es sich gelohnt.
Nun musste er wieder hinunter.
Am einfachsten schien es, sich auf das Garagendach abzuseilen. Doch seit dem Unfall in Arpajon misstraute Lenfant der Festigkeit von Schornsteinen. Er beschloss daher, noch einmal über die ganze Länge des Daches zu klettern, zurück zur Dachrinne und zum Dachgesims, wo es einen sicheren Halt gab.
Vorsichtig umkletterte er die Stelle, wo der zerbrochene Ziegel lag. Er legte das Seil in Form einer Acht zusammen und verstaute es unter seiner Jacke. Dann kniete er sich in die Dachrinne, streckte einen Arm und ein Bein vor, erfühlte mit den Zehen den Mauerhaken aus Zink und begann vor- und zurückzuwippen, um den Abstieg einzuleiten.
Wäre da nur der Schuss gewesen, hätte er instinktiv schneller gemacht. Aber zuerst, um eine Sekunde früher, erfasste ihn das Licht.
Grell war es auf ihn gerichtet und blendete ihn, obwohl er nicht einmal direkt hineinsah. Da fiel ein Schuss; wenige Zentimeter von seiner Hüfte flog der Putz weg.
Intuitiv begriff er, dass das Licht und der Schuss vom Haus gegenüber kamen, das so friedlich dastand. Die gesamte Fassade unter ihm wurde angestrahlt – es war die reinste Licht- und Tonschau! Wenn er seinen Abstieg unbedingt fortsetzen wollte, hatte der Schütze genug Zeit, ein ganzes Magazin auf ihn abzufeuern.
Noch bevor der zweite Schuss fiel, schwang er sich wieder mit dem ganzen Körper aufs Dach und drückte sich flach gegen die Ziegel. Das reichte nicht aus, das flach einfallende Licht erfasste ihn immer noch und noch immer wurde auf ihn geschossen.
Aber wenigstens erlaubte ihm das Licht, sich mit einem Sprung hinter den Schornstein zu retten.
Nun wandte er sich direkt der Lichtquelle zu. Es war kein Scheinwerfer, sondern das Licht kam aus einer Wohnung mit zwei weit offen stehenden Fenstern. Dort war niemand zu sehen. Der Rest des Hauses war in undurchdringliches Dunkel gehüllt.
Am aufblitzenden Mündungsfeuer konnte Lenfant erkennen, dass der Schütze von einer Dachluke oberhalb der Wohnung aus schoss und sich nahezu auf seiner Höhe befand. Die Kugel schlug mit dem sonderbaren, tiefen Ton einer Terrakottaglocke in einen Schornsteinkopf ein.
Da hörte er jemanden rufen. Es war eine Frauenstimme, die nicht vom Speicher her kam, sondern vom Erdgeschoss. Sie schrie aus vollem Hals einen Namen, der dumpf und verzerrt klang.
»Da, ein Einbrecher! … Haltet den Dieb!«
Wieder fiel ein Schuss. Diesmal prallte die Kugel von den Ziegeln ab, Splitter flogen auf und überschlugen sich in waghalsigen Sprüngen, bis sie am Ende der Dachschräge in die Tiefe fielen.
Hinter dem Schornstein aus Backstein fand Lenfant Deckung. Er musste blitzschnell handeln und wusste bereits, was er zu tun hatte. So ließ ihn auch nicht das rasende Hämmern in seinen Ohren, nicht das Gefühl, überrumpelt worden zu sein, nicht die Angst dort innehalten, sondern ein abgrundtiefer Ekel, der in ihm aufstieg.
Da, ihm gegenüber, hatte ihn ein menschliches Wesen, ein selbsternannter Tugendwächter, geduldig vom Grunde seines Loches aus unerbittlich und heimtückisch beobachtet. Ganz heimlich, still und leise hatte er seinen Anschlag ausgeheckt, um ihn kaltblütig mit einer Kugel in den Rücken zehn Meter über dem Erdboden abzuknallen!
Am liebsten hätte er ihm zugerufen: »Ich trage keine Waffe, ich trage nie eine Waffe!« Doch was hätte das schon genützt?
Die Pistole bellte immer noch. Das war keine Spielzeugwaffe, sondern ein richtiges Profikaliber. Lenfant dachte bei sich: einer von der Polizei! Es konnte ja auch nur einer von der Polizei sein oder ein Gefängniswärter, der mit dem Segen der Gesellschaft auf solch eine abscheuliche Weise einen anderen Menschen einfach niederschoss.
Er musste sich beeilen. Bis zum First bot ihm der Schornstein einen toten Winkel. Also kroch er, die Lage unwillkürlich falsch einschätzend, ruhig in seinem Schatten hinauf. Er hörte, wie eine weitere Kugel auf die Ziegel klatschte. Genau als er oben ankam, traf es ihn wie ein Peitschenhieb am Schädel.
Bevor ihm schwarz vor Augen wurde, brachte er gerade noch die Kraft auf, über den Dachfirst zu steigen, um sich auf der anderen Seite in Sicherheit zu bringen. Da lag er nun auf den Ziegeln, mit dem Gesicht nach oben, Arme und Beine von sich gestreckt – Das wars wohl, ja, das wars dann wohl!
Nicht der Schmerz, sondern das Rauschen in seinem Schädel war unerträglich.
Er blieb bei Bewusstsein, aber, wie ein Boxer kurz vor dem K.o., lag er zunächst nur so da, während es in seinem Kopf wie in einem Dampfkessel dröhnte.
Ihm war, als wäre sein Schädel geplatzt. Ein wenig über dem Ohr fuhr ihm der Schmerz hinein. Er befühlte die Stelle, seine Finger wurden nass: Das Blut quoll nur so aus der Wunde in seinen Hemdkragen. Als er versuchte sich aufzusetzen, überkam ihn Schwindel.
Doch er konnte noch klar denken. Wie ein verwundetes Tier im feindlichen Revier sorgte er sich weniger um seine Wunde als um seine Flucht. Er knöpfte seine Jacke auf, nahm das Seil wieder heraus, erhob sich und kletterte zusammengekrümmt weiter.
Auf dieser Seite des Daches gab es keinen Schornstein, dafür aber die Fernsehantenne.
Unter großer Anstrengung band er das Seil daran fest, sicherte sich noch unter den Achseln und seilte sich, die Beine gegen die Wand gestemmt, rücklings ab. Die jähe Anstrengung war so groß, dass ihm die Ohren sausten. Bevor er ohnmächtig wurde, tauchte nochmals die Antenne vor seinen Augen auf. Sie sah aus wie ein großer Lichtrechen, der sich inmitten der Sternbilder hin- und herzuwiegen schien.
II
Die Wäschestücke schwammen in den beiden Spülbecken aus rostfreiem Stahl. Yvonne tauchte ihre Hände ins Wasser. Es war noch hellrot vom Blut, und der Wasserstrahl wirbelte geronnene Blutpartikel an die Oberfläche.
Als Doktor Lenfant eintrat, drehte sie den Wasserhahn zu, trocknete ihre Hände am Geschirrtuch ab und fragte, ohne sich umzudrehen:
»Hat er mit Ihnen gesprochen?«
Er wirkte ein wenig größer als sein Bruder. Auch das Alter war ihm deutlicher anzusehen: das Haar wuchs ihm spärlicher, die Falten um die Mundwinkel waren ausgeprägter. Ach ja, er war ja auch drei Jahre älter als sein Bruder, also so um die zweiundvierzig… Oder war das etwa seine Schuhgröße?
»Sie machen mir doch einen Kaffee, ja, Yvonne?«
Der Ton war höflich, zu höflich; sie würde sich auf lange Erklärungen gefasst machen müssen. Doch da musste sie eben durch. Warum hatte sie denn an die Schuhgröße denken müssen, wenn nicht deswegen, weil ihr Schwager, Doktor André Lenfant, unweigerlich wieder davon anfangen würde, dass sie endlich in ein neues Leben treten sollten?
Sie wies mit dem Kinn auf den Gaskocher. Aus der Kaffeemaschine dampfte es bereits heraus; Kaffeeduft verbreitete sich langsam in der Küche.
Yvonne drehte die Maschine um, stellte sie auf den Tisch, nahm zwei lavendelblaue Kaffeeschalen aus dem Schrank und tat je zwei Stück Zucker hinein. Kling, klong, kling, klong machte es, die eine der beiden Tassen klang tiefer als die andere.
»Er hat mit mir gesprochen…«, sagte André. »Gewissermaßen. Sie kennen ihn ja. Ich werd mitten in der Nacht gerufen, und… Nun gut, lassen wir das! Ich wundre mich über gar nichts mehr! Bitte Yvonne, wie lautet Ihre Version?«
Er zitterte. Er war weiß vor Müdigkeit, oder vor Wut. Sein Gesicht wurde von einem verächtlichen Grinsen verzerrt.
»Denn seine Version ist die mit dem Garagentor, das ihm angeblich einen Fetzen Haut abgerissen hat, als es plötzlich um drei Uhr morgens einfach so zugeknallt ist. Es wär schön, wenn ihr mich wenigstens nicht für einen Vollidioten halten würdet. Eine Tür welchen Kalibers, bitte?«
»Dass es eine Kugel war, das hab ich Ihnen gesagt«, sagte Yvonne ruhig. »Regen Sie sich nicht auf, André, davon wird es auch nicht besser. Als ich ihn in diesem Zustand hab heimkommen sehen, hab ich es mit der Angst zu tun bekommen. An wen hätt ich mich denn Ihrer Meinung nach wenden sollen?«
»An mich, natürlich!«, sagte Doktor Lenfant, der klein von Statur war, wütend. »An mich, denn mir ginge es so richtig an den Kragen, wenn diese Sache da bekannt würde!«
»Das hab ich nie gesagt!«
»Aber das schwingt ständig mit! Seit… Seit zwanzig Jahren! Ich geb mich den schönsten Illusionen hin. Seit Jahren bild ich mir ein, dass damit Schluss ist, und zack, auf einmal geht wieder alles von vorne los! Ein Fassadenkletterer! Sehr spaßig! Sehr amüsant! – Sie haben überhaupt keinen Sinn für Moral, Yvonne, tut mir Leid, dass ich Ihnen das so sagen muss! Sie sind es, Sie, verstehen Sie mich? Sie tragen die Verantwortung! Sie dürften das nicht dulden!«
Er trug ein johannisbeerfarbenes Polohemd, die Ärmel hatte er hochgekrempelt. Seine stark behaarten Unterarme waren noch feucht, er hatte sich gerade die Hände im Badezimmer im ersten Stock gewaschen.
»Wie lange ist das jetzt schon her?«, fragte sich Yvonne. »Drei Jahre? Oder ist es gar schon fünf Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben?«
Sie klopfte leicht mit den Fingerspitzen gegen die Kaffeemaschine, damit der Kaffee besser durchlief. Sie vermieden es, sich anzusehen. Unterdessen sprach er weiter. Na ja, es musste nun einmal gesagt werden. Doch auch er fühlte sich in seiner Rolle als großer Bruder und Moralinstanz nicht sonderlich wohl.
»Mein Gott! Ich gehör wahrlich nicht gerade zu den verklemmten Leuten, aber…«
Sie ließ ihn reden, nahm alles, was er sagte, widerspruchslos auf, wie ein Schwamm, ohne Ironie und Unterwürfigkeit.
»Und die Kleine? Wie alt ist sie jetzt? Fünfzehn?«
»Bald siebzehn.«
»Siebzehn! Aber Yvonne, sind Sie sich denn darüber im Klaren, was das bedeutet, wenn sie eines Tages erfährt, dass ihr Vater ein Dieb ist! Nein, nein und nochmals nein!«
Wie sollte man ihrem Onkel bloß sagen, dass Solange nicht nur auf dem Laufenden war, sondern inzwischen auch selbst an den Expeditionen teilnahm, dass sie begabt und mit Begeisterung bei der Sache war, ja dass sie dabei glücklich war? »Wir sind eben anders als die anderen.«
»Wir sind glücklich so, André.«
»Glücklich?«
Zum ersten Mal schaute er sie direkt an. Ihr Gesicht wirkte abgespannt, die Haare fielen ihr auf die Schultern, außer einer Strähne, die immer noch um den Lockenwickler gewickelt war. Auf ihrem abgenutzten Morgenmantel waren auf Höhe des Oberschenkels Blutflecken zu sehen; sie hatte nämlich dabei helfen müssen, den Verletzten ins Haus zu tragen.
Ja klar, sie ging schon auf die Vierzig zu, und dennoch: Die kleine Frau hatte sich ihren Kinderblick bewahrt. Sie war zwar etwas kurz geraten, aber ein gelenkiges und kräftiges kleines Persönchen. Sie war keineswegs unproportioniert, ganz im Gegenteil, man konnte ohne weiteres sagen, dass sie noch eine sehr attraktive Frau war.
Während sie den Kaffee eingoss, neigte sie ihre breite Stirn: Das Idealbild einer fleißigen Schülerin. – Glücklich! Da blieb nichts weiter zu sagen.
Er nahm die Tasse mit dem heißen Kaffee und fragte, wie die ganze Sache vor sich gegangen sei.
»Ich weiß nicht.«
»Sie hatten damit nichts zu tun?«
»Nein.«
»Hat Julien allein gearbeitet?«
Die Antwort kam fast ohne Zögern.
»Ja.«
»Das ist nicht wahr«, sagte er ruhig.
Sie schwieg. Er trank einen Schluck, merkte, dass sich der Zucker noch nicht aufgelöst hatte. Sie öffnete die Schublade und reichte ihm einen Löffel. Es war ein richtiges kleines Schmuckstück, das antik anmutete, versilbert und ziseliert war. Schwer lag es in der Hand. Das war bestimmt kein Artikel aus dem Supermarkt.
Doktor Lenfant schüttelte den Kopf.
»Ich nehm an, euer Hausrat ist inzwischen komplett! Oder?«
Leicht autoritär klang das, aber nicht mit der Absicht, sie zu demütigen. Es war vielmehr der professionelle Ton, mit dem sich ein Arzt Respekt bei den Familienangehörigen eines Patienten verschafft.
»Wird er bleibende Schäden davontragen?«, fragte sie.
»Keine Ahnung. Ich bin schließlich nicht der liebe Gott. Der hat, wie mir scheint, das Seinige schon getan. Wäre die Kugel auch nur wenige Millimeter versetzt eingedrungen, wäre ihr Einfallswinkel nur ein bisschen anders verlaufen, dann hätte sie ihm den Schädel durchbohrt. Sie können eine Kerze zu Ehren von Santa Ballistika anzünden.«
Es musste inzwischen schon acht oder neun Uhr sein; das Licht brannte seit dem Morgengrauen. Das Fenster stand offen, doch die Läden waren noch geschlossen. Yvonne stieß sie nun auf; das leicht milchige Licht des Tages fiel ins Zimmer.
Ein leichter Nebel lag noch über der Seine. Es war einer jener Morgen, an denen man sich sagt: Es wird heiß werden heut!
Das riesige Fabrikgebäude befand sich auf dem anderen Ufer, fünfhundert Meter flussabwärts. Vom Küchenfenster aus konnte man es nicht sehen, der dumpfe Lärm der großen Pressen war dagegen schwach zu hören.
»Er wird schätzungsweise drei Wochen brauchen, bis er wieder auf die Beine kommt. Ich kann ihm ein Attest für die Fabrik ausstellen. Die Geschichte mit dem Garagentor ist zwar nicht besonders gut, doch mir fällt auch nichts Besseres ein. Wie stehts mit Juliens Ruf auf der Arbeit?«
»Gut.«
»Wann nimmt er seinen Urlaub?«
»Die Fabrik schließt Ende der Woche.«
»Mein Gott!«, sagte André plötzlich. »Ihr habt alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Ihr habt Arbeit, ein Haus, ihr seid gesund… Wenn ihr es wenigstens nötig hättet. Aber nein!«
»Versuchen Sie erst gar nicht, das zu verstehen, André.«
»Ach, das hab ich schon vor zwanzig Jahren aufgegeben. Wo ist die Kleine?«
Yvonne zögerte, dann sagte sie, als bedauerte sie das:
»Es sind Ferien.«
»Genau deswegen frag ich. Wo ist sie?«
»…ans Meer gefahren.«
»Wohin ans Meer?«
Er wurde ungeduldig, da er ihr alle Wörter wie Würmer aus der Nase ziehen musste, und schlug wieder einen Ton resignierter Gleichgültigkeit an.
»Na ja, egal, lassen wir das! Rufen Sie mich heute Abend an, dann werden mir die Ergebnisse der Analysen vorliegen. Berühren Sie die Wundklammern die nächsten acht Tage nicht. Es tut mir wirklich außerordentlich Leid, meine arme Yvonne.«
»Sie sind ein feiner Kerl«, sagte sie.
Sie begann zu weinen. Er tat so, als sähe er sie nicht, und schaute auf die Seine hinaus, die in zehn Metern Entfernung vorbeifloss.
Er kannte die Stelle, wo immer die Angler saßen und das Boot lag, das wie das Haus Ma Jolie hieß. Auf der anderen Seite des Flusses war ein großes, bereits abgeerntetes Weizenfeld zu sehen. Vor der Flanke des Waldes von Saint-Germain stiegen an diesem überaus warmen Morgen Hitzeschlieren auf.
»Wo ist es passiert? … Sagen Sie mir bloß nicht, dass Sie das nicht wissen.«
»Am anderen Ende von Paris.«
»Das ist vage.«
»Bei Corbeil, in einer Wohnsiedlung.«
»War das Zufall?«
Sie begriff im ersten Moment nicht gleich, was er damit meinte, doch dann zuckte sie mit den Schultern.
»Nein, kein Zufall. Ich hab vorgestern eine kleine Erkundungstour gemacht.«
»Ich verstehe! Immer sind Sie die Anstifterin.«
»Das kann man so nicht sagen, André. Wir beschließen gemeinsam, ans Werk zu gehen. Aber einer muss sich ja schließlich vor Ort umsehen. Ich nehm die Ente, schau mich ein wenig um. – Doch wozu erzähl ich Ihnen das eigentlich alles.«
Doktor Lenfant hob die Arme.
»Meine Familie«, sagte er wie niedergeschlagen. »Meine Familie! Aber verdammt noch mal! Ist Ihnen denn klar, dass Sie eine Kriminelle sind?«
»So nennen die Leute das wohl«, sagte sie fast gleichgültig.
Dann begriff sie plötzlich, dass es ihrem Schwager nicht darauf ankam, sie in eine strafrechtliche Kategorie einzuordnen, sondern dass er sie beschuldigte, ihren Mann in den Tod geschickt zu haben.
»Nein! So ist das nicht!«, entgegnete sie entrüstet. »Nein, André, das dürfen Sie nicht sagen!«
Sie legte die beiden Handflächen fest aufeinander und hielt sie hoch.
»So sind wir beiden, Julien und ich! Und vielleicht eben gerade deswegen!«, sagte sie mit ernster, aufrichtiger Stimme.
»Nennen Sie das, wie Sie wollen, André. Für uns ist das Leben gerade deshalb lebenswert!«
»Lebenswert?«
»Ja!«
Ganz aufgeregt nahm sie den kleinen Silberlöffel, der noch immer auf dem Tisch lag, und ließ ihn von ziemlich weit oben auf den Tisch fallen. Er traf mit einem dumpfen Geräusch auf dem moltonbeschichteten Wachstuch auf. Eigentlich hatte sie einen reinen Ton erwartet.
»Unser Leben ist erfüllt, rein! Julien, ich, die Kleine – das klingt rein! Wir sind keine Dutzendexistenzen, verstehen Sie? Wir auf der einen Seite, die Welt auf der anderen: Das heißt rein sein!«
Was sie da sagte, klang unzusammenhängend, doch ihr Schwager verstand sie sehr gut. Er wusste, dass es nichts bringen würde, mit ihr zu diskutieren. Er stellte seine Tasse wieder auf den Tisch, ein leicht bitterer Zug umspielte seine Lippen.
»Ich dagegen bin unrein. Die Welt braucht mich, ich geh in die Welt!«
»Weil Sie Ihre eigenen, handfesten Interessen haben!«, warf sie ihm kampflustig entgegen. Doch sogleich riss sie sich wieder zusammen.
»Tut mir Leid, André. Sie sind ein feiner Kerl. Und glauben Sie mir, auch Julien ist wirklich ein guter Kerl. – Und ich bin vielleicht auch kein so schlechter Mensch, wie Sie denken.«
»Wer hat denn behauptet, dass Sie ein schlechter Mensch sind? Hören Sie mir einmal gut zu, Yvonne. Ich hab seit Jahren auf Moralpredigten verzichtet. Sie sind ja schließlich schon alt genug. Eigentlich müssten Sie wissen, was Sie tun. Doch letzte Nacht hat jemand auf Julien geschossen, hat versucht, ihn wie einen räudigen Hund zur Strecke zu bringen. Ist das deutlich genug?«
»Ich weiß.«
»Schon möglich, dass ihr Geschmack am Risiko findet, dass euch das ein angenehmes Kribbeln in der Magengrube verschafft, doch zu diesem Preis ist das der helle Wahnsinn. Julien ist mein Bruder. Er ist der Vater von Solange. Ich werd mich davor hüten, den Moralapostel zu spielen. Ich spreche jetzt als Arzt. Mit seinen vierzig Jahren sollte Julien nicht mehr den Akrobaten mimen. Umso weniger nach diesem Unfall, der sicherlich nicht folgenlos an ihm vorübergehen wird.«
Obwohl Doktor André Lenfant ein wenig größer war als sein Bruder, maß er kaum mehr als einen Meter fünfundsechzig. Die Lenfants gehörten jenem kleinen, ganz unverfälschten Menschenschlag an, dessen Vertreter schlank, agil und kräftig sind, zähe Muskeln haben und einen wachen Verstand. Der Stammbaum der Familie verlor sich im Dunkel der Zeiten; er umfasste bereits fünfzig Generationen, allesamt gesunde Menschen. Die ersten Lenfants waren Flussschiffer gewesen, in Le Lendit, in Le Valfleuri, in Bercy, in La Maube, in Bougival oder in Poissy, niemals weiter als fünfhundert Meter von der Seine entfernt. Nach und nach waren sie in die Vororte abgedrängt worden. Überall und insbesondere auch in Paris sind so die Bewohner der Vororte die einzig wahren Ureinwohner.
André konnte – gewiss aus einem Mangel an Imponiergehabe heraus – schwer feierlich sein, oder zumindest nicht lange. Mit dem Fuß zog er nun einen Hocker unter dem Tisch hervor und setzte sich. Sogleich schlug er einen vertraulicheren Ton an.
»Ich werd es ein andermal überprüfen, von Corbeil nach Poissy sind es jedenfalls leicht hundert Kilometer. In seinem jetzigen Zustand – und ich weiß, wovon ich spreche – war es für Julien unmöglich, alleine hierher zurückzukommen.«
»Er hatte die Ente.«
»Und wo ist der Wagen jetzt?«
»Ich weiß nicht… in der Garage.«
»Ist er nicht! Bevor ich über die Schleuse gekommen bin, habe ich meinen Wagen vor der geschlossenen Garage abgestellt. Sie war leer, und auch in der Umgebung war das Auto nirgends zu sehen. Yvonne, ich führe hier keine polizeiliche Untersuchung durch, ich will euch helfen. Julien hat gut einen Liter Blut verloren, und er war ziemlich lange bewusstlos. Wer hat ihn hierher zurückgebracht? Sie?«
»Nein.«
»Wer dann?«
»Keine Ahnung.«
»Ein Komplize?«
»Nein. Das ganz sicher nicht.«
»Ich verstehe!«, sagte er in einem scherzhaften Ton. »Das berühmte Gesetz des Schweigens regiert die Unterwelt.«
»Eben deswegen, weil wir keine Komplizen haben, gehören wir nicht zur Unterwelt!«
Sie sprachen in einem ganz normalen Unterhaltungston. Man konnte spüren, dass sie sich gegenseitig schätzten, allen Meinungsverschiedenheiten zum Trotz.
»Das klingt ein wenig fadenscheinig, oder? Und die Hehler, sind das vielleicht keine Komplizen?«
»Es gibt keine Hehler, es gibt bloß Käufer!«
»Wortklaubereien, so kommen wir nicht weiter. Könnten Sie mir vielleicht wenigstens sagen, ob sich dieser Unbekannte um die Reinigung des Wagens kümmert?«
»Er hat Julien in seinem eigenen Wagen heimgebracht.«
»Na ja, ich möchte nicht wissen, wie der jetzt aussieht! Nun gut, nehmen wir einmal an, dass dem so ist! Ein barmherziger Samariter hat Julien aufgelesen, hat ihn heimgebracht und ist dann wieder mit seinem blutverschmierten Wagen weggefahren, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Damit komm ich wieder auf das zurück, was ich ursprünglich wissen wollte: Steht der Wagen noch in Corbeil? Yvonne, ich wollte mich einfach nur anbieten, ihn von dort zu holen, falls dazu noch Zeit ist.«
Yvonne bekam feuchte Augen.
»Sie sind ein feiner Kerl, André. Danke, aber wir regeln das schon.«
»Wieder der große Unbekannte?«
»Nein.«
Yvonne holte tief Luft. Julien hatte oben nichts sagen wollen, das ganze Durcheinander hatte ihn in eine Art mentalen Wundstarrkrampf versetzt. Da sie sowieso schon zu viel über die ganze Sache gesagt hatte, könnte sie nun ja auch gleich ganz mit der Sprache herausrücken.
»Solange«, sagte sie. »Sie war bei ihrem Vater.«
André stieß einen leisen Pfiff aus. Er hatte so etwas schon geahnt, es aber nicht zu glauben gewagt. Er fragte kalt:
»Arbeitet sie schon lange mit?«
»Seit sie aufs Gymnasium geht«, sagte Yvonne. »Sie ist begabt, und es gefällt ihr. Wir sind eben anders als die anderen, André.«
III
Der junge Mann legte beim Fahren die Arme flach auf das Lenkrad, als wäre die Ente ein Militärlaster. Er schoss die abfallende Straße nach Poissy hinunter und bremste erst an der Kreuzung ab.
»Geradeaus«, sagte Solange, »wir müssen über die Brücke«.
»Ich erinner mich«, sagte er nur.
Er blickte auf die Seine, auf deren Wasser die Morgensonne tanzte.
Er musste sehr groß sein, denn sogar im Sitzen war er fast einen Kopf größer als Solange.
Mit ihren Rattenschwänzen, dem erstaunten Blick und dem kindlichen Mund wirkte sie wie ein verschüchtertes kleines Mädchen. Sie beobachtete den jungen Mann, der da in ihr Leben trat, vorsichtig von der Seite.
Sie hatten nur wenige Worte gewechselt. Sie redete ihn mit »Sie« an, er sagte »Du« zu ihr. Er war beinahe zu korrekt, sogar ein wenig reserviert. Sie fühlte sich irgendwie minderwertig, an Alter, Größe, und Erfahrung unterlegen. Eine kleine graue Maus, eine unbedeutende »Pinoquette«, wie ihre Mutter sie wegen der Ähnlichkeit mit dem Pinocchio aus dem Kinderbuch, das sie einmal zu Weihnachten bekommen hatte, nannte.
Sie kannte weder seinen Namen noch sein Alter; eigentlich wusste sie überhaupt nichts über ihn. Er war einfach aufgetaucht, hatte seine Heldentat vollbracht und fuhr sie nun zurück bis vor die Haustür, bevor er wieder verschwinden würde – ein wahrer Gentleman.
Sie fragte sich, ob sie nicht eigentlich ein bisschen plaudern sollten, hatte jedoch keine Lust dazu. ›Er findet mich bestimmt doof. Und wenn schon.‹ Sie wollte einfach nur jede einzelne Sekunde an seiner Seite genießen.
Nach der Brücke war er nach rechts in die enge Rue de Carrières abgebogen, wo Solange alle Leute kannte; das Auto war jetzt lauter zu hören. Beinahe hoffte sie, dass man sie in Begleitung dieses gut aussehenden jungen Mannes bewundern würde. Ihr war nämlich plötzlich aufgefallen, dass er tatsächlich sehr gut aussah!
Er sah sie an und äußerte zum ersten Mal Interesse an ihr:
»Wie heißt du eigentlich?«
»Solange Lenfant«, antwortete sie wie ein artiges Schulmädchen.
Leise fügte sie noch etwas hinzu, er konnte sie jedoch nicht verstehen.
»Was?«
»Ich hab gesagt, dass Ihre Augen golden sind.«
Er war braungebrannt und hatte einen Dreitagebart. Er lächelte kaum sichtbar.
»Wie die von einem Frosch?«
»Nein!«, rief sie erschrocken. »Nicht wie die von einem Frosch!«
«Wie alt bist du denn?«
»Siebzehn.«
»Deine Zöpfe sind hässlich«, erklärte er ihr.
»Aber praktisch beim Arbeiten«, verteidigte sie sich. »Ich steck sie dann einfach unter die Mütze.«
»Es ist unmöglich von deinen Eltern, dass sie dich sowas machen lassen.«
Er sagte es nicht boshaft, aber unmissverständlich. Seine jugendliche Stimme verriet, dass er aus dem Süden kam.
Sie erreichten den Kanal, es roch nach Hafen. Im Vorbeifahren sah er ein Schild.
»Achtung Sandbänke?«
»Das ist für die Frachtkähne«, erklärte sie ihm, »das heißt, ab hier darf nicht mehr überholt werden.«
Als er die Schleuse zum ersten Mal gesehen hatte, lag sie geschlossen und grau im ersten Licht des Tages da, kein Schiff war weit und breit zu sehen. Er hatte damals den Century stromabwärts geparkt, dicht neben der gepflasterten Laderampe, die zum Fluss hinunterführte. Der Verletzte lag ausgestreckt auf der Rückbank, das um seinen Kopf gewickelte Hemd war blutdurchtränkt, aber er war wieder bei Bewusstsein; schweigsam zwar, jedoch bei klarem Verstand. Nach fünf Minuten hatte er das Boot gesehen, wie es um die Spitze der Insel bog. Die Kleine kam mit ihrer Mutter im kimonoartigen Morgenmantel zurück. Der Verletzte war zwar geschwächt, konnte sich aber aufrecht halten. Er ließ sich leicht hinübertransportieren. Die Kleine hatte ihn dann gebeten, nach Corbeil zurückzufahren, um das Auto zu holen. Es waren ruhige Leute, die auf überflüssige Erklärungen verzichteten und kein großes Theater veranstalteten. Die Mutter hatte nur »Vielen Dank« gesagt, als wäre nichts weiter vorgefallen.
Man erreichte die Ile de la Dérivation zu Fuß über das Schleusentor. Die Inselbewohner ließen ihre Autos für gewöhnlich entlang des Ladekais stehen, wenn sie sie nicht in den drei oder vier privaten Eternitgaragen ein Stück flussaufwärts, Richtung Andrésy, abstellten.
Sie sah den Aronde vor der Garage stehen.
»Das muss mein Onkel sein. Sie können bestimmt mit ihm zurück nach Paris fahren.«
»So?«, sagte er.
Er parkte die Ente hinter dem Auto des Onkels und stieg aus, ein schlanker junger Mann. Seine nackten Füße steckten in Ledersandalen, außerdem trug er eine abgewetzte Kammgarnhose, ein helles Popelinehemd im Militärstil und eine Tweedjacke mit hochgeschlagenem Kragen.
Er war groß, wirkte aber nicht riesig. Solange war neben ihm jedoch klein wie alle Lenfants, ein Nichts, nur ein unbedeutender Gebrauchsgegenstand. Unter der Stewardessmütze kamen ihre straßenköterblonden Rattenschwänze zum Vorschein, und zur knielangen Stoffjacke mit Lederkragen trug sie eine enge Velourshose. Mit dem hochgeschlagenen Kragen und den unter der Mütze versteckten Haaren wirkte sie eher wie ein Junge, was in ihrem »Metier« sicher von Vorteil war.
Der junge Mann sah sich in aller Ruhe den Kanal, die Garage und das Treiben an der Schleuse an. Da entdeckte er den Äskulapstab auf dem Aronde.
»Dein Onkel ist Arzt?«
»Ja.«
Sie deutete auf die andere Seite des Kanals.
»Das rote Dach da drüben bei den drei Pappeln, das ist unser Haus. Das schönste auf der ganzen Insel.«
»Ach, ihr wohnt auf einer Insel?«, meinte der junge Mann.
»Ja, zwischen dem Kanal und der Seine.«
Er sah sich alles sehr aufmerksam an, so, als würde er eine imaginäre Karte der Gegend erstellen. Etwas schien ihn zu stören. Er zeigte auf den schlecht geteerten Weg.
»Wo geht es da hin?«
»Nach Andrésy und nach Conflans.«
»Sind das größere Orte?«
»Conflans-Sainte-Honorine«, präzisierte sie. »Das haben Sie ja wohl schon mal gehört, oder?«
»Ich komm von ziemlich weit her.«
Ihr war jedoch aufgefallen, dass sein Buick ein Nummernschild mit der 78 des Departements Seine-et-Oise trug. Sie wollte ihn schon darauf ansprechen, sagte dann aber aus natürlicher Zurückhaltung lieber doch nichts.
»Da drüben auf der anderen Seite liegt Poissy. Da gehen wir immer zum Einkaufen hin. Papa arbeitet in der Sattlerei, bei Simca.«
»Ach ja, Simca!«, bemerkte er.