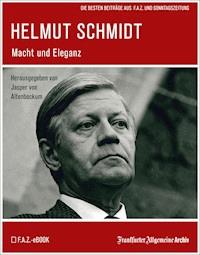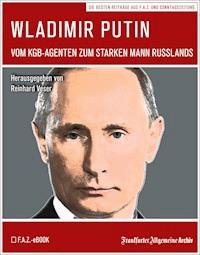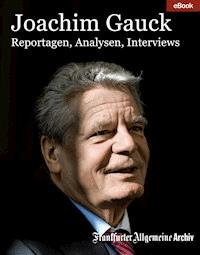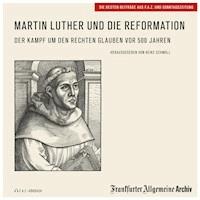Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mode lebt von Menschen. Daher kommt man für ein Buchprojekt zum Thema gar nicht umhin, aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und der Beilage "Z" Porträts von wichtigen Designern auszuwählen. Ingeborg Harms, Anke Schipp, Jennifer Wiebking, Dirk Schümer und Alfons Kaiser haben in den vergangenen Jahren viele der wichtigsten Modemacher der Welt getroffen. Mal war es eines der äußerst seltenen Interviews mit einem deutschen Journalisten (Miuccia Prada), mal war es ein groß gefeierter Abschied (Tom Ford), mal war es die Entdeckung eines Jungstars (Guillaume Henry). Meist sind es nur Momente, die aber helfen können, die Modegeschichte besser zu verstehen. Immer sollten es Designer sein, die mit ihrer Mode mehr sagen, als sich in Zahlen oder Trends ausdrücken lässt. Wenn man, umgekehrt gesagt, die Kollektionen der hier vorgestellten Designer sieht, sollte der zwingende Gedanke sein: Dahinter steckt immer ein kreativer Kopf. Wir stellen eine Auswahl der wichtigsten Köpfe vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Modemacher
Porträts aus der Welt des schönen Scheins
Herausgegeben von Alfons Kaiser
F.A.Z.-eBook 8
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
Fotografie: Helmut Fricke
eBook-Produktion: Rombach Druck- und Verlagshaus
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2012 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelgestaltung: Hans Peter Trötscher. Foto: F.A.Z.-Foto / Helmut Fricke
Das Titelfoto zeigt ein Defilée des Designers Alexander McQueen.
ISBN: 978-3-89843-246-7
Vorwort
Dahinter steckt immer ein kreativer Kopf
Von Alfons Kaiser
Mode lebt von Menschen. Daher kommt man für ein Buchprojekt zum Thema gar nicht umhin, aus der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« und der Beilage »Z« Porträts von wichtigen Designern auszuwählen.
Natürlich sind die Strategien der Luxuskonzerne wichtig, die unergründlich-untergründigen Wege des Trends, die seltsamen Launen der Konjunktur und ihre Auswirkungen auf das Geschäft mit dem schönen Schein. Aber die kreativen Köpfe bewegen diese Strategien, Trends und Märkte mehr als in jeder anderen Branche.
Man erkennt das am Beispiel von Karl Lagerfeld, der nicht nur das Erbe von Coco Chanel verwaltet, sondern in einer »One-Man-Show« einen Konzern erblühen lässt. Oder bei Marc Jacobs, der als Designer für Louis Vuitton die Umsätze des Luxuskonzerns LVMH in knapp mehr als einem Jahrzehnt zu vervierfachen half. Oder bei Miuccia Prada, die viele Trends so stark vorgibt, dass Hunderte Modemarken in aller Welt eine Saison später mit ähnlichen Mustern oder Stoffen zu brillieren versuchen.
Ingeborg Harms, Anke Schipp, Jennifer Wiebking, Dirk Schümer und ich haben in den vergangenen Jahren viele der wichtigsten Modemacher der Welt getroffen. Mal war es eines der äußerst seltenen Interviews mit einem deutschen Journalisten (Miuccia Prada), mal war es ein groß gefeierter Abschied (Tom Ford), mal war es die Entdeckung eines Jungstars (Guillaume Henry). Meist sind es nur Momente, die aber helfen können, die Modegeschichte besser zu verstehen.
Immer sollten es Designer sein, die mit ihrer Mode mehr sagen, als sich in Zahlen oder Trends ausdrücken lässt. Wenn man, umgekehrt gesagt, die Kollektionen der hier vorgestellten Designer sieht, sollte der zwingende Gedanke sein: Dahinter steckt immer ein kreativer Kopf. Wir stellen eine Auswahl der wichtigsten Köpfe vor.
So sehen moderne Klassiker aus: Aus einer Prèt-a-porter-Schau des Designers Dries van Noten F.A.Z.-Foto / Fricke
Guillaume Henry: Der kleine Nick der Mode
Er ist seine eigene Muse: Das Traditionshaus Carven hat sich zum Modelabel der Stunde gemausert, auch weil der Chefdesigner so ein netter Bursche ist.
Von Jennifer Wiebking
Madame Carven ist eigentlich ein Mann mit dicken Wollstrümpfen und verwuschelten Haaren. Die Hosenbeine seiner himmelblauen Chino hat er morgens im Hotelzimmer in Florenz um ein paar Zentimeter nach oben gekrempelt. Und jetzt, da er sich endlich mal hinsetzen kann, das eine Bein über das andere geschlagen, zieht er noch immer nervös am Stoff herum. Leute, die ihn kennen, sagen, er sei schüchtern; obwohl es für Schüchternheit nun wirklich keinen Grund gibt.
Vor drei Jahren hat Guillaume Henry begonnen, das Pariser Traditionshaus Carven umzukrempeln, so wie nun seine Hosen. Seitdem steckt er seine eigene Persönlichkeit in die Marke, gibt ihr einen bizarr-charmanten Charakter und ist mit dem passenden Gesicht dazu in der Modewelt zum Darling der Stunde geworden. Carven könnte ebenso Guillaume Henry heißen.
Carven, wie man es inzwischen kennenlernt, ist deshalb auch nicht mehr nur pariserisch, sondern hat seine Wurzeln eigentlich dort, wo der Bursche aufgewachsen ist, wo der Senf besonders gut ist und ansonsten nicht viel passiert: in der ostfranzösischen Region um Dijon. Als er 12 ist, schenken seine Eltern dem Jungen mit den kreativen Ambitionen eine Nähmaschine. In seinem Kinderzimmer näht er ein Teil nach dem anderen, und wenn er damit fertig ist, befestigt er an jedem Stück ein Preisschild. Carven ist auch heute noch nichts für den kleinen Geldbeutel – und trotzdem für mehr als nur ein paar wenige erreichbar. Seine Preise legte Guillaume Henry schon damals so fest, dass sich seine Mutter die Sachen eben noch leisten konnte.
Das geht ein paar Jahre so, bis der Junge aus Dijon erstmals Notiz von Madame Carven nimmt, einer Frau, die eigentlich Carmen de Tommaso heißt und zu der Zeit noch selbst in ihrem Pariser Atelier steht. Es ist Ende der Neunziger, und langsam zieht es den Jungen vom Land in die Stadt. Carven hat da bereits einiges hinter sich: Das im Jahr 1945 von der Modemacherin gegründete Haute-Couture-Haus schneiderte zwischendurch Uniformen für Stewardessen und schließlich Bürokleidung für Männer. Man kann den Glauben an den langfristigen Erfolg in der Mode verlieren, wenn man sich die Biographie von Carven durchliest.
Carmen de Tommaso aber engagiert sich unbeirrt weiter, auch für junge Designtalente. Sie organisiert einen Wettbewerb für Modestudenten, und Guillaume Henry, damals 22 Jahre alt, nimmt daran teil – und gewinnt. »Als sie mir den Preis überreichte, sagte sie, dass sie jetzt so etwas wie meine Patentante der Mode sei.«
Aus dem Patenkind, heute 33 Jahre alt, wird schließlich Carvens Adoptivvater. 2009, nach Stationen bei den Häusern Paule Ka und Yves Saint Laurent – das seit dieser Woche Saint Laurent Paris heißt – bekommt er mal wieder etwas aus dem Hause Carven überreicht. Es ist der Vertrag als Chefdesigner. Kurz darauf gelingt es Guillaume Henry, die Marke aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Dazu schaut er sich Bilder aus den fünfziger Jahren an, von den Mädchen jener Zeit, die sich von Madame Carven einkleiden ließen, so wie die Schauspielerin Martine Carol.
Guillaume Henrys Dornröschen-Marke tanzt wenig später mit seinem Esprit auf vielen Bällen, auf großen und auf kleinen. In Deutschland etwa hängen Carven-Kleider in Städten wie Berlin oder Hamburg, aber auch in solchen, die keine natürliche Umgebung für neue, junge Designer sind, zum Beispiel in Saarbrücken, dem pfälzischen Neumarkt, Bonn oder Wiesbaden.
»Es ist keine Mode, die Leute verschreckt«, sagt Guillaume Henry, der nun, am Abend, nicht mehr in dem klimatisierten Konferenzraum des Hotels vom Vormittag sitzt, sondern am Rande eines Sportplatzes steht. Er hat sich in Anbetracht der Hitze in Florenz dann doch noch einmal umgezogen und sieht trotzdem ganz ähnlich aus wie beim ersten Treffen. »Ich mag es, wenn die Kleidung, die ich für Carven entwerfe, von frühmorgens bis spätabends getragen werden kann«, sagt er.
Der Club Sportivo Firenze ist an diesem Abend neben einem Sportplatz auch der Schauplatz, um Guillaume Henrys kommende Herrenkollektion als Teil der Modemesse Pitti Uomo zu präsentieren. Es ist seine dritte für das Traditionshaus, das, wie er mit Nachdruck sagt, ein demokratisches Label sei. Schon Madame Carven war bemüht, Haute Couture zu schaffen, die dennoch zugänglich ist. Heute wäre das eine Unmöglichkeit in einer Zeit, in der gerade die Absonderung von der Masse der Prêt-à-Porter-Labels die Existenz der Couture sichert.
Guillaume Henry aber kehrt das Verhältnis von Carven zur Couture von damals einfach um. Carven macht heute demokratische Mode mit Besonderheiten, die das Ganze individuell und somit nach einem Hauch Extraarbeit aussehen lassen, ohne dabei Entsprechendes zu kosten. »Ich hasse die Frustration, wenn man von etwas träumt, es sich aber nicht leisten kann.« Wenn man, wie er erklärt, gerne das Stück von der Seite eines Magazins tragen würde, aber sich dann doch nur die Kopie leisten könne. »Ich möchte, dass Menschen ihre Träume auch anfassen können.«
Die Marke muss nicht so heißen wie er, damit man erkennt, dass Guillaume Henry sich vor allem an Leute wie ihn selbst richtet. Unter ihm ist Carven zur bunten Mischung geworden, die Spaß macht und dennoch nicht zu sehr ins Gewicht fällt, die gutverdienende Berufseinsteiger verzückt oder zum Geburtstag und an Weihnachten bei Studentinnen aus gutverdienendem Elternhaus ganz weit oben steht. Einen Rock gibt es für etwas unter 300 Euro, ein Kleid für etwas über 300 Euro, die Sonnenbrille liegt dazwischen. Das ist natürlich nicht billig – aber eben auch kein Vergleich zu dem, was in dieser Nachbarschaft bei Modemachern aus Paris vor wenigen Jahren noch normal war.
Inzwischen ist in der Modewelt ein neues Verständnis entstanden, was den Preis von Kleidung betrifft. Junge Labels wie der New Yorker Designer Alexander Wang, die Pariserin Isabel Marant oder eben Carven siedeln sich als zeitgemäße Marken, wie man sie auch nennt, ganz bewusst preislich unterhalb der Konkurrenz an, ohne dass man das mit minderer Qualität verbinden würde. Im Gegenteil, es könnte wie eine Art Freundschaftsangebot der Häuser verstanden werden oder wenigstens als Zeichen, dass die Marke nicht als komplett abgehoben daherkommen soll. »Es geht um einen ganz gewöhnlichen Menschen mit ganz gewöhnlichen Qualitäten, der trotzdem Spaß haben möchte. Sie ist nicht naiv, sie ist einfach super spontan«, sagt Henry über seine typische Kundin.
Carvens Hemden tragen abnehmbare Lätzchen um den Hals. Zu seinen Lieblingsspielereien gehört es, Blusen um den Oberkörper zu binden, sie zu raffen, ihren Stoff zu schlitzen und zu stanzen. Er spielt mit Charme und testet dabei, wie weit er gehen kann. »Etwas, das zu sexy daherkommt, wird wieder rausgeschmissen.« Noch heute ist »Der kleine Nick«, der Kinderbuchheld mit seinen zu weiten Hosen, den verstrubbelten Haaren und dem akkuraten Hemd unterm roten Pullunder, eine Inspiration für Guillaume Henry: Nicht alles muss streng sitzen, insgesamt ergibt sich aber ein schlüssiges Bild. Interessanterweise sehen sich Henry und Nicolas sogar ein bisschen ähnlich.
Nach der Pitti-Schau in Florenz möchte Henry, statt Interviews zu geben, sich zunächst einmal mit einem Glas Wein zu seinen Bekannten setzen. Gespräche, die für den Vormittag mit ihm geplant waren, verschiebt er. Guillaume Henry ist so spontan wie seine Mode. Später vermutet man ihn auf dem grünen Rasen des Sportplatzes in Tornähe – mit einer Handvoll Models und einem Fußball. »Es war ja kein Catwalk, sondern ein Sportywalk«, sagt er nach der Schau, in der Männermodels in grünen Steppmänteln, fliederfarbenen Hosen, in Neonorange, Königsblau und Himbeere in einem lustigen Wettrennen um das Spielfeld zirkulierten – gemeinsam mit einem Tross von Kellnern und einer Blaskapelle der Bersaglieri, einer Infanterietruppe des italienischen Militärs.
Das Label Carven habe keinen besonders außergewöhnlichen Businessplan, sagt Guillaume Henry. Wichtiger sei die Aura des Hauses. Über den eigenen Chefdesigner wird sie nach außen transportiert. Er wünsche sich, dass seine Freunde Carven tragen könnten. »Sie haben sich immer über die Preise der Sachen beschwert, die sie gerne hätten. Das versuchen wir zu verbessern.« Überhaupt gehe es eigentlich nicht nur um die bestimmte Hose oder das eine Hemd, sondern um die Stimmung, die man damit transportiere.
So schaut Guillaume Henry auch nicht in das Archiv des Hauses, sondern auf das Leben seiner Gründerin. »Wer Madame Carven war, ist mir wichtig. Weniger wie sie ein Kleid zusammengenäht hat, sondern wie sie gelebt hat und mit wem sie befreundet war.«
Am Ende dieses Tages in Florenz verschwindet der Junge aus der Region mit dem guten Senf dann ganz zwischen Dutzenden Menschen, die seine Freunde sein könnten, die genauso aussehen wie er. Nach der Schau auf dem Sportplatz stehen die Models aufgereiht auf einem Podest. Und Guillaume Henry steckt irgendwo dazwischen.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 24.6.2012
Tomas Maier: No logo!
Wie der deutsche Designer aus »Bottega Veneta« eine erfolgreiche Mode- und Luxusmarke gemacht hat
Von Alfons Kaiser
Er ist nur kurz da. Am Mittwoch kam er aus New York nach Heidelberg, am Donnerstag flog er nach Tokio, an diesem Freitag eröffnet er dort im Bezirk Ginza mit einem Dinner das größte »Bottega Veneta«-Geschäft der Welt. Tomas Maier, Chefdesigner der italienischen Luxusmarke, hat aber, obwohl er vor 30 Jahren seine nordbadische Heimat verließ, um in die Modewelt zu gehen, deutsche Mythen immer dabei: in Florida, wenn er mit seinem Porsche 911 von seinem Haus an der Küste nach Miami Beach fährt, in Tokio, wo die Stockwerke des 900-Quadratmeter-Geschäfts mit einer Treppe verbunden sind, die von der freischwingenden Treppe im Schmuckmuseum seiner Heimatstadt Pforzheim inspiriert ist – und in Heidelberg natürlich auch, wo er von seiner Suite im »Europäischen Hof« auf das Schloss blickt, das sandsteinrot im Nebel schimmert.
Die kurze Reise in seine deutsche Vergangenheit ist fast eine Heimholung. Am Mittwochabend erhielt er in Heidelberg als erster Designer den Forum-Preis der »Textilwirtschaft« – bisher wurden nur Textil- und Modeunternehmer geehrt, am Mittwoch neben Maier der Modeschmuck-Konzern »Bijou Brigitte« und der Mannheimer Modehaus-Chef Richard Engelhorn. Die Ehrung Maiers gilt nicht nur der Marke, »die als eine der wenigen den internationalen Wettbewerb mit Hermès oder Louis Vuitton aufnehmen könnte«, wie Peter Paul Polte sagt, der Herausgeber der Fachzeitschrift. Sie zeigt vor allem die Freude über einen deutschen Modemacher, der sich international durchgesetzt hat. Darüber ist selbst Wikipedia so überrascht, dass er dort als »Italian-born« gilt – obwohl er mit vereinten badisch-venezianischen Kräften ein Lederwarenhaus zu einer der wichtigsten Luxusmarken der Welt aufbaut.
Denn dass seine Herkunft auch seine Mode bestimmt – das ist für Tomas Maier, der auf dem Weg zum Erfolg nur das H in seinem Vornamen verloren hat, nicht nur eine Anekdote. Die Erzählungen, die um seine Person gestrickt werden, müssen daher natürlich damit beginnen, dass er auf der Pforzheimer Waldorfschule – stricken lernte. Ein Klischee, aber auch eine gute Voraussetzung, gleich nach dem Abitur im Jahr 1977 auf die Modeschule der Chambre Syndicale in Paris zu gehen. Wichtiger noch ist ihm, dass die Waldorfpädagogik künstlerische und praktische Tatkraft hervorrief: »Wenn es etwas zu reparieren gibt, kann ich das auch selbst. Wenn die Putzfrau nicht kommt, mache ich das auch.«
Nachmittags und am Wochenende half der Junge seinem Vater, dem Architekten Rudolf Maier. Auf den Baustellen in der Umgebung entwickelte er die Fähigkeit, schwierige Projekte in Zusammenarbeit mit Handwerkern und Auftraggebern durchzuziehen – heute macht er nichts anderes. Außerdem erwarb er einen soliden Sinn für Proportionen, Statik, Materialien, Farbe, Funktion, den man auch in der Mode braucht. Ganz nebenbei hilft ihm dieses Wissen heute, die allesamt über seinen Schreibtisch gehenden Geschosspläne der vielen neuen »Bottega Veneta«-Geschäfte zu verstehen.
Dieser Mann will die ganze Marke bestimmen. Da steht er seinem alten Freund Tom Ford nicht nach. Der damalige GucciStar bot ihm 2001 den Designerjob bei »Bottega Veneta« an, der 1966 gegründeten Lederwarenmarke, die kurz zuvor von der zum PPR-Konzern gehörenden Gucci-Gruppe (zu der auch Yves Saint Laurent, Stella McCartney, Alexander McQueen und Balenciaga gehören) gekauft worden war. Tomas Maier, der nach mehr als zwei Jahrzehnten in Paris als Designer für Marken wie Hermès, Sonia Rykiel, Iceberg und Revillon gerade nach Florida gezogen war, wo er seit 1997 mit seinem Partner Andrew Preston die Bade- und Freizeitmodemarke »Tomas Maier« aufgebaut hatte, war fest entschlossen abzusagen. Als er die Werkstätten in Vicenza im Veneto sah, die der Marke »Bottega Veneta« ihren Namen geben, sagte er sofort zu. »Da waren noch ungeahnte Fähigkeiten des intrecciato, der Leder-Flechtkunst, vorhanden.« Seitdem pendelt er zwischen Miami, wo er lebt und arbeitet, und Mailand, wo er arbeitet und im Hotel wohnt. Er reist nur mit Handgepäck, sendet alles weitere per Fed-Ex um die Welt – und freut sich, dass er nach Tokio mal auf die Lufthansa gebucht wurde, noch so eine deutsche Qualitätsmarke, die ihm gefällt.
Am 12. Juni 2001 begann er mit der Arbeit in Mailand. Binnen sechs Jahren vervielfachte er den Umsatz – auf 267 Millionen Euro im vergangenen Jahr, 67 Prozent mehr als im Vorjahr. Expandiert wird in einer Geschwindigkeit, die das kleine Haus fast zu sprengen droht, weil es nicht seit Jahrzehnten wächst wie Giorgio Armani oder Ralph Lauren. Tomas Maier sieht von den meisten Geschäften nur noch die »floor plans«. Allein in diesem Jahr sollen noch 23 Läden eröffnet werden, bald auch weitere in Deutschland neben den dreien in Hamburg, Berlin und München.
Und während in Japan die zum konkurrierenden LVMH-Konzern gehörende Marke Louis Vuitton über die Schwierigkeiten des Marktes klagt, ist Patrizio di Marco, der Vorstandsvorsitzende von »Bottega Veneta«, äußerst zufrieden. Er führt das Wachstum mit 40 Läden in Japan darauf zurück, dass die japanischen Mode-Fans nicht mehr die mit Labeln protzenden massenfabrizierten Marken ertragen – und sich lieber mit dezenten Leder-Visitenkartenhaltern für 250 Dollar oder Taschen aus geflochtenem Leder ohne metallenes Logo für 2 500 Dollar eindecken.
Für strenge Klarheit und persönlichen Touch wiederum steht Maier ein. »Ganz zu Beginn war es ein Kampf«, sagt er offen. »Aber wenn man zu einer Strategie steht, dann zahlt es sich aus.« Es hat wohl geholfen, dass er, heute 50 Jahre alt, nicht mehr so ganz jung war, als er begann. Während inzwischen oft Mittzwanziger Chefdesigner werden, war er also durchaus erwachsen, selbstbewusst genug – und nicht von dieser Marke abhängig. Daher ging es ihm auch nicht unbedingt darum, schnell Geld zu verdienen: »Ich wollte es langfristig aufbauen.«
Und das hat er gründlich getan. Zunächst einmal verbannte er alle Logos, verbrannte sogar alte Prototypen. Der Markennamen ist nur im Inneren der Produkte zu sehen. Er begann mit den althergebrachten Taschen. Sie werden in Vicenza per Hand geflochten, kosten mindestens ein Monatsgehalt, sind in sanften bis erdigen Tönen gehalten, aus sehr weichem Leder, weil man damals im Veneto nur Nähmaschinen zum Verarbeiten hatte. Heute werden sie gerne nachgemacht. »Das schmeichelt mir natürlich«, sagt Maier lachend. Doch muss sich inzwischen die wachsende Rechtsabteilung des Unternehmens mit immer mehr Kopien auseinandersetzen und in immer mehr Ländern das Copyright für die Flechttechnik beantragen. Aber ohnehin könne man das Handwerk nicht so leicht nachahmen, sagt Maier. Die Originale kommen ohne eine Naht aus und sind vollkommen verflochten.
Zu den großen und kleineren Lederwaren entwickelte Maier eine Damen- und eine Herrenlinie. Teils mit geflochtenen Einsätzen, jedenfalls in den abgetönten Farben und der frisch-klassischen Anmutung der Taschen, die denn auch auf dem Laufsteg brav ins Bild gehalten werden – ein Marketingcoup, der nur Lederwarenmarken gelingt, die sich eine Prêt-à-porter-Kollektion leisten. Dann kamen Schmuck und Juwelen hinzu; die Colliers aus geflochtenen Goldfäden fertigt die Schmuckmanufaktur »Victor Mayer« – aus Pforzheim. Im Februar wurde eine Möbel-Kollektion vorgestellt – weshalb die neuen Läden größer sein müssen als die bisherigen. Über Uhren wird verhandelt. Und auch für einen Duft hat Maier schon mit Fachleuten nachgedacht. Wann ist es genug? Wann ist es zuviel? »So weit soll es nicht kommen. Ich habe alle Kategorien unter Kontrolle. Herstellung und Preis garantieren, dass wir den Kunden nicht zuviel zumuten.« Weil er in den Werkstätten nur eine bestimmte Zahl an Taschen herstellen lassen kann, müsse er eben diversifizieren. Außerdem sei die Produktpalette wegen der Nachfrage entstanden, sagt Maier – und verschweigt, dass man in eigenen Geschäften, die Modemarken heute wegen der höheren Margen dem Verkauf über Kaufhäuser vorziehen, viele Produkte anbieten muss, damit die Kleider nicht so verloren aussehen.
Und dann hat Tomas Maier ja auch noch »Tomas Maier«. In 150 Geschäften auf der Welt wird die Beach- und Sportswear vertrieben – und im eigenen Laden in Miami Beach. Auch dort sind deutsche Mythen zu besichtigen. Porzellan von Nymphenburger, Meissen und KPM zum Beispiel verkauft er, seit kurzem auch Teddybären von Steiff. Mittendrin Tomas Maier, der Qualitätsmarken um sich schart, die seine amerikanischen Kunden begeistern. Er hat sein Deutschland einfach nach Florida verlegt. Und wenn er wieder mal ins richtige Deutschland fährt, dann kommt er nur mit Handgepäck.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11.5.2007
Viktor & Rolf: Wir wollen nicht nur spielen
Die Modemacher aus Amsterdam, entwickeln die Avantgarde zum Geschäft – und statten den Robert-Wilson-«Freischütz« aus.
Von Anke Schipp und Alfons Kaiser
Sind wir schon mittendrin? An der Herengracht malt ein Künstler Kanalwasser und Backsteinhäuser. Eine Frau Antje mit Hörern auf dem Kopf und Frappuccino in der Hand schiebt ein rosa Fahrrad mit Blümchen vorbei. Am Haus von Viktor & Rolf in der »Goldenen Bucht« der schönsten Amsterdamer Gracht knien zwei Bauarbeiter und setzen neue alte Pflastersteine ein. Ihr Ghettoblaster übertönt – »Are we human, or are we dancer?« – sogar das Hämmern. Kunst, Mode, Handwerk, Musik: Noch bevor die beiden größten niederländischen Modemacher aufgetreten sind, hat die Schau an der schmalen Straßenfront schon begonnen. Willkommen bei den Traumtänzern und Wirklichkeitsverdrehern!
»Hallo, ich bin Viktor!« – »Hallo, ich bin Rolf!« Damit sind die größten Unterschiede schon benannt. Der Rest verliert sich in Gleichheit. Differenzen werden weggelächelt. Die Hornbrille, Markenzeichen seit zehn Jahren, der Bart, der nicht so recht sprießen will, die gleichmäßigen Bewegungen: zwei Illusionskünstler in einer Person – oder einer in zweien? Zur Unterscheidung halten sich die Augen an den grünen Nike-Schuhen (Viktor) und der schwarzen Smokingjacke (Rolf) fest. Getrennt wollen sie nicht interviewt werden. Sie heißen ja auch nicht Viktor oder Rolf. Sondern Viktor und Rolf. Wie Siegfried und Roy. Oder Gilbert und George.
Die Ähnlichkeiten gehen bis in die Kindheit zurück. Viktor Horsting, der Zurückhaltende, stammt aus Geldrop, einem bescheidenen Vorort von Eindhoven. Rolf Snoeren, der Schüchterne, wurde, ebenfalls 1969, in Dongen geboren, 50 Kilometer entfernt. In ihrer Jugend entdeckten sie unabhängig voneinander die Mode. »Ich habe mich anders angezogen als der Rest der Klasse«, sagt Rolf, dessen Vater als Ingenieur in einem Stahlwerk arbeitete. »Weniger Jeans, mehr Krawatte. Wir fühlten uns anders, vielleicht auch, weil wir schwul waren.« Aus seiner Umgebung, in der er sich fremd fühlte, floh er in die Phantasie, zeichnete Menschen und wollte Modezeichner werden. »Dann traf ich ihn.«
Er, Viktor, spricht noch besser Englisch und dazu noch Deutsch. Vor drei Jahrzehnten lebte er drei Jahre lang mit seinen Eltern in Bergen bei Hannover, weil sein Vater als Soldat dorthin versetzt worden war. Er ließ sich – wie so viele deutsche Modemacher – von Antonia Hilkes NDR-Sendung »Neues vom Kleidermarkt« inspirieren. Auch er verabschiedete sich aus der Vorstadt in die Phantasie. An der Arnheimer Kunstakademie, wo sie von 1989 bis 1992 studierten, lernten sie sich kennen.
Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als eine neue Welt zu erfinden. Viktor & Rolf kehrten alles um, drehten es auf links, stellten es auf den Kopf. Weil es keine holländische Modeszene gab, gingen sie nach dem Studium nach Paris. Dort waren sie schon wieder Außenseiter, zogen zurück nach Amsterdam, nutzten die »Hassliebe zur Mode«, wie Rolf sie nennt, um von außen das System in Frage zu stellen und gleichzeitig das Bedürfnis nach exaltierter Zurschaustellung zu befriedigen.