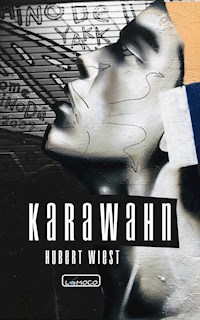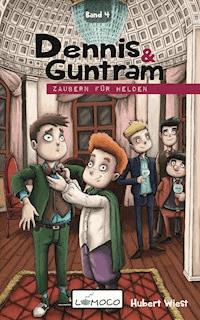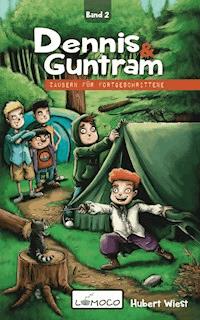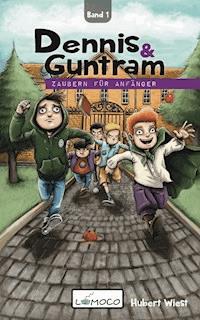Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nur ein kleiner Rechenfehler und die zehnjährige Loona landet im Land des Dinge-Erfindens. Ausgerechnet Monstärker soll Loona vor einer wild gewordenen Stachelbeere retten. Er mag keine Menschen, denn die sind noch schlimmer als Präsident Göhrkin. Monstärker kann Loona gar nicht schnell genug wieder loswerden. Doch Loona ist vom Dinge-Erfinden begeistert und lässt sich nicht so schnell abwimmeln. +++ Als Präsident Göhrkin zum Schutz der Bevölkerung Dinge-Erfinden verbieten lässt, wollen Monstärker und seine Freunde mit erfundenen Waffen gegen diese Entscheidung kämpfen. Loona versucht Hitzkopf Monstärker davon abzuhalten. Kann sie ihn mit Worten überzeugen? Und dann ist da noch die Sache mit dem Rechnen ... +++ Ein fantastisches Abenteuer, bei dem sich alles um die Frage dreht: Gibt es irgendwann keine Ideen mehr? +++ Für Leserinnen und Leser ab 8 Jahren und alle großen Fantasten! lomoco.de +++ "Ein absolut fantastisches Buch für Kinder und Erwachsene", Anna K. +++ "Ich will auch Dinge erfinden", Paul T. +++ "Meine Kinder lieben Monstärker und Loona. Spannend, fantasievoll, tiefgründig – ein echter Geheimtipp", Yvonne S. +++ "Sind irgendwann alle Ideen gedacht? Dieser Frage jagen Loona und Monstärker in einem atemberaubenden Abenteuer nach", Alex
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hubert Wiest
Monstärker und der Kristall des Zweifels
Für Nina, Janek, Ben und Lola
KAPITEL EINS
Dieser bescheuerte Mathetest. Ich hatte wirklich besseres zu tun, als meine Zeit mit Mathe zu verplempern. Eigentlich wollte ich mit Tim Hockey spielen, aber Mama hatte gesagt: „Heute Nachmittag lernst du für die Matheprüfung. Das verstehst du doch, meine Loona.“
Immer wenn Mama sagte „Das verstehst du doch, meine Loona“, ging es Mama überhaupt nicht darum, dass ich es verstand. Ich musste es einfach tun. Das war total ungerecht!
Ich saß also vor meinem Mathebuch und sollte 25 - 7 rechnen. Das brauchte wirklich niemand. Wofür gab es heutzutage Taschenrechner und Handys? Ich stellte mir 25 Stachelbeeren vor. Sie waren fast so groß wie ich – richtige Monsterbeeren. Fauchend stakste ein Drache auf die Beeren zu. Seine hellgrünen Schuppen glänzten giftig. Er hatte das Maul weit aufgerissen und schnappte nach der ersten Stachelbeere. Wie Blut lief der Beerensaft aus seinem Maul. Und dann verschlang er die nächste und die übernächste. Fast alle fraß er auf. Als er nach der siebten Stachelbeere schnappte, fuhr diese armlange Stacheln aus und rollte angriffslustig auf den Drachen zu, tänzelnd wie ein Boxer. Der Drache tappte nach links und rechts. Er war viel zu schwerfällig. Als die Beere den Drachen in den Hintern stach, jaulte er auf.
Und plötzlich war da dieser lila Nebel. Es sah aus, als käme er aus dem Boden neben dem Kuscheltierregal. Nach Vanille und Himbeermarmelade duftete er. Ich liebte Himbeermarmelade und Vanille! Neugierig ging ich auf den Nebel zu. Dann stand ich mittendrin. Er umhüllte mich wie duftende Watte. Aber nur für ein paar Sekunden. Schon war er wieder verschwunden.
Ich blickte hoch. Nein, das konnte nicht sein! Das war völlig unmöglich: Anstatt vor meinem Bücherregal stand ich auf einer Lichtung mitten in einem Dschungel. Zwischen zwei Bäumen sah ich grüngelbe Drachenschuppen glitzern. Schwefelgestank wehte zu mir herüber.
Ich kniff mir ins Ohrläppchen. „Hey, aufwachen Loona“, murmelte ich zu mir selbst. Schließlich war ich schon zehn und ging fast in die Fünfte. Ich glaubte nicht mehr an Drachen und so.
Da schoss eine riesige Stachelbeere zischend auf mich zu. Ihre dolchspitzen Stacheln funkelten im Sonnenlicht. Sie würden mich gleich durchbohren. Panisch sprang ich zur Seite und rannte in den Dschungel. Große ledrige Blätter schlugen mir ins Gesicht. Irgendwelche Affen veranstalteten ein heilloses Spektakel. Schon nach ein paar Schritten hatte ich totales Seitenstechen. Meine Lunge brannte. Aber die Angst trieb mich weiter. Die Stachelbeere walzte alles hinter mir platt. Sie würde mich gleich einholen!
Ich griff nach dem nächstbesten Ast über mir, zog mich hoch. Im Sportunterricht hatte das nie so gut geklappt, aber irgendwie schaffte ich es jetzt. Ich kletterte immer weiter hinauf, bis ich ganz oben auf einem Ast hockte, der gerade dick genug war, mich zu tragen. Mit einem Arm hielt ich den Stamm umschlungen, als wäre er mein bester Freund, und das war er im Augenblick wahrscheinlich auch. Ich versuchte, langsamer zu atmen, tief ein und tief aus, tief ein und tief aus. Das war doch alles nicht echt. Ich zwickte mir abwechselnd in beide Ohrläppchen. Aber ich blieb in diesem komischen Dschungel auf dem wackeligen Ast.
Unter mir hörte ich ein Zischen. Es war so fies, dass es selbst das Geschrei der Affen übertönte. Ängstlich blickte ich hinunter. Mein Puls raste. Dort unten wartete sie auf mich. Ungeduldig rollte die Stachelbeere um meinen Baum. Immer wieder stieß sie ein Zischen aus, als wollte sie sagen: „Irgendwann musst du herunterkommen. Ich kann warten. Ich habe Zeit.“
„Was willst du von mir? Hau ab!“, brüllte ich sie an.
Die Stachelbeere nahm Anlauf. Und dann gab sie Vollgas, raste auf meinen Baum zu. Warum hatte ich mir ausgerechnet so einen dünnen ausgesucht? Aber jetzt war es zu spät. Wie ein Feuerball schoss die Stachelbeere auf meinen Baum zu. Panisch umklammerte ich den Stamm.
Es krachte, als wäre ein Lastwagen gegen den Baum gedonnert. Holz splitterte. Ich konnte mich kaum halten, wurde hin und her gerissen. Ich machte die Augen einfach zu und wartete darauf, in die Tiefe zu fallen. Aber irgendwie hielt der Stamm – diesmal zumindest.
Die Stachelbeere hatte schon wieder Anlauf genommen. Ein Keuchen und Pfeifen mischte sich unter ihr Fauchen. Ein paar ihrer Stacheln waren gebrochen, aber Dutzende waren noch bereit, mich aufzuspießen. An einer Stelle hatte sich die Monsterbeere matschig gestoßen. Roter Saft quoll heraus. Mit einem Schnauben holte sie erneut aus, um meinen Baum zu fällen. Die Affen waren verstummt. Es war plötzlich totenstill.
„Hiiilfe!“, schrie ich. Noch ein Prusten, noch ein Zischen. Es war, als würde die Beere mit den Hufen scharren. Ich krallte meine Hände in die Rinde des Stammes. Das würde mir auch nichts helfen, wenn der Baum erst einmal fiel. Die Monsterbeere holte noch weiter aus.
Und dann rollte sie los, auf mich zu. Sie beschleunigte wie eine Rakete. Ich wollte nicht hinsehen. Aber in diesem Moment, ehe ich meine Lider gesenkt hatte, sah ich einen Typen vor die Stachelbeere springen. Todesmutig stellte er sich ihr in den Weg. Was sollte das bringen? Wie wollte er das Ding aufhalten? Als hätte er alle Zeit der Welt, hob er seine Hände, hielt die Finger so komisch und murmelte zornige Silben. Im nächsten Augenblick würde die Stachelbeere ihn überrollen. Da schrie er: „Aber hopp!“
Ein gigantisches Marmeladenglas stand auf einmal vor ihm. Die Stachelbeere schwebte über dem Glas. Sie war fast auf meiner Höhe. Mit den Füßen konnte ich beinahe die Stacheln berühren.
Da platzte die Stachelbeere und floss in das Glas. Ein süßer Geruch breitete sich aus. Es duftete wie bei Oma im Sommer in der Küche. Und dann sah ich das Schild auf dem Glas. In gleichmäßig geschwungenen Buchstaben, solche wie ich sie nicht malen konnte, stand darauf: Stachelbeermarmelade. Und kleiner darunter, mit einem Ausrufezeichen dahinter: Achtung stachelig!
Ich konnte es nicht fassen. Der Typ hatte mich gerettet.
„Kannst runterkommen“, rief er und fuhr über seine zotteligen Haare.
Ich nickte. Meine Kehle fühlte sich so trocken an, als hätte ich einen halben Eimer Sand verschluckt. Vorsichtig kletterte ich herab. Meine Arme waren verkrampft. Ich konnte sie kaum bewegen. Und meine Beine zitterten.
Der Typ war genauso groß wie ich. Nur seine postgelben Fransenhaare, die in alle Richtungen abstanden, überragten mich. Er trug silbern glitzernde Turnschuhe mit winzigen Flügeln außen dran. Bei jedem Schritt flatterten sie. Er hatte eine gestreifte Pluderhose an und ein T-Shirt, das mit sonderbaren Zeichen vollgekritzelt war. Er grinste mich aus seinen grünen Augen ärgerlich an. Seine Haut war so braun, dass die milchweißen Zähne wie eine Lichterkette funkelten.
„War ganz schön knapp“, brummte er.
„Danke.“ Ich versuchte, die Trockenheit in meinem Hals herunterzuschlucken.
„Monstärker“, sagte der Typ. Jetzt grinste er unverschämt.
„Wer ist stärker?“ Meine Frage schien ihn für einen Augenblick aus der Fassung zu bringen. Er kratzte sich am Hinterkopf, dann erklärte er: „Monstärker, ich heiße Monstärker.“ Er streckte mir seine Hand entgegen. Unsicher schüttelte ich sie und sagte: „Ich bin Loona.“
Ich war es gewohnt, dass mich die Leute anglotzten, wenn ich meinen Namen sagte. Aber wer Monstärker hieß, sollte das besser nicht tun. Dabei hatte ich ihm noch nicht einmal gesagt, dass man meinen Namen mit zwei O schrieb, aber Luna aussprach. Ich liebte meine Eltern wirklich, aber wegen des Namens war ich immer noch sauer auf sie. Meine Freundinnen hießen doch auch einfach Emma, Mia und Hannah.
„Wie hast du das gemacht mit der Monsterbeere? Kannst du zaubern?“, fragte ich und kam mir total dämlich vor. An Zauberer glaubte ich wirklich nicht mehr.
„Quatsch, ich kann nicht zaubern. Ich hab das Marmeladenglas einfach erfunden.“
Ich starrte ihn fassungslos an. Erfunden? Was war das für ein Blödsinn?
„Du bist doch auch eine Makah-Uhba? Ich meine, du hast rote Haare und grüne Augen und Sommersprossen.“
Moment! Da lief etwas total schief. Das musste ich sofort klarstellen. „Ich habe braune Haare, bestenfalls kastanienfarben, aber bestimmt nicht rot. Und meine Augen sind braun. Hast du mich verstanden? Und wegen meiner Sommersprossen solltest du mich besser in Ruhe lassen. Dein Gesicht sieht schließlich auch aus wie mit Schokostreusel gesprenkelt.“ Ich hasste es, wenn mich jemand als rothaarig bezeichnete, und meine Augen waren wirklich braun. Okay, bei miesem Licht sahen sie vielleicht schlammgrün aus. Das war alles. „Und so ein Uhba-Uhba-Affe bin ich bestimmt nicht. Du spinnst doch!“
Der Typ, also dieser Monstärker, fuhr mich zornig an: „Makah-Uhba, kein Affe! Ich bin ein Makah-Uhba und dachte, du gehörst zu uns, weil du so aussiehst. Hab mich wohl getäuscht. Woher kommst du denn?“ Monstärker ging um mich herum und sah mich so komisch an.
„Ich komme aus München. Das liegt in Deutschland. Ich bin ein Mensch keine Makah-Uhba“, fügte ich unsicher hinzu. Vielleicht kannte der Typ nicht einmal Deutschland. Schließlich gab es in Deutschland keinen Dschungel, höchstens in irgend so einem Freizeitpark. Aber wie sollte ich da hingekommen sein? Ich kam mir total bescheuert vor. Da stand ich mitten in einem Dschungel und erklärte einem Typen, der Monsterstachelbeeren in Marmelade verwandeln konnte, dass ich ein Mensch und kein Affe war.
Monstärker verschränkte seine Arme vor der Brust und tappte mit einem Fuß nervös immer wieder auf den Boden. „Ein Mensch? Ich hätte es wissen müssen, dass du keine Makah-Uhba bist. Sonst hättest du dich wegen der kleinen Stachelbeere nicht so bescheuert angestellt. Wie bist du hergekommen?“
Ich zuckte mit den Schultern. Ich hätte es Monstärker gerne gesagt, aber ich wusste es ja selbst nicht. „Da war dieser Nebel“, murmelte ich. „Er hat nach Vanille und Himbeermarmelade geduftet.“
„Du bist mit dem Transportnebel gekommen?“, fragte Monstärker ungläubig.
Ich nickte, tat so als würde ich ihn verstehen. „Und wie komme ich zurück?“, wollte ich wissen.
„Mit dem weißen Transportnebel. Hoffentlich kommt er, bevor es dunkel wird. Nachts kann es im Moroah-Dschungel verdammt ungemütlich werden. Ich meine mit all den erfundenen Dingen. Wütende Stachelbeeren sind da echt Kinderkram.“ Monstärker setzte sich auf einen Baumstumpf und holte ein kleines Päckchen aus seiner Hosentasche. Er zog einen Kaugummistreifen heraus und schob ihn nachdenklich in den Mund. „Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Menschen den Transportnebel noch benutzen könnt. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Bestimmt hat Göhrkin seine Finger im Spiel.“
„Wer ist Göhrkin?“
„Unser Präsident.“
„Kann ich auch einen Kaugummi haben?“, fragte ich und deutete auf das Päckchen, das Monstärker zwischen den Fingern drehte. Gobos fantastischer Kaugummi stand in verschnörkelten Buchstaben darauf. Ohne mich anzusehen, gab mir Monstärker einen Kaugummi.
Als ich mir den orangefarbenen Streifen in den Mund steckte, schien die ganze Welt nach Mango zu schmecken.
„Mhh, genial.“
„Ist von Gobo, dem besten Kaugummi-Erfinder.“
Ich nickte und stellte mir vor, die Welt wäre eine einzige Mango.
„Wie geht das mit dem Dinge-Erfinden?“, fragte ich schließlich.
„Hmm“, machte Monstärker, als hätte er damit meine Frage schon beantwortet.
„Kannst du mir das beibringen?“
„Ist nichts für Menschen. Zum Dinge-Erfinden braucht man neue Ideen. Die habt ihr Menschen nicht. Denn jede Erfindung funktioniert nur ein einziges Mal.“
Ich verstand nicht, was Monstärker damit meinte.
Mittlerweile war die Sonne fast untergegangen. Sie leuchtete von rot über grün bis blau und silbern, in Farben, die ich noch nie gesehen hatte. Längst schrien die Affen wieder oder was für Tiere das sonst waren. Monstärker schien allmählich nervös zu werden. Er ging die Lichtung auf und ab und tat so, als würde er etwas suchen. Meinen Fragen wich er aus. Er wollte mir nichts mehr vom Dinge-Erfinden erzählen. Überhaupt war er nicht besonders gesprächig. „Hoffentlich kommt dieser Transportnebel bald. Wenn es erst dunkel ist, kann ich für nichts garantieren“, murmelte Monstärker. Er sah besorgt aus.
Ein lautes Brüllen brachte die Affen augenblicklich zum Schweigen. Monstärker fuhr herum. „Auf den Baum“, rief er mir zu. Doch ehe ich auch nur einen Schritt in Richtung des Baums machen konnte, stürmte ein riesiges Vieh auf die Lichtung. Es hatte die Form eines Tyrannosaurus, aber sein Körper war mit zotteligem Fell bedeckt, schwarz und verfilzt. Das Tier stank wie eine Mülltonne im Hochsommer. Zwischen seinen dolchlangen Zähnen tropfte Speichel herab, der die Pflanzen augenblicklich verdorren ließ.
„Hierher. Komm her! Sei ein gutes Tier!“, versuchte Monstärker das Monster zu sich zu locken.
Ich stolperte ein paar Schritte rückwärts. Der nächste Baum war viel zu weit weg.
Doch längst hatte das zottelige Vieh Monstärker entdeckt. Brüllend rannte es auf ihn zu. Monstärker stellte sich breitbeinig hin. Er hob seine Hände, streckte die Arme aus und klappte die Mittelfinger so komisch ein. Wieder murmelte er sonderbare Silben, die ich nicht verstand. Und dann, als das Biest aus vollem Lauf nach Monstärker schnappen wollte, schrie er: „Aber hopp!“
Sekundenbruchteile bevor es mit seinen Fangzähnen Monstärker zu fassen bekam, stand das Vieh plötzlich auf einer hellgrünen Eisbahn. Sie war spiegelglatt. Das Vieh rutschte in einem Affentempo an Monstärker vorbei. Die Dinosaurierbeine begannen sich wie Windmühlenflügel zu drehen. Schließlich verhedderten sie sich und das Monster stürzte, während es auf einen riesigen Baum zuschoss. Das war nicht so ein mickriges Bäumchen, sondern ein richtiger Urwaldriese. Kopf voraus in vollem Tempo donnerte das Vieh gegen den Stamm. Ein paar Blätter segelten herab. Das Tier jaulte auf. Monstärker sprang auf mich zu und zerrte mich ins Dickicht. Es dauerte, bis sich das Vieh wieder aufrichtete. Jaulend tappte es von einem Bein aufs andere.
„Ist gut, jetzt hau endlich ab!“ Ich zuckte zusammen, aber Monstärker hatte nicht mich gemeint, sondern das Biest, das tatsächlich murrend auf der anderen Seite der Lichtung im Dschungel verschwand.
„Nachts wird der Moroah-Dschungel immer gefährlicher, Loona“, schnauzte mich Monstärker an, als wäre es meine Schuld.
„Mit den Monstern wirst du doch lässig fertig.“ Ich versuchte, selbstbewusst zu klingen, als hätte ich überhaupt keine Angst. Aber das war komplett gelogen. Meine Knie zitterten total.
„War das wieder so ein Dinge-Erfinden?“, fragte ich unsicher.
„Ja, ja“, tat Monstärker meine Frage unwirsch ab. „Mit den erfundenen Sachen werde ich schon fertig, ich bin schließlich ein Makah-Uhba. Aber nachts sind die Vokaren auf ihren Raubzügen unterwegs. Wenn die uns erwischen, ist alles aus.“ Bei dem Wort Vokaren versagte fast seine Stimme und ich wusste, gegen die Vokaren war der zottelige Tyrannosaurus das reinste Schoßhündchen. Ich wollte fragen, wer die Vokaren waren, da rief Monstärker: „Da, da, da“, und deutete auf die Lichtung.
Aber da war nichts. Nur ein wenig Bodennebel breitete sich aus. Kein Monster griff uns an. Und die Affen über uns quietschten immer noch vergnügt.
„Dein Transportnebel“, rief Monstärker und schob mich auf die Lichtung. „Beeil dich! Er wartet nicht ewig. Transportnebel sind unglaublich schnell beleidigt. Wenn sie merken, dass du sie nicht ernst nimmst, verschwinden sie sofort.“
Ich ging ein paar Schritte auf den weißen Nebel zu. Ein wenig Bodennebel, das war alles.
„Geh endlich, Loona!“, schrie Monstärker. Wie er meinen Namen aussprach klang fast, als würde er sich ein wenig Sorgen um mich machen. Ich tat Monstärker den Gefallen und ging auf den Nebel zu. Wie in ein Schwimmbecken, dessen Wassertemperatur ich prüfen wollte, streckte ich meinen Fuß, die Zehen voraus, in den Nebel. Und dann stieg ich hinein, zog meinen zweiten Fuß nach.
„Darf ich dich wieder besuchen kommen?“, fragte ich belustigt. Mir war klar, dass mich dieser Bodennebel nicht nach Hause bringen würde.
„Ihr Menschen bleibt besser in eurer Welt“, hörte ich Monstärker noch sagen. „Es war ein Versehen, dass du hierhergekommen bist.“ Ich hörte Monstärkers Worte nur noch dumpf. Der Nebel legte sich dick wie Zuckerwatte um mich. Doch schon einen Augenblick später begann er sich wieder zu lichten.
Der Dschungel war verschwunden und ich stand auf der Wiese hinter unserem Haus, dort, wo ich mit Tim immer Hockey trainierte.
„Loona, du Schlafmütze, warum kommst du jetzt erst?“, begrüßte mich Tim.
„Mama hat mich zum Mathelernen verdonnert.“
Und dann erzählte ich ihm die ganze Geschichte mit Monstärker und den Monstern. Natürlich glaubte mir Tim kein Wort.
„Loona, du spinnst doch“, sagte er mitleidig.
„Ehrlich, du brauchst nur den lila Transportnebel.“
Es funktionierte nicht.
„Loona, das ist doch alles Blödsinn.“
Tim ließ sich nicht überzeugen. Er weigerte sich, mir die Geschichte zu glauben. Und am Abend war ich mir selbst nicht mehr sicher, ob die Sache mit Monstärker wirklich passiert war. Als ich mir die Zähne putzte, bildete ich mir ein, dass meine Haare tatsächlich einen leichten Rotstich hatten. Und meine Augen schimmerten ein wenig grünlich.
KAPITEL ZWEI
Auch wenn ich mit Tim nicht mehr über Monstärker sprach und meinen Eltern sowieso nichts davon erzählt hatte, musste ich dauernd an die Welt des Dinge-Erfindens denken. Mit meinen Eltern konnte ich über solche Sachen überhaupt nicht reden. Sie würden mich wie ein Kleinkind behandeln und idiotische Vorschläge machen wie: „Mach doch dein Schlaflicht von früher an, wenn es dir nachts zu dunkel ist.“
Meine Eltern begannen sich ernsthaft Sorgen um mich zu machen.
„Loona, du lernst zu viel. Du musst mehr Pausen machen und dann konzentriert arbeiten“, sagte Mama, und Papa schlug sogar vor, dass ich Nachhilfe nehmen sollte. Meine Eltern hatten überhaupt nichts verstanden. Ich verrechnete mich doch absichtlich, um endlich wieder nach Makah-Uhbien zu reisen!
Nach ein paar Tagen verbot mir Mama sogar, so viel Rechnen zu üben und schickte mich zu Tim. Ich sollte mit ihm spielen, mich ein wenig ablenken. Dazu hatte ich keine Lust, aber mit meinen Rechnungen kam ich auch nicht weiter.
Tim wollte Monopoly spielen. Ich hasste Monopoly. Da verlor ich immer. Aber heute ließ ich es über mich ergehen und tat Tim den Gefallen. Wie immer nach ein paar Runden hatte Tim alle guten Straßen gekauft und begann, seine bescheuerten Häuser und Hotels zu bauen. Parkstraße und Schlossallee, alles pflasterte er zu. Irgendwann stand ich zehn Felder vor der Schlossallee. Tim war unglaublich stolz auf sein neues Hotel. Er nannte es Schlosshotel.
„Du bist dran, Loona“, drängte Tim und mampfte ein Stück Schokolade nach dem anderen. Tim war wirklich in Ordnung, aber wenn es um Schokolade oder Monopoly ging, hatte er einen Knall. Er konnte nicht genug bekommen. Wegen seiner Liebe zur Schokolade hatte ihn unser Hockeytrainer schon mehrfach ermahnt. Tim sollte ein paar Kilo abnehmen. Er war einfach zu langsam, selbst als Torwart kam es beim Hockey auf Geschwindigkeit an.
„Du musst würfeln.“
Ich schüttelte die beiden Würfel in meiner Faust. Dann ließ ich sie über das Spielfeld kullern. Der erste Würfel blieb liegen. Eine Vier. Der zweite rollte immer weiter, hatte längst das Spielfeld auf der anderen Seite verlassen. Schließlich wurde er langsamer. Jede Umdrehung schien mehr Kraft zu kosten als die vorangegangene. Klack, da blieb der Würfel liegen und sechs goldene Punkte blitzten mir entgegen. Nein, das durfte nicht wahr sein. Ich hasste Monopoly, aber noch mehr hasste ich, zu verlieren. Keine Ahnung woher der Würfel die Kraft noch nahm. Jedenfalls kippte er noch einmal weiter und sieben Punkte strahlten mir entgegen.
Auf einmal war er da: Der lila Nebel, der nach Vanille und Himbeermarmelade roch. „Siehst du! Es gibt ihn tatsächlich“, wollte ich Tim zurufen. Doch irgendwie hatte mich der zuckerwattezähe Nebel längst eingefangen. Ich steckte mittendrin und sog den wunderbaren Duft auf.
Als sich der Nebel gelichtet hatte, erwartete ich den Moroah-Dschungel um mich herum. Stattdessen stand ich in einer sonderbaren Straße. Sie war kerzengerade und links und rechts in immer gleichen Abständen von grünen Häusern gesäumt, die wie Bauklötze aussahen, gleichmäßig und fensterlos. Ab und zu stand ein größeres, rotes Bauklotzhaus dazwischen.
Nein, ich träumte nicht. Ich stand wirklich in dieser komischen Straße.
„Monstärker“, rief ich zaghaft und ging die Straße hinunter. Fünf grüne Häuser, ein rotes Haus, fünf grüne Häuser, ein rotes Haus. Dort vorne ging jemand. Ich rannte ihm nach. „Halt“, rief ich. Er schien mich nicht zu hören. Ich rannte schneller. Da war wieder dieses Seitenstechen. „Monstärker!“
Endlich hatte ich ihn eingeholt. Von hinten sah ich, dass er seine postgelben Haare gegelt und ordentlich gescheitelt hatte. Obwohl er keine silbernen Flügelturnschuhe trug und auch keine gestreifte Pluderhose anhatte, packte ich ihn an der Schulter und riss ihn unhöflich zu mir herum. „Monstärker“, rief ich und starrte in ein verwundertes Gesicht. Der Typ hatte die gleiche braune Haut und weiße Zähne. Er grinste unsicher, aber nicht unhöflich. „Bitte?“, fragte er.
„Monstärker?“ Ich wusste, es war nicht Monstärker, auch wenn er ihm irgendwie ähnlich sah.
Der Typ verstand nicht, was ich wollte, und wand seine Schulter aus meiner Hand.
„Entschuldigung, ich hab dich verwechselt. Ich dachte, ich bin in Makah-Uhbien.“
Mit einem Handgriff kontrollierte der Typ den Sitz seiner Frisur, dann antwortete er belustigt: „Selbstverständlich bist du in Makah-Uhbien. Das hier ist Goraschan, die Hauptstadt. Warst du noch nie im Stadtteil Monopol?“
Ich schüttelte meinen Kopf. „Gibt es hier keine erfundenen Dinge? Alles sieht so gleich aus.“
Der Kerl legte seinen Kopf ein wenig schief und lächelte mich mitleidig an: „Ach so, du suchst die alten erfundenen Stadtteile. Die liegen am Ende der Schlossallee, auf der anderen Seite des Stadtplatzes. Aber warum willst du nicht hierbleiben? Monopol ist viel moderner. Das hier ist die Zukunft der Makah-Uhbas. Monopol wurde in einer richtigen Fabrik produziert, wie bei den Menschen.“ Er strahlte mich an.
Als ich nicht reagierte, zeigte er mir die Richtung zu den erfundenen Stadtteilen. „An deiner Stelle würde ich es mir noch einmal überlegen“, sagte er kopfschüttelnd und ging weiter.
„Danke!“ Ich rannte los. Ich musste Monstärker finden.
Am Ende der Schlossallee fand ich den Stadtplatz. Und es war, als würde ich eine andere Welt betreten. Die Häuser sahen verrückt aus. Keines glich dem anderen. Eines war lila- orange gestreift, das nächste mit blauen Vogelfedern verkleidet und das dritte sah aus wie eine riesengroße rosa Waschmaschine. Ein anderes schwebte über dem Boden und war mit armdicken Tauen verankert. Und das übernächste drehte sich fortwährend, wobei Türen und Fenster an den immer gleichen Stellen blieben, als gehörten sie nicht zu dem Haus. Der Platz war voller Makah-Uhbas. Sie hatten knallbunte Haare, manche in Regenbogenfarben, und trugen die abenteuerlichsten Klamotten: Einer hatte eine geblümte Kaffeekanne auf dem Kopf, ein anderer ein T-Shirt aus Karotten und ein kleiner Rothaariger war mit einem halben Dutzend Schwimmreifen bekleidet und hatte Sprungfedern unter seine Schuhe montiert. Ein Stuhl, auf dem ein Stapel selbstumblätternder Bücher lag, eilte über den Platz. Ein kichernder Makah-Uhba trug eine Eismaschine um den Hals und verteilte sternförmiges Glitzereis, das nach Apfelstrudel duftete. Ein roter, ein gelber und ein grüner Papagei saßen in einem Ampelhäuschen und stritten darum, wer leuchten durfte. Ein fettes Sofa rollte auf mich zu und brummte: „Kleine Pause gefällig? Du siehst etwas mitgenommen aus, mein Kind.“
Ich nickte dankbar und ließ mich auf die weichen Polster fallen. Ich versank fast darin und konnte kaum noch auf die Straße sehen. Auf dem Sofa neben mir lag eine Kaugummipackung: Gobos fantastischer Kaugummi. So einen hatte mir Monstärker gegeben. Ich nahm die Packung. Hoffentlich Mangogeschmack. Enttäuscht sah ich, dass die Packung leer war. Wie sollte ich hier jemals Monstärker finden?
„Magst du einen Kaugummi von mir?“
Enzianblaue Augen strahlten mich an. Die Haare des Typen waren genauso blau. Sie waren kurz geschnitten, ordentlich gekämmt und gegelt. Er lächelte fröhlich: „Ich bin Roccho. Du kannst gerne einen von meinen haben – mit Karubi-Geschmack. Die mag ich am liebsten.“
Ich zog einen dunkelroten Kaugummistreifen aus der Verpackung. Unsicher steckte ich ihn in den Mund. Er schmeckte nach Karamell, nein doch eher nach Himbeere mit einem Hauch von Zimt und Maracuja – echt gut.
„Ich bin Loona“, nuschelte ich. „Schreibt man mit zwei O in der Mitte.“
„Hab dich noch nie hier gesehen, Loona.“
„Ich bin zum ersten Mal in Goraschan. Das letzte Mal war ich in diesem Dschungel.“
Roccho legte mir seine Hand auf die Schulter, als wären wir beste Freunde. „Kann es sein, dass du ein Mensch bist?“
Ich fühlte mich ertappt. „Jjja, ich bin mit dem lila Nebel gekommen“, stotterte ich.
Roccho klatschte begeistert in die Hände. „Das ist Wahnsinn, ganz wunderbar. Es war schon immer mein größter Wunsch, einen richtigen Menschen kennenzulernen.“
„Danke, aber dafür kann ich nichts. In meiner Welt gibt es nur Menschen.“
Mir fiel auf, dass die anderen Makah-Uhbas einen großen Bogen um uns machten. Und wer doch näher kam, verbeugte sich vor Roccho.
„Loona, was bin ich nur für ein Glückspilz? Darf ich dich zu einem Eis einladen?“
Ich zögerte. Roccho deutete auf eine Eisdiele gleich nebenan. Stühle aus geflochtenen Plastikstrohhalmen wackelten vor dem Laden hin und her. Über jedem Tisch war ein geringelter Papierschirm aufgespannt.
„Die haben das beste Eis in Goraschan, auch wenn es erfunden ist. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Fabriken ein besseres Eis herstellen können. Es wird nicht mehr lange dauern.“
Roccho zog mich sanft zur Eisdiele hinüber.
„Ich bin übrigens ein persönlicher Berater von Präsident Göhrkin.“
Als müsste er es mir beweisen, zog Roccho seinen Ausweis aus der Innentasche seines Sakkos. Sichtlich stolz zeigte er ihn mir. „Der ist echt! Ihr Menschen habt doch auch Ausweise.“
Ich nickte.
„Bei uns sind Ausweise ganz neu. Präsident Göhrkin hat sie erst letzten Monat eingeführt.“
Wir setzten uns auf die Strohhalmstühle. Roccho bestellte zwei Überraschungseisbecher. Er räusperte sich ein paar Mal. Es kam mir so vor, als würde er seinen ganzen Mut zusammenkratzen. Schließlich sagte er: „Loona, ich habe eine Bitte an dich.“
Aha, er wollte etwas von mir. Darum war er die ganze Zeit so freundlich, fast schleimig.
„Schieß los. Aber ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann.“
„Doch, du bist ein Mensch. Du kannst mir ganz bestimmt helfen.“ Roccho blinzelte mich an.
Eine Makah-Uhba mit blau-weiß karierten Haaren brachte unsere Eisbecher. Meiner sah wie ein Pokal aus. Rocchos wie eine Waschpulvertrommel.
Ich konnte nicht warten, musste gleich probieren. Das Eis schmeckte köstlich!
„Kannst du mir Rechnen beibringen, Loona?“
Ich verschluckte mich. Ausgerechnet ich sollte Rechennachhilfe geben? Ich war doch nur hier, weil ich mich selbst dauernd verrechnete.
„Bitte“, sagte Roccho. Er sah ernst dabei aus.
„Ich bin nicht besonders gut in Mathe ...“