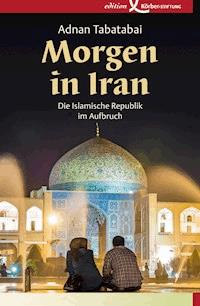
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition Körber-Stiftung
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Kaum ein Land hat im Westen ein so negatives Image wie die Islamische Republik Iran. Die jahrtausendealte persische Kultur, die prächtigen Sehenswürdigkeiten: All das tritt in der öffentlichen Wahrnehmung zurück hinter religiösem Dogmatismus und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen. Doch wer das Leben in Iran darauf reduziert, greift zu kurz, erklärt Adnan Tabatabai. Iran ist ein Land voller Spannungen und Widersprüche und die Iraner haben gelernt, sich dazwischen zu bewegen. Wer das Land verstehen will, muss deshalb einen Perspektivwechsel wagen, so der iranischstämmige Politikberater. Denn Tabatabai ist überzeugt: In den nächsten Jahren wird sich Iran dem Westen immer weiter öffnen. Aber nicht, indem es sich einfach nach westlichen Vorstellungen umformt, sondern indem die Menschen ihren eigenen Weg zu mehr Freiheit finden. In beiden Gesellschaften gleichermaßen zuhause erzählt Tabatabai von seinem Iran - die negativen Seiten nicht ignorierend, aber den Blick geschärft für die Chancen und Potenziale des Landes. Iran ist ein Land im Aufbruch. Adnan Tabatabai ermutigt uns, diese Tendenzen zu unterstützen - kenntnisreich, aber ohne Bevormundung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinem lieben Vater
Ich wünschte, du könntest in diesem Buch blättern
Mögest du in Frieden ruhen
Realitäten einer anderen Welt
»Guten Morgen, liebe Fluggäste. Ihr Mahan Air Flug W 5101 nach Teheran ist in wenigen Minuten für Sie zum Einsteigen bereit.« Am Gate C36 des Flughafens Düsseldorf mache ich mich gemeinsam mit den anderen überwiegend iranischen Passagieren auf zum Boarding. Noch einmal Reisepass und Flugschein vorzeigen, »Safar be cheir – Gute Reise!«, und los geht es. Wie bei jeder meiner regelmäßigen Iran-Reisen vergegenwärtige ich mir während dieser letzten Schritte zum Flugzeug, dass ich in weniger als fünf Stunden in Iran sein werde – einem Land, in dem ich nach der Ankunft nicht nur meine Uhr, sondern auch mich selber umstellen muss. Eine andere Sprache, andere Umgangsformen, ein ganz anderes Stadtbild, vom Klima und dem Essen ganz zu schweigen. Nichts davon ist mir fremd, die Umstellung vom deutschen in das iranische Umfeld verläuft für mich fließend und fällt mir zunehmend leichter, je älter ich werde. Denn ich bin als Sohn iranischer Eltern zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe aber seit meiner Kindheit jedes Jahr mehrere Wochen in Iran verbracht. Für Familie und Freunde in Iran bin ich ein »deutscher Iraner« und für die Freunde in Deutschland ein »iranischer Deutscher«. Für mich ist das gelebte und harmonische Realität. Dennoch wird mir in manch ruhiger Stunde bewusst, was für unterschiedliche Welten ich seit jeher miteinander in Einklang zu bringen versuche. Wenn mir das meist sehr gut gelingt, heißt es noch lange nicht, dass das für Außenstehende auch so ist.
»Kodja ro bishtar dust dari – Iran ya Alman? – Welches Land magst du lieber? Iran oder Deutschland?«, wurde ich als kleiner Junge in Iran oft gefragt. »Ich mag beide Länder gleich gern«, antwortete ich, denn ich war einfach nicht bereit, mich zu entscheiden. Da Verwandte und Freunde wussten, dass ich ein großer Fußballfan bin, folgte sogleich die nächste, etwas kniffligere Frage. »Wenn Iran gegen Deutschland Fußball spielt, wer soll dann gewinnen?« Auch hier wollte ich keine Entscheidung fällen und antwortete: »Ich wünsche mir, dass Iran irgendwann mal eine so starke Mannschaft hat, dass sie gegen Deutschland unentschieden spielen kann.« In diesem Wunsch nach einem Unentschieden zeigte sich bereits früh mein Streben nach Harmonie zwischen beiden Welten.
Das ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Die kulturellen Unterschiede zwischen Iran und Deutschland einerseits und die jeweiligen Alltagsrealitäten andererseits sind zum Teil gravierend. Glaubt man Umfragen, gibt es kaum ein Land mit weltweit negativerem Image als die Islamische Republik. Nun kann man natürlich darüber streiten, inwiefern das auf eine undifferenzierte Medienberichterstattung zurückzuführen ist, die sich primär auf Negativschlagzeilen konzentriert und so ein besonders düsteres Bild Irans zeichnet. Unstrittig ist jedoch, dass es eben sehr wohl schockierende Realitäten in Iran gibt, die ein schlechtes Licht auf das Land werfen und für Unbehagen sorgen – besonders in Ländern wie Deutschland. Vielen ist Iran als ein Land bekannt, in dem es öffentliche Hinrichtungen gibt, in dem Frauen gesetzlich benachteiligt und Minderheiten entrechtet werden. Sie erfahren, dass in der Islamischen Republik eine systemkritische Opposition keinen politischen Spielraum hat und mitunter strafrechtlich verfolgt wird. Überdies nehmen Menschen weltweit zur Kenntnis, dass zahlreiche Bürgerrechtsaktivisten und politische Dissidenten in Haft sitzen und in den Gefängnissen fürchterliche Verhältnisse herrschen. Wenn beim Freitagsgebet in Teheran Tausende Menschen die Fäuste in die Luft recken und »Marg bar Amrika! – Nieder mit Amerika!« und »Marg bar Esra’il! – Nieder mit Israel!« skandieren, läuft vielen ein eiskalter Schauer über den Rücken.
In Iran trifft man auf niemanden, weder auf gesellschaftlicher noch auf politischer Ebene, der diese Realitäten leugnet. Spätestens im vertrauensvollen Gespräch wird offen über die schwerwiegenden Probleme des Landes geredet – auch in höchsten politischen Kreisen. Denn es ist ja keineswegs so, als bekämen sie all das nicht mit. Öffentliche Institutionen wie das Academic Center for Education, Culture and Research (Djahad-e Daneshgahi) erheben detailreiche Statistiken zu allen gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen. Besonders problembeladene oder sensible Erkenntnisse dieser Umfragen werden jedoch nicht öffentlich zugänglich gemacht und nur auf höchster politischer Ebene in Umlauf gebracht – vor allem, wenn es um Probleme wie Drogenmissbrauch, Kriminalität und Jugendarbeitslosigkeit geht. Es wird zwar einerseits dafür gesorgt, dass sich die zuständigen staatlichen Stellen der Probleme bewusst sind, andererseits aber auch versucht, eine öffentliche Debatte darüber zu vermeiden. Das mag vor allem sicherheitspolitische Gründe haben. Man möchte keine Proteste riskieren, wenn bestimmte Probleme offen angesprochen werden, ohne dass es dafür vorzeigbare Lösungsansätze seitens der Politik gibt. Sicherlich spielen auch machtpolitische Erwägungen eine Rolle, wenn die politische Führung des Landes ihre Versäumnisse nicht einräumen und sich keiner öffentlichen Kritik ausgesetzt sehen möchte. Es ist aber auch ein generelles Phänomen in Iran, dass über innenpolitische Probleme höchst ungern öffentlich gesprochen wird. Einzig wenn die amtierende Regierung von ihren politischen Gegnern kritisiert wird, erfährt man von Korruption, sozialer Ungleichheit und hoher Arbeitslosigkeit, für die sie verantwortlich sei. Solche Kritik an der Regierung erfolgt jedoch vornehmlich aus machtpolitischem Kalkül und hat nicht primär zum Ziel, die Missstände tatsächlich beheben zu wollen.
Zudem bleiben die öffentlichen Diskussionen inhaltlich vage. Vieles wird angedeutet, wenig konkretisiert. Will man z.B. in einer Podiumsdiskussion oder einem Interview Politiker kritisieren, spricht man von »manchen« (»ba’ziha«), statt die betreffende Person beim Namen zu nennen, obwohl der informierte Zuhörer genau weiß, wer gemeint ist. Diese Form der Rücksichtnahme (molahezeh) dient vor allem der Gesichtswahrung (hefz-e aberu). Weder gibt man sich selbst die Blöße, noch stellt man andere dadurch bloß, in aller Offenheit gesprochen oder andere in Verruf (aberurizi) gebracht zu haben. Der Politiker, der sich am allerwenigsten daran gehalten hat, war der ehemalige Staatspräsident Mahmud Ahmadinejad. Er attackierte gezielt seine politischen Gegner namentlich. Auch aus diesem Grund ist er im Laufe seiner Amtszeit bei weiten Teilen der politischen Elite des Landes in Ungnade gefallen.
Diese Besonderheit der politischen Kultur Irans kommt nicht von ungefähr, man findet sie auch im Privaten. Denn auch Familien versuchen häufig, in einem guten Licht zu erscheinen und Angelegenheiten, wie z.B. Krankheiten oder finanzielle Not, möglichst nicht nach außen dringen zu lassen. Solche Themen möchte man lieber nur unter sich oder mit Vertrauten besprechen. Davon ausgenommen sind gesellschaftspolitische Probleme des Landes, schließlich betreffen diese nicht die eigene Familie, und man kann offener darüber streiten. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Denn wenn sich wie im Falle des Nuklearstreits die Weltmächte in der iranischen Wahrnehmung zusammenschließen, um die Islamische Republik wirtschaftlich und politisch unter Druck zu setzen, tendieren viele Iraner gegenüber ausländischen Gesprächspartnern dazu, ihr Land in Schutz zu nehmen, und sprechen daher nur ungern über die verschiedenen inneriranischen Probleme.
Dann spürt man bei seinem Gegenüber eine defensive Haltung – ein Bedürfnis, Missstände zu relativieren oder zu betonen, dass es die Weltmächte mit Iran noch nie gut meinten. Üblicherweise folgen dann Ausführungen darüber, dass es in anderen Ländern auch Menschenrechtsprobleme gebe, dass der Westen doppelte Standards anwende und gegenüber Ländern wie Saudi-Arabien schweige und dass die Situation in Iran ja auch gar nicht so schlimm sei, wie sie immer wieder dargestellt werde. An all diesen Punkten ist sicher etwas Wahres, doch ist eine solch defensive und relativierende Haltung gegenüber den negativen Realitäten eigentlich gar nicht notwendig. Denn diesen, sagen wir, Schwächen steht eine Reihe von Stärken gegenüber. Blickt man auf die Gesamtheit dessen, was Iran als Land und die Iraner als Volk ausmacht, könnte man viel selbstbewusster und bereitwilliger über fortwährende Probleme sprechen. Denn das Land weist in allen Bereichen das notwendige Potenzial auf, Missstände aus eigener Kraft zu überwinden.
Als Iraner, der in Deutschland lebt, erfahre ich selber, wie ich in Iran dazu neige, westliche Positionen und Realitäten zu erklären. Egal, ob es die Frage nach der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel ist oder es aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen sind (»Nein, keine Sorge! Deutschland wird seine Muslime vor der AfD schützen«). Gleichzeitig erachte ich es als meine Aufgabe, außerhalb Irans die Islamische Republik, ihre politischen Dynamiken und gesellschaftlichen Entwicklungen verständlich zu machen (»Nein, das ist zu kurz gegriffen! Die Situation in Iran ist viel komplexer, als man denkt«).
Als jemand, der in eine sehr politische iranische Familie geboren ist und jährlich mehrere Male in verschiedene Teile des Landes reist, habe ich das Glück, authentische Einblicke sowohl auf der politischen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene zu erhalten. Unter Politikern, Akademikern, Sicherheitsexperten und Journalisten erfreue ich mich der Möglichkeit, sowohl mit erzkonservativen Hardlinern als auch mit liberalen Reformern und unabhängigen Denkern im Gespräch zu sein. Der Kreis von Verwandten, Freunden und Bekannten, mit denen ich mich über die Situation im Land unterhalten kann, reicht vom wohlhabenden Unternehmer aus dem Norden Teherans bis zum sehr einfach lebenden Viehzüchter in einem nur 150 Einwohner zählenden Dorf vor der Stadt Alamdeh am Kaspischen Meer.
Politiker interpretieren tagesaktuelle Themen stets gemäß ihrer politischen Ausrichtung. Ich halte es für notwendig, auch mit jenen das Gespräch zu suchen, deren ideologische Einstellung für einen selbst schwer erträglich, dogmatisch oder radikal ist. Der Erkenntnisgewinn ist nämlich enorm, denn absurd anmutende Aussagen zwingen einen aufgrund des gedanklichen Schocks, den sie erzeugen, zum Nachdenken. Hierbei stellt man entweder fest, dass Teile dieser Aussagen doch gar nicht so abwegig sind – was eine echte Wissenserweiterung mit sich bringt. Oder man ruft sich noch einmal in Erinnerung, warum man dieser absurd wirkenden Aussage nicht zustimmen kann – womit man sich die eigenen Überzeugungen erneut argumentativ in Erinnerung gerufen hat. Wer sich für Iran mehr Pluralismus und Offenheit wünscht, muss daher auch selber pluralistisch und offen auf unterschiedliche Gesprächspartner zugehen. Schließlich bedeutet miteinander im Gespräch zu sein keineswegs, einander zuzustimmen.
Die einfachen Menschen auf der Straße, in Redaktionen, Cafés und Hörsälen wiederum erzählen mir ihre sehr persönlichen Sichtweisen auf die Lebensrealität Irans – wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch und kulturell. Natürlich gibt es in den Ausführungen jede Menge Gemeinsamkeiten. Und genau diese Gemeinsamkeiten sind es, die es mir als Autor erlauben, auch mal Sätze zu formulieren, die mit »die Mehrheit der Iraner sagt …« oder »viele Iraner sind der Auffassung, dass …« beginnen. Solche Aussagen sollen jedoch nur eine allgemeine Tendenz wiedergeben. Über sie kann und muss diskutiert werden. Solange das Durchführen repräsentativer Umfragen in Iran sehr schwierig bleibt, sind Ergebnisse von Meinungsumfragen – besonders zu brisanten innenpolitischen Themen – mit Vorsicht zu genießen.
Nach all diesen Gesprächen, zusätzlichen Recherchen und dem fortwährenden Lesen iranischer Medien entstand bei mir ein Gesamtbild der derzeitigen Realitäten in der Islamischen Republik. Ich sage hier bewusst Realitäten im Plural, denn es existieren in Iran viele Wahrheiten, Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen. Man entdeckt jede Menge Grautöne, wo ein einfaches Schwarz-Weiß vermutet wurde.
Darum geht es mir in diesem Buch. Ich möchte das gesellschaftspolitische Umfeld, in dem über 80 Millionen Menschen leben, mit all seinen Spannungsfeldern und bestehenden Dynamiken vorstellen. Während primär der Facettenreichtum und die Komplexität des Landes aufgezeigt werden, dient das Buch auch der Entmystifizierung Irans. Denn nicht alles, was Iran auszeichnet, ist aus westlicher Perspektive ungewöhnlich, kompliziert oder befremdlich. Vieles ist sogar ganz normal. Natürlich ist es unmöglich, in einem solchen Buch den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Jedoch ist es mein Anliegen, möglichst viele Aspekte zu beleuchten, die neugierig machen und zu weiterführender Lektüre anregen. Sie werden ebenso feststellen, dass ich bei der Wiedergabe der Aussagen meiner Gesprächspartner nur selten eine eigene Kommentierung vornehme. Denn es erscheint mir unerlässlich, deren Ausführungen und Ansichten für sich sprechen zu lassen und Ihnen als Leserin oder Leser weder den eigenen Eindruck noch die eigene Deutung zu nehmen.
Der überwiegenden Mehrheit der an Iran Interessierten bereitet die Menschenrechtslage des Landes Sorgen. Die wohl am besten recherchierten Informationen darüber bietet Amnesty International, deren Reporte im Internet frei zugänglich sind. Dieses Buch wird immer wieder auf bestehende Missstände im Hinblick auf die Bürgerrechte hinweisen. Ich habe mich jedoch bewusst dazu entschieden, den Schwerpunkt auf die Potenziale, Chancen und vielversprechenden Dynamiken in der Politik, der Wirtschaft, den Medien und in der Zivilgesellschaft zu legen. Denn nur wenn man sich dieser bewusst wird, ist eine realistische Einschätzung der Realitäten und Zukunftsperspektiven der Islamischen Republik Iran möglich.
All das, was gestern geschah und heute Realität ist, wird morgen von Bedeutung bleiben. Es gilt, in den folgenden Kapiteln darzustellen, innerhalb welcher Spannungsfelder und im Wechselspiel welcher Gegenpole die Zukunft der Islamischen Republik Iran gestaltet wird. Die Beschäftigung mit diesen Themen wird dabei helfen, die Ausrichtung der verschiedenen Wandlungsprozesse in Iran nachzuvollziehen. Man muss aber auch erkennen, in welchem Tempo und in welchen Schritten diese Prozesse erfolgen können. Mit der Beschreibung der wichtigsten staatlichen und gesellschaftlichen Organe, Institutionen und Strukturen möchte ich deutlich machen, dass es in allererster Linie die Menschen in Iran sind, die am besten beurteilen können, welche Veränderungen für ihr Land die richtigen sind und welcher Weg sie dorthin führt. Auch sind nur sie es, die das Tempo dieses Prozesses vorgeben können.
Zu guter Letzt: Schreibt man als in Deutschland lebender Iraner ein Buch über die Islamische Republik, riskiert man, Leserinnen und Leser in beiden Ländern vor den Kopf zu stoßen. Dafür sind bestimmte Sachverhalte schlichtweg zu umstritten – ganz gleich, wie man sie darstellt. Sei es die Menschenrechtssituation, die politische Haltung Irans zu Israel, die Bedeutung der Religion in der Politik oder die Rolle der Revolutionsgarden. Es gibt jede Menge Wespennester, in die man als Autor unausweichlich stechen wird. Entscheidend ist jedoch die Bereitschaft, sich den Diskussionen zu stellen. Schließlich habe ich jedes Wort, jede These und jede Erklärung nach bestem Wissen und Gewissen formuliert.
Die Revolution weist den WegZwischen Demokratie und Theokratie
»So, Ahmad. Die Namen der Kandidaten habe ich schon mal. Jetzt sag mir die dazugehörigen Codes. Aber langsam, damit ich bloß nichts durcheinanderbringe.« Ahmad räuspert sich kurz, nimmt den vor ihm liegenden Handzettel mit der Liste der Kandidaten in die Hand und liest seinem Kumpel leise, aber deutlich vor:
»6492 für Aref.«
»Chob!«
»1965 für Oladeghabad.«
»Chob!«
»2148 für Badamtchi.«
»Chob!«
»2846 für Djalali.«
»Chob!«
Am Ende der Liste angekommen, hat Ahmad 46 Codes und die dazugehörigen Nachnamen vorgelesen und sein Kumpel 46 Mal »Chob!« – »Okay!« gesagt. Dann wechseln sie die Rollen, und Ahmad lässt sich Namen und Codes von seinem Freund diktieren.
Es ist der 26. Februar 2016. Die beiden befinden sich in einem Wahllokal im Teheraner Stadtteil Gisha. Sie nehmen an den parallel stattfindenden Wahlen für das Parlament und den sogenannten Expertenrat teil. Aus der mit Abstand bevölkerungsstärksten Provinz Teheran können bis zu 30 Kandidaten ins Parlament und 16 in den Expertenrat gewählt werden. Auf den entsprechend riesigen Wahlzetteln muss jeder Wähler alle Namen handschriftlich eintragen sowie den dazugehörigen vierstelligen Code eines jeden Kandidaten. »Das ist echt ’ne Menge Arbeit, wenn wir wählen gehen«, sagt Emad Chonsari. »Damit zeigen wir, wie wichtig uns Wahlen sind.« Schmunzelnd fügt der frisch verheiratete Politikstudent hinzu, dass in vielen Ländern Wähler dagegen »einfach nur Kreuze machen oder einen Knopf drücken müssen«. Dass bei Wahlen in Iran lange Schlangen vor den Wahllokalen entstehen, liege also nicht nur an der stets hohen Beteiligung, sondern auch daran, »dass die Stimmenabgabe 10 bis 15 Minuten pro Wähler dauert«.
Gewählt wird in Iran in Schulen und Moscheen. Anders als z.B. in Deutschland können sich Wähler aussuchen, in welchem Wahllokal sie ihre Stimme abgeben. Man muss nur in der eigenen Provinz bleiben. Natürlich ist auch in Iran die Wahl geheim, aber die Szene in einem Wahllokal gleicht eher einem Besuch auf dem Basar. Überall liegen kleine Flugblätter und Wahllisten herum. Viele legen ihr Smartphone oder Tablet vor sich, um die Namen und Codes abzuschreiben. Auf diese Weise ist natürlich auch für andere ersichtlich, wer für wen seine Stimme abgibt. Wahlbeobachter laufen zwar durch die Räume, doch sie räumen nur hin und wieder die Tische auf, werfen Flugblätter weg, bevor die nächsten Wähler wieder welche mitbringen und liegen lassen – teilweise mit Absicht, um Unentschlossene bei der Stimmabgabe zu beeinflussen.
* * *
Seit der Gründung der Islamischen Republik Iran 1979 haben 34 Wahlen stattgefunden. Doch was bedeuten Wahlen in einem politischen System wie dem der Islamischen Republik? Ist der Gottesstaat, wie er häufig genannt wird, nun eine Theokratie oder eine Demokratie? Ist das System islamisch oder republikanisch? Was bedeutet eine Wahlbeteiligung von meist über 60 Prozent für eine Theokratie? Häufig hört man, die Wahlen in Iran hätten keine Bedeutung, weil sie nicht demokratisch seien. Aber warum überraschen die Ergebnisse dann immer wieder? Wenn die Wahlen in Iran jedoch demokratisch, also geheim und frei sind, warum werden dann so viele Kandidaten nicht zur Wahl zugelassen und manche Präsidentschaftskandidaten seit mehreren Jahren unter Hausarrest gestellt?
All diese Widersprüchlichkeiten entstehen, weil das politische System der Islamischen Republik theokratische und demokratische Eigenschaften in sich vereint. Es existieren in ihr direkt gewählte, demokratisch legitimierte Institutionen neben solchen, die von staatlichen Stellen legitimiert werden und Einfluss auf die vom Volk gewählten Einrichtungen ausüben. Zwar gibt es in jedem politischen System gewählte und nicht gewählte Institutionen. Auch in Demokratien wird weder die Führung der Justiz noch die des Militärs von der Bevölkerung gewählt. Der Einfluss nicht gewählter Institutionen auf die Arbeit der demokratisch legitimierten Regierung ist in Iran jedoch vergleichsweise groß. So können vor allem die Justiz und der Sicherheitsapparat (Militär, Geheimdienste, Polizei etc.) die Regierungsarbeit konterkarieren. Man unterscheidet in Iran zwischen der Regierung und der sogenannten Systemelite, die aus den etwa 30 bis 40 einflussreichsten Akteuren in Politik, Geistlichkeit und Militär besteht. Manche sind derzeitige Amtsträger in offizieller Funktion, andere waren früher im Staatswesen tätig und sind aufgrund ihrer Autorität weiterhin politisch relevant. Für jede Regierung in der Islamischen Republik ist es daher wichtig, ein gutes Verhältnis zu den wichtigsten Personen der Systemelite zu pflegen. Denn neben dem Rückhalt in der Bevölkerung braucht die Regierung auch deren Unterstützung.
Daraus entsteht ein Spannungsfeld zwischen den politischen Kräften, die die demokratisch legitimierten Einrichtungen der Islamischen Republik stärken wollen, und jenen, die die unantastbare Position nicht gewählter Institutionen befürworten. Die Islamische Republik Iran befindet sich so in einem ständigen Tauziehen zwischen Demokratie und Theokratie.
Die Verfassung Irans sieht vor, dass vier politische Institutionen vom Volk direkt gewählt werden: der Staatspräsident, das Parlament, der Expertenrat und die Kommunal- und Stadträte. Die Kommunal- und Stadträte (shora-ye shahr) stellen auf lokaler Ebene die unterste Stufe des politischen Systems Irans dar. Ihre Geschichte reicht bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als im Zuge der Konstitutionellen Revolution 1905 bis 1907 das erste Parlament im Nahen und Mittleren Osten entstand. Seither wurde die Funktion dieser Räte mal ausgesetzt, mal abgeschafft, erneut ins Leben gerufen und so fort. So hat man während des Iran-Irak-Krieges (1980–88) die Kommunal- und Stadtratswahlen ausgesetzt, sie aber 1998 wieder eingeführt.
Alle vier Jahre werden lokale Politiker in diese Räte gewählt. Als Kommune gilt etwa ein einzelnes Dorf oder aber der Bezirk einer größeren Stadt. Ähnlich wie in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden kümmern sich diese Räte um lokale Angelegenheiten wie Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Kultur und Regionalwirtschaft. In einem großflächigen Vielvölkerstaat wie Iran mit seinen unterschiedlichsten geografischen Gegebenheiten ist diese lokale Entlastung für eine Zentralregierung sicherlich notwendig. Bemerkenswert ist dabei, dass die iranische Verfassung der Zentralregierung untersagt, Verantwortlichen eines Kommunalrats in lokalen Angelegenheiten Anweisungen zu geben. Im Gegenteil: Die Regierung in Teheran muss sich in regionalen und lokalen Belangen den Kompetenzen der Kommunalräte beugen. Dieser föderale Ansatz bietet den Bürgern die Chance, die Verantwortung für Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, wie z.B. Schulen, Krankenhäuser, Lebensmittelversorgung etc., jenen lokalen Politikern zu übertragen, die mehrheitlich ihre Interessen vertreten, was für ein zentral regiertes Land wie Iran überrascht.
Im Gegensatz zu anderen repräsentativen Institutionen des Systems werden Kandidaten der Kommunal- und Stadträte aber nicht vorher vom Wächterrat geprüft, d.h., zentralstaatliche Stellen haben keinerlei Einfluss darauf, wer kandidieren darf und gewählt werden kann. Bei allen anderen Wahlen auf nationaler Ebene kann der Wächterrat indes Kandidaten ablehnen.
Das Parlament der Islamischen Republik Iran wird offiziell madjles-e shora-ye eslami1 oder kurz madjles genannt. Aus den 31 Provinzen des Landes werden insgesamt 290 Abgeordnete für eine vierjährige Amtszeit in das Parlament gewählt. Entsprechend ihrer Bevölkerungsgröße werden aus den Provinzen mindestens drei (z.B. aus der kleinen Provinz Ilam) und maximal 30 Abgeordnete (aus der bevölkerungsreichsten Provinz Teheran) entsandt. Zwar vertreten die Parlamentarier die Belange ihrer Wahlkreise, es ist jedoch ihre Pflicht, als Abgeordnete des Parlaments nationale Angelegenheiten prioritär zu behandeln. Für die anerkannten religiösen Minderheiten – Juden, Christen und Zoroastrier – werden fünf Sitze im Parlament reserviert, da sie aufgrund ihrer geringen Anzahl an der Gesamtbevölkerung sonst Gefahr laufen würden, nicht genügend Stimmen für ihre Repräsentanten zu erhalten.
Klassische Parteien weisen eine klare innere Struktur auf und verfügen über ein Parteiprogramm. Beides fehlt iranischen Parteien. Der Sprecher des Parlaments, Ali Laridjani, hat dies wiederholt beklagt, wie zuletzt auf einer Pressekonferenz am 1. Dezember 2015, in der er hervorhob, dass die Parlamentswahlen zu sehr auf einzelne Abgeordnete statt auf Parteien fokussiert seien.
Das iranische Parlament besteht somit in erster Linie aus Einzelpersonen, die politischen Strömungen angehören, aber keine gemeinsame und verbindliche Struktur als Parlamentsfraktion haben. Die Regierung kann sich also nicht auf eine Fraktionsdisziplin, wie man sie aus Deutschland kennt, verlassen. Vielmehr muss sie in jeder Frage die Mehrheit der Abgeordneten neu gewinnen. Dem Parlament werden hierbei laut Verfassung vier Funktionen zugesprochen. Bei der Ausübung dieser Funktionen und der Zusammenarbeit mit der Regierung kommt der eigentliche politische Einfluss des Parlaments zur Geltung. Erfolg oder Misserfolg einer jeden amtierenden Regierung hängt also davon ab, ob sich das Parlament bei der Ausübung seiner vier Parlamentsfunktionen regierungsfreundlich oder eher regierungskritisch verhält.
Die Gesetzgebungsfunktion des Parlaments sieht vor, eigene Gesetzesentwürfe zu entwickeln oder Gesetzesinitiativen der Regierung zu prüfen und über sie abzustimmen. Ohne breite parlamentarische Zustimmung können keine neuen Gesetze verabschiedet oder bestehende verändert werden. Das verleiht dem Parlament einen großen Einfluss auf Minister und den Staatspräsidenten, und umgekehrt muss die Regierung viel mehr Überzeugungsarbeit als in westlichen Demokratien leisten.
Die Kommunikationsfunktion besagt, dass alle Parlamentsdebatten live im staatlichen Rundfunk übertragen werden. Lob und Kritik der Parlamentarier am Staatspräsidenten oder an einzelnen Ministern erfahren so landesweite Aufmerksamkeit.
Auch durch seine Kontrollfunktion kann das Parlament die Regierung unter Druck setzen. Den Abgeordneten steht es zu, einzelne Minister ins Parlament einzubestellen und einen Rechenschaftsbericht über ihre Tätigkeit zu verlangen. Auch das Haushaltsbudget obliegt der Kontrolle des Parlaments. Der Staatspräsident muss den Staatshaushalt für das folgende Kalenderjahr einem gesonderten parlamentarischen Ausschuss zur Prüfung vorlegen. Eine anschließende Diskussion wird ebenfalls öffentlich übertragen. So wollte die derzeitige Regierung das Verteidigungsbudget kürzen, was das Parlament jedoch verhinderte.
Und schließlich nimmt das Parlament durch seine Wahlfunktion direkten Einfluss auf die Zusammensetzung der Regierung. Jeder vom Staatspräsidenten nominierte Minister braucht das Vertrauen von zwei Dritteln des Parlaments, bevor er als solcher vereidigt werden kann. Darüber hinaus hat das Parlament die Möglichkeit, Minister mittels eines Amtsenthebungsverfahrens (estizah) aus dem Amt zu wählen. Ähnlich wie in Deutschland spielt es aber durchaus eine Rolle, welcher politischen Strömung der nominierte Minister angehört. Der Reformer Mohammad Chatami holte ausschließlich seinesgleichen ins Kabinett. Unter Ahmadinejad bestand das Kabinett nur aus Prinzipientreuen. Unter Hassan Rohani ist das anders. Hier finden sich sowohl Kabinettsmitglieder aus dem Kreis der Reformer wie auch aus dem Lager der Prinzipientreuen. Diese fraktionsübergreifende Zusammensetzung des Kabinetts bildet den Kern der pragmatischeren Politik Hassan Rohanis.
Die bestehenden Parteien Irans organisierten sich bisher innerhalb zweier politischer Lager (djenah): den Prinzipientreuen (osulgera) und den Reformern (eslahtalab). Da es keine klar voneinander zu trennenden Parteien gibt, entstehen kurz vor Parlamentswahlen mehrere Wahllisten. Bei der letzten Wahl 2016 traten die reformorientierte »Liste der Hoffnung« (list-e omid), die »Große Koalition der Prinzipientreuen« (e’telaf bozorg-e osulgerayan) sowie die weitestgehend aus unabhängigen Kandidaten formierte »Koalition der Stimme des Volkes« (e’telaf-e seda-ye mellat) an. Die Bezeichnung Koalition (e’telaf) bedeutet, dass sich kleinere Parteien und Einzelakteure zusammengeschlossen haben, und ist nicht als ein Zusammenschluss von Parteien zur Regierungsbildung zu verstehen, wie etwa in Deutschland. Interessanterweise lassen sich manche Kandidaten auf mehreren Wahllisten aufstellen. So erhöhen sie ihre Chance, ins Parlament gewählt zu werden. Kaum jemand wird ihnen das vorwerfen, denn die auf einer Wahlliste aufgestellten Kandidaten unterliegen später im Parlament ja keinem Fraktionszwang.
Das Wählerverhalten hat jedoch gezeigt, dass immer mehr Menschen nach ganzen Listen, also einer politischen Strömung, und seltener einzelne Kandidaten gewählt haben. Dies kam vor allem der reformorientierten »Liste der Hoffnung« (list-e omid) zugute. Politiker dieser Liste galten als Unterstützer der Regierung von Hassan Rohani. Von ihr erhofften sich die Wähler eine innenpolitische und außenpolitische Öffnung des Landes sowie einen wirtschaftlichen Aufschwung. Damit haben es auch wenig bekannte Personen ins Parlament geschafft. Es wird zu beobachten sein, ob dieses »listenorientierte« Wählen das politische Verhalten der Abgeordneten im Besonderen prägen wird und sie stärker als bisher im Parlament üblich als eine Fraktion auftreten. Inzwischen ist auch die Einführung einer elektronischen Stimmabgabe im Gespräch. Für die Präsidentschaftswahl 2017 wird ein erster Testlauf zwischen Innenministerium und Wächterrat diskutiert. Die ansonsten so geduldigen Wähler dürften eine solche Modernisierung der Wahlen sicher begrüßen, da sie die Stimmabgabe besonders bei Parlamentswahlen deutlich vereinfachen würde.
Seit der Präsidentschaft von Hassan Rohani gibt es neben den Prinzipientreuen und den Reformern mit den Moderaten (e’tedaliun) eine weitere politische Strömung, die an Bedeutung gewinnt. In ihr versammeln sich progressive Vertreter aus dem Lager der Prinzipientreuen einerseits und konservative Akteure aus dem Reformlager andererseits, die in vielen politischen Fragen (z.B. der Wirtschafts-, Außen- und Sicherheitspolitik) mittlerweile einer Meinung sind. Diese Entwicklung hin zu einer politischen Mitte war entstanden, da jene Politiker in beiden Lagern, die eine Weiterentwicklung von Staat und Gesellschaft befürworteten, sich innerhalb ihrer Strömungen nicht durchsetzen konnten. Dies bedeutet aber auch, dass in den beiden bisherigen Lagern die radikalen Kräfte zurückbleiben und an politischem Einfluss verlieren.
Die Bedeutung der politischen Lager im Parlament ist allerdings nur in der Provinz Teheran wirklich stark ausgeprägt. Hier spielt eine Art Fraktionszwang durchaus eine Rolle. Teheraner Abgeordnete sind die im Vergleich zu anderen bekannteren Politiker, sind in den Medien präsenter und prägen daher den politischen Diskurs im gesamten Land. Dass im derzeitigen Parlament alle aus Teheran stammenden Abgeordneten dem Lager der Reformer und Moderaten angehören, wird den amtierenden Staatspräsidenten freuen. So kann er hoffen, dass das Parlament in Zukunft seine Reformpolitik unterstützt.
Wenn man sich jedoch vom Wahlkreis Teheran entfernt und Wahlkreise des Parlaments in anderen Provinzen betrachtet, spielen die Parteienlandschaft und Fraktionszugehörigkeit bei den Parlamentariern eine deutlich kleinere Rolle. Vielmehr zählen für diese Abgeordneten der infrastrukturelle Aufbau ihrer Provinz sowie die Verbesserung der sozioökonomischen Lebensverhältnisse ihrer Wählerschaft. Und da viele dieser Ziele nur mit Regierungsmitteln umzusetzen sind, versuchen sich diese Politiker mit der amtierenden Regierung gut zu stellen, um für ihren Wahlkreis Budgets zu sichern. So entsteht häufig eine regierungsfreundliche Mehrheit im Parlament, die zwar nicht unbedingt parteipolitisch im Einklang mit der Regierung ist, sehr wohl aber z.B. deren Wirtschaftspolitik unterstützt.
Der Staatspräsident (ra’ise djomhur) ist die wichtigste Institution, die vom Volk alle vier Jahre direkt gewählt wird. Ähnlich wie in Frankreich und den USA kann der Staatspräsident nur einmal wiedergewählt werden. Erst nach Ablauf der Amtszeit eines Präsidenten können sich Amtsvorgänger erneut zur Wahl stellen.
Ein Präsidentschaftskandidat benötigt im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Erhält keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, entscheidet eine Stichwahl mit einfacher Mehrheit.
Der Staatspräsident hat die Aufgabe, die Minister seines Kabinetts zu benennen. Da diese jedoch von einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament bestätigt werden müssen, halten die kandidierenden Minister im Plenum eine Antrittsrede. Gegner und Befürworter des Kandidaten aus der Reihe der Parlamentarier halten vor der Abstimmung kurze Anschlussreden. Interessant hierbei ist, dass Gegner zehn Minuten Redezeit erhalten, während Befürworter das Podium nur fünf Minuten lang betreten dürfen. In diesem Abstimmungsprozess, der sich über eine ganze Woche hinzieht, wird deutlich, wie groß die Unterstützung des frisch gewählten Staatspräsidenten im bereits bestehenden Parlament ist. Je mehr Minister abgelehnt werden, desto mehr muss sich der Regierungschef auf Widerstand aus dem Parlament vorbereiten.
Nun übt aber nicht nur das Parlament Einfluss auf die Wahl der Minister aus. Leiter wichtiger Ressorts, wie die des Außen- und des Innenministeriums, des Verteidigungs- und des Geheimdienstministeriums, können nur mit der Zustimmung des Revolutionsführers ernannt und vereidigt werden.
Die vierte und letzte Institution mit repräsentativem Charakter ist der direkt vom Volk gewählte Expertenrat. Der madjles-e chobregan-e rahbari besteht aus 88 Geistlichen, die ebenso wie das Parlament aus Vertretern der 31 Provinzen des Landes gewählt werden. Während für kleinere Provinzen je ein Sitz in diesem Rat vorgesehen ist, ist die Provinz Teheran mit 16 Geistlichen im Expertenrat vertreten. Gewählt wird er alle acht Jahre.
Die Aufgaben des Expertenrats bestehen darin, den Revolutionsführer zu ernennen, ihn in seiner Amtsausführung zu überwachen und ihn gegebenenfalls auch seines Amtes zu entheben. Somit verleiht der vom Volk direkt gewählte Expertenrat dem Revolutionsführer indirekte demokratische Legitimität. Natürlich setzt dies aber voraus, dass dieses Gremium den Willen seiner Wählerschaft hinreichend repräsentiert. Inwieweit das tatsächlich geschieht, lässt sich kaum überprüfen, da die Sitzungen des Expertenrats unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.
Der Revolutionsführer (rahbar-e enghelab)2 ist die höchste Entscheidungsinstanz im politischen System Irans – das Staatsoberhaupt. Seine Autorität basiert auf dem Konzept der »Herrschaft des Rechtsgelehrten« (velayat-e faghih). Als solcher muss er mindestens den religiösen Rang eines Ayatollah bekleiden. Seine Aufgabe ist es, darüber zu wachen, dass die Politik gemäß der islamischen Lehre handelt. Zudem gilt er als religiöse Autorität für die Muslime weltweit. Keine politische Entscheidung von größerer innen- oder außenpolitischer Bedeutung wird ohne seine Zustimmung gefällt. In seinen zahlreichen Predigten und Ansprachen gibt er die Grundsätze für alle relevanten Politikfelder vor, von der Kultur über die Wirtschaft bis hin zur Außen- und Sicherheitspolitik. Innerhalb des von ihm inhaltlich vorgegebenen, aber zum Teil sehr abstrakten Rahmens gestalten Regierung, Parlament und Justiz dann konkrete Politik.
Zu den Kompetenzen des Revolutionsführers gehört auch die Ernennung einer ganzen Reihe von sehr einflussreichen Personen und Institutionen innerhalb des politischen Systems. Er allein ernennt den Chef der Polizei- und Ordnungskräfte des Landes (niru-ye entezami), den Leiter der staatlichen Rundfunkanstalt IRIB (seda va sima), den Präsidenten der Justiz (re’is-e ghovve-ye ghazai-ye) sowie die ranghöchsten Kommandeure der Nationalen Armee (artesh) und der Revolutionsgarden (sepah-e pasdaran). Die beiden Letztgenannten unterstehen dem ebenfalls vom Revolutionsführer gewählten Generalstabschef. Oberster Befehlshaber des Militärs bleibt jedoch der Revolutionsführer selbst.
Während es auch in demokratischen Ländern nicht unüblich ist, dass der Präsident die obersten Richter ernennt oder Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, ist dagegen in Iran der Einfluss des Revolutionsführers auch auf den staatlichen Rundfunk sehr groß, denn er besitzt die Hoheit über das einflussreichste Kommunikationsmedium im Land. Die staatliche Rundfunkanstalt IRIB ist mit einer riesigen Infrastruktur ausgestattet, mit der private Medienanstalten nicht konkurrieren können. So stellt der Revolutionsführer sicher, dass er seine Grundsatzreden und Vorgaben an die Politik stets über alle Kanäle der staatlichen TV- und Radioanstalten senden kann.
Auch die Zusammensetzung des Wächterrates (shora-ye negahban) gehört zu den Aufgaben des Revolutionsführers. Er besteht aus zwölf Personen, sechs islamischen Rechtsgelehrten und sechs Verfassungsrechtlern. Primäre Aufgabe des Wächterrates ist es, Gesetzesentwürfe, die im Parlament verabschiedet wurden, auf ihre Vereinbarkeit mit dem Islamischen Recht und der Verfassung zu überprüfen. Somit »wacht« dieser Rat über die Verfassung und die Scharia. Die sechs islamischen Rechtsgelehrten werden vom Revolutionsführer ernannt, die sechs Verfassungsrechtler hingegen vom Parlament gewählt. Der Präsident der Justiz ernennt hierfür mehrere Kandidaten, aus denen das Parlament sechs Vertreter in den Wächterrat wählt. Findet ein Gesetzentwurf in beiden Gremien keine Zustimmung, wird der sogenannte Feststellungsrat3 angerufen, dessen 30 Mitglieder ebenfalls vom Revolutionsführer allein bestimmt werden. Der Feststellungsrat dient dem Staatsoberhaupt als Beratungsinstanz und hat die Funktion, die Interessen des Systems (maslahat-e nezam), also nicht etwa des Volkes, zu wahren. In strittigen Fällen wiegt also die Einschätzung des Feststellungsrates schwerer als die des Wächterrates, und somit stehen im Zweifelsfall die politischen über den ideologischen oder verfassungsrechtlichen Bedenken.
Auf den ersten Blick ist ein solcher Vorgang bei der Gesetzgebung nicht ungewöhnlich. Auch in Deutschland wird ein Vermittlungsausschuss eingeschaltet, wenn sich Bundestag und Bundesrat bei Gesetzesentwürfen nicht einig werden. Jedoch werden sie hierzulande nur temporär einberufen. Überdies setzen sie sich aus gewählten Bundestagsabgeordneten zusammen und vermitteln dann zwischen den demokratisch legitimierten Institutionen Bundesrat und Bundestag. In der Islamischen Republik Iran hingegen schränken zwei nicht gewählte Institutionen – Wächterrat und Feststellungsrat – die Gesetzgebungsfunktion des gewählten Parlaments ein.
Doch auch der Wächterrat übt einen erheblichen Einfluss auf die Zusammensetzung fast aller repräsentativen Institutionen aus. Sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten für Parlaments-, Expertenrats- und Präsidentschaftswahlen müssen von ihm zugelassen werden. In erster Instanz – der Registrierung im Innenministerium – findet bereits eine formelle Prüfung statt. Alle Kandidaten müssen iranische Wurzeln haben, in Iran geboren sein, einen postgraduierten Universitätsabschluss besitzen und ein tadelloses polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Die eigentliche Prüfung übt dann allerdings der Wächterrat aus. Er stellt sicher, dass die Kandidaten ohne jeden Zweifel hinter den Grundwerten der Islamischen Republik stehen. Niemand, der sich für die Wahlen zum Expertenrat, Parlament oder Staatspräsidenten aufstellen lassen möchte, darf auch nur den leisesten Verdacht erregen, eine Änderung des politischen Systems anzustreben. Während formale Kriterien wie Bildungsabschluss, Alter und Lebenslauf objektiv nachvollziehbar sind, fällt der Wächterrat seine Entscheidung über die politischen Ambitionen eines Kandidaten nach eigenem Gutdünken. Im Falle einer Ablehnung haben Kandidaten die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Auch wenn es schon Fälle einer Revision gegeben hat, bilden diese eher die Ausnahme.
Von den Kandidaten, die sich zu einer Wahl aufstellen lassen, wird nur ein Bruchteil zugelassen. So hatten sich für die Präsidentschaftswahl 2013 im Innenministerium 686 Kandidaten registrieren lassen. Nach der Prüfung durch den Wächterrat blieben nur acht übrig. Von den knapp 12.000 Kandidaten für die Parlamentswahl 2016 wurden nur etwas mehr als die Hälfte zugelassen. Bei den parallel stattfindenden Expertenratswahlen ließ der Wächterrat lediglich 161 von über 800 Kandidaten zu. Bei 88 zu vergebenden Sitzen bedeutete dies, dass die Konkurrenz um die vorhandenen Sitze nicht sehr groß war.
Einzig die Kommunal- und Stadträte bleiben von diesem Prüfungsverfahren des Wächterrats verschont. Hier gibt es zum Teil anderweitige lokal verankerte Zulassungsbeschränkungen wie ethnische Zugehörigkeit und Konfession oder Familienzugehörigkeit und sozialer Status. Zentralstaatliche Organe mischen sich hier jedoch nicht ein.
Es ist diese Nichteinmischung staatlicher Organe auf kommunaler Ebene, die den Fortbestand der Islamischen Republik sichert. Während viele ausländische Beobachter der Auffassung sind, die Islamische Republik halte sich nur durch Kontrolle und Unterdrückung ihrer Bevölkerung am Leben, wird die Bedeutung der politischen Arbeit auf lokaler Ebene missachtet. Es besteht kein Zweifel, dass auch in Iran politische Aktivisten, die sich gegen das System stellen, eingeschüchtert und inhaftiert werden. Doch ein Mindestmaß an politischer Teilhabe bleibt gesichert und gibt der Bevölkerung die Möglichkeit, Einfluss auf die politische Realität des Landes zu nehmen. Das zeigen die zum Teil überraschenden Wahlergebnisse, bei denen völlig unerwartet der vermeintliche Außenseiter Staatspräsident wird oder altgediente Parlamentarier plötzlich keine Stimmen mehr erhalten. Ebenso zeigen die unterschiedlich ausgerichteten Regierungen der letzten Jahre, dass Wahlen die Marschroute der Politik des Landes verändern können. Ob sich demokratische Prozesse auf lokaler Ebene auch auf die nationale übertragen lassen, hängt in den kommenden Jahren von zwei wichtigen Fragen ab: Wie verläuft das machtpolitische Tauziehen zwischen republikanisch und theokratisch orientierten Akteuren? Und wer wird Nachfolger des derzeitigen Revolutionsführers Ayatollah Chamenei?
Der amtierende Staatpräsident Hassan Rohani und seine Fürsprecher, die ehemaligen Präsidenten Ali Akbar Hashemi-Rafsandjani und Mohammad Chatami, bilden den Kern jener Politiker, die den republikanischen Charakter der Islamischen Republik stärken wollen. Sie setzen sich seit jeher für die Stärkung der repräsentativen, vom Volk gewählten Institutionen ein. In seiner Amtszeit als Staatspräsident stärkte Chatami (1997–2005) die Stadträte in ihrer politischen Bedeutung und lokalen Kompetenz und ebnete den Weg für mehr politische Teilhabe (mosharekat). Er setzte sich für die Verbesserung des Wahlrechts, der Situation von Journalisten sowie der Rechtslage von Nichtregierungsorganisationen (NGO) ein. Ungeachtet der vielen Rückschläge während seiner Amtszeit bleibt die Reformpolitik in Iran eng mit seinem Namen verknüpft. Sein Wahlaufruf bei der Parlaments- und Expertenratswahl 2016, alle Kandidaten der »Liste der Hoffnung« zu wählen, war erfolgreich. Neben Chatami ist es Hashemi-Rafsandjani, der mit seiner Unterstützung Hassan Rohani 2013 ins Präsidentenamt verhalf. Als 2009 Millionen Menschen auf die Straße gingen, weil sie den Sieg von Ahmadinejad als Wahlfälschung ansahen, forderte Hashemi-Rafsandjani, dass Regierungsvertreter den Demonstranten Rede und Antwort stehen und sie respektvoll behandeln müssen. Für seine offene Kritik an der Niederschlagung der Proteste wurde er in der Systemelite heftig angegriffen, während er in der Bevölkerung dafür überwiegend Sympathien erntete. Aufgrund des damaligen »Rechtsrucks« rückte Hashemi-Rafsandjani in die Nähe Mohammad Chatamis und der Reformer.
Allen reformwilligen Iranern wurde klar, dass eine Präsidentschaft Rohanis zwar keine zweite Reformära einleiten, aber zumindest den Weg dorthin ebnen könnte. Seinen Wählern ist bewusst, dass Rohani als Mann aus dem Sicherheitsapparat des Systems kein Reformer sein kann. Vielmehr verfolgt er im Interesse der Stabilität und der nationalen Sicherheit eine Politik der innen- und außenpolitischen Öffnung sowie eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Diese Linie erschien seinen Wählern 2013 nach acht Jahren Präsidentschaft des ultrakonservativen Mahmud Ahmadinejad als beste Option.
Wie die letzten Parlaments- und Expertenratswahlen gezeigt haben, können sich Rohani, Hashemi-Rafsandjani und Chatami derzeit der Unterstützung einer Mehrheit aller Iraner sicher sein. Rohani hat im Wahlkampf die Bedeutung kompetitiver Wahlen immer wieder deutlich gemacht. Im Dezember 2015 erklärte er darüber hinaus bei einem Treffen mit den Verantwortlichen des Innenministeriums für die Kandidatenauswahl, dass er volles Vertrauen in das Wahlverhalten der Bürger habe und sie »die wahren Entscheidungsträger« seien. Auch Hashemi-Rafsandjani sagte im Januar 2016, der effektivste Weg gegen externe Einflussnahme (nofuz) auf die inneriranische Politik seien ein lebendiger Wahlkampf und eine hohe Wahlbeteiligung. Gleichzeitig rief Hashemi-Rafsandjani die Iraner zur nationalen Einheit (vahdat-e melli) auf. Wahlen steigern seiner Auffassung nach Irans internationales Prestige, da sie die Befürwortung des politischen Systems in der Bevölkerung zeigen.




























