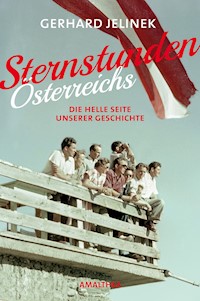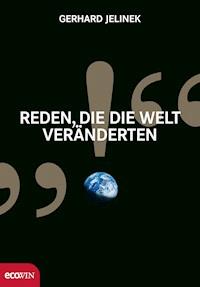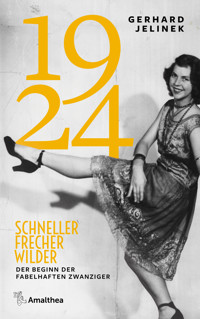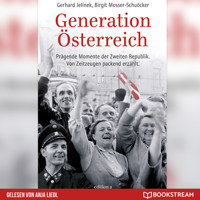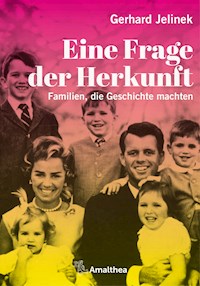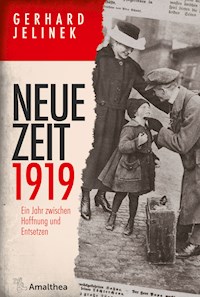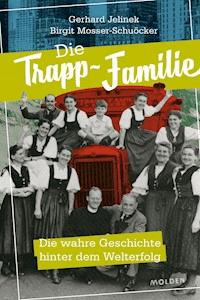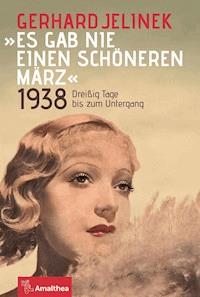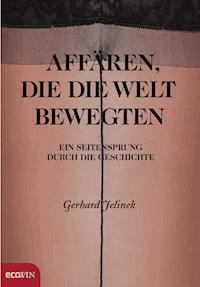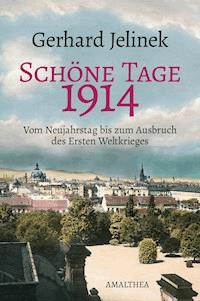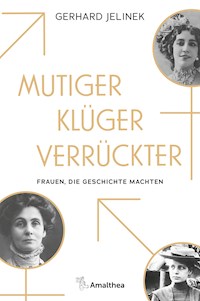
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Mehr als nur schön anzusehen Sie waren außergewöhnlich. Sie haben die Welt verändert. Von den Anfängen der Zeit bis heute haben sich Frauen auf so verschiedenen Gebieten wie Politik, Kunst, Literatur oder Wissenschaft erfolgreich behauptet. Dabei mussten sie stärker und erfinderischer als Männer sein, um sich gegen Benachteiligung und Konventionen durchzusetzen – und bezahlten nicht selten einen hohen Preis: Maria Magdalena wird zur Sünderin gemacht. Olympe de Gouges fordert Menschenrechte für Frauen und wird zum Opfer der Französischen Revolution. Das "Freudenmädchen" Ching Shih beherrscht mit einer Piratenflotte das südchinesische Meer und die englische Aristokratin Jane Elizabeth Digby wird zur heimlichen Königin von Damaskus ... Lesen Sie von mehr als zwei Dutzend inspirierenden Frauen – und von jenen Männern, die sie behinderten und förderten, hassten und liebten. Mit zahlreichen Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERHARD JELINEK
MUTIGERKLÜGERVERRÜCKTER
FRAUEN, DIE GESCHICHTE MACHTEN
Mit 26 Abbildungen
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2020 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Valence, www.valencestudio.com
Umschlagabbildungen: Lola Montez (oben rechts) © mauritius images/Pictorial Press Ltd/Alamy, Emmeline Pankhurst (unten links) © mauritius images/David Cole/Alamy, Lise Meitner (unten rechts) © mauritius images/Science Source Lektorat: Martin Bruny
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11/14,22 pt Chaparral Pro
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-183-2
eISBN 978-3-903217-58-4
Inhalt
Vorwort
Lilith
»Ich will nicht unter dir liegen«
Kleopatra
»Von allen meinen unzählbaren Schmerzen ist keiner so groß und furchtbar wie die kurze Zeit, die ich von Dir getrennt war«
Maria Magdalena
»Die Frau, die vollständig verstanden hatte«
Boudicca
»Sofern wir Menschen, die in warmen Wassern baden, als Männer bezeichnen dürfen«
Mathilde von Quedlinburg
»Ein Edelstein aus dem Stamm des Königshauses«
Artemisia Gentileschi
»Bevor er noch einmal in mich eindrang, riss ich ihm ein Stück Fleisch aus«
Dorothea Christiane Erxleben
»Gelehrsamkeit trägt sehr vieles bei zu der Menschen Glückseligkeit«
Olympe de Gouges
»Von Paris bis Peru und von Rom bis nach Japan – ist das allerdümmste Tier, meiner Meinung nach, der Mann«
Sophie Blanchard
»Allons, ce sera pour la dernière fois«
Ching Shih
»Ein toter Fischer fängt keine Fische«
Jane Elizabeth Digby
»Ja, ein wildes, wildes Herz«
Ada Lovelace (Augusta Ada King, Countess of Lovelace)
»Der analytische Automat nimmt einen Rang ganz für sich allein ein«
Lola Montez (Maria Dolores Elisa Gilbert)
»Schlagt das Luder tot!«
Bertha von Suttner
»Frieden ist die Grundlage und das Endziel des Glückes«
Emmeline Pankhurst
»Wir bewegen uns langsam wie ein Gletscher vorwärts, aber niemand kann ihn stoppen«
Nellie Bly
»Mein Ziel vor Augen behielt ich das Herz kühl«
Elise Ottesen-Jensen
»I dream of the day when all the children who are born are welcome«
Eugenie Schwarzwald
»Frau von edelster Rasse«
Pola Negri (Barbara Apolonia Chałupiec)
»Ne Polin isse, schwarzhaarig isse, also heeßste Pola Negri«
Eleanor Roosevelt
»Die Zukunft gehört jenen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben«
Wallis Warfield Simpson
»Mit dem tiefsten persönlichen Schmerz wünscht Wallis Simpson bekannt zu geben, dass sie jede Absicht, seine Majestät zu ehelichen, aufgegeben hat«
Geertruida Wijsmuller-Meijer
»Unglaublich, so rein arisch und doch so verrückt«
Lise Meitner
»Herzlich liebe ich die Physik wie einen Menschen, dem man sehr viel verdankt«
Beate Uhse
»Ich fühle mich nicht einer prüden Gesellschaft verpflichtet«
Rosa Parks
»Wir haben noch einen langen Weg zu gehen«
Dank
Literatur
Bildnachweis
Namenregister
Der Autor
Vorwort
Sie waren außergewöhnlich. Sie waren erstaunlich mutig. Sie waren klug, und sie waren gelegentlich auch ein wenig verrückt, aber nie dumm. Sie haben die Welt verändert. Sie haben Geschichte geschrieben. Ihr Bild wurde von der Nachwelt gemalt, verschleiert, verzerrt und gelegentlich vergöttlicht. In diesem Buch werden mehr als zwei Dutzend Porträts von Frauen gezeichnet, in denen sich Geschichte spiegelt.
Aus diesen Geschichten sind die Männer, die sie behinderten, die Männer, die sie unterstützten, sie förderten, sie liebten – bis in den Wahnsinn –, nicht wegzudenken.
Am Anfang waren ein Mann und eine Frau. Sie hieß Lilith, nicht Eva. Und sie war ein Vorbild oder ein Schreckgespenst für viele Frauen im Lauf der Menschheitsgeschichte. Lilith – jedenfalls die Figur, die in den diversen Überlieferungen der Jahrtausende geschaffen wurde – war selbstbewusst, selbstbestimmt, mutig, ein Geschöpf Gottes und auch ein bisschen verrückt. Mit ihr beginnt alles. Und alles, was man von ihr weiß, ist eine Erfindung der vergangenen Jahrhunderte. In Lilith wurde – meist von Männern – ein Frauenbild projiziert, das je nach Zeitgeist und Auslegung selten als Vorbild, öfter als Warnung dienen sollte. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Ein Geschöpf in zwei Ausformungen. Und er erkannte, es war gut.
Von den Anfängen der Zeit bis heute haben sich Frauen auf so verschiedenen Gebieten wie Politik, Kunst, Literatur oder Wissenschaft erfolgreich behauptet. Dabei mussten sie in den vorwiegend patriarchalisch geprägten Gesellschaften stärker, klüger und erfinderischer als Männer sein, um sich gegen Benachteiligung und Konventionen durchzusetzen – und sie bezahlten nicht selten einen hohen Preis: Die Jüngerin Maria Magdalena wird über Jahrhunderte von der biblischen Begleiterin des Rabbi Jesus zur Sünderin stilisiert, Mythen, Kunst und Überlieferung verdichten mehrere Frauenschicksale zu einer Person. Im Neuen Testament bezeugt sie als Erste und Einzige die Auferstehung »ihres Meisters«. Die anderen Apostel erfahren aus ihrem Mund das Wunder. Sie war mutiger und wagte sich ans Grab des Gekreuzigten, die Männer blieben im Versteck.
Mythen machen Geschichte. Vieles, was als historische Tatsache berichtet wird, erweist sich sehr oft als literarische Erfindung, mehr noch als Mittel der politischen Propaganda im Machtkampf der Zeiten. Geschichte wird geschrieben, die Überlieferung ist Mittel zum politischen Zweck. Die »ägyptische« Königin Kleopatra ist weder Ägypterin noch bloß Geliebte. Sie spielt über Jahrzehnte eine zentrale Rolle im Kampf um die Herrschaft über die Reste des hellenistischen Erbes. Zweimal benützt sie, zweimal lässt sie sich benützen, um ihre Stellung zu festigen. An der Seite der mächtigsten Römer, Julius Cäsar und später Marcus Antonius, verfolgt sie eine wagemutige Strategie, lange ist sie damit erfolgreich, schließlich zahlt sie mit ihrem Leben den Preis der Macht.
Selbstbestimmung und Gleichberechtigung sind kein Verdienst der jüngeren Vergangenheit. Frauen haben sich in all den Jahrtausenden, die wir heute einigermaßen überblicken können, Einfluss erkämpft. Die keltische Stammeskönigin Boudicca führt Hunderttausende Krieger in Schlachten gegen römische Legionen auf der britischen Insel. Mutig, aufrührerisch, vermeintlich im Kampf für ihre weibliche Ehre, aber schließlich wird ihr Heereshaufen besiegt, ihr Volk versklavt.
Olympe de Gouges nimmt im revolutionären Paris des ausgehenden 18. Jahrhunderts die vollmundigen Erklärungen der Jakobiner ernst. Die hehren Prinzipien der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderlichkeit gelten nur für Männer, obwohl auch Frauen auf den Barrikaden kämpfen. Sie fordert das Selbstverständliche: Menschenrechte müssen auch für Frauen gelten. Olympe de Gouges fordert mutig und ein wenig naiv-verrückt von den revolutionären Machtpolitikern Gerechtigkeit auch für Königin Marie-Antoinette. Und sie wird ihren Kopf unter der Guillotine verlieren, wie die Königin. Gleichberechtigt im Tod.
Das »Freudenmädchen« (in Wahrheit eine gewaltsam zur Prostitution gezwungene Frau) Ching Shih beherrscht für ein Jahrzehnt mit einer Piratenflotte von Tausenden Dschunken das Südchinesische Meer. Die Freibeuterin führt strenge Regeln zur Disziplinierung der Piraten ein und setzt sie blutig durch. Selbst drakonische Gebote sind ein zivilisatorischer Fortschritt gegenüber rechtloser Willkür.
Die englische Aristokratin Jane Elizabeth Digby wird zur ungekrönten Königin von Damaskus, nachdem sie einen um Jahrzehnte jüngeren Beduinen-Scheich ehelicht. Auf ihrem Lebensweg durch die Jahrzehnte bis in den arabischen Orient wird die Lady von einem indischen Vizekönig, einem k. u. k. Ministerpräsidenten, einem bayerischen Freiherrn, Bayerns König Ludwig II., einem griechischen General, Dichtern und Poeten begleitet.
Mehr zur Weiterentwicklung der Menschheit hat sicherlich die in Wien geborene Forscherin Lise Meitner beigetragen, die die Geheimnisse der Atomspaltung theoretisch erklärt. Wir wundern uns, warum nicht sie, sondern ihr wissenschaftlicher Begleiter Otto Hahn dafür mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Augusta Ada King Countess of Lovelace kann als erste Programmiererin der Geschichte gesehen werden. Dorothea Christiane Erxleben darf als erste Frau 100 Jahre vor anderen Geschlechtsgenossinnen zum Doktor der Medizin promovieren, weil es der preußische König Friedrich anordnet. Sophie Blanchard steigt in ihrem Ballon Dutzende Male vor Hunderttausenden in die Lüfte, überquert allein die Westalpen und stürzt über den Straßen von Paris zu Tode. Die amerikanische Redakteurin Nellie Bly erfindet den »investigativen« Journalismus und gewinnt im Auftrag des Verlegers Joseph Pulitzer ein Wettrennen um die Erde auf den fiktiven Spuren von Jules Verne. Während des Ersten Weltkrieges berichtet die Amerikanerin vom Krieg der Habsburger-Armee in Galizien. Da ist die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner schon drei Jahre tot, ihre Prophezeiungen sind wahr geworden, ihr Lebenstraum versinkt in Blut.
Mutiger, klüger, verrückter. Zwei Dutzend Frauen haben Geschichte gemacht, erlebt, erlitten, durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende. Jede Auswahl muss – nota bene – eine sehr subjektive sein (und hätte auch ganz anders getroffen werden können). Und einige Frauenporträts sind schon für eine (allfällige) Fortsetzung geschrieben. Jedes Frauenschicksal steht für sich und für unzählige (und ungezählte) andere Schicksale, Epochen und Gesellschaften. Ihre Geschichten werden – mehr oder minder – chronologisch erzählt. Das letzte Kapitel ist dem Kampf einer amerikanischen Näherin gewidmet, die sich weigert, ihren Sitzplatz in einem städtischen Bus in der amerikanischen Südstaaten-Stadt Montgomery einem Weißen zu überlassen. Rosa Parks wird so zum Symbol des Kampfes gegen den Rassismus. Ihr Satz »Wir haben noch einen langen Weg zu gehen« ist anno 2020 bedrückend aktuell.
Lilith. Mit allen Attributen der Verführung. Adams erste Frau wird in der Geschichte zur Projektionsfläche geheimer Wünsche und Ängste. Die selbstbewusste und gleichberechtigte Frau verlässt das Paradies und Adam. Dieser wird von Gott mit Eva getröstet. Die weitere Geschichte ist bekannt.
Lilith
»Ich will nicht unter dir liegen«
Als Gott den ersten Menschen geschaffen hatte, sagte er: ›Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.‹ Und er schuf ihm eine Frau – gleich ihm – aus Erde und nannte sie Lilith.« Adam und Eva. Der erste Mann und die erste Frau. Falsch. In der hebräischen Mythologie heißt die erste Frau Lilith, nicht Eva. Die trifft erst später im Paradies ein. So beginnt die Geschichte der Menschheit in einem Dreiecksverhältnis. Gott erschafft Adam, den Menschen. Weil sich dieser einsam fühlt und das bunte Liebesleben der paarweise erschaffenen Tiere mit sich steigerndem Missvergnügen betrachtet, bittet er Gott, ihm ein Gegenstück zu schaffen. Gott zeigt sich verständnisvoll. Der Herr des Himmels und der Welt geht also nach dem gleichen bewährten Rezept vor. Wie bei Adam nimmt er Erde, Staub, Lehm und formt ein Geschöpf »nach seinem Ebenbild«. Mit Haut und langen Haaren. Adam hat eine Frau. Er kann nun die heißen sumerischen Nächte zu zweit verbringen. Es könnten paradiesische Zustände sein.
Aber der erste Mann Adam erweist sich als einfallsloser Liebhaber, seine Lilith hingegen ist eine selbstbewusste Partnerin. Sie pocht auf Gleichberechtigung in allen Lagen. Schließlich habe Gott sie aus dem gleichen Stoff geformt wie das männliche Pendant. Auch in ihrer Sexualität will Lilith gleichberechtigt sein, ihre Wünsche sind denen des Mannes nicht nachgeordnet. Wieder beschreibt die alte Überlieferung die Szene im Garten Eden klar und deutlich. Bald begannen die beiden zu streiten. Lilith sagte zu Adam: »Ich will nicht unter dir liegen.« Und er sagte: »Ich will nicht unter dir liegen, sondern auf dir, weil du verdienst, die Unterlegene zu sein und ich der Überlegene.« Sie sagte zu ihm: »Wir sind beide gleich, weil wir beide aus Erde gemacht sind.«
Der Geschlechterkampf hat also schon im Garten Eden begonnen. Aber Lilith fackelt nicht lange herum. Sie ruft den Namen ihres Schöpfers und erhebt sich in »die Lüfte der Welt«. Lilith scheint also durchaus Engelseigenschaften gehabt zu haben. Sie fliegt. Mit dieser Kunst ist sie aber nicht allein. Das Verlassen des Paradieses bleibt nicht unbemerkt. Nach einem Hinweis von Adam schickt der althebräische Gott der Mythen drei Engel aus, die Adams Frau wieder ins Paradies locken sollen. Lilith weilt derweilen am Roten Meer, heißt es geografisch eher unbestimmt. Da wir uns den Garten Eden irgendwo im Lande der Sumerer vorstellen wollen, wird sich die sagenhafte Lilith irgendwo an der Küste der Arabischen Halbinsel aufgehalten haben. Die ultimative Aufforderung, heim ins Paradies zu wandern, lehnt die selbstbewusste Frau ab. »Wie kann ich wie eine ehrbare Hausfrau leben?« Die Engel drohen damit, sie im Meer zu ertränken. Doch wieder zeigt sich der selbstbestimmte Charakter von Adams erster Frau. Sie denkt gar nicht daran, den Befehlen nachzukommen.
Es wird zwar noch eine Weile verhandelt, aber Gott straft Lilith, indem er täglich 100 ihrer »Dämonenkinder« tötet. Ganz logisch geht die Geschichte also nicht weiter. Wir lassen das aus. Adam, dessen Rolle allen später geborenen Männergenerationen nicht zur Ehre gereicht, ruft wieder einmal Gott an und beklagt sich bitterlich. Die Frau sei ihm davongelaufen.
Gott ist in diesem offenbar hauptsächlich von männlichen Priestern am Lagerfeuer weitererzählten Urmythos gegenüber Adam sehr verständnisvoll. Er rügt seine erste Schöpfung nicht, weil er sich wenig partnerschaftlich benommen hat. Nein, Gott geht neuerlich ans Werk und formt eine weitere Partnerin für Adam. Dieser ist allerdings sehr anspruchsvoll und lehnt Gottes zweiten Versuch empört ab. Wiederum ist der oberste Weltenlenker nachsichtig und macht sich ein drittes Mal ans Werk. Diesmal transplantiert Gott eine Rippe des tief schlafenden Adam und baut um diese Rippe ein schönes Wesen, dem er auch einiges von der Sinnlichkeit und Verführungskraft Liliths mitgibt. Gott nennt sein Geschöpf Eva. Da unsere Geschichte aber unzweifelhaft im heutigen Südirak zu lokalisieren ist, wird Eva wohl einen sumerischen Namen getragen haben.
Das Erste Buch Mose lässt eine geografische Eingrenzung des Paradieses zu. Gesucht wurde es über Jahrhunderte, gefunden bis heute nicht. 80, 100 und mehr Theorien gibt es, wo sich der biblische Garten Eden befunden haben könnte. Er war Ziel von Gelehrten und schwer bewaffneten Kreuzrittern. Sie glaubten tatsächlich, das Paradies mit dem Schwert erobern und besetzen zu können. Seit Jahrhunderten suchen Altertumsforscher das Paradies und finden es immer wieder an anderen Orten.
Für den deutschen Mönch Martin Luther waren die Versuche, das himmlische Paradies geografisch zu verorten, ohnehin lächerlich. »Möglich ist’s, dass es zu der Zeit also gewesen ist, dass Gott einen Garten gemacht oder ein Land beschränkt hat, aber nach meinem Dünken wollt ich gern, dass es so verstanden möchte werden, dass es der ganze Erdboden wäre.«
Jeder Mythos dürfte irgendwo eine historische Wurzel haben. So wird in der mesopotamischen Vorlage zur Genesis-Erzählung der Garten Eden als Widerspiegelung des Tempelgartens in Eridu gedeutet. Die kargen Reste der sumerischen Stadt Nun liegen heute unter einem Ruinenhügel im Süden des Irak. Vor gut 8000 Jahren beherbergte Eridu das wichtigste Heiligtum des Gottes Enki. Er galt als Herr der Welt, des Süßwassers, des Todes und des schöpferischen Geistes. Es ist die Stätte und die Stadt, in der Geschichte begann. Hier kann der Garten Eden gewesen sein.
Das Paradies der Sumerer war ein friedlicher Tierpark, eine Kulturlandschaft, wie sie Jean-Jacques Rousseau gemalt haben könnte. »Rein, sauber, hell« soll der Garten Eden sein, seine Bewohner, auch die gewalttätigsten, sind friedlich. Der Löwe tötet nicht, und der Wolf raubt kein Schaf. Es grünt und blüht im Paradies, weil der Sonnengott das Land mit süßem Grundwasser befeuchtet. Im sumerischen Epos Enki und Nammu wird die Erschaffung des Menschen so geschildert: Die Göttinnen Nammu und Ninmach formen den Menschen aus der Verbindung von Lehm und dem heiligen Wasser des Urozeans. Immer ist es Staub mit Wasser vermischt, aus dem der Mensch geknetet wird. Die Grundrezeptur bleibt also gleich: in der Bibel, in den sumerischen Epen, in der hebräischen Überlieferung, in der erst später entstandenen Kabbala und auch im Koran.
Die Beschreibung dieser paradiesischen Zustände ist älter als die Schöpfungsgeschichte der Bibel, viel älter. Das Alte Testament ist also abgeschrieben? Nein, vielmehr belegt das heilige Buch der Juden und der Christen die ungebrochene mündliche Tradition uralter Mythen. Die biblische Erzählung gehört zum abendländischen Grundwissen. Selbst wer die Geschichte von Adam, Eva, dem Apfel und der Schlange nicht im Buch Genesis gelesen hat, kennt sie, und sei es nur aus der Kunstgeschichte, in der das Bild von Mann, Frau, Apfelbaum und böser Schlange zu den Stereotypen der Malerei und Bildhauerei zählt.
Adam und Eva – so weit folgt die Genesis den älteren sumerischen Dichtungen – leben im Garten Eden. Es geht ihnen gut, keine Rede von Streit. Lilith, die Vorgängerin Evas, kommt im Alten Testament nur ein Mal als Randbemerkung vor. Im verwüsteten Land Edom treiben dunkle und böse Geister ihr Unwesen. Wilde Katzen und Wüstenhunde streunen durch die zerstörte Landschaft, und eben dort »rastet Lilith und findet einen stillen Ort für sich«. Viel mehr lässt uns die Bibel über Adams erste Frau nicht wissen. Erst sehr viel später, im Mittelalter, wird aus der alttestamentarischen Randfigur ein böser weiblicher Dämon, der sich in so manch feuchten Traum der Männer einschleicht und dort für unsaubere Gedanken verantwortlich gemacht wird.
Vor Evas Verführung beim Apfelbaum scheint das paradiesische Leben eher langweilig gewesen zu sein. Im Gegensatz zum sumerischen Mythos erzählt die Bibel nichts vom Geschlechtsleben. Adam, der aus Erde Gemachte, und seine Eva sind – bis zum »Sündenfall« – kinderlos. Sie kennen keine Lust, keine Scham, sie vermehren sich nicht, sie sind nach Gottes Ebenbild geformt. Sie sind eigentlich noch keine Menschen in unserem heutigen Sinn. Um sich von Gott zu unterscheiden, bedarf es des Fehlers, des Widerspruchs, des Ungehorsams, vor allem der Sterblichkeit.
Der Mensch wird zum Menschen, indem er eigenständigen Willen zeigt. Und es ist die Frau, die den ersten Schritt weg vom Gottähnlichen zum Menschen macht. Sie will vom Baum der Erkenntnis naschen. Die Schlange als Symbol für das Böse, den Teufel, braucht es dazu gar nicht. Sie wird als Ausrede ins Bild gerückt. Michelangelo malt Lilith als Wesen aus Frau und Schlange, die ihrer Nachfolgerin Eva den Apfel reicht. Eva will das Verbotene tun. Sie beißt in eine Feige, denn um einen Feigenbaum wird es sich wohl gehandelt haben. »Malus« – das Böse – steht nur im Lateinischen für »Apfel«. Es ist der Baum des Bösen, an dem die verbotenen Früchte wachsen und es ist – welche Gleichsetzung – auch der Baum der Erkenntnis. Wissen kann zur Auflehnung gegen Gott führen. Wird der Mensch zu klug, zu besserwisserisch, lehnt er sich gegen Gott auf, folgt die Strafe auf den Fuß. Adam und Eva werden aus dem Paradies vertrieben, sie beginnen als Menschen zu leben. Sie lernen Angst und Leiden, Lust und Freude kennen. Sie beginnen sich zu lieben und zu vermehren. Es gibt paradiesische Momente, aber auch teuflisches Leid. Und es gibt den Tod.
Schuld an dem Schlamassel ist die Frau. Adam, der wiederum nicht souverän reagiert, schiebt alles auf Eva – diese bezichtigt die Schlange. Gott reagiert empört und vertreibt die zwei aus dem Garten Eden. Adam muss fortan als Bauer den kargen Boden bearbeiten und Feldfrüchte fürs Überleben der Menschheit anbauen. Eva erlebt in der Sünde Lust, muss aber unter Schmerzen Kinder auf die Welt bringen. Das erste Paar zeugt drei Söhne, Kain, Abel und Set, außerdem eine nicht genau bezifferte Zahl an Töchtern und einige unbekannte Söhne. Da Adam das fürwahr »biblische« Alter von 930 Jahren erreicht, kann er die Weltbevölkerung schon in erster Generation deutlich steigern.
Lilith erlebt – geschätzte 6000 Jahre nach ihrer Schöpfung – eine Wiedergeburt. Die sumerische Figur der ersten Frau, die von Adam gleichberechtigt und selbstbewusst ihre Rechte einfordert, wird in den 1960er-Jahren zu einer Ikone des Feminismus. Während die biblische Eva in einer patriarchalischen Tradition steht, symbolisiert Lilith die Selbstständigkeit der Frau und ihren Widerstand gegen männliche Unterdrückung. Sie verweigert den Druck, sich im Namen einer höheren Autorität zu fügen, und wird dafür bestraft. Gleichzeitig beflügelt sie Männerfantasien über Jahrhunderte. Johann Wolfgang von Goethe lässt sie in der Walpurgisnacht tanzen. Mephisto weiß, wer die Schöne ist: »Lilith ist das. Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht wieder fahren.« Goethe greift für seinen Faust alte Quellen aus dem Talmud auf, in dem Lilith schon im 5. Jahrhundert nach Christus als nächtlicher Dämon herumfliegt. Zu Adams erster Frau wird sie in den Überlieferungen erst ein paar Jahrhunderte später. Die Frauen, die in diesem Buche porträtiert werden, stammen alle irgendwie von der sagenumwobenen Lilith ab oder entsprechen jedenfalls dem Frauenbild, das rund um die Figur der Lilith in den Jahrhunderten gezeichnet wurde.
So ist auch diese Frau irgendwie ein Geschöpf der Männer, aber sie ist ihnen entflogen.
Kleopatra
»Von allen meinen unzählbaren Schmerzen ist keiner so groß und furchtbar wie die kurze Zeit, die ich von Dir getrennt war«
Eine Frau wird Opfer der politischen Propaganda und dadurch zur unsterblichen Legende. 2000 Jahre nach ihrem Tod ist Kleopatra VII. noch immer eine der berühmtesten Frauen der Menschheitsgeschichte. Sie hat das antike Ägypten 22 Jahre regiert, in einer extrem unsicheren Zeit zwei der mächtigsten Männer des damaligen Erdkreises zu ihren Geliebten gemacht, vier Kinder geboren und den östlichen Teil des Mittelmeers kontrolliert. Nebenbei hat die Königin noch ihre Schwester verfolgen und ihre Brüder ermorden lassen. Nach heutigem Maßstab gelten diese Gewalttaten als eher unfeine politische Methoden. Vier Jahrzehnte vor Beginn unserer Zeitenrechnung legten Herrscher und Beherrschte andere Richtschnüre an – die Durchsetzung von Machtinteressen mit Gift und Schwert war übliche Praxis.
Kleopatra beflügelte überdies die sexuellen Fantasien vieler Generationen und inspirierte William Shakespeare zu seinem Drama Antonius und Cleopatra.
Eine gute Nachrede hatte Kleopatra in der literarischen Welt nicht. So schrieb Heinrich Heine: »Dieses launische, lustsüchtige, wetterwendische, fieberhaft kokette Weib, diese antike Pariserin, diese Göttin des Lebens gaukelt und herrscht über Ägypten, dem schweigsam starren Totenland … Überall Tod, Stein und Geheimnis … Und über dieses Land herrschte als Königin die schöne Kleopatra. Wie witzig ist Gott!«
Königin Kleopatra ist eine der Hauptfiguren des historischen Boulevards. Sie ist Projektionsfläche erotischer Wünsche, eine Frau, die durch ihre Liebeskünste tapfere römische Helden verführt, sie durch orientalische Sinnesfreuden verwirrt, den mächtigen Gaius Julius Cäsar von der planmäßigen Erfüllung seiner Kriegsgeschäfte abbringt, seine Rückkehr nach Rom verzögert, ihn durch ausschweifende sexuelle Erlebnisse von seiner rechtmäßigen Ehefrau entfremdet, in unvorstellbarem Luxus lebt, den antiken Rechthabern wie Cicero mit Überheblichkeit begegnet und Konventionen bricht, weil eine junge Frau über größeren Reichtum verfügt als die Weltmacht der Römischen Republik. Kleopatra ist eine einzige Provokation für die schlichten Republikaner in Rom. Das glanzvolle Rom ist vier Jahrzehnte vor der Geburt von Jesus Christus ein höchst bescheidenes Provinzstädtchen an einem eher unbedeutenden Fluss. Jedenfalls aus der Sicht einer Königin, die sich in einer direkten Ahnenlinie zu Alexander dem Großen wähnen kann.
Kleopatra. Die ägyptische Königin, die eine hellenistische Herrscherin war. Zur Sicherung ihrer Macht und ihres Reichs verbündet sich Kleopatra mit den jeweils mächtigsten Römern: Julius Cäsar und seinem Nachfolger Marcus Antonius.
Das Colosseum ist noch längst nicht errichtet, das Pantheon nicht einmal eine Idee, die Caracalla-Thermen bleiben späteren Jahrhunderten vorbehalten, und die Kaiserpaläste werden erst in gut 100 Jahren gebaut. Roms Straßen sind eng, verwinkelt, schmutzig, laut und stinkend. Das Forum erinnert noch immer an die Kuhweide, die es war. Dabei betrachten sich die Römische Republik und die Stadt auf den sieben Hügeln als Nabel der Welt. Dank des erfolgreichen Kriegshandwerks der römischen Legionen hat sich Rom zur Zeit Cäsars die militärische Oberhoheit im Mittelmeerraum erkämpft. Kulturelle Hervorbringungen zeichnen die Römische Republik nicht aus.
Wichtige Technologien haben die römischen Stämme von den geheimnisvollen Etruskern übernommen. Die Stärke des jungen Gemeinwesens, das sich da von Mittelitalien aus anschickt, die Welt (zumindest jenen Teil, den sie damals gekannt haben) zu erobern, liegt in der Organisationskraft, in der praktischen Anwendung von Erfindungen anderer und in einer militärischen Disziplin, die nicht besonders sympathisch, aber erfolgreich ist.
Kulturell spielt die Stadt am Tiber eine Nebenrolle. Alexandria ist das Paris der Antike. Größer, schöner, kosmopolitischer und viel reicher als Rom. Und in und über Alexandria herrschen die Abkommen jener Feldherren, die Alexander den Großen beerben durften: die Ptolemäer.
Kleopatra stammt aus altem makedonischen, also griechischem Adel. Die ägyptische Herrscherin ist daher Griechin, sie spricht Griechisch und lebt eine griechische Kultur, die im 1. Jahrhundert vor der Geburt eines jüdischen Sektenführers ihren klassischen Höhepunkt längst überschritten hat. Ein paar Jahrhunderte lässt es sich auch in einer langsam in Dekadenz versumpfenden Kultur ganz angenehm leben (wer denkt da ans Heute?). Im »griechischen Zeitalter« spielen die alten Griechen keine Rolle mehr. Athen ist ein Schatten seiner selbst, längst unter der Kontrolle Roms. Die Zeiten, in denen griechische Städte wie Athen, Korinth oder Sparta zumindest die östlichen Mittelmeerküsten beherrschten, sind längst in mythologischer Erinnerung versunken. Das komplizierte Gefüge des Hellenismus zerbröselte vor dem Ansturm der römischen Legionen. Es brauchte damals erstaunlich wenige Männer, um die Welt zu erobern, wenn sie nur in Reih und Glied marschieren konnten.
Kleopatra war eine der letzten hellenistischen Herrscherinnen, die im Strategiespiel einen Einsatz leistete, um eine ptolemäische Vormacht in einem ägyptischen Großreich zu sichern. Den Preis dafür zahlte sie an die Schutzmacht Rom.
Kleopatra wurde etwa 69 vor Christus als dritte Tochter des Ptolemaios XII. Auletes geboren. Sie hatte auch zwei Halbschwestern, die über Ägypten herrschten, Berenike IV. und Arsinoë IV. Letztere war nach einem Staatsstreich gegen ihren Vater an die Macht gekommen. Familienmitglieder wurden in diesen Kreisen als Konkurrenten um Macht und Geld, als potenzielle Mörder oder zu Ermordende eingestuft. Es ging drunter und drüber.
Als Julius Cäsar Ägypten im Jahr 47 vor Christus eroberte, versuchte Kleopatra ihre Machtstellung unter seiner Protektion zu erhalten – oder vielmehr wiederzuerlangen. Dafür war der 21-Jährigen jedes Mittel recht, denn ihre Chancen standen schlecht. Sie war vor ihrem Bruder und seiner Armee in die Syrische Wüste geflüchtet, lebte in einem schäbigen Zelt, unterstützt von einer Söldnerbande, weit weg vom Luxusleben eines Palastes. Sie hatte die Regentschaft mit ihrem gerade erst 13-jährigen Bruder teilen müssen, mit dem Kleopatra auch noch verheiratet worden war. Die Familienverhältnisse in diesen fernen Zeiten sind etwas eigentümlich.
Die doppelten Bande verhinderten aber keineswegs, dass die Berater ihres Ehemann-Bruders – er hieß praktischerweise auch Ptolemaios, genauer der Dreizehnte – Kleopatra als überflüssige Mitregentin einstuften und sie sich der Ermordung nur durch Flucht bis nach Syrien entziehen konnte. Ihre Versuche, sich mit einem Haufen von Bewaffneten nach Alexandria durchzukämpfen, scheiterten an den Festungsmauern von Pelusium. Kleopatras Lage war dementsprechend hoffnungslos.
Die Stadt lag im Altertum am östlichsten Nilarm und wird durch eine Erwähnung im Alten Testament »geadelt«. Und ausgerechnet an diesem Ort sollte in diesen Tagen ein entscheidendes Kapitel des römischen Bürgerkrieges enden. Am Strand vor Pelusium landet der große Gnaeus Pompejus Magnus, erbitterter Gegner Cäsars im Bürgerkrieg. Geschlagen und ohne Schutz bewährter Legionen, erhofft er sich vom ptolemäischen König Unterstützung gegen Julius Cäsar.
Eine Fehlkalkulation. Der ägyptische König – vielmehr seine Berater – wägen die Erfolgsaussichten ab und setzen ihre Karten auf den siegreichen Gaius Julius Cäsar. Kaum an den Strand gewatet, ermorden sie den großen Pompejus, schlagen ihm sein Haupt ab und präsentierten die schauerliche Trophäe drei Tage später dem Cäsar in Alexandria. Dieser soll darob nicht eben begeistert gewesen sein. Immerhin war Pompejus ein Römer, wenn auch ein erbittert bekämpfter Todfeind, aber immerhin ein großer General. Die nach Rom gesendeten Kuriere berichteten, Cäsar habe sich mit Schrecken abgewandt und angesichts des schon leicht verwesten Hauptes bittere Tränen geweint. Ein solch menschliches Rühren kam propagandistisch bei den Anhängern des Pompejus recht gut an, immerhin war ja der General und Konsul auch Cäsars Partner und Schwiegersohn gewesen. Auch bei den Römern sind die Macht- und Familienverhältnisse verwoben, aber selten amikal.
Traurig, aber doch zufrieden zieht sich Cäsar in einen strategisch günstigen Teil des Palastviertels zurück. Den Bewohnern Alexandrias ist ja nicht zu trauen. Denn Cäsar ist in diesen Tagen weniger Eroberer als Gefangener seiner gepriesenen Schnelligkeit. Er hat sich mit relativ wenigen Truppen zu weit vorgewagt, ist von militärischem Nachschub abgeschnitten und wird im gewaltigen Palast von Alexandria von den Einheimischen monatelang belagert, ehe es seinen Legionen gelingt, aus Syrien bis ins Land am Nil zu marschieren und Cäsar aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Für die rivalisierenden Parteien in der ägyptischen Hauptstadt beginnt ein Rennen um die Gunst des verhassten Römers. Die 21-jährige Kleopatra ist dabei strategisch im Nachteil. Sie sitzt im Zelt vor Pelusium, kann nicht vor oder zurück. Die Hauptstadt scheint unendlich weit entfernt. Doch dann hat ihr Vertrauter Apollodoros aus Sizilien eine brillante Idee. Sie wird die Truppen ihres Bruders austricksen. Ein Boot bringt sie den Nil aufwärts bis nach Memphis, das heutige Luxor. In acht weiteren Tagen segelt sie einen anderen Nilarm abwärts nach Alexandria. Um nicht erkannt zu werden, lässt sich die junge Königin in einen Ledersack (oder Teppich – die Überlieferung nimmt es nicht so genau) einrollen. Im Schutz der Dämmerung legt ein kleines Ruderboot an den Palastmauern an. Apollodoros nimmt seine Königin huckepack auf die Schulter und trägt sie in den Palast. So will es die Legende wissen.
In Cäsars Gemächern wird Kleopatra aus dem Ledersack gebeutelt. Daraus lässt sich schließen: Kleopatra war relativ klein und ziemlich schlank. Viel mehr wissen wir nicht über ihr Äußeres. Statuen und Bildnisse auf Münzen stellen sie mit einer ausgeprägten Nase dar, nicht unbedingt eine Schönheit nach klassischen Idealen. Ihr ein wenig pathetisches Auftreten verfehlt die Wirkung nicht. Gehen wir davon aus, dass sich die junge Königin nach ihrem Reiseabenteuer für den Römer frisch gemacht hat. Cäsar ist jedenfalls beeindruckt. Die 21-Jährige hat ein paar Argumente, die den alten Soldaten überzeugen. Julius Cäsar galt schon unter seinen antiken Zeitgenossen als Weiberheld. Und männliche Macht wurde damals auch durch die körperliche Unterwerfung von Frauen demonstriert. Von Liebe war keine Rede. Cäsar selbst war vier Mal verheiratet, opferte seine Ehen und seine Töchter für politische Allianzen. Mit der jungen Königin besiegelt Cäsar eine Allianz. Der Westen – Rom – übernimmt auch den Osten – Alexandria. Die junge Ptolemäerin hat nur eine Option. Um gegen die militärische Übermacht und den Expansionsdrang Roms zu kämpfen, fehlen Kleopatra alle Mittel. So nutzt sie die eine Chance und unterwirft sich dem um Jahrzehnte älteren Feldherrn.
Kleopatra lebte während Cäsars letzten Jahren in Rom. Von ihrem Palast am Esquilin hatte sie einen guten Überblick über die Intrigen in der Hauptstadt des Römischen Reiches. Ihre Anwesenheit und ihr durchaus nicht bescheidenes Auftreten wurden von alteingesessenen Polit-Clans als zusätzliche Bedrohung ihrer Macht empfunden. Sie war eine orientalische Königin in einer noch immer nach republikanischen Grundsätzen regierten Stadt. Sie war eine selbstbewusste Frau in einem Gemeinwesen, wo Männer dominierten. Sie war die exotische Geliebte eines römischen Diktators. Daheim eine Königin, in Rom eine Kurtisane. Kleopatra war reich, reicher als jeder Mann in der Tiber-Stadt. Und sie zeigte den Reichtum. Sie trug Schmuck, wie ihn noch keine Frau in Rom gesehen hatte (die besten Stücke ließ sie ohnehin in Alexandria). Plinius bezifferte den Wert der Perlen, die sie als Ohrgehänge vorzugsweise trug, mit 420 Talenten pro Stück. Bei den römischen Immobilienpreisen konnte man mit einer Perle eine fashionable Villa am Mittelmeer erstehen.
Kleopatra fiel aus allen Ordnungsrahmen. Sie war eine sichtbare Provokation. Sie war unter Cäsars Schutz unantastbar. So musste Cäsar selbst sterben.
Im Senat wird der Diktator auf seinem erhöhten Stuhl von Bittstellern umringt. Ein Dutzend Senatoren drängen zu Cäsar, ziehen Messer aus der Toga und stechen zu. Er schreit auf, wehrt sich, brüllt wie ein wildes Tier. Ins Gesicht, in die Brust, in den ganzen Körper dringen die Messerspitzen ein. Der Feldherr kann sich losreißen, stürzt auf den Marmorboden des Senats, seine Toga blutig, zerfetzt. An den Iden des Märzes im Jahr 44 vor Christus wird der Diktator Julius Cäsar Opfer einer Verschwörung innerhalb seines engsten Kreises von Vertrauten.
Für Kleopatra ist der Tod ihres Geliebten und politischen Beschützers eine Katastrophe. Sie verdankt ihr Reich und ihre Herrschaft über Ägypten Cäsars Legionen. Sie muss rasch handeln. Bei der Eröffnung von Cäsars Testament erlebt sie eine Enttäuschung. Der tote Herrscher Roms erwähnt sie mit keinem Wort, erwähnt auch den gemeinsamen Sohn Caesarion nicht. Cäsar setzt seinen Neffen Gaius Octavius zum Erben seines ungeheuren Vermögens ein.
Die Ägypterin verlässt Rom, sie fühlt sich nicht mehr sicher. Sie muss mit ihrem acht Jahre jüngeren Bruder und Ehemann Ptolemaios heim in ihr Reich, nach Alexandria. Ptolemaios überlebt den Ortswechsel nur kurz. Er stirbt unter ungeklärten Umständen. Der jüdische Historiker Flavius Josephus, bei dem Kleopatra aber immer besonders schlecht beschrieben wird, bezichtigt die Königin des Brudermords. Angesichts ihrer Vita und der landestypischen Verhaltensweisen ist Kleopatra ein Bruder- und Gattenmord durchaus zuzutrauen. Da nach ägyptischer Tradition eine Frau immer einen Mitregenten braucht, setzt die Königin praktischerweise ihren dreijährigen Sohn, den kleinen Caesarion, auf den goldenen Thron und erhebt ihn gleich in den Rang eines »vater- und mutterliebenden« Gottes. Mit der Erwähnung des »Vaters« Cäsar ist ein gewaltiger Machtanspruch verbunden.
Kleopatra regiert nun weit vom eigentlichen Zentrum des Geschehens das reiche Land am Nil. In Rom tobt der finale Machtkampf zwischen den Cäsarenmördern und dem politischen Erben Marcus Antonius und dem tatsächlichen Erben, Cäsars 18-jährigem Neffen Octavius. Während der eine als erfolgreicher und beliebter Feldherr von seinen Soldaten und von vielen Frauen geliebt wird, verdankt der so viel Jüngere seine Machtposition nur dem Testament des ermordeten Onkels. Die beiden höchst unterschiedlichen Rivalen um Cäsars Erbe, die Macht über Rom und das Weltreich, müssen sich verbünden. Antonius amtiert als Konsul nach Cäsar wie ein Alleinherrscher in Rom. Octavius verbündet sich mit mächtigen Senatoren und wird so zum Gegenspieler. Mit einem de facto Militärputsch schaltet Antonius den Senat, vor allem aber die alte römische Nobilität aus. Er bindet seinen Rivalen um die Macht mit einem bedeutungslosen Dritten in ein »Triumvirat« ein. Sie erhalten, wohl nicht ganz freiwillig, weitgehende Vollmachten, die sie auch nützen. Die drei Männer erklären Tausende Mitglieder der alten Machtelite, Ritter und Senatoren, für vogelfrei. Überall werden Proskriptionslisten angeschlagen. Es ist das Todesurteil für viele, die sich nicht rechtzeitig aus Rom absetzen können. Antonius & Co. kassieren die Vermögen der republikanisch gesinnten Cäsarenmörder und finanzieren so den Bürgerkrieg gegen Brutus und Cassius, denen die Flucht nach Kleinasien gelungen ist und die dort römische Legionen sammeln, um sie gegen die Herren Roms in Stellung zu bringen.
Von Kleopatra – ausgerechnet – verlangen die Mörder ihres Geliebten die Auslieferung von Schiffen und Proviant für die Truppen. Die Ptolemäerin liefert nicht. Im Oktober des Jahres 42 vor Christus kommt es zur Entscheidungsschlacht. Die verfeindeten Herren sehen einander – wie angekündigt – bei Philippi in Makedonien wieder. Es wird das Ende von Brutus und Cassius.
Das Römische Imperium kann nun zwischen Marcus Antonius und Octavius aufgeteilt werden. Marcus Antonius hat die erste Wahl, und er entscheidet sich für den weit attraktiveren – östlichen – Teil des Römischen Reichs. Ägypten inklusive.
Der Herr über den reichen Osten zitiert bald die ägyptische Königin in sein Lager bei Tarsos in Kilikien. Von dort ist es nicht mehr ganz so weit über Syrien, Palästina nach Ägypten. Für solche Reisen zog man damals allerdings ein Schiff vor. Also lässt Kleopatra ihre Prunkgaleere zu Wasser. Die Segel sind purpurfarben, der Rumpf ist vergoldet. Das macht Eindruck. Was dann passiert, könnte in einem Drehbuch für einen Hollywoodschinken der 1960er-Jahre stehen. Beim Einlaufen in den Hafen stehen als Meerjungfrauen kostümierte Mädchen und Lustknaben an der Reling. Die Königin selbst hat sich als irdische Personifikation der griechischen Liebesgöttin Aphrodite verkleidet, wobei der Mehrwert des Kostüms im Weglassen besteht. Antonius, der sinnlichen Reizen nicht ungern erliegt, wird aufs schaukelnde Schiff gebeten und von der erfahrenen Kleopatra bezirzt. Die erotisierende Fantasie der antiken Geschichtsschreiber galoppiert davon. Mit einer Serie üppiger Festgelage habe die Orientalin den Herrn des Imperiums verführt und so zu ihrem Verbündeten gemacht. Die Politik mit persönlichem Körpereinsatz war schon beim großen Cäsar erfolgreich. Noch einmal wird sie Leib und Seele einem Mann unterwerfen, um ihre Macht zu sichern. Cäsars Epigone wird auch sein Nachfolger in Kleopatras Bett. Das war dann rückblickend betrachtet eine falsche Entscheidung.
Wie groß tatsächlich die sexuelle Anziehung zwischen den beiden Machtmenschen war, lässt sich schwer feststellen, alle Geschichtsschreibung aus der Zeit, die in Wahrheit drei Generationen später erfolgt, dient jedenfalls politischen Zielsetzungen und auch der Unterhaltung der Leser. Das im Bett besiegelte Bündnis zwischen (Ost-)Roms Herrscher und einer hellenistischen Königin ergibt für beide Teile Sinn und wird den Menschen im Orient als Vermählung von Aphrodite und Dionysos erklärt. Es ist die heilige Vereinigung zweier Götter, zweier Welten und Religionen. Isis und Osiris, Aphrodite und Dionysos, Kleopatra und Marcus Antonius.
Immerhin zieht der Römer im Winter des Jahres 41 vor Christus mit seiner neuen Geliebten nach Alexandria. Das Leben an der Mittelmeerküste gestaltet sich für absolute Herrscher durchaus angenehm. Fast ein Jahr genießt das Paar die Früchte der neuen Partnerschaft. Doch dann verlangt die politische Lage ein Eingreifen des Marcus Antonius. Seine Frau Fulvia und sein Bruder Lucius haben in Italien versucht, die Unzufriedenheit der aus dem Kriegsdienst entlassenen Legionäre (es ging um die Verteilung von Land an die Veteranen) zu nutzen, und mobilisieren in Rom und in anderen italischen Städten gegen den (Drittel-)Mitregenten Octavius. Diesen Perusinischen Krieg kann Octavius gewinnen. Dennoch ist die Lage äußerst volatil. Marcus Antonius muss schleunigst aus dem Osten, wo er eigentlich gegen die Parther Krieg führen wollte, nach Rom zurückkehren und nach der Niederlage seines Bruders und seiner Frau den Streit mit Cäsars Erben planieren. Dabei hilft der Tod. Die Ehefrau von Marcus Antonius, Fulvia, stirbt so überraschend, dass ihr mäßig trauernder Witwer gleich die Schwester von Octavius, Octavia, heiraten kann. Auch sie war überraschend Witwe geworden.
Die Nachricht von der neuen Ehe ihres Geliebten erreicht Kleopatra im Wochenbett. Die Königin brachte Zwillinge zur Welt, die sie Alexander Helios (»Sonne«) und Kleopatra Selene (»Mond«) taufte. Marcus Antonius ist an seinen Kindern, trotz der so poetischen Namensgebung, vorläufig nicht weiter interessiert. Politisch und ehelich hat er jetzt andere Interessen. Er verlegt seinen Wohnsitz mit Octavia nach Athen und regiert von dort aus den Osten der Welt. Ungeachtet des Bündnischarakters der Ehe mit Octavia zeugt Antonius auch mit ihr drei Kinder. Aber auch dieses Eheglück währt nicht sehr lange. Weil der zugesagte Nachschub von 20 000 Legionären aus Rom für den Krieg gegen die Parther ausbleibt, segelt Antonius nach Alexandria, um seine zwischenzeitlich ignorierte, aber nicht vergessene Geliebte Kleopatra zur Überlassung von ptolemäischen Truppen zu überreden. Alte Liebe rostet nicht. Der Römer muss das Zwillingspärchen offiziell als seine Kinder anerkennen, zeugt einen weiteren Sohn, zieht in den Kampf gegen die Parther, siegt und ordnet die ganze Levante neu. Seine Geliebte bekommt dabei die schönsten Teile, etwa alle reichen Städte an der phönizischen Küste, die Dattelhaine um Jericho und die Bitumenvorräte im Reich der Nabatäer. Schon damals brachte der Besitz von Erdölquellen schöne Gewinne.
Kleopatra kann zufrieden sein. Octavius in Rom ist es weniger. Er wirft seinem Rivalen Antonius vor, römisches Vermögen an seine Geliebte zu verschleudern. Dieser Vorwurf sorgt naturgemäß beim römischen Publikum für die erwünschte Empörung. Das Volk von Rom ließ sich leicht für die Machtspiele der Patrizierfamilien benutzen. Der römische Staat ist schon längst keine republikanische Demokratie mehr, die den hehren Ansprüchen genügen würde. Der »Plephs« lässt sich regelmäßig seine Stimmen bei den Wahlen zu den vielen Ämtern mit barer Münze oder Getreidespenden abkaufen, eine Art antike Mindestsicherung. Es regiert Populismus pur. Antonius ignoriert die aufgestachelten Proteste daheim und lebt mit seiner Königin fernab der römischen Kuhweide. Er lässt Silberdrachmen mit einem Doppelporträt prägen. So kommt Kleopatra zur Ehre, als erste Nichtrömerin auf römischen Münzen mit Diadem und der Inschrift »Kleopatra, Königin der Könige und ihrer königlichen Söhne« abgebildet zu werden.
Die Missachtung der Stimmung in Rom erweist sich als gefährlicher Fehler. Bei zwei Herrschern ist einer zu viel. Und immer bereitet die Propaganda den Krieg vor. Gerüchte über das sagenhaft luxuriöse und dekadente Leben des Antonius werden breit gestreut. Schuld trage die Fremde, die exotische Frau mit ihren Tricks und Täuschungen. Und in Rom machen Gerüchte die Runde: Bei einer Wette, wer die teuerste und kostbarste Mahlzeit verspeisen könne, soll Kleopatra eine Perle in Essigsäure aufgelöst und getrunken haben. Diese Geschichte, wahrscheinlich frei erfunden, prägt das Bild der Königin und überlagert die historische Person bis zur Unkenntlichkeit. Antonius war mit seiner PR-Offensive in Rom viel weniger erfolgreich.
Nach einem siegreichen Feldzug gegen einen armenischen König zieht sich Antonius ins prächtige Ephesos zurück. 16 Legionen und die Flotte werden an der anatolischen Küste versammelt. Kleopatra finanziert den Heeresaufmarsch und übernimmt mit ihrer Flotte den Nachschub. Aus Rom fliehen zahlreiche Senatoren vor Octavius nach Ephesos. Sie berichten Antonius vom Machtrausch des Octavius und beschwören ihn, Kleopatra heim nach Alexandria zu schicken. Ein zweites Mal ist die Königin zum Feindbild geworden. Doch Antonius schätzt die Lage abermals falsch ein. Statt sich von Kleopatra zu trennen und damit Octavius seine Propagandabasis zu entziehen, schickt er dessen Schwester Octavia den offiziellen Scheidebrief. Damit stößt er die römische Nomenklatura vor den Kopf. Eine Römerin für eine Ptolemäerin verlassen? Empörung rund um die sieben Hügel.
Es kommt, wie es eben kommen musste. Antonius marschiert mit seinen Truppen nach Westgriechenland und erwartet dort das Heer des Octavius. Dessen Feldherren sind schneller, dessen Flotte erfolgreicher. Antonius wird vom Nachschub abgeschnitten und eingeschlossen. Ein Durchbruchversuch der Flotte scheitert, nur die ägyptischen Kampfgaleeren sprengen den maritimen Belagerungsring. Kleopatra und Antonius können nach Alexandria entkommen. Ihr letztes Jahr beginnt. Nach rascher Abwägung der langfristigen Erfolgsaussichten fallen Verbündete und Bundesgenossen ab. Die Macht erodiert. Die Truppen des Octavius marschieren bis nach Alexandria, dort verliert Antonius seine letzte Schlacht und tut das, was von einem glücklosen Feldherrn erwartet wird. Er stürzt sich ins eigene Schwert. Wohl nicht nur aus Gram, weil ihm das falsche Gerücht von einem Selbstmord Kleopatras zugetragen wird.
Die Königin hat sich schon einmal mit all ihren kostbaren Schätzen in ihr Grabmal zurückgezogen. Der sterbende Antonius wird zu ihr gebracht und haucht dort sein Leben aus. So wird es berichtet. Für Kleopatra geht es nur noch um einen ehrenvollen Nachruf. Sie will nicht zum Prunkstück eines Triumphzugs übers Forum Romanum werden. Sie droht Octavius, sich selbst zu töten. Damit würde sie seinem Triumphmarsch die Hauptattraktion rauben. Das ist ihr letzter Trumpf, aber sie hat ein schwaches Blatt. Eine orientalische Königin in Ketten – genau das ist es, was der römische Pöbel liebt.
Der Historiker Plutarch berichtet von einer zwölftägigen Haft im Mausoleum unter römischer Bewachung und den letzten Versuchen Kleopatras, doch noch mit Octavius einen Handel zu schließen. Sie will den Thron wenigstens für ihre Kinder retten, dafür wäre sie sogar bereit, die Erniedrigung auf sich zu nehmen, Stargast eines Triumphzugs in Rom zu sein. Octavius lässt diese »Drohung« kalt. Einmal noch darf sie ins Mausoleum, den Tod ihres Geliebten Antonius beweinen. Sie tut das in wohlgesetzten Reimen, die der Dichter Plutarch gut 100 Jahre nach Kleopatras Tod der Nachwelt aufzeichnet – also mit Sicherheit erfindet. Über der Urne mit der Asche des Antonius klagt sie ihr Leid: »Verstecke mich und begrabe mich hier mit Dir, von allen meinen unzählbaren Schmerzen ist keiner so groß und furchtbar wie die kurze Zeit, die ich von Dir getrennt war.«
In der ägyptischen Sommerhitze des Jahres 30 vor Christus schließt sich Kleopatra mit ihren treuen Dienerinnen Iras und Charmion im Mausoleum ein. Ein letztes Mahl will sie halten, ehe sie sich Octavius ausliefert. Ein Bauer bringt einen Korb Feigen. Die Bewacher schöpfen keinen Verdacht. Unter den Feigen ist eine Kobra verborgen. Sie wird Kleopatra in den Oberarm beißen, ihr Gift versprühen und die Königin in Purpur bekleidet auf ihrer goldenen Liegestatt standesgemäß sterben lassen.