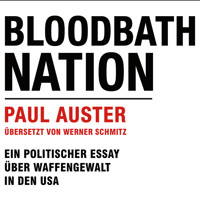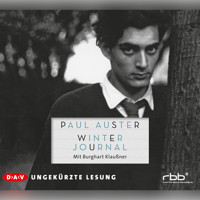9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der Schriftsteller Sidney Orr ist nach einem Unfall auf dem Weg der Genesung. Als er ein wundervolles blaues Notizbuch kauft, verschwindet seine Schreibhemmung. Die Geschichten fliegen ihm nur so zu. Eine gebiert die andere, bis ihm dämmert: Sie führen immer häufiger in ausweglose Situationen. Wie sein Leben. Seine Frau verschließt sich vor ihm und hütet ein Geheimnis. Was ist da im Spiel? Zufall? Magie? «Paul Auster ist der Zeremonienmeister des Zufalls.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «Paul Austers neuer Roman macht süchtig.» (Welt am Sonntag)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Ähnliche
Paul Auster
Nacht des Orakels
Roman
Deutsch von Werner Schmitz
für Q.B.A.S.G.
(im Gedenken)
Ich war lange Zeit krank gewesen. Als ich das Krankenhaus verlassen durfte, konnte ich kaum noch gehen, konnte mich kaum noch daran erinnern, wer ich eigentlich war. Ein wenig Mühe wird es Sie schon kosten, hatte der Arzt gesagt, aber dann sind Sie in drei, vier Monaten wieder ganz auf den Beinen. Ich habe ihm nicht geglaubt, seinen Rat aber trotzdem befolgt. Man hatte mich bereits abgeschrieben, und jetzt, da ich ihre Voraussagen durchkreuzt hatte und rätselhafterweise nicht gestorben war – was blieb mir da anderes übrig, als zu leben, wie wenn ich noch ein Leben vor mir hätte?
Ich begann mit kleinen Ausflügen, höchstens ein, zwei Blocks von meiner Wohnung und dann wieder nach Hause. Ich war erst vierunddreißig, aber die Krankheit hatte mich praktisch zum alten Mann gemacht – zu einem dieser zittrigen, schlurfenden Opas, die keinen Fuß vor den andern setzen können, ohne sich zuvor durch einen Blick nach unten zu vergewissern, welcher Fuß welcher ist. Selbst bei dem Schleichtempo, zu dem ich damals gerade mal imstande war, rief das Gehen eine seltsame körperlose Leichtigkeit in meinem Kopf hervor, ein Durcheinander von wirren Signalen und zuckenden Gedankensplittern. Die Welt hüpfte und schwamm vor meinen Augen, wogte wie Reflexionen auf einem gewellten Spiegel, und wenn ich versuchte, mich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren, ein einzelnes Ding in diesem Ansturm wirbelnder Farben – zum Beispiel das blaue Kopftuch einer Frau oder die roten Hecklichter eines vorbeifahrenden Lieferwagens–, brach es sofort auseinander, löste sich auf, verschwand wie ein Tropfen Farbe in einem Glas Wasser. Alles flatterte und wackelte, schoss in alle möglichen Richtungen davon, und in den ersten Wochen hatte ich Schwierigkeiten, überhaupt festzustellen, wo mein Körper aufhörte und die Außenwelt anfing. Ich rannte an Mauern und Mülleimer, verhedderte mich in Hundeleinen und umherfliegenden Papierfetzen, geriet auf den glattesten Bürgersteigen ins Stolpern. Ich hatte mein Leben lang in New York gewohnt, begriff aber die Straßen und Menschenmassen nicht mehr, und bei jedem meiner kleinen Gänge kam ich mir vor wie einer, der sich in einer fremden Stadt verlaufen hat.
Der Sommer kam früh in diesem Jahr. Seit Ende der ersten Juniwoche war es konstant schwül, drückend: Tag für Tag derselbe stumpfe grünliche Himmel; Müllgestank und Auspuffgase, eine Luft zum Schneiden; und jeder Stein, jede Betonplatte strahlte Hitze aus. Dennoch gab ich nicht auf, zwang mich jeden Morgen die Treppe hinunter und auf die Straße, und als sich das Durcheinander in meinem Kopf lichtete und meine Kräfte langsam zurückkehrten, konnte ich meine Spaziergänge allmählich in die entfernteren Winkel des Viertels ausweiten. Aus zehn Minuten wurden zwanzig, aus einer Stunde wurden zwei, aus zwei Stunden wurden drei. Meine Lungen schnappten nach Luft; ständig in Schweiß gebadet, ließ ich mich treiben wie ein Zuschauer im Traum eines anderen, beobachtete die Welt, die in allen Gangarten vor sich hin lief, und staunte darüber, dass auch ich einmal wie die Leute um mich herum gewesen war: immer in Eile, immer auf dem Weg von hier nach da, immer spät dran, immer eifrig bestrebt, vor Sonnenuntergang noch tausend Dinge zu erledigen. Bei diesem Spiel konnte ich nicht mehr mithalten. Ich war jetzt Ausschussware, ein Haufen defekter Teile und neurologischer Rätsel, und dieses ganze hektische Scheffeln und Ausgeben ließ mich kalt. Um nicht vollends zu verzweifeln, fing ich wieder zu rauchen an und vertrieb mir die Nachmittage in klimatisierten Coffeeshops, trank Limonade, aß gegrillte Käsesandwichs, lauschte Gesprächen und arbeitete mich durch sämtliche Artikel der dort ausliegenden Tageszeitungen. Zeit verging.
An dem fraglichen Morgen – 18.September 1982 – verließ ich die Wohnung irgendwann zwischen halb zehn und zehn. Meine Frau und ich lebten in Cobble Hill, einem Teil von Brooklyn in der Mitte zwischen Brooklyn Heights und Carroll Gardens. Auf meinen Wanderungen bewegte ich mich gewöhnlich nach Norden, an diesem Morgen aber ging ich nach Süden, wandte mich an der Court Street nach rechts und ging so eine Strecke von sechs oder sieben Blocks weiter. Der Himmel hatte die Farbe von Zement: graue Wolken, graue Luft, grauer Nieselregen, getrieben von grauen Windstößen. Ich hatte immer eine Schwäche für solch trübes Wetter gehabt und fühlte mich wohl dabei, empfand keinerlei Bedauern, dass wir die Hundstage hinter uns hatten. Etwa zehn Minuten nachdem ich aufgebrochen war, entdeckte ich zwischen Carroll und President Street eine Schreibwarenhandlung. Sie lag auf der anderen Straßenseite und war zwischen einer Schuhreparaturwerkstatt und einer 24-Stunden-Bodega eingeklemmt, die einzige helle Fassade in einer Reihe schäbiger, gesichtsloser Gebäude. Ich nahm an, es gab sie noch nicht lange, aber trotz ihrer Neuheit und trotz der raffinierten Auslage im Schaufenster (Türme aus Kugelschreibern, Bleistiften und Linealen, die die New Yorker Skyline darstellen sollten) wirkte der Paper Palace zu klein, als dass er viel Interessantes zu bieten haben konnte. Dass ich mich entschloss, die Straße zu überqueren und hineinzugehen, hatte seinen Grund offenbar darin, dass ich mir insgeheim wünschte, wieder mit der Arbeit anzufangen – ohne es zu wissen, ohne mir des Drangs bewusst zu sein, der sich in mir angestaut hatte. Ich hatte seit Mai, seit meiner Entlassung aus dem Krankenhaus, nichts mehr geschrieben – keinen Satz, kein Wort – und auch nicht die leiseste Neigung dazu verspürt. Jetzt, nach vier in Apathie und Schweigen verbrachten Monaten, setzte ich es mir plötzlich in den Kopf, mich mit einem frischen Vorrat an Schreibmaterial zu versehen: neue Kulis und Bleistifte, neues Notizbuch, neue Tintenpatronen und Radiergummis, neue Schreibblöcke und Aktenmappen, alles neu.
An der Kasse hinterm Eingang saß ein Chinese. Er schien ein bisschen jünger als ich zu sein, und als ich beim Betreten des Ladens einen Blick durchs Fenster warf, sah ich ihn gebeugt über einem Schreibblock sitzen und mit einem schwarzen Druckbleistift Zahlenkolonnen notieren. Trotz der Kälte, die an diesem Tag in der Luft lag, trug er ein kurzärmliges Hemd – ein dünnes, locker sitzendes Sommerhemd mit offenem Kragen–, das seine kupferfarbenen Arme noch dünner erscheinen ließ. Die Tür klingelte, als ich sie aufzog, und der Mann hob kurz den Kopf, um mich mit einem höflichen Nicken zu grüßen. Ich erwiderte den Gruß, aber ehe ich etwas sagen konnte, senkte er den Kopf wieder über seine Berechnungen.
Der Verkehr draußen auf der Court Street musste gerade in eine Flaute geraten sein, oder die Schaufensterscheibe war außerordentlich dick, jedenfalls wurde ich, als ich in den ersten Gang trat, um mir den Laden genauer anzusehen, plötzlich gewahr, was für eine Stille dort herrschte. Ich war der erste Kunde des Tages, und die Stille war so ausgeprägt, dass ich das Kratzen des Bleistifts hinter mir hören konnte. Wenn ich heute an diesen Morgen denke, fällt mir als Erstes immer das Geräusch dieses Bleistifts ein. Und das so intensiv, dass, wenn die folgende Geschichte überhaupt einen Sinn hat, hier der Anfang zu suchen ist – im Zeitraum der wenigen Sekunden, als das Geräusch dieses Bleistifts das einzige Geräusch war, das es auf der Welt noch gab.
Ich schob mich durch den Gang, hielt alle paar Schritte an, um mir die Sachen in den Regalen anzusehen. Es waren im Wesentlichen die üblichen Büro- und Schulbedarfsartikel, aber für einen so beschränkten Raum war die Auswahl bemerkenswert breit gefächert, und mich beeindruckte die Sorgfalt, die auf die Beschaffung und Anordnung einer solchen Fülle von Waren verwandt worden war, die von Heftzungen in sechs verschiedenen Längen bis zu zwölf verschiedenen Büroklammermodellen nichts auszulassen schien. Als ich hinten um die Ecke bog und den anderen Gang Richtung Eingangstür betrat, fiel mir ein Regal auf, das eine Reihe hochwertiger Importartikel zur Schau stellte: in Leder gebundene Schreibblöcke aus Italien, Adressbücher aus Frankreich, zierliche Reispapiermappen aus Japan. Des Weiteren zwei Stapel Notizbücher aus Deutschland und Portugal. Die portugiesischen Notizbücher erschienen mir besonders reizvoll, und kaum hatte ich die festen Einbände und die fadengehefteten Bögen robusten, klecksresistenten Papiers mit karierter Lineatur erblickt und eins davon in die Hand genommen, wusste ich auch schon, dass ich mir eins kaufen würde. Es war nichts Extravagantes oder Demonstratives daran: ein praktischer Gebrauchsgegenstand – strapazierfähig, einfach, zweckdienlich, ganz gewiss nicht die Art von Notizbuch, die als Geschenk in Frage kommen könnte. Aber mir gefiel, dass es in Leinen gebunden war, und mir gefiel auch die Form: dreiundzwanzigeinhalb mal achtzehneinhalb Zentimeter, also etwas weniger hoch und dafür breiter als gewöhnlich. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich empfand diese Abmessungen als äußerst befriedigend, und als ich das Notizbuch zum ersten Mal in der Hand hielt, spürte ich so etwas wie physisches Behagen, eine jähe Woge unbegreiflichen Wohlbefindens. Es waren nur noch vier von diesen Notizbüchern übrig, jedes in einer anderen Farbe: schwarz, rot, braun und blau. Ich entschied mich für das blaue, das zufällig gerade oben lag.
Fünf Minuten später hatte ich die anderen Dinge, derentwegen ich gekommen war, zusammengesucht, trug sie nach vorne und legte sie auf den Ladentisch. Der Mann schenkte mir wiederum ein höfliches Lächeln und begann die Preise der verschiedenen Artikel in die Kasse einzutippen. Als er jedoch zu dem blauen Notizbuch kam, hörte er kurz auf, hielt das Buch hoch und strich mit den Fingerspitzen leicht über den Einband. Eine Geste der Wertschätzung, fast schon eine Liebkosung.
«Schönes Buch», sagte er mit starkem Akzent. «Aber nicht mehr. Nicht mehr Portugal. Sehr traurige Geschichte.»
Ich konnte ihm nicht folgen, doch statt ihn in Verlegenheit zu bringen und ihn zu bitten, es zu wiederholen, murmelte ich etwas von der Eleganz und Schlichtheit des Notizbuchs und wechselte dann das Thema. «Haben Sie das Geschäft schon lange?», fragte ich. «Es sieht alles so neu und sauber aus.»
«Ein Monat», sagte er. «Große Eröffnung am zehnten August.»
Als er das verkündete, schien er sich ein wenig gerader aufzurichten, sich mit jungenhaftem, militärischem Stolz in die Brust zu werfen, aber als ich ihn fragte, wie die Geschäfte denn so liefen, legte er das blaue Notizbuch sachte auf den Ladentisch und schüttelte den Kopf. «Sehr schlecht. Viel Enttäuschung.» Als ich ihm in die Augen sah, begriff ich, dass er mehrere Jahre älter war, als ich zuerst gedacht hatte – er war mindestens fünfunddreißig, vielleicht schon vierzig. Ich machte eine lahme Bemerkung von wegen, er solle nur durchhalten und den Dingen die Chance geben, sich zu entwickeln, aber er schüttelte nur wieder den Kopf und lächelte. «Immer mein Traum, Laden besitzen», sagte er. «Laden wie dieser mit Schreibzeug und Papier, mein großer amerikanischer Traum. Geschäft für alle Leute, stimmt’s?»
«Stimmt», sagte ich, ohne aber recht zu wissen, wovon er redete.
«Alle machen Wörter», fuhr er fort. «Alle schreiben Dinge auf. Kinder in Schule benutzen meine Bücher. Lehrer schreiben Noten in meine Bücher. Liebesbriefe werden in Umschlägen von mir verschickt. Hauptbücher für Buchhalter, Notizblöcke für Einkaufslisten, Terminkalender für Wochenplan. Alles hier wichtig für Leben, und das macht mich glücklich, gibt meinem Leben Ehre.»
Der Mann hielt seine kleine Rede mit so feierlichem Ernst, mit solcher Entschlossenheit und Hingabe – ich muss gestehen, ich war richtig bewegt. Was ist das für ein Schreibwarenhändler, fragte ich mich, der seinen Kunden die Metaphysik des Papiers erklärt und sich selbst eine wesentliche Rolle in den unzähligen Angelegenheiten der Menschheit zumisst? Das hatte schon etwas Komisches, glaube ich, aber während ich ihm zuhörte, war mir nicht nach Lachen zumute.
«Gut formuliert», sagte ich. «Ich bin ganz und gar Ihrer Meinung.»
Das Kompliment schien seine Laune ein wenig zu heben. Mit einem kleinen Lächeln und einem Kopfnicken tippte er wieder auf die Tasten seiner Kasse ein. «Viele Schriftsteller hier in Brooklyn», sagte er. «Ganze Gegend voll von ihnen. Gut für Geschäft vielleicht.»
«Vielleicht», sagte ich. «Das Dumme mit Schriftstellern ist nur, dass die meisten kein Geld haben.»
«Ah», sagte er, blickte von der Kasse auf und zeigte ein breites Lächeln, das seine schiefen Zähne sehen ließ. «Sie müssen selbst Schriftsteller sein.»
«Verraten Sie das ja keinem», antwortete ich, weiter um einen munteren Tonfall bemüht. «Das soll ein Geheimnis bleiben.»
Das war keine sehr komische Bemerkung, aber der Mann schien sie ausgesprochen amüsant zu finden und kriegte sich vor Lachen kaum noch ein. Sein Lachen hatte einen seltsamen, abgehackten Rhythmus – ein Mittelding zwischen Singen und Sprechen – und kam in einer Reihe kurzer mechanischer Triller aus seiner Kehle: Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. «Verrate keinem», sagte er, als der Ausbruch sich gelegt hatte. «Streng geheim. Nur unter uns. Meine Lippen versiegelt. Ha ha ha.»
Er wandte sich wieder der Kasse zu, und als er meine Sachen in einer großen weißen Einkaufstüte verstaut hatte, war seine Miene wieder ernst geworden. «Wenn Sie eines Tages eine Geschichte in blaues Portugalbuch schreiben», sagte er «freut mich sehr. Füllt mein Herz mit Freude.»
Darauf wusste ich nichts zu antworten, aber ehe mir etwas einfiel, nahm er eine Visitenkarte aus seiner Hemdtasche und reichte sie mir über den Ladentisch. Oben stand in auffälliger Schrift PAPER PALACE. Darunter Adresse und Telefonnummer, und ganz unten rechts in der Ecke war als letzte Information zu lesen: M.R.Chang, Inhaber.
«Ich danke Ihnen, Mr.Chang», sagte ich, die Karte studierend. Dann schob ich sie mir in die Tasche und zückte mein Portemonnaie, um zu bezahlen.
«Nicht Mister», sagte Chang und zeigte wieder sein breites Lächeln. «M.R.Das klingt mehr bedeutend. Mehr amerikanisch.»
Auch darauf wusste ich nichts zu erwidern. Ein paar Ideen, wofür die Initialen stehen könnten, huschten mir durch den Kopf, aber die behielt ich für mich. Mentale Ressourcen. Multiple Resultate. Mysteriöse Reputation. Manche Kommentare bleiben besser unausgesprochen, und ich sparte mir die Mühe, dem armen Mann meine dummen Scherze aufzudrängen. Nach kurzem verlegenem Schweigen reichte er mir die weiße Einkaufstüte und bedankte sich mit einer Verbeugung.
«Viel Glück mit Ihrem Laden», sagte ich.
«Sehr kleiner Palast», sagte er. «Nicht viel Auswahl. Aber Sie sagen, was Sie brauchen, und ich bestelle. Alles was Sie wollen.»
«Okay», sagte ich. «Abgemacht.»
Aber als ich mich zum Gehen wandte, flitzte Chang hinter dem Ladentisch hervor und verstellte mir den Weg zur Tür. Offenbar glaubte er, wir hätten soeben ein höchst bedeutsames Geschäft abgeschlossen, und wollte mir nun die Hand darauf geben. «Abgemacht», sagte er. «Gut für Sie, gut für mich. Okay?»
«Okay», wiederholte ich und ließ mir von ihm die Hand schütteln. Ich fand es absurd, aus so wenig so viel zu machen, aber es kostete mich ja nichts, da mitzuspielen. Außerdem wollte ich endlich weiterkommen, und je weniger ich sagte, desto eher konnte ich gehen.
«Sie fragen, ich finde. Alles, ich finde alles für Sie. M.R.Chang liefert alles.»
Darauf schwenkte er meinen Arm noch ein paar Mal, dann hielt er mir die Tür auf und nickte mir lächelnd zu, als ich mich an ihm vorbei in den rauen Septembertag hinausschob.1
Seit jenem Morgen sind zwanzig Jahre vergangen, und vieles von unserem Gespräch ist mir entfallen. Ich suche in meiner Erinnerung nach den fehlenden Dialogstücken, finde aber nur noch ein paar isolierte Fragmente, Einzelheiten, denen der ursprüngliche Kontext verloren gegangen ist. Sicher bin ich mir allerdings, dass ich ihm meinen Namen genannt habe. Und zwar unmittelbar nachdem er dahintergekommen war, dass ich Schriftsteller bin, denn ich höre ihn noch fragen, wie ich heiße – für den unwahrscheinlichen Fall, dass er auf eins meiner Bücher stieße. «Orr», hatte ich ihm geantwortet, also zunächst meinen Nachnamen genannt, «Sidney Orr.» Changs Englisch reichte aber nicht aus, meine Antwort zu verstehen. Er hörte Orr als «or», und als ich lächelnd den Kopf schüttelte, nahm seine Miene den Ausdruck verlegener Verwirrung an. Ich wollte den Irrtum schon richtig stellen und ihm meinen Namen buchstabieren, doch ehe ich etwas sagen konnte, leuchteten seine Augen wieder auf, und dazu machte er heftige Ruderbewegungen, in der Annahme, ich hätte womöglich «oar» gesagt. Wieder schüttelte ich lächelnd den Kopf. Nun vollends mit seinem Latein am Ende, seufzte Chang laut auf und sagte: «Schreckliche Sprache, dieses Englisch. Zu kompliziert für mein armes Gehirn.» Das Missverständnis blieb bestehen, bis ich das blaue Notizbuch vom Ladentisch nahm und meinen Namen in Blockschrift auf die innere Umschlagseite schrieb. Das schien das gewünschte Ergebnis herbeizuführen. Nach so viel Mühe ersparte ich es mir, ihm zu erzählen, dass die ersten Orrs in Amerika ursprünglich Orlovsky geheißen hatten. Mein Großvater hatte den Namen abgekürzt, damit er sich amerikanischer anhöre – so wie Chang sich aus dem gleichen Motiv die dekorativen, aber sinnlosen Initialen M.R. vor den seinen gesetzt hatte.
Ich hatte vorgehabt, in einem Lokal in der Gegend zu frühstücken, aber von den zwanzig Dollar, die ich mir eingesteckt hatte, waren nur noch drei und ein bisschen Kleingeld übrig – das reichte nicht einmal für das Tagesfrühstück zu 2,99$, wenn man Steuer und Trinkgeld berücksichtigte. Ohne die Einkaufstüte hätte ich meinen Spaziergang vielleicht einfach fortgesetzt, aber ich hatte wenig Lust, das Ding mit mir durch die Gegend zu schleppen, und da das Wetter inzwischen ziemlich scheußlich geworden war (das feine Nieseln hatte sich zu einem Dauerregen entwickelt), spannte ich meinen Schirm auf und ging nach Hause.
Es war ein Samstag, und meine Frau hatte, als ich die Wohnung verließ, noch im Bett gelegen. Grace hatte einen Vollzeitjob und nur am Wochenende die Möglichkeit, einmal auszuschlafen, sich den Luxus zu gönnen, ohne Wecker aufzuwachen. Um sie nicht zu stören, war ich so leise wie möglich hinausgeschlichen und hatte ihr einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. Jetzt sah ich, dass sie ein paar Zeilen hinzugefügt hatte. Sidney: Hoffe, du hattesteinen schönen Spaziergang. Ich gehe Besorgungen machen. Bin bald zurück. Wir sehen uns auf der Ranch. Love, G.
Ich ging in mein Arbeitszimmer am Ende des Flurs und packte meine neuen Sachen aus. Das Zimmer war winzig – der Platz reichte gerade für einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein kleines Bücherregal mit vier schmalen Brettern–, genügte mir aber für meine Bedürfnisse, denn auf dem Stuhl sitzen und Worte zu Papier bringen war alles, was ich dort wollte. Ich war seit der Entlassung aus dem Krankenhaus schon einige Male in dem Zimmer gewesen, aber bis zu diesem Samstagmorgen im September – den ich lieber den fraglichen Morgen nenne – hatte ich, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal auf dem Stuhl Platz genommen. Als ich jetzt meinen erbärmlichen, entkräfteten Hintern auf den harten Holzsitz senkte, kam ich mir vor wie jemand, der von einer langen und beschwerlichen Reise nach Hause gekommen ist, ein vom Glück verlassener Reisender, zurückgekehrt, um seinen rechtmäßigen Platz in der Welt wieder einzufordern. Es war schön, wieder da zu sein, schön, wieder da sein zu wollen, und in dem Glücksgefühl, das mich überkam, als ich wieder an meinem alten Schreibtisch saß, beschloss ich, das Ereignis durch einen Eintrag in das blaue Notizbuch zu feiern.
Ich setzte eine frische Tintenpatrone in meinen Füllfederhalter, öffnete das Notizbuch auf der ersten Seite und starrte die oberste Zeile an. Ich hatte keine Ahnung, wie ich anfangen sollte. Zweck der Übung war nicht so sehr, etwas Bestimmtes zu schreiben, sondern mir selbst zu beweisen, dass ich noch zum Schreiben imstande war – daher spielte es keine Rolle, was ich schrieb, solange ich nur überhaupt etwas zu Papier brachte. Alles wäre mir recht gewesen, ein Satz so richtig wie der andere, aber ich wollte das neue Notizbuch ja auch nicht mit irgendetwas Dummem einweihen, und so wartete ich noch und sah mir die kleinen Quadrate auf dem Papier an, die Reihen mattblauer Linien, die als Gitter auf der weißen Fläche lagen und sie in winzige identische Kästchen unterteilten, und als ich meine Gedanken über diese angedeuteten Einfriedungen hinschweifen ließ, musste ich plötzlich an ein Gespräch denken, das ich zwei Wochen zuvor mit meinem Freund John Trause geführt hatte. Wenn wir zusammen waren, sprachen wir beide nur selten über Bücher, aber an diesem Tag hatte John erwähnt, er habe einige Romanautoren wieder gelesen, die er in seiner Jugend bewundert habe – neugierig, ob ihre Werke ihm auch heute noch etwas sagten oder nicht, neugierig, ob sein Urteil als Zwanzigjähriger dreißig Jahre später noch genauso ausfallen würde. Er ging zehn Autoren durch, zwanzig Autoren, streifte alles von Faulkner und Fitzgerald bis zu Dostojewski und Flaubert, aber was mir von seinen Ausführungen am lebhaftesten im Gedächtnis blieb – und woran ich jetzt denken musste, als ich vor dem blauen Notizbuch an meinem Schreibtisch saß–, war ein kleiner Exkurs über eine Anekdote in einem Buch von Dashiell Hammett. «Da steckt ein ganzer Roman drin», hatte John gesagt. «Ich bin zu alt, um selbst darüber nachdenken zu wollen, aber ein junger Hüpfer wie du könnte da was Großes und Gutes draus machen. Es ist ein phantastischer Ausgangspunkt. Man braucht nur noch die passende Geschichte dazu.»2
John war sechsundfünfzig. Zwar nicht mehr jung, aber auch noch nicht so alt, dass er sich selbst als alt betrachtete, zumal er sich sehr gut hielt und immer noch wie Mitte bis Ende vierzig aussah. Ich kannte ihn seit drei Jahren, und unsere Freundschaft ging direkt auf meine Ehe mit Grace zurück. Ihr Vater hatte in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit John zusammen in Princeton studiert, und obwohl die beiden dann auf ganz verschiedenen Gebieten arbeiteten (Graces Vater war Bezirksrichter in Charlottesville, Virginia), hatten sie sich nie aus den Augen verloren. Ich lernte ihn daher als Freund der Familie kennen und nicht als den bekannten Schriftsteller, den ich seit der Highschool gelesen hatte – und den ich noch immer für einen unserer besten Autoren hielt.
Zwischen 1952 und 1975 hatte er sechs literarische Werke veröffentlicht, nun aber seit über sieben Jahren nichts mehr. John war jedoch nie sehr schnell gewesen, und dass die Pause jetzt etwas länger als gewöhnlich geraten war, bedeutete keineswegs, dass er nicht arbeitete. Ich hatte seit der Entlassung aus dem Krankenhaus schon einige Nachmittage mit ihm verbracht, und während unserer Gespräche über meinen Gesundheitszustand (der ihm unentwegt große Sorgen machte), seinen zwanzigjährigen Sohn Jacob (der ihm in letzter Zeit viel Kummer bereitete) und die Bredouille der Mets (eins unserer Lieblingsthemen) hatte er genug Hinweise über seine gegenwärtigen Aktivitäten eingestreut, aus denen ich schließen konnte, dass er intensiv mit etwas beschäftigt war und sehr viel Zeit auf ein Projekt verwandte, das schon weit fortgeschritten sein musste – und vielleicht bald abgeschlossen sein würde.
Er meinte die Flitcraft-Episode im siebten Kapitel des Malteser Falken, die Szene, in der Sam Spade Brigid O’Shaughnessy das eigenartige Gleichnis von dem Mann erzählt, der aus seinem Leben aussteigt und verschwindet. Flitcraft ist ein typischer Durchschnittsmensch– Ehemann, Vater, erfolgreicher Geschäftsmann, jemand, der sich über nichts zu beklagen hat. Als er eines Tages zum Mittagessen geht, stürzt aus dem zehnten Stock einer Baustelle ein Balken auf die Straße und landet um ein Haar auf seinem Kopf. Nur wenige Zentimeter weiter, und Flitcraft wäre zerschmettert worden, aber der Balken verfehlt ihn, und abgesehen von einem Splitter, der vom Bürgersteig aufspringt und ihn im Gesicht trifft, kommt er unverletzt davon. Dennoch lässt ihn der Vorfall nicht los, der Gedanke, dem Tod nur knapp entronnen zu sein, bringt ihn aus der Fassung. Hammett schreibt: «Es kam ihm vor, als habe jemand den Deckel vom Leben gehoben und ihn einen Blick in die Mechanik werfen lassen.» Flitcraft erkennt, dass die Welt nicht so vernünftig und wohl geordnet ist, wie er gedacht hat, dass er von Anfang an alles falsch verstanden und bisher noch überhaupt nichts begriffen hat. Die Welt wird vom Zufall regiert. Willkür verfolgt uns an jedem Tag unseres Lebens, und jederzeit kann uns dieses Leben genommen werden – ohne jeden Grund. Als Flitcraft seine Mahlzeit beendet hat, gelangt er zu dem Schluss, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als sich dieser destruktiven Macht zu unterwerfen und sein Leben durch irgendeinen sinnlosen, vollkommen willkürlichen Akt der Selbstverneinung zu zertrümmern. Er will gewissermaßen Feuer mit Feuer bekämpfen; er denkt gar nicht daran, nach Hause zu gehen oder sich von seiner Familie zu verabschieden, er denkt nicht einmal daran, sich auf der Bank noch etwas Geld zu holen, sondern steht einfach auf, fährt in eine andere Stadt und fängt sein Leben noch einmal von vorne an.
In den zwei Wochen, seit John und ich über diese Stelle gesprochen hatten, war mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen, dass ich den Wunsch haben könnte, mich der Herausforderung zu stellen und diese Geschichte weiter auszuarbeiten. Auch ich fand, sie sei ein guter Ausgangspunkt – gut, weil jeder von uns sich schon einmal vorgestellt hat, aus seinem Leben auszusteigen; gut, weil jeder von uns schon einmal gewünscht hat, jemand anderer zu sein–, aber das bedeutete nicht, dass ich irgendein Interesse daran hatte, der Sache nachzugehen. Als ich jedoch an diesem Morgen zum ersten Mal seit nahezu neun Monaten wieder an meinem Schreibtisch saß, mein frisch erstandenes Notizbuch anstarrte und krampfhaft einen ersten Satz zu finden versuchte, der mich nicht in Verlegenheit bringen oder mir den Mut nehmen würde, beschloss ich, es doch einmal mit der alten Flitcraft-Episode zu versuchen. Das war nicht mehr als ein Vorwand, ein Tasten nach einem möglichen Einstieg. Wenn ich imstande wäre, ein paar halbwegs interessante Ideen zu notieren, könnte ich immerhin von einem Anfang sprechen, auch wenn ich nach zwanzig Minuten aufhören und niemals etwas daraus machen würde. Also zog ich die Kappe von meinem Füller, drückte die Feder auf die oberste Linie der ersten Seite des blauen Notizbuchs und begann zu schreiben.
Die Worte kamen schnell, wie von selbst, scheinbar ohne große Anstrengung. Das überraschte mich, aber solange ich meine Hand weiter von links nach rechts bewegte, war das nächste Wort immer schon da und wartete nur, mir aus der Feder zu fließen. Ich sah meinen Flitcraft als einen Mann namens Nick Bowen. Er ist Mitte dreißig, arbeitet als Lektor bei einem großen New Yorker Verlag und ist mit einer Frau namens Eva verheiratet. Dem Beispiel von Hammetts Urbild folgend, kann er in seinem Job nur erfolgreich sein, wird von seinen Kollegen bewundert, ist finanziell auf der sicheren Seite, glücklich verheiratet und so weiter. So jedenfalls erscheint es einem flüchtigen Beobachter, aber in meiner Version der Geschichte hat Bowen schon längere Zeit mit Problemen zu kämpfen. Die Arbeit langweilt ihn (obwohl er das nicht zugeben will), und nach fünf Jahren einer relativ stabilen und zufriedenen Beziehung mit Eva ist seine Ehe zum Stillstand gekommen (auch dieser Tatsache vermag er nicht ins Gesicht zu sehen). Statt sich mit seiner zunehmenden Unzufriedenheit zu beschäftigen, verbringt Nick seine Freizeit in einer Werkstatt an der Desbrosses Street in Tribeca, wo er sich mit der langwierigen Aufgabe befasst, den Motor eines kaputten Jaguar zu reparieren, den er im dritten Jahr seiner Ehe erworben hat. Er ist ein gefragter junger Lektor bei einem angesehenen New Yorker Verlagshaus, aber in Wahrheit zieht er es vor, mit den Händen zu arbeiten.
Die Geschichte beginnt damit, dass Bowen das Manuskript eines Romans auf den Schreibtisch bekommt. Ein kurzes Werk mit dem viel sagenden Titel Nacht des Orakels, angeblich verfasst von Sylvia Maxwell, einer beliebten Autorin der zwanziger und dreißiger Jahre, die knapp zwei Jahrzehnte zuvor gestorben war. Dem Agenten zufolge, der es eingeschickt hatte, war dieses verschollene Buch 1927 entstanden, in dem Jahr, in dem Maxwell mit einem Engländer namens Jeremy Scott, einem unbedeutenden Künstler, der später als Dekorateur für britische und amerikanische Filmproduktionen gearbeitet hatte, nach Frankreich durchgebrannt war. Als die Affäre nach achtzehn Monaten vorbei war und Sylvia Maxwell nach New York zurückkehrte, ließ sie den Roman bei Scott. Er behielt ihn bis ans Ende seines Lebens, und als er, wenige Monate bevor meine Geschichte beginnt, mit siebenundachtzig Jahren starb, fand sich in seinem Testament eine Klausel, die das Manuskript Maxwells Enkelin vermachte, einer jungen Amerikanerin namens Rosa Leightman. Durch sie war das Buch an den Agenten gelangt – mit der klaren Anweisung, es zunächst an Nick Bowen zu schicken; niemand sonst sollte es vor ihm zu Gesicht bekommen.
Das Päckchen gelangt an einem Freitagnachmittag in Nicks Büro, wenige Minuten nachdem er sich ins Wochenende verabschiedet hat. Als er am Montagmorgen zurückkommt, liegt das Buch auf seinem Schreibtisch. Nick ist ein Bewunderer der anderen Romane von Sylvia Maxwell und will daher gleich mit diesem anfangen. Aber kaum hat er die erste Seite aufgeschlagen, klingelt das Telefon. Seine Assistentin teilt ihm mit, Rosa Leightman sei am Empfang und frage, ob er ein paar Minuten Zeit für sie habe. Schick sie rein, sagt Nick, und ehe er auch nur die ersten Sätze des Buchs zu Ende lesen kann (Der Krieg war fast vorbei, aber das wussten wir nicht. Wir waren zu klein, um irgendetwas zu wissen, und da der Krieg überall war, konnten wir…), tritt Sylvia Maxwells Enkelin in sein Büro. Sie ist überaus schlicht gekleidet, so gut wie nicht geschminkt und trägt ihr Haar in einer altmodischen Kurzfrisur, und doch ist ihr Gesicht so reizend, findet Nick, so schmerzlich jung und ungeschützt, ein solches (denkt er plötzlich) Inbild von Hoffnung und entfesselter menschlicher Energie, dass es ihm den Atem verschlägt. Genau so ist es mir ergangen, als ich Grace das erste Mal sah – dieser lähmende Schlag ins Gehirn, der mir den Atem raubte–, weshalb es mir nicht schwer fiel, diese Gefühle auf Nick Bowen zu übertragen und sie mir im Kontext dieser anderen Geschichte auszumalen. Um die Sache noch einfacher zu machen, beschloss ich, Rosa Leightman mit Graces Körper zu versehen – bis hin zu den kleinsten, individuellsten Eigenarten, einschließlich der Kindheitsnarbe auf ihrer Kniescheibe, dem leicht schiefen linken Schneidezahn und dem Schönheitsfleck auf ihrer rechten Wange.3
Auch ich hatte Grace per Zufall in einem Verlagsbüro kennen gelernt, was vielleicht erklärt, warum ich beschloss, Bowen gerade diesen Job zu geben. Das war im Januar 1979 gewesen, nicht lange nachdem ich meinen zweiten Roman beendet hatte. Mein erster Roman und ein früherer Erzählungsband waren von einem kleinen Verlag in San Francisco herausgebracht worden, aber jetzt war ich bei einem größeren, stärker kommerziell ausgerichteten Haus, Holst & McDermott in New York, untergekommen. Etwa zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung suchte ich meine Lektorin in ihrem Büro auf, und als wir im Verlauf unseres Gesprächs auf die Gestaltung des Buchumschlags zu sprechen kamen, nahm Betty Stolowitz das Telefon von ihrem Schreibtisch und meinte: «Ich finde, wir sollten Grace holen und sie nach ihrer Meinung fragen.» Wie sich herausstellte, arbeitete Grace bei Holst & McDermott als Designerin und hatte den Auftrag, den Schutzumschlag für Selbstporträt mit imaginärem Bruder zu entwerfen – so der Titel des kleinen Buchs, in dem es um meine Grillen und meine Tag- und Albträume ging.
Betty und ich diskutierten noch drei, vier Minuten lang weiter, und dann betrat Grace Tebbetts den Raum. Sie blieb ungefähr eine Viertelstunde, und als sie aufstand und wieder in ihr Büro zurückkehrte, war ich in sie verliebt. Völlig abrupt, überzeugend, unerwartet. Ich hatte von dergleichen in Romanen gelesen, aber immer angenommen, die Autoren übertrieben die Gewalt des ersten Blicks – dieses endlos debattierten Moments, in dem der Mann zum ersten Mal in die Augen seiner Geliebten sieht. Für einen geborenen Pessimisten wie mich war das eine absolut schockierende Erfahrung. Ich kam mir vor, als hätte man mich in die Welt der Troubadoure zurückgestoßen, als durchlebte ich plötzlich eine Stelle im ersten Kapitel von La Vita Nova (…als mir zum ersten Mal die herrliche Gebieterin meines Geistes erschien), als bewohnte ich die faden Phrasen von tausend vergessenen Liebessonetten. Ich brannte. Ich schmachtete. Ich darbte. Ich verstummte ganz und gar. Und das alles passierte mir in der ödesten Umgebung, im harten Neonlicht eines amerikanischen Büros am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts – dem letzten Ort auf der Welt, an dem man damit rechnen würde, auf die Leidenschaft seines Lebens zu stoßen. Solche Ereignisse lassen sich nicht erklären, es gibt keinen objektiven Grund dafür, warum wir uns in den einen Menschen verlieben und in den anderen nicht. Grace war eine gut aussehende Frau, aber selbst in diesen ersten turbulenten Sekunden unserer ersten Begegnung, als ich ihr die Hand gab und sie sich auf einen Stuhl neben Bettys Schreibtisch setzte, vermochte ich zu sehen, dass sie keine übermäßige Schönheit war, keine dieser Kinogöttinnen, die einen mit dem Glanz ihrer Vollkommenheit überwältigen. Zweifellos war sie ansehnlich, beeindruckend, ein erfreulicher Anblick (wie auch immer man diese Ausdrücke verstehen mag), aber so heftig ich mich zu ihr hingezogen fühlte, war mir doch auch bewusst, dass es mehr als nur physische Anziehung war, dass der Traum, den ich jetzt zu träumen anfing, mehr war als nur eine momentane Anwandlung animalischer Begierde. Grace machte einen intelligenten Eindruck auf mich, doch als sie im Lauf des Gesprächs ihre Vorstellungen zu dem Buchumschlag entwickelte, stellte ich fest, dass sie kein sehr redegewandter Mensch war (sie zögerte häufig zwischen zwei Sätzen, beschränkte ihr Vokabular auf schlichte, sachliche Ausdrücke und schien kein Abstraktionstalent zu haben), und nichts von dem, was sie an diesem Nachmittag sagte, war in irgendeiner Weise brillant oder bemerkenswert. Abgesehen von einigen freundlichen Bemerkungen zu meinem Buch wies nichts in ihrem Verhalten darauf hin, dass sie auch nur das leiseste Interesse an mir hatte. Und dennoch war ich in einen Zustand höchster Qual geraten – ich brannte, schmachtete und darbte: ein Mann, der in die Falle der Liebe getappt war.
Sie war einen Meter zweiundsiebzig groß und wog siebenundfünfzig Kilogramm. Schlanker Hals, lange Arme und lange Finger, helle Haut, kurzes, schmutzig blondes Haar. Ihre Frisur hatte, wie mir später auffiel, einige Ähnlichkeit mit der, die man von den Abbildungen des Titelhelden in Der kleine Prinz kennt – abgesägte Spitzen und Locken–, und vielleicht verstärkte diese Assoziation die leicht androgyne Aura, die Grace umgab. Ebenso muss die männliche Kleidung, die sie an diesem Nachmittag trug, zu diesem Eindruck beigetragen haben: schwarze Jeans, weißes T-Shirt und ein mattblaues Leinenjackett. Etwa fünf Minuten nach ihrem Eintreten legte sie das Jackett ab und hängte es über ihre Stuhllehne, und als ich ihre Arme sah, diese langen, glatten, unendlich weiblichen Arme, wusste ich bereits, dass ich erst wieder Ruhe finden würde, wenn ich sie berühren konnte, wenn ich das Recht erworben hatte, meine Hände auf ihren Körper zu legen und ihre bloße Haut zu streicheln.
Aber ich möchte nicht an der Oberfläche von Graces Körper bleiben, möchte mehr als die zufälligen Gegebenheiten ihrer physischen Existenz. Natürlich sind Körper wichtig – wichtiger, als wir zuzugeben bereit sind–, aber wir verlieben uns nicht in Körper, wir verlieben uns ineinander, und mag auch vieles von dem, was wir sind, auf Fleisch und Knochen beschränkt sein, so gibt es doch auch manches andere. Wir alle wissen das, aber sobald wir über den Katalog von oberflächlichen Eigenschaften und Äußerlichkeiten hinauswollen, gehen uns die Worte aus und zerfallen in mystisches Gefasel und nebulöse, substanzlose Metaphern. Manche nennen das die Flamme des Seins. Andere sprechen vom inneren Funken oder vom inneren Licht des Ich. Wiederum andere sprechen vom Feuer der Wesenheit. Stets handelt es sich um Bilder von Wärme und Licht, und jene Energie, die Essenz des Lebens, die wir manchmal als Seele bezeichnen, wird einem anderen Menschen immer durch die Augen vermittelt. Zweifellos hatten die Dichter Recht, auf diesem Punkt zu beharren. Das Mysterium des Verlangens beginnt mit dem Blick in die Augen des Geliebten, weil man nur dort etwas vom Wesen des anderen erhaschen kann.
Graces Augen waren blau. Dunkelblau mit grauen, auch mit einigen braunen oder haselnussbraunen Einsprengseln. Es waren komplexe Augen, Augen, die je nach Intensität und Tönung des in sie einfallenden Lichts die Farbe wechselten, und als ich sie an jenem Tag in Bettys Büro zum ersten Mal sah, kam mir der Gedanke, dass ich noch nie eine Frau gesehen hatte, die eine solche Gemütsruhe ausstrahlte, eine solche Gelassenheit: es war, als befinde sich Grace, die damals noch keine siebenundzwanzig war, bereits auf einer höheren Seinsebene als wir anderen. Ich will damit nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise reserviert wirkte, dass sie in einer glückseligen Wolke von Herablassung oder Gleichgültigkeit über ihren Lebensumständen schwebte. Im Gegenteil, sie war während der ganzen Besprechung durchaus lebhaft, lachte gern, lächelte, sagte immer das Richtige und machte dazu die richtigen Gesten; doch hinter ihrem professionellen Umgang mit den Ideen, die Betty und ich ihr vorlegten, verspürte ich einen auffallenden Mangel an innerer Anspannung, eine Ausgeglichenheit, die sie der üblichen Konflikte und Aggressionen des modernen Lebens zu entheben schienen: Selbstzweifel, Neid, Sarkasmus, das Bedürfnis, andere zu bewerten oder herabzusetzen, der brennende, unerträgliche Schmerz persönlicher Ambitionen. Grace war jung, ihre Seele aber war alt und verwittert, und als ich an diesem ersten Tag mit ihr bei Holst & McDermott saß, ihr in die Augen sah und die Konturen ihres schlanken, kantigen Körpers studierte, verliebte ich mich in genau das: in die Ruhe, die sie umhüllte, in das strahlende Schweigen, das in ihr loderte.
Bowen jedoch machte ich mit Absicht zu jemandem, der ich nicht bin, zum Gegenteil meiner selbst. Ich bin groß, also machte ich ihn klein. Ich habe rötliches Haar, also gab ich ihm dunkelbraunes. Ich habe Schuhgröße fünfundvierzig, also steckte ich ihn in Größe zweiundvierzig. Ich gestaltete ihn nach keinem mir bekannten Vorbild (jedenfalls nicht bewusst), aber kaum hatte ich ihn mir im Kopf zusammengesetzt, wurde er erstaunlich lebendig – es war beinahe, als könnte ich ihn sehen, beinahe, als sei er ins Zimmer getreten und stünde nun neben mir, als legte er mir eine Hand auf die Schulter, beugte sich über den Schreibtisch und läse mit, was ich zu Papier brachte… als sähe er mir zu, wie ich ihn mit meiner Feder zum Leben erweckte.
Schließlich winkt Nick sie auf den Stuhl ihm gegenüber am Schreibtisch, und Rosa nimmt Platz. Es folgt ein längeres verlegenes Schweigen. Nick kann zwar wieder atmen, aber es fällt ihm nichts ein, was er sagen könnte. Rosa bricht das Eis mit der Frage, ob er am Wochenende Zeit gefunden habe, das Buch zu lesen. Nein, antwortet er, es ist zu spät hier angekommen. Ich habe es erst heute Morgen erhalten.
Rosa wirkt erleichtert. Das ist gut, sagt sie. Es gibt Gerüchte, der Roman sei eine Fälschung, er stamme gar nicht von meiner Großmutter. Da ich mir selbst kein Urteil erlauben konnte, habe ich das Manuskript von einem Handschriftenexperten analysieren lassen. Sein Gutachten kam am Samstag; er sagt, es sei echt. Nur damit Sie Bescheid wissen. Nacht des Orakels wurde tatsächlich von Sylvia Maxwell geschrieben.
Das klingt, als gefalle Ihnen das Buch, sagt Nick, und Rosa sagt ja, es habe sie sehr bewegt. Wenn es 1927 geschrieben wurde, fährt er fort, dann kam es nach Das brennende Haus und Erlösung, aber vor Landschaft mit Bäumen – es wäre demnach ihr dritter Roman. Da war sie noch nicht mal dreißig, stimmt’s?
Achtundzwanzig, sagt Rosa. So alt, wie ich jetzt bin.
Die Unterhaltung wird noch fünfzehn, zwanzig Minuten lang fortgesetzt. Nick hat an diesem Vormittag hundert Dinge zu erledigen, aber er bringt es nicht fertig, sie zum Gehen aufzufordern. Die junge Frau wirkt so offen und klar, so wenig jedweder Selbsttäuschung hingegeben, dass er sie noch ein Weilchen anschauen und den Eindruck ihrer Erscheinung ganz in sich aufnehmen will – und ihre Erscheinung ist schön, findet er, und zwar eben weil sie sich dessen nicht bewusst ist, weil sie ihrer Wirkung auf andere absolut keine Beachtung schenkt. Bedeutendes wird nicht besprochen. Rosa ist die Tochter von Sylvia Maxwells ältestem Sohn (einem Spross aus Maxwells zweiter Ehe mit dem Theaterregisseur Stuart Leightman), erfährt er, sie ist in Chicago geboren und aufgewachsen. Als Nick sie fragt, warum sie solchen Wert darauf gelegt hat, das Buch zuerst ihm zu schicken, sagt sie, sie kenne sich im Verlagsgeschäft überhaupt nicht aus, aber Alice Lazarre sei ihr von allen Gegenwartsautoren die liebste, und seit sie wisse, dass Nick ihr Lektor ist, stehe für sie fest, dass er genau der Richtige für das Buch ihrer Großmutter sei. Nick lächelt. Alice wird sich freuen, sagt er, und als Rosa wenige Minuten später aufsteht und sich zum Gehen anschickt, nimmt er ein paar Bücher aus einem Regal, alles Erstausgaben von Alice Lazarre, und schenkt sie ihr. Ich hoffe, Nacht des Orakels wird Sie nicht enttäuschen, sagt Rosa. Warum sollte es mich enttäuschen?, fragt Nick. Sylvia Maxwell war eine erstklassige Schriftstellerin. Na ja, sagt Rosa, das Buch hier ist anders als die anderen. In welcher Hinsicht?, fragt Nick. Schwer zu sagen, antwortet Rosa, in jeder Hinsicht. Sie werden es beim Lesen schon selber merken.
Es waren natürlich noch andere Entscheidungen zu treffen, eine Menge wichtiger Einzelheiten mussten noch ersonnen und in die Szene eingearbeitet werden – erzählerisches Füllmaterial, das Authentizität suggerierte. Zum Beispiel: Seit wann lebt Rosa in New York? Was tut sie hier? Hat sie einen Job, und falls ja, ist die Arbeit ihr wichtig oder bloß ein Mittel, genug Geld zu verdienen, um die Miete bezahlen zu können? Und wie steht es mit ihrem Liebesleben? Ist sie verheiratet oder nicht, gebunden oder ungebunden, ist sie auf Männerjagd, oder wartet sie geduldig, dass ihr irgendwann der Richtige über den Weg läuft? Anfangs wollte ich eine Fotografin aus ihr machen, oder vielleicht eine Filmeditorin – etwas, was mit Bildern zu tun hatte, nicht mit Worten, also genau wie bei Grace. Auf jeden Fall unverheiratet, noch nie verheiratet, aber vielleicht mit jemandem zusammen oder, noch besser, erst vor kurzem von jemandem getrennt, nach einer langen, qualvollen Affäre. Einstweilen wollte ich mich mit diesen Fragen gar nicht beschäftigen, ebenso wenig mit ähnlichen Fragen, die Nicks Frau betrafen – Beruf, familiärer Hintergrund, musikalische und literarische Vorlieben und so weiter. Ich schrieb die Geschichte ja noch nicht wirklich, ich legte lediglich in groben Zügen die Handlung fest und konnte es mir nicht leisten, mich in die Details von Nebensächlichkeiten zu vertiefen. Das hätte mich zum Nachdenken gezwungen, aber ich wollte jetzt nur vorankommen und sehen, wohin die Bilder in meinem Kopf mich führen würden. Es ging mir nicht darum zu steuern; nicht einmal darum, Entscheidungen zu treffen. Meine Aufgabe an diesem Vormittag bestand einfach darin, dem zu folgen, was sich in meinem Inneren abspielte, und um das zu tun, musste ich den Federhalter nur ununterbrochen in Bewegung halten.
Nick ist kein Filou, kein Weiberheld. Nie hat er seine Frau betrogen, und ihm ist auch jetzt nicht bewusst, dass er es auf Sylvia Maxwells Enkelin abgesehen haben könnte. Er fühlt sich zu ihr hingezogen, keine Frage, das Schillernde und Einfache ihres Wesens hat es ihm angetan, und kaum hat sie sein Büro verlassen, schießt ihm der ungebetene Gedanke durch den Kopf – ein wahrhaftiger Blitz der Begierde–, dass er alles tun würde, um mit dieser Frau ins Bett zu gehen, dass er wahrscheinlich sogar seine Ehe dafür opfern würde. Männer denken so etwas zwanzigmal am Tag, und nur weil jemand ein momentanes Aufflackern von Erregung spürt, muss er noch lange nicht die Absicht haben, diesem Impuls nachzugeben; dennoch, Nick hat diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht, da wird er von Schuldgefühlen und Ekel vor sich selbst geschüttelt. Um sein Gewissen zu beruhigen, ruft er seine Frau auf ihrer Arbeitsstelle an (Anwaltskanzlei, Maklerbüro, Krankenhaus – muss noch geklärt werden) und teilt ihr mit, er wolle sie am Abend zum Essen ausführen und werde einen Tisch in ihrem Lieblingsrestaurant reservieren.
Sie treffen sich um acht. Beim Aperitif und den Vorspeisen läuft es noch ganz gut, doch als sie dann auf irgendeine unbedeutende häusliche Angelegenheit zu sprechen kommen (ein kaputter Stuhl, das bevorstehende Eintreffen eines Vetters von Eva in New York, irgendetwas Nebensächliches), geraten sie ziemlich schnell in Streit, nicht sehr heftig vielleicht, aber der gereizte Tonfall genügt schon, die Stimmung zu zerstören. Nick entschuldigt sich, Eva akzeptiert; Eva entschuldigt sich, Nick akzeptiert; aber die Luft ist raus aus dem Gespräch, und die eben noch vorhandene Harmonie will sich nicht wieder einstellen. Als der Hauptgang serviert wird, sitzen sie beide nur noch schweigend da. Das Restaurant ist brechend voll, entsprechend lebhaft geht es zu, und als Nick geistesabwesend den Blick umherschweifen lässt, sieht er plötzlich Rosa Leightman, die zusammen mit fünf oder sechs anderen an einem Ecktisch sitzt. Eva fällt auf, dass er in diese Richtung blickt, und fragt, ob er einen Bekannten entdeckt hat. Das Mädchen da, sagt Nick. Sie war heute Morgen in meinem Büro. Er erzählt ihr ein wenig von Rosa, erwähnt den Roman ihrer Großmutter, Sylvia Maxwell, und versucht dann das Thema zu wechseln, aber Eva hat sich inzwischen umgedreht und sieht zu Rosas Tisch hinüber. Sie ist sehr schön, sagt Nick, findest du nicht auch? Nicht schlecht, antwortet Eva. Aber eine komische Frisur, Nicky, und furchtbar angezogen. Das spielt keine Rolle, sagt Nick. Sie ist lebendig – lebendiger als irgendwer, den ich seit Monaten gesehen habe. Frauen wie sie können einem Mann den Kopf verdrehen.