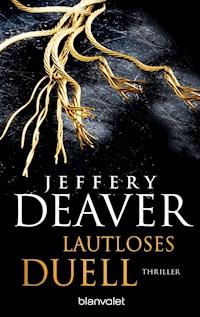7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Michael Hrubek ist ein berüchtigter Gewaltverbrecher. Seine Einweisung in die Psychiatrie verdankt er der Kronzeugin Lis Atcheson, die ihn einst in zwei Mordfällen als Täter identifiziert hat. Da gelingt ihm in einer stürmischen Herbstnacht die Flucht. Und während Hrubek von allen Seiten gejagt wird, bewegt er sich wie magnetisch angezogen auf das abgelegene Haus zu, das von Lis und ihrem Mann Owen, einem bekannten Strafverteidiger, bewohnt wird. Als die Nachricht vom Ausbruch Hrubeks dort eintrifft, macht sich Owen sogleich selbst auf den Weg, um den Entflohenen abzufangen. Doch der Zeitpunkt der Abrechnung ist bereits gekommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Ähnliche
Jeffery Deaver
Nachtgebet
Thriller
Deutsch von Klaus Fröba
Buch
Michael Hrubek ist ein berüchtigter Gewaltverbrecher. Seine Einweisung in die Psychiatrie verdankt er der Kronzeugin Lis Atcheson, die ihn einst in zwei Mordfällen als Täter identifiziert hat. Da gelingt ihm in einer stürmischen Herbstnacht die Flucht. Und während Hrubek von allen Seiten gejagt wird, bewegt er sich wie magnetisch angezogen auf das abgelegene Haus zu, das von Lis und ihrem Mann Owen, einem bekannten Strafverteidiger, bewohnt wird. Als die Nachricht vom Ausbruch Hrubeks dort eintrifft, macht sich Owen sogleich selbst auf den Weg, um den Entflohenen abzufangen. Doch der Zeitpunkt der Abrechnung ist bereits gekommen …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Praying For Sleep« bei Viking Penguin, New York.
Die deutschsprachige Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Nachts, wenn du nicht schlafen kannst« beim Knaur Verlag.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
E-Book-Ausgabe 2016 Copyright der Originalausgabe © 1993 by Jeffery Deaver Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1995 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München Copyright dieser Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: © www.buerosued.deUmschlagmotiv: © Arcangel Images/Mark Fearon
ISBN 978-3-641-19623-3V001
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Und lockt ihn keine Wendung des GesprächsHeraus, warum er die Verwirrung angelegt,Die seiner Tage Ruh’ so wild zerreißtMit stürmischer, gefährlicher Verrücktheit?
WILLIAM SHAKESPEARE Hamlet
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
Eins …
Sanft wie eine Wiege schaukelte ihn der Leichenwagen. Die alte Karre holperte über den von Baumwurzeln aufgerissenen, von Frostbeulen aufgeplatzten Asphalt der Landstraße. Sie zockelten nun schon stundenlang über das Waschbrett, es hätte ihn nicht gewundert, wenn es noch tagelang so weitergegangen wäre. Aber plötzlich quietschten die altersschwachen Bremsen, der Wagen legte sich scharf in die Kurve, und dann waren sie auf glatter, ebener Fahrbahn, auf einer Staatsstraße, und kamen schneller voran.
Er rieb das Gesicht an dem Stück Satin, das in die gummierte Leichenhülle eingenäht war. In der Finsternis hätte er natürlich nicht sehen können, was in schön geschwungener Schrift mit schwarzem Faden auf das gelbe Stück Tuch eingestickt war, aber er hatte es schon vorhin gelesen:
Union GummiwarenTrenton, NJ 08606MADE IN USA
Er schmiegte die aufgedunsene Wange an den Stoff und sog durch die winzige Öffnung – dort, wo der Reißverschluss nicht ganz zugezogen war – die Luft ein. Dass der Leichenwagen plötzlich so ruhig dahinglitt, gefiel ihm gar nicht, es beunruhigte ihn. Es kam ihm vor, als stürze er geradewegs in die Hölle oder mindestens in ein tiefes, finsteres Loch, in dem er womöglich – mit dem Kopf nach unten – auf ewige Zeiten festhing …
Der Gedanke machte ihm Angst, und als die Angst lange genug Zeit gehabt hatte, sich immer mehr aufzublähen, fand er die Kraft, sich zu einem Entschluss durchzuringen. Den Kopf in den Nacken gelegt, die wulstigen Lippen nach innen gezogen, packte er mit den kräftigen, wie bei einer alten Katze gelblich grau verfärbten Zähnen den Reißverschluss und fing mit seiner mühevollen Kleinarbeit an: einen Zentimeter, noch einen … Stück für Stück zerrte er den winzigen Griff nach unten. Die Luft in der Leichenhülle war kalt und verbraucht, er atmete sie gierig ein. Je mehr er in sich hineinsaugen konnte, desto mehr ließ seine Platzangst nach.
Die Männer, die für den Abtransport der Toten zuständig waren, nannten diese Gummisäcke »Behälter für Unfalltote«. Aber er hatte nie erlebt, dass sie je einen Unfalltoten darin transportiert hätten. Die, die sie wegkarrten, waren daran gestorben, dass sie sich das Treppenhaus im Block E hinuntergestürzt hatten. Sie waren krepiert, weil sie sich die Pulsadern aufgeschlitzt hatten. Mit dem Gesicht in der Kloschüssel waren sie verreckt. Oder weil sie sich, wie der Mann heute Nachmittag, einen Fetzen Stoff um den Hals geschlungen hatten.
An einen Unfall konnte er sich nicht erinnern.
Wieder schob er die Zähne vor und arbeitete weiter am Reißverschluss. Schon zehn Zentimeter, zwölf. Sein kahl geschorener, runder Schädel tauchte aus der zackengesäumten Öffnung auf. Er sah mit dem dicken runden Kopf und den gefletschten Zähnen ein bisschen wie ein Bär aus – nur, es war ein haarloser Bär, ohne das kleinste Fetzchen Fell, und der Schädel war bis auf wenige helle Stellen blau verfärbt.
Als er sich schließlich umsehen konnte, war er enttäuscht, dass sie ihn gar nicht in einem richtigen Leichenwagen wegkarrten. Ein ganz gewöhnlicher Kombi. Nicht mal schwarz, sandfarben war er. Keine Vorhänge am hinteren Fenster, keine Sichtblenden. Schemenhaft, weil der Herbst schon Dunstschwaden in die Abenddämmerung mischte und der Wagen ziemlich schnell fuhr, sah er die Umrisse der Bäume, die Masten von Überlandleitungen, Verkehrsschilder und Scheunen vorbeihuschen.
Nach fünf Minuten nahm er sich wieder den Reißverschluss vor, wütend, weil seine Arme immer noch in dem verdammten Gummisack feststeckten. »Scheiß-New-Jersey-Gummi. Beschissen gute Wertarbeit«, murmelte er und zerrte den Reißverschluss ein paar Zentimeter tiefer.
Eine steile Falte grub sich in seine Stirn. Was … was war das für ein Geräusch?
Musik. Kam von den durch eine Spanholzplatte vom hinteren Stauraum abgetrennten Vordersitzen. Eigentlich hatte er nichts gegen Musik, aber es gab eine Art von Gedudel, bei der er rotsah. Die zum Beispiel, die er jetzt hörte – Country-Musik, eine Westernmelodie. Dabei lief ihm jedes Mal eine Gänsehaut über den Rücken.
Ich hasse diesen Scheißgummisack, dachte er. Ekelhaft solide gearbeitet.
Dann fiel ihm ein, dass er nicht allein war. Dass dieser Sack voll gestopft war mit den Seelen der zerschmetterten und aufgeschlitzten Leichen. Die Treppenspringer, die in der Kloschüssel Ertrunkenen und die mit den aufgeschnittenen Pulsadern – alle waren sie hier drin gefangen.
Er glaubte fest daran, dass diese Seelen ihn hassten. Weil er sich dazugemogelt hatte. Deshalb wollten sie ihn lebendig hier begraben, in diesem verdammten Gummisack, für immer und ewig. Und während ihm das durch den Kopf ging, überfiel ihn zum ersten Mal an diesem Abend echte Panik – blutige, siedend heiße, eiskalte Panik. Er versuchte, sich, wie er’s gelernt hatte, durch Atemübungen zu entspannen, aber es war schon zu spät. Er brach in Schweiß aus, Tränen stiegen ihm in die Augen. Er zwängte, so weit es nur ging, unter der straff sitzenden Hülle die Hände nach oben und trommelte gegen die dicke Gummihaut. Trat mit den nackten Füßen dagegen. Rammte den Nasenrücken gegen den Reißverschluss, der sich prompt festhakte und sich kein Stück mehr vor oder zurück bewegen ließ.
Und da fing Michael Hrubek zu schreien an.
Die Musik brach ab. Gedämpfte Stimmen, irritiertes Murmeln. Der Wagen schlingerte nach rechts wie ein Flugzeug, wenn es von starkem Seitenwind gepackt wird.
Hrubek stemmte sich mit aller Kraft hoch, sank kraftlos zurück, versuchte es wieder – und noch einmal und noch einmal. Seine knotigen Nackenmuskeln schwollen von der Anstrengung an wie Schiffstaue, die Augen traten ihm fast aus den Höhlen. Er schrie, weinte, schrie. Eine Klappe in der Trennwand flog auf. Zwei weiße Augäpfel starrten in den Stauraum. In seiner Angst nahm Hrubek weder den Wärter wahr noch dessen hysterisches Gestammel. »Halt an!«, rief der Mann, »bring, um Himmels willen, die verdammte Karre zum Stehen!«
Der Kombi schleuderte auf die Bankette zu, Splitt prasselte in wildem Stakkato gegen das Bodenblech, eine Wolke aus Staub hüllte den Wagen ein. Die Pfleger sprangen heraus und rannten nach hinten. Vor der Heckklappe tauchten zwei pastellgrüne Overalls auf. Einer der beiden Pfleger riss die hintere Tür auf. Über Hrubeks Kopf ging ein kleines Lämpchen an, aber das Licht spendete keinen Trost, im Gegenteil, es versetzte ihn nur noch mehr in Angst und Schrecken und löste eine neue Flut unartikulierter Schreie aus.
»Scheiße«, sagte der eine Pfleger, »der ist gar nicht tot.«
»Ist gar nicht tot? Verdammt, das ist ein Ausbruchsversuch. Los, zurück nach vorn.«
Hrubek fing wieder zu schreien an und bäumte sich, wie von Krämpfen geschüttelt, auf. Seine Adern schwollen zu verschlungenen Knotensträngen an, zum Zerreißen gespannt zeichneten sie sich auf dem blauen Schädel und im Nacken ab. Blutgetränkter Schaum quoll ihm aus den Mundwinkeln. Beiden Pflegern war klar, dass er kurz vor einem Schlaganfall stehen musste. Und genau das hofften sie.
»He! Gib Ruhe!«, schnauzte der jüngere Pfleger ihn an.
Der andere schrie mit schriller Stimme: »Du brockst dir nur noch mehr Ärger ein.« Dann sagte er ruhig und leidenschaftslos, ohne Zorn und Vorwurf: »Wir haben dich. Also, mach hier kein Theater. Wir bringen dich jetzt zurück.«
Hrubek stieß einen gellenden Schrei aus. Die bloße Urgewalt dieses Schreis schien zu bewirken, dass der Reißverschluss des Gummisacks aufplatzte und die winzigen Metallzähne wie Schrotkugeln in alle Richtungen davonstoben. Schluchzend, nach Luft japsend, bäumte er sich auf, gab sich einen Ruck und ließ sich über die hintere Ladekante zu Boden rollen. Und da kauerte er nun auf dem Seitenbankett, nackt bis auf die Boxershorts, den Kopf an die Stoßstange gebettet, deren Chrom sein Gesicht wie eine verzerrte Fratze widerspiegelte. Die beiden Pfleger, die mit tänzelnden Schritten zurückwichen, schien er gar nicht wahrzunehmen.
»Also gut, jetzt reicht’s aber«, sagte der Jüngere drohend. Als Hrubek nicht darauf reagierte, sondern nur, von Weinkrämpfen geschüttelt, den Nacken an der Stoßstange rieb, schwang er den abgebrochenen Ast einer Eiche – doppelt so lang wie ein Baseballschläger.
»Nein«, rief sein älterer Kollege noch, aber es war schon zu spät. Mit aller Wucht hatte der jüngere Kollege den Knüppel auf Hrubeks nackte Schulter geschlagen. Fast lautlos brach ein Stück vom Ast ab, Hrubek schien den Schlag überhaupt nicht gespürt zu haben. Der jüngere Pfleger drehte das übrig gebliebene Stück kurz in den Händen, packte neu zu und holte aus.
»Warte, du Saukerl.«
Diesmal fing der ältere den Knüppel mit der Hand ab. »Nein, das ist nicht unser Job.«
Hrubek rappelte sich hoch, seine Brust blähte sich mit jedem Atemzug mehr auf. Stumm starrte er auf die beiden Wärter, die hastig nach hinten auswichen. Aber der Koloss machte keine Anstalten, sich auf sie zu stürzen. Erschöpft stand er da, musterte die beiden einen Augenblick lang mit verwunderter Neugier und ließ sich dann wieder zu Boden fallen. Auf allen vieren kroch er, wimmernd wie ein Baby, die Böschung hinunter ins Gras. Vom nasskalten Herbsttau, der ihm wie mit Eisfingern die Haut streifte, merkte er nichts.
Die beiden Pfleger nahmen sich nicht einmal Zeit, die Hecktür zuzuschlagen. Verstohlen verdrückten sie sich nach vorn und sprangen ins Führerhaus. Im nächsten Augenblick preschte der Kombi los, ein Schwall von Splitt und Staub deckte Hrubek zu, der in seiner Benommenheit die unzähligen Steinchen, die auf ihn einprasselten, gar nicht spürte. Zur Seite gekrümmt, lag er keuchend da und pumpte sich die Lungen voll mit kalter, nach Dreck, Exkrementen, Blut und Schmieröl stinkender Luft. Erleichtert sah er den Kombi in einem Schwaden aus blauen Auspuffgasen und Reifenabrieb verschwinden.
Er war den Männern dankbar dafür, dass sie diesen schrecklichen Sack mitgenommen hatten – dieses verdammte Ding aus der Gummiwarenfabrik von New Jersey, das voll gestopft war mit den Geistern der Toten.
Es dauerte nur wenige Minuten, dann war von seiner Panik nur noch der dumpfe Schmerz der Erinnerung geblieben. Auch der versank wie ein verdämmernder Gedanke, dann war es ausgestanden. Hrubek kam auf die Füße und reckte sich – kahlköpfig und blau wie ein Druide – zu seiner vollen Länge von einsdreiundneunzig. Er riss ein Büschel Gras aus und wischte sich den Mund und das Kinn ab. Dann studierte er die Landschaft. Die Straße verlief mitten durch ein tief eingeschnittenes Tal, links und rechts vom Asphaltband ragten Felsbuckel aus dem Boden. Hinter ihm, im Westen – dort, wo der Leichenwagen hergekommen war, lag, meilenweit weg und verloren im Dunkel, die Heilanstalt. Vor ihm flackerte der Lichtschein entfernter Häuser.
Wie ein Tier, das seinen Häschern entkommen ist, drehte er sich, immer auf der Hut, taumelnd im Kreis – unschlüssig, welche Richtung er einschlagen sollte.
Und dann, als habe er Witterung aufgenommen, wandte er sich den Lichtern im Osten zu. Er fing an zu rennen, sehr schnell – und mit einer seltsamen, wie aus düsteren Vorahnungen erwachsenen Geschmeidigkeit.
Zwei …
Aus dem Graublau des Himmels war tiefes Schwarz geworden. »Was ist das? Da drüben?« Die Frau deutete auf eine Sternschnuppe über der Baumreihe aus Erlen, Eichen und einigen wenigen Birken, die – weit, weit hinten – die Grenze ihres Grundstücks markierte.
Der Mann saß neben ihr, er stellte sein Glas auf den Tisch und drehte den Kopf. »Ich bin nicht ganz sicher.«
»Ich wette, es ist das Sternbild der Kassiopeia.« Ihr Blick löste sich vom Himmel und schweifte in die Weite, wo sich, nur durch das tintenschwarze Loch eines dunklen Neu-England-Sees von ihrem Grund und Boden getrennt, der State Park erstreckte.
»Gut möglich.«
Seit einer Stunde saßen sie hier draußen auf der Terrasse, genossen die für November ungewohnt laue Abendluft und ließen sich innerlich von einem guten Fläschchen Wein wärmen. Die Kerze in der meerblauen Lampe warf mildes Licht auf ihre Gesichter, in der Luft lag der süßliche Geruch von halb verrottetem Laub. Obwohl es im Umkreis von einer halben Meile keine Nachbarn gab, unterhielten sie sich mit gedämpfter Stimme, fast im Flüsterton.
»Spürst du nicht auch manchmal, dass uns hier draußen immer noch irgendwas von Mutter umgibt?«, fragte sie zögernd.
Er lachte. »Weißt du, wie ich mir Geister immer vorgestellt habe? Sie müssen nackt sein, denke ich. Arme Seelen laufen nun mal nicht in Kleidern herum, oder?«
Sie warf ihm einen Seitenblick zu. Mehr als das Grau seiner Haare und das helle Braun seiner Freizeithose konnte sie, weil die Schatten der Nacht tiefer geworden waren, nicht mehr erkennen. Und sie dachte bei sich: Wenn ich beschreiben sollte, was mir bei diesem Anblick spontan durch den Kopf geht, würde mir am ehesten das Wort »gespenstisch« einfallen. »Dass es keine Geister gibt, weiß ich selber. So hab ich das auch nicht gemeint.« Sie griff nach der Flasche und schenkte sich nach. Kalifornischer Chardonnay, ein edler Tropfen. Sie schätzte im Halbdunkel die Entfernung falsch ein, der Flaschenhals schlug klirrend gegen das Glas. Unwillkürlich zuckten sie beide zusammen.
Der Blick ihres Mannes ruhte wieder auf dem Sternbild, als er fragte: »Beunruhigt dich irgendetwas?«
»Nein, nein. Überhaupt nicht.«
Lisbonne Atcheson ließ die Finger durchs kurz geschnittene, blonde Haar gleiten, erreichte aber mit dem gedankenverlorenen Spiel ihrer geröteten, schon ein wenig faltigen Hände nur, dass das Haar nun anders lag, wenn auch nicht unbedingt ordentlicher. Zufrieden reckte sie ihren – trotz der schon vierzig Lebensjahre schlank gebliebenen – Körper und ließ den Blick ein paar Sekunden lang über das dreistöckige Haus im Kolonialstil gleiten, das hinter ihnen in die Nacht ragte. Und einen Atemzug später sagte sie: »Was ich vorhin gemeint habe … das mit Mutter … es ist nicht leicht zu erklären.« Aber sie war nun mal Lehrerin, daran gewöhnt, Kinder in der Sprache der Queen zu unterrichten, und der Regel verpflichtet, dass man, so schwierig es sein mochte, wenigstens den Versuch unternehmen musste, sich präzise auszudrücken. Also nahm sie einen neuen Anlauf. »Eine Art von Gegenwart, das habe ich gemeint.«
Wie aufs Stichwort fing die Kerze zu flackern an.
»Ich ziehe die Bemerkung zurück.« Sie nickte der Flamme zu, sie mussten beide lachen. »Wie spät ist es?«
»Kurz vor neun.«
Lis rutschte tiefer in den Gartenstuhl, zog die Knie an und schlang sich den langen Baumwollrock so um die Beine, dass nur noch die Spitzen ihrer braunen, mit goldfarbenem Weinlaub verzierten Cowboystiefel unter dem Saum hervorsahen. Als sie wieder einen Blick hoch zu den Sternen warf, ging ihr durch den Sinn, dass ihre Mutter sicherlich eine gute Spukerscheinung abgegeben hätte. Vor acht Monaten war sie gestorben – hier draußen, wo sie und Owen jetzt saßen. Die alte Dame hatte, den Blick in der Weite der Landschaft verloren, in ihrem geliebten antiken Schaukelstuhl gesessen und sich plötzlich, als habe sie etwas Besonderes bemerkt, vorgebeugt und »oh, natürlich« gesagt, und dann war sie gestorben – von einer Sekunde zur anderen, still und friedlich.
Das ganze Haus hätte sich trefflich als Szenario für Spukgeschichten geeignet. In dem klobigen, trutzigen Bau gab es so viel Platz, dass sogar eine der kinderreichen Familien, wie sie im gebärfreudigen achtzehnten Jahrhundert gang und gäbe gewesen waren, leicht darin untergekommen wäre. Von außen machte es mit den von allen Wettern gegerbten braunen Schindeln und den dunkelgrün verputzten Fugen einen etwas düsteren Eindruck, es erinnerte ein wenig an ein Schuppentier. Zur Zeit der Revolutionskriege war es eine Soldatenschenke gewesen, später hatte man es innen in viele kleine, durch schmale Flure verbundene Räume aufgeteilt. Die längs und quer laufenden Deckenbalken waren vom Holzwurm befallen, und Lis’ Vater hatte steif und fest behauptet, die daumengroßen Dellen, die noch in den Pfosten und an einigen Stellen in den Wänden zu erkennen waren, stammten von jenen Musketenkugeln, mit denen die Soldaten der Rebellenarmee die Briten Zimmer um Zimmer, Stockwerk um Stockwerk aus dem Haus vertrieben hätten.
Weiß der Himmel, wie viele Hunderttausende von Dollar die Renovierung des Hauses in den letzten fünfzig Jahren verschlungen hatte, aber aus unerfindlichen Gründen hatten es ihre Eltern nie geschafft, ordentliche elektrische Leitungen legen zu lassen; mehr als ein paar schummerige Lampen mit niedriger Wattzahl konnte das marode Netz nicht verkraften. Von der Sitzecke auf der Veranda sah es aus, als blinzelten überall trübe gelbsüchtige Augen durch die Lamellen der Klappläden.
Lis, mit den Gedanken immer noch bei ihrer Mutter, sagte: »Es war kurz vor ihrem Ende, da hat sie zu mir gesagt: Ich habe gerade mit deinem Vater gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er bald zu mir kommt.« Es war eines von jenen Gesprächen gewesen, bei denen einem unwillkürlich eine Gänsehaut über den Rücken kriecht, denn damals war ihr Vater schon seit zwei Jahren tot gewesen. »Natürlich hat sie sich das nur eingebildet. Aber für sie war es so, als hätte sie wirklich mit Vater geredet.« Und er selbst, mein Vater?, dachte sie. Nein. Père L’Auberget geisterte bestimmt nicht als Spukerscheinung durch das Haus. Er war tot umgefallen, als er in der Herrentoilette auf dem Heathrow Airport wütend am Handtuchspender gezerrt hatte, weil das widerspenstige Ding kein Papier ausspucken wollte.
»Aberglaube«, sagte Owen.
»Nun, in gewisser Weise ist er ja tatsächlich zu ihr gekommen. Ein paar Tage später ist sie gestorben.«
»Trotzdem.«
»Ich rede über die Gefühle von Menschen, die von sich glauben, dass sie zusammengehören. Davon, was sie wohl empfinden, wenn einer von ihnen nicht mehr lebt und der andere spürt, dass sie sich bald wiedersehen werden.«
Er fand das Gerede über die Geister der Toten langweilig, nippte an seinem Weinglas und kam dann, um das Thema zu wechseln, auf seine bevorstehende Geschäftsreise zu sprechen. Das heißt, eigentlich ging es ihm mehr um die Frage, ob es wohl zu schaffen sei, sich vor Donnerstag noch einen Anzug reinigen zu lassen. »Ich meine, weil ich doch bis Sonntag bleibe. Wenn ich …«
»Warte mal.« Lis drehte rasch den Kopf und starrte auf die dicht gewachsenen Fliederbüsche, die ihr den Blick auf den Hintereingang des Hauses versperrten. »Hast du nichts gehört?«
»Nein, ich glaube, ich habe nichts …« Er brach mitten im Satz ab, hob den Finger, nickte. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen, aber die Geste verriet, dass auch er nun angestrengt ins Dunkel lauschte.
»Da!«, sagte sie. »Da war es wieder.«
Leise patschende Schritte, die auf der Zufahrt näher kamen. Oder bildete sie sich das nur ein?
Sie suchte Owens Blick. »Ob das wieder der Hund ist?«
»Der von den Busches? Nein, der steckt im Zwinger. Hab ich vorhin, als ich beim Joggen vorbeigekommen bin, selber gesehen. Wild, würde ich eher sagen.«
Lis seufzte. Das Rotwild aus dem nahe gelegenen Wald hatte sich im Laufe des Sommers auf ihrem Grundstück an Blumen, Obst und Gemüse für gut und gern zweihundert Dollar gütlich getan und ihnen erst letzte Woche einen wunderschönen japanischen Zwergahorn so kahl gefressen, dass der Sprössling sich bestimmt nie wieder erholte. Sie stand auf. »Na, denen jag ich so einen Schrecken ein, dass sie so schnell nicht wiederkommen.«
»Soll ich das lieber übernehmen?«
»Nein, ich wollte sowieso noch mal anrufen. Und vielleicht mach ich mir einen Tee. Möchtest du auch was?«
»Nein danke.«
Sie griff nach der leeren Weinflasche und machte sich auf den Weg zum Haus. Kaum mehr als zwanzig Schritte den von Ziersträuchern und in voller Blüte stehenden Pflanzkübeln gesäumten Pfad hinunter – und dann noch an den Fliederbüschen vorbei, die freilich um diese Jahreszeit recht trostlos aussahen. Auf dem kleinen Teich schwammen die Blüten der Wasserlilien, doch als sie genauer hinsah, entdeckte sie – wie verwunschen im gelben Lichtschimmer aus dem Obergeschoss des Hauses – auf der Wasserfläche ihr Spiegelbild. Obwohl es nicht für ihre Ohren bestimmt war, hatte sie gelegentlich aufgeschnappt, dass der eine oder andere es ein »einfaches« Gesicht nannte. Sie hatte solche Bemerkungen nie als abwertend empfunden. Einfach, das war für sie ein Synonym für »schlicht«, und Schlichtheit war ihrer Meinung nach nicht nur die Anfangsstufe, sondern geradezu die Voraussetzung für Schönheit. Zum zweiten Mal an diesem Abend fuhr sie sich mit der Hand durchs Haar, der Wasserspiegel half ihr dieses Mal, tatsächlich ein wenig Ordnung in ihre Frisur zu bringen – gerade noch rechtzeitig, bevor eine Brise ihr Spiegelbild im Teich zerfließen ließ.
Sie ging weiter – jetzt innerlich entspannt, die rätselhaften Geräusche waren nicht mehr zu hören. Und überhaupt, hier in Ridgeton musste man sich nicht fürchten. Ein zauberhaftes Dörfchen, von bewaldeten Hügeln umgeben, eingebettet in saftig grüne Weiden. Rinder- und Schafherden, wohin man auch blickte, eine richtige Bilderbuchlandschaft. Und die Gegend war berühmt für ihre Rennpferdezucht. Hier waren sich Menschen, lange bevor die dreizehn Staaten die Idee einer politischen Vereinigung erwogen hatten, einig gewesen in der Überzeugung, dass die Behaglichkeit des Lebens ein höheres Gut sei als wirtschaftlicher Fortschritt und zur Schau gestellter Reichtum. Eine Maxime, die durch drei Jahrhunderte hindurch Ridgetons Entwicklung bestimmt hatte. Auch hier hatte die neue Zeit ihre Spuren hinterlassen, auch in Ridgeton konnte man Pizza über die Straße und Tiefkühlkost kaufen und Gleitboote mieten und Videos ausleihen, aber wenn es Abend wurde und all das gesagt und getan war, was gesagt und getan sein musste, wurde das Dorf zu einer Festung hinter wehrhaften Mauern. Es wurde dann wieder, was es seinem tiefsten Wesen nach war: ein Ort, an dem die Männer ein erdverbundenes Leben führten – denn die Erde war es, von der sie lebten, auf der sie ihre Häuser bauten und deren Wert die Höhe des Darlehens bestimmte, das sie aufnehmen konnten – und die Frauen die Kinder großzogen und sich um Haus und Herd kümmerten.
Ridgeton war eines von jenen glücklichen Fleckchen Erde, an denen man mit menschlichen Tragödien nur selten und mit roher Gewalt nie in Berührung kommt.
Und so war Lis, als sie feststellte, dass die mit türkisfarbenem Butzenglas ausgelegte Hintertür offen stand, eher verwundert als ernsthaft besorgt. Sie blieb stehen, die pendelnde Bewegung, mit der sie die Weinflasche hin und her geschwungen hatte, hörte abrupt auf. Schwindsüchtig gelber Lichtschimmer malte vor ihren Füßen ein verzerrtes Viereck auf den Rasen. Sie machte einen kleinen Bogen um die üppigen Fliederbüsche und suchte die Zufahrt ab. Nein, keine fremden Autos. Der Wind, vermutete sie.
Und dann ging sie ins Haus, stellte die Weinflasche auf den klobigen Klotz mitten in der Küche – ein schönes altes Stück, das früher tatsächlich der Hackklotz eines Schlachters gewesen war, und warf flüchtig einen Blick auf die Treppe, die von der Küche zum Keller führte. Nein, da war nichts, kein pummeliger Waschbär, kein vorwitziges Stinktier. Einen Atemzug lang blieb sie noch stehen und horchte, ob sich im Haus etwas rührte. Als sie nichts hörte, stellte sie den Kessel auf den Herd, kramte in ihren Vorräten an Kaffee und Tee und entschied sich für einen Hagebuttentee. Sie wollte gerade nach der Dose greifen, als ein Schatten über sie fiel. Sie erstarrte. Rang nach Luft. Und blickte schließlich in zwei haselnussbraune Augen.
Die Frau, die vor ihr stand, war Mitte dreißig, sie trug eine locker fallende Bluse aus weißem Satin, einen Minirock aus irgendeinem schimmernden Material und Stulpenstiefel mit niedrigen Absätzen. Die schwarze Jacke hatte sie sich über den Arm gelegt, den Rucksack über die Schulter gehängt.
Lis schluckte, sie merkte, dass ihr die Hände zitterten. Einen Augenblick lang standen sich die beiden Frauen reglos gegenüber und musterten sich stumm. Dann löste sich Lis mit einem Ruck aus der Erstarrung, beugte sich vor und schloss die andere in ihre Arme. »Portia!«
Die Jüngere ließ den Rucksack von der Schulter gleiten und stellte ihn neben die Weinflasche auf den Hackklotz. »Hallo, Lis.«
Ein paar Sekunden lang Schweigen, zum Schneiden dick.
Dann sagte Lis: »Ich hab gar nicht … Ich meine, ich dachte, du rufst vom Bahnhof aus an. Wir waren schon ziemlich sicher, dass du nicht mehr kommst. Ich wollte dich anrufen, hab aber nur den Anrufbeantworter erwischt. Na ja, jedenfalls ist es schön, dich wiederzusehen.«
Sie hörte selbst, wie nervös sie die Sätze herunterhaspelte. Besser, sie hielt den Mund.
»Da war jemand am Bahnhof, der hat mich mitgenommen. Warum soll ich euch Mühe machen, hab ich mir gedacht.«
»Das hätte uns doch keine Mühe gemacht.«
»Wo habt ihr eigentlich gesteckt? Ich hab schon oben nach euch gesucht.«
Lis antwortete nicht, sie stand nur da und starrte die junge Frau an. Dieses Gesicht – und das blonde, von einem schwarzen Stirnband gehaltene Haar … derselbe Farbton wie bei ihr. Portia wiederholte stirnrunzelnd ihre Frage.
»Oh, wir sitzen draußen. Mit dem Blick auf den See. Ist das nicht eine merkwürdige Nacht? Wie im Altweibersommer. Und das im November! Hast du was gegessen?«
»Ja, danke. Brunch, heute Nachmittag um drei. Lee war da, wir sind erst spät aufgestanden.«
»Komm mit nach draußen zu Owen. Trink wenigstens ein Gläschen Wein mit uns.«
»Nein, wirklich, ich möchte nichts.«
Sie gingen denselben Pfad zurück, den Lis gekommen war, nebeneinander, nur durch ein paar Millimeter getrennt, aber auch die kamen ihnen wieder wie eine unsichtbare Mauer vor, so dick hing das Schweigen zwischen ihnen. Schließlich fragte Lis, wie die Bahnfahrt gewesen sei.
»Na ja, ich bin angekommen. Wenn auch mit Verspätung.«
»Und wer hat dich mitgenommen?«
»Ich kenn ihn nicht. Ich glaube, sein Sohn und ich sind zusammen auf die Highschool gegangen. Er hat mir dauernd was von einem Bobbie erzählt. So, als ob ich den kennen müsste. Aber er hat mir seinen Nachnamen nicht genannt.«
»Bobbie Kelso, der ist in deinem Alter. Sein Vater … das ist so ein Langer, Kahlköpfiger!«
»Ja, der wird’s gewesen sein«, sagte Portia beiläufig, während sie den Blick über den schwarzen See gleiten ließ.
Lis sah ihre Schwester an, als suche sie irgendwas in Portias Augen. »Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist.«
Portias einzige Reaktion war ein undefinierbarer Laut, vielleicht ein unterdrücktes Lachen – oder auch nur ein Schniefen. Sie legten die letzten Schritte schweigend zurück.
»Willkommen!«, rief Owen seiner Schwägerin entgegen, stand auf und küsste sie auf die Wange. »Wir hatten schon alle Hoffnung aufgegeben.«
»Hm – na gut, gehen wir’s noch mal eines nach dem anderen durch. Ich hatte keine Gelegenheit, euch anzurufen. Tut mir Leid.«
»Kein Problem. Hier auf dem Land nehmen wir so was locker. Komm, trink ein Schlückchen Wein mit uns.«
»Kelso hat sie vom Bahnhof aus mitgenommen«, sagte Lis. Sie deutete auf einen Gartenstuhl. »Setz dich. Ich mach eine neue Flasche auf. Wir haben uns eine Menge zu erzählen.«
Aber Portia wollte sich nicht setzen. »Nein danke. Es ist ja noch nicht so spät. Warum erledigen wir nicht erst mal die schmutzigen Geschäfte?«
Wieder konnten sie das Schweigen mit Händen greifen. Lis’ Blick pendelte zwischen ihrer Schwester und ihrem Mann hin und her. »Ich finde …«
»Es sei denn, es gibt irgendwelche Probleme.«
Owen schüttelte den Kopf. »Nicht direkt.«
Lis zögerte. »Warum setzt du dich nicht ein paar Minuten zu uns? Für alles andere bleibt uns doch morgen noch Zeit genug.«
»Eh-eh«, machte Portia, »bringen wir’s lieber gleich hinter uns.« Sie lachte. »Wie die Anwälte so zu sagen pflegen.«
Owen wandte sich zu ihr um. »Wie du willst.« Lis hätte gern in seiner Miene gelesen, aber sein Gesicht lag im Schatten. »Im Arbeitszimmer liegt alles bereit.«
Er ging voraus, Portia maß ihre ältere Schwester mit einem bedeutungsvollen Blick und folgte ihm.
Lis machte sich noch einen Augenblick lang auf der Veranda zu schaffen, blies die Kerze aus, nahm den Leuchter … Als es beim besten Willen nichts mehr zu tun gab, ging auch sie aufs Haus zu. Es war, als wollten ihr die Tautropfen, die sie mit den Stiefelspitzen aus dem nachtfeuchten Gras aufwirbelte, den Weg weisen. Kassiopeia hingegen schien hoch über ihr am Nachthimmel ihr Antlitz zu verhüllen; das Sternbild verschwamm hinter milchigen Schwaden, dann verschluckte eine dunkle Wolke es vollends.
Kies knirschte unter seinen Schuhen, die altertümlich anmutenden, schmiedeeisernen Lampen an den aus grob gehauenen Granitsteinen gemauerten Außenwänden des Gebäudes warfen alle paar Meter ihren Schein auf die Zufahrt, und so war er, während er auf das Gebäude zuging, abwechselnd in helles Licht getaucht und in Finsternis gehüllt. Von oben aus einem der Fenster hörte er das schrille, atemlose Wehklagen einer Frau. Sie schrie eine Qual, die nur sie allein verstand, hinaus in die Nacht. Ihren Namen kannte er nicht, für ihn war sie nur die Patientin 223-81.
An der vergitterten Tür neben der Laderampe machte er Halt und schob seine Plastikkarte in den Schlitz des silberfarbenen Kästchens, das hier, wo alles aussah, als habe man sich vor eine mittelalterliche Ritterburg verirrt, wie ein anachronistischer Fremdkörper anmutete. Die Tür sprang auf, der Mann trat ein. Ein halbes Dutzend Augenpaare richtete sich auf ihn. Aber die Männer und Frauen in weißen Kitteljacken oder blauen Overalls sahen, als ob sie ein schlechtes Gewissen hätten, schnell wieder weg.
Ein junger Arzt kam eilends auf ihn zu, drängte sich neben ihn und flüsterte: »Es ist schlimmer, als wir dachten.« Er wirkte mit seinem zerzausten, schwarzen Haar und den dicken, unruhig bebenden Lippen ausgesprochen nervös.
Dr. Ronald Adlers Blick huschte über die kleine Gruppe, die sich hier versammelt hatte. »Schlimmer, Peter? Ich weiß zwar im Einzelnen noch nicht, was los ist, aber ich bin darauf gefasst, dass es ziemlich schlimm ist.«
Er strich sich das ungekämmte, sandgraue Haar aus den Augen und fuhr sich, den Blick auf den Toten gerichtet, gedankenverloren mit dem Zeigefinger über die Wange. Der Leichnam eines hünenhaften, kahlköpfigen Mannes lag vor ihm, die große Tätowierung auf dem rechten Oberarm hatte sich im Laufe der Jahre ein wenig verwaschen. Auf dem Stiernacken zeichnete sich ein rötliches Würgemal ab. Das Gesicht war bleich, an der dunklen Farbe des Rückens sah man, wie tief der Blutpegel schon im toten Körper abgesunken war.
Adler gab dem jungen Arzt unwirsch einen Wink. »Gehen wir in mein Büro. Warum lungern hier so viele Leute rum? Scheuchen Sie sie weg! In mein Büro, sofort.«
Die beiden Männer verschwanden durch eine schmale Schwingtür und liefen den halbdunklen Flur hinunter, schweigend, nur vom Widerhall ihrer Schritte begleitet und von einem rätselhaften gedämpften Jaulen. Vielleicht immer noch die Patientin 223-81. Oder der Wind, der durch das immerhin schon hundert Jahre alte Gemäuer der Heilanstalt strich. Der Staat sparte an allen Ecken und Enden, das vom Holzwurm zerfressene Deckengebälk hatte sich verzogen, und die Wände aus rotem Granit verbreiteten eine spartanische, klösterliche Atmosphäre. Wenigstens hatte man sie in Adlers Direktionsbüro tapeziert. Dennoch sah es hier eher aus wie im Kontor eines billigen Jakobs oder in der Kanzlei irgendeines Winkeladvokaten.
Adler knipste das Licht an und warf den Mantel auf die altmodische Couch. Der Notruf heute Abend hatte ihn zwischen den Schenkeln seiner Frau erreicht. Also gut, er war aus dem Bett gekrochen und hatte sich in aller Eile angezogen. Dass er den Gürtel vergessen hatte, merkte er erst jetzt, der Hosenbund war ihm über den Bauch gerutscht. Sagen wir: über eine gewisse Leibesfülle, die, wenn man in den Vierzigern ist, zu den beinahe unvermeidlichen Attributen des Älterwerdens gehört. Trotzdem war ihm die schlackernde Hose so peinlich, dass er sich schnell hinter dem Schreibtisch verkroch. Er starrte ein, zwei Atemzüge lang aufs Telefon, als könne er gar nicht fassen, dass es nicht klingelte.
Dann herrschte er den jungen Assistenzarzt an: »Also los, Doktor. Stehen Sie hier nicht rum, Setzen Sie sich, und berichten Sie mir.«
»Ein detailliertes Bild haben wir noch nicht. Er sieht Callaghan der Statur nach zum Verwechseln ähnlich.« Peter Grimes deutete mit dem Kopf in Richtung Ladestation, wo der Tote lag. »Wir vermuten, dass er …«
Adler unterbrach ihn. »Von wem reden Sie? Wer ist er?«
»Der Flüchtige, meinen Sie? Michael Hrubek. Nummer 458-94.«
»Weiter.« Adlers Handbewegung signalisierte Ungeduld, Grimes legte ihm einen abgegriffenen Aktenordner auf den Schreibtisch.
»Also, was Hrubek betrifft – es sieht so aus …«
»Hrubek? So ein Großer, Breitschultriger? Ich hätte nie gedacht, dass der uns Ärger macht.«
»Hat er auch nicht. Bis heute.«
Adler starrte irritiert auf den jungen Assistenzarzt. Grimes’ wulstige Lippen schnappten bei jedem Wort auf und zu wie ein Fischmaul. Adler fand das so widerlich, dass er den Blick rasch senkte. Er blätterte in der Akte, während Grimes fortfuhr: »Er hat sich den Kopf kahl geschoren. Wie Callaghan. Den Rasierapparat muss er irgendwo geklaut haben. Dann hat er sich das Gesicht blau gefärbt. Hat einen Kugelschreiber zerbrochen und die Tinte mit Wasser …« Irgendetwas in Adlers Blick beunruhigte ihn. Er wusste nicht genau, ob es Zorn oder Ungeduld oder beides war, setzte sich aber vorsichtshalber und beeilte sich, mit seinem Bericht zu Ende zu kommen. »Und dann ist er in die Tiefkühlkammer gestiegen. Eine Stunde hat er da drin gehockt, jeder andere wäre erfroren. Kurz bevor unsere Leute Callaghan abholen und zum Coroner bringen wollten, hat Hrubek den Toten versteckt und ist selber in den Leichensack gekrochen. Die Männer haben sich ordnungsgemäß davon überzeugt, dass tatsächlich ein Toter drin lag, kalt und blau, und …«
Ein kurzes, bellendes Gelächter kam über die dünnen Lippen des Direktors. Das Lächeln, zu dem sie sich verziehen wollten, verkümmerte, als er plötzlich den Eindruck hatte, dass ihn von seinen eigenen Lippen der Duft seiner Frau anwehte. »Blau? Das kann doch nicht stimmen. Blau?«
Grimes konnte ihm das schnell erklären, Callaghan war durch Strangulation gestorben. »Er war, als wir ihn heute Nachmittag gefunden haben, blau angelaufen.«
»Dann, junger Freund, war er nur vorübergehend blau. Sobald man jemanden, der sich erhängt hat, abschneidet, ist die Blaufärbung ganz schnell verblasst. Wieso wussten die blöden Kerle das nicht? Ich denke, die arbeiten öfter für den Coroner?«
»Nun – äh …« Den Rest schenkte sich Peter Grimes.
»Hat der den Fleischkutschern was getan?« Eine dunkle Vorahnung sagte Adler, dass er möglicherweise irgendwann heute Nacht anfangen musste, schon mal grob zusammenzurechnen, was als Folge dieses Ausbruchs an Schadenersatzforderungen auf den Staat zukommen konnte.
»Nicht ein Haar hat er ihnen gekrümmt. Beide behaupten, sie hätten versucht, ihn wieder einzufangen, aber er sei spurlos verschwunden.«
»Wieder einzufangen! Das glaube ich denen aufs Wort.« Adler nickte hämisch und wandte sich wieder der Akte zu. Mit einer Handbewegung bedeutete er Grimes, ruhig zu sein, und las nach, was in den Papieren über Michael Hrubek festgehalten war.
DSM-III-Diagnose: Paranoide Schizophrenie … Monosymptomatisch, von Wahnvorstellungen verfolgt … Behauptet, in insgesamt siebzehn Heilanstalten eingewiesen worden und aus sieben geflohen zu sein; eine offizielle Bestätigung für diese Angaben liegt bislang nicht vor.
Adler sah hoch. »Aus sieben Heilanstalten geflohen? Sieben?«
Ehe dem jungen Mann eine Reaktion auf diese rhetorische Frage einfallen konnte – eine überzeugende Antwort hätte es sowieso nicht gegeben –, war der Direktor schon wieder in seine Lektüre vertieft.
… Die Einweisung erfolgte gemäß § 403 der bundesstaatlichen Gesetze über die Verwahrung Geisteskranker auf unbefristete Zeit … Akustische Halluzinationen ohne visuelle Begleiterscheinungen … Leidet unter schweren Panikanfällen, in deren Verlauf mit psychisch bedingten Gewaltakten seitens des Patienten gerechnet werden muss. Der Intelligenzquotient des Patienten wird als durchschnittlich bis überdurchschnittlich beurteilt … Lediglich bei Aufgaben, die extrem abstraktes Denken erfordern, zeigt der Patient Schwierigkeiten … Glaubt, dass er aus religiösen Gründen verfolgt und geächtet werde. Er führt das darauf zurück, dass Menschen, die ihn hassen, unwahre Gerüchte über ihn verbreiten … Die Begriffe Rache und Vergeltung scheinen, oftmals in biblischen oder historischen Zusammenhängen, bei seinen Wahnvorstellungen eine entscheidende Bedeutung zu haben … Es ist eine partikulare Abneigung gegen Frauen festzustellen …
Dann las Adler das beigeheftete Blatt mit den Daten über Hrubeks Körpergröße, Gewicht und Blutwerte und den Messergebnissen der physischen und psychischen Belastbarkeitstests. Er verzog keine Miene, obwohl sein Herz ein paar Takte schneller schlug, als ihm klar wurde, dass dieser verdammte Kerl eine mörderische Bestie war, Gott im Himmel.
»Derzeit ruhig gestellt durch chlorpromazine Hydrochloride«, las er vor, »dreitausendzweihundert Milligramm pro Tag, in mehreren Dosen … Ist das ernst gemeint, Peter?«
»Ich fürchte, ja. Drei Gramm Thorazin.«
»Scheiße«, murmelte Adler.
»Äh …« Der Assistenzarzt kippte nach vorn und stemmte die Daumen so heftig auf einen Bücherstapel, dass das Fleisch unter den Nägeln rot anlief. »Dazu wäre allerdings anzumerken …«
»Raus damit. Ohne Umschweife.«
»Er hat die Medizin in die Backentasche geschoben.«
Adler spürte, wie ein Hitzeschwall über sein Gesicht zog. Seine Stimme war nur noch ein heiseres Flüstern, als er sagte: »Weiter. Erzählen Sie, was los war.«
»Es war ein Film.«
»Ein Film?«
Grimes schlug klickend die lange nicht mehr geschnittenen Daumennägel aneinander. »Ein Abenteuerfilm. Und der Held hat so getan, als nähme er Drogen …«
»Sie meinen, bei uns im Freizeitraum? Worauf wollen Sie eigentlich raus?«
»Wie gesagt, ein Abenteuerfilm. Aber er hat das Zeug nicht wirklich geschluckt. Die Pillen, meine ich. Er hat so getan, als würde er sie nehmen, aber er hat sie in der Backentasche versteckt und später ausgespuckt. Ich glaube, es war Harrison Ford. Äh – der Hauptdarsteller. Eine Menge Patienten haben es danach ein paar Tage lang genauso gemacht. Ich nehme an, bei Hrubek hat keiner damit gerechnet, dass er so was überhaupt gedanklich umsetzen kann. Darum hat das bei ihm niemand kontrolliert. Vielleicht war der Hauptdarsteller auch Nick Nolte.«
Adler atmete langsam aus. »Wie lange hat er sein Zuckerchen nicht genommen?«
»Vier Tage. Oder, sagen wir, fünf.«
Adler dachte nach. Sein Gedächtnis war geordnet wie ein medizinisches Handbuch, im Geiste schlug er das Kapitel Psychopharmaka auf. Psychotisches Verhalten wird bei Schizophrenie durch die Verabreichung antipsychotischer Medikamente kontrolliert. Physische Nebenwirkungen, wie etwa bei Narkotika, waren bei Thorazin nicht zu befürchten. Aber wenn der Stoff dem Körper vorenthalten wurde, musste Hrubek Wirkung zeigen. Übelkeit, Schwindelgefühle, Schweißausbrüche und gesteigerte Nervosität. Und solche Erscheinungen waren Vorboten eines mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Anfalls von Panik.
Und Panik war es, was Schizophrene so gefährlich machte.
Ohne die gewohnte Dosis Thorazin konnten sich Patienten wie Hrubek in psychotische Wutausbrüche hineinsteigern. Mitunter wurden sie sogar zum Mörder. Sie hörten dann Stimmen, die ihnen einflüsterten, sie hätten ganz recht daran getan, zum Messer oder zum Baseballschläger zu greifen, und die sie drängten, loszuziehen und es wieder zu tun.
Hrubek, machte Adler sich klar, würde überdies unter schwerer Schlaflosigkeit leiden. Was konkret bedeutete, dass er sich zwei, drei Tage lang in einem krankhaften Wachzustand befand. Zeit genug, um all seine chaotischen Wahnvorstellungen auszutoben.
Das schrille Wehklagen wurde lauter, es drang bis in Adlers Büro. Adler fuhr sich mit den Handballen über die Wangen. Wieder roch er den Duft seiner Frau. Und wünschte sich, er könnte die Uhr um eine Stunde zurückdrehen. Und vor allem wünschte er sich, nie etwas von Michael Hrubek gehört zu haben.
»Wie ist das mit dem Thorazin rausgefunden worden?«
Grimes’ schnappende Fischmaullippen kauten wieder Wasser.
»Einer von den Pflegern hat das Zeug unter Hrubeks Matratze gefunden. Vor einer halben Stunde.«
»Wer?«
»Stu Lowe.«
»Wer weiß sonst etwas davon? Dass der Kerl sich das Zeug in die Backentasche geschoben hat?«
»Er selbst und Sie und ich. Und die Oberschwester. Lowe hat es ihr erzählt.«
»Oh, das ist ja wirklich großartig. Also gut, hören Sie zu. Sagen Sie Lowe … sagen Sie ihm, wenn er je wieder ein Wort, auch nur ein verdammtes Wort darüber verlauten lässt, ist er seinen Job los. Und … Augenblick mal … die Särge …« Ein beunruhigender Gedanke ging Adler durch den Kopf. »Die werden doch im Block C aufbewahrt? Wie, zum Teufel, ist Hrubek dort hingekommen?«
»Das weiß ich nicht.«
»Dann finden Sie’s raus.«
Grimes saß mit hochrotem Kopf vor Adlers Schreibtisch. »Das ging alles sehr schnell«, stammelte er. »Extrem schnell, würde ich sagen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Informationen, die wir brauchen. Ich muss Akten anfordern und verschiedene Leute anrufen.«
»Sie werden niemanden anrufen.«
»Verzeihung. Ich verstehe nicht ganz.«
Adler blaffte ihn an: »Sie rufen ohne meine ausdrückliche Genehmigung niemanden an.«
»Nun, der Vorstand …«
»Mann Gottes! Erst recht niemanden vom Vorstand.«
»Nun, bisher habe ich ja keine Telefonate geführt«, beeilte sich Grimes zu versichern und fragte sich, wieso er eigentlich auf einmal kein Fünkchen Zivilcourage mehr aufbrachte.
»Du lieber Gott!«, explodierte Adler, »die Polizei haben Sie auch noch nicht verständigt?«
»Nein, nein. Natürlich nicht.« Er hatte bei der Polizei anrufen wollen. Vorhin. Aber da war gerade Adler gekommen. Mit Bestürzung stellte er fest, dass ein unkontrolliertes Zucken durch seine Finger lief. Großer Gott, hoffentlich kein Anzeichen für einen bevorstehenden Kollaps des zentralen Nervensystems? Nicht dass er in Ohnmacht fiel oder seinem Chef auf den Fußboden pinkelte!
»Sollen wir die Polizei verständigen oder nicht?«, grübelte Adler halblaut vor sich hin. »Lassen Sie uns mal gemeinsam darüber nachdenken. Er hält sich sicher noch in der Nähe von … Wo ist das Ganze passiert?«
»Bei Stinson.«
Adler wiederholte den Ortsnamen leise. Dann umklammerte er den weißen Aktenordner mit beiden Händen, als ob er ihn festhalten müsste, damit er nicht davonschwebte in die unergründlichen Höhen dieses viktorianischen Kerkers, den man ihm als Büro zumutete. Dann hellte sein düsteres Gemüt sich ein wenig auf. »Wer hat die Leiche aus der Tiefkühlkammer geholt und zum Leichenwagen transportiert?«
»Lowe und … der andere war, glaube ich, Frank Jessup.«
»Schicken Sie beide zu mir hoch.« Adler vergaß die schlackernden Hosen, stand auf und ging zum Fenster. Das Glas hatte bestimmt seit Monaten kein Fensterleder mehr gesehen. »Sie sind mir dafür verantwortlich, dass die Angelegenheit absolut vertraulich behandelt wird, verstanden?«
»Ja, Sir«, sagte Grimes automatisch.
»Und finden Sie, gottverdammt noch mal, raus, wie der Kerl aus Block E entkommen konnte.«
»Ja, Sir.«
»Sagen Sie allen vom Personal: Falls jemand gegenüber der Presse auch nur ein Wort verlauten lässt, ist er gefeuert. Keine Polizei, keine Presse. Wenn einer von denen hier auftaucht, schicken Sie ihn zu mir hoch. Unser Job hier ist hart genug, oder sehen Sie das anders? Na also. Und – äh – die beiden Wärter … zu mir. Sofort.«
»Ronnie, fühlst du dich jetzt besser?«
»Mir geht’s gut«, zischte der übergewichtige junge Mann wütend. »Also, wie steht’s? Was werden Sie dagegen unternehmen? Mal ganz ehrlich.«
Dr. Richard Kohler spürte, wie sich die billigen Sprungfedern verzogen, als der Patient im Bett nach oben rutschte, bis fast ans Kopfteil, so weit wie möglich von ihm weg, als sei er schuld an allem, was Ronnie quälte. Ronnies Blick huschte unruhig hin und her, voller Misstrauen gegen den Mann, der ihm in den letzten sechs Monaten Vater, Bruder, Arzt und Freund gewesen war. Nun musterte er ihn aus Augen, denen nichts entging – nicht die gewellte Locke im schütter werdenden Haar des Arztes, nicht sein hageres Gesicht, die schmalen Schultern, die beinahe mädchenhaft schlanke Taille. Es war, als wolle er sich Kohlers Aussehen unauslöschlich einprägen, um nötigenfalls der Polizei eine möglichst genaue Personenbeschreibung geben zu können.
»Bedrückt dich irgendetwas, Ronnie?«
»Ich kann das nicht verkraften. Ich schaff’s nicht, Doktor. Es macht mir einfach zuviel Angst.« Er winselte wie ein Kind, das sich gegen ungerechte Vorwürfe wehrt. Und dann, von einem Augenblick zum anderen völlig ruhig und vernünftig, sagte er im Plauderton: »Ich glaube, es ist vor allem dieser Dosenöffner.«
»Oder liegt’s vielleicht an der Küche? Diese Küchenarbeit – ist es die vielleicht?«
»Nein, nein, nein«, wimmerte Ronnie, »der Dosenöffner, den kann ich nicht verkraften. Ich weiß nicht, warum Sie das nicht verstehen.«
Kohler musste gähnen – so herzhaft, dass sein ganzer Leib dabei zu beben schien. Sein Körper verlangte so nach Schlaf, dass er bereits Schmerzwellen aussandte. Kein Wunder, der Arzt war seit drei Uhr auf den Beinen. Hier, in der halboffenen Abteilung, hielt er sich seit heute Morgen um neun Uhr auf. Zuerst hatte er den Patienten dabei geholfen, das Frühstück zuzubereiten und den Tisch zu decken. Um zehn Uhr hatte er vier von ihnen zu ihrer Arbeitsstelle gefahren. Halbtagsjobs, wenigstens das. Er musste jeden Tag, auch heute, eine Menge Zeit aufwenden, um den anderen Angestellten zu erklären, wie es um seine Patienten stand und dass sie von ihnen nichts zu befürchten hätten.
Den Rest des Tages hatte er mit den fünf jungen Frauen und Männern verbracht, die zu Hause geblieben waren, entweder weil sich bisher für sie noch kein Job gefunden hatte oder weil sie heute, am Sonntag, frei hatten. Der übliche Tagesrhythmus. Das therapeutische Einzelgespräch mit jedem seiner Schutzbefohlenen. Danach der eintönige Alltagstrott: Hausarbeit. Sie hatten kleine Projektgruppen gebildet, weil seine Patienten das, was gesunde Menschen ganz selbstverständlich erledigen, nur zu bewältigen vermochten, wenn sie jemanden an ihrer Seite wussten, mit dem sie sich beraten konnten. Tomaten schälen, Gemüse waschen und klein schneiden, Fenster putzen, organische und nichtorganische Abfälle aussortieren, Badezimmer sauber machen, sich gegenseitig etwas vorlesen. Die einen absolvierten ihr tägliches Pflichtprogramm mit gesenkten Köpfen, allenfalls mit gelegentlich gerunzelter Stirn. Andere waren selbst von einfachsten Handgriffen so überfordert, dass sie den ganzen Tag nervös an den Lippen nagten oder sich die Augenbrauen auszupften und jeden Moment Gefahr liefen, infolge zu starker Beatmung der Lunge zusammenzubrechen. Aber irgendwie klappte es eben doch.
Und dann die Katastrophe.
Kurz vor dem Abendessen bekam Ronnie seinen Anfall. Ein anderer Patient öffnete neben ihm mit einem elektrischen Dosenöffner eine Büchse Tunfisch. Und in dem Moment fing Ronnie zu schreien an und rannte aus der Küche. Was eine Kettenreaktion von Hysterie bei mehreren anderen Patienten auslöste. Kohler hatte sie schließlich so weit beruhigt, dass sie mit dem Abendessen anfangen konnten. Sie nahmen gemeinsam am Tisch Platz, Kohler saß bei ihnen. Nach dem Essen wuschen sie das Geschirr ab und machten in der Küche Ordnung. Danach spielten sie Spiele und berieten, was sie im Fernsehen sehen wollten. Die Mehrheit entschied sich für eine Wiederholung von Cheers, die Minderheit, die für M*A*S*H votiert hatte, fand sich murrend damit ab. Anschließend gab’s die Medizin. Die Pillen schluckten sie mit Saft, das Thorazin in flüssiger Form schmeckte sowieso nach Orangensirup, das löffelten sie pur. Und dann war es Zeit zum Schlafengehen.
Nur Ronnie wollte nicht ins Bett kriechen, Kohler fand ihn im hintersten Winkel seines Zimmers, in die Ecke gekauert.
Und nun, als er ihn wenigstens dazu überredet hatte, sich aufs Bett zu legen, fragte er ihn: »Was schlägst du denn vor, was ich gegen das Geräusch unternehmen soll?«
»Weiß ich doch nicht.« Ronnies Stimme klang dumpf, wie erstickt, er kaute auf der Zunge herum. Das machten die Patienten immer, wenn ihnen der Mund von den Proketazinen ausgedörrt war.
Maßnahmen dem Zweck anzupassen – das war die schwierigste Aufgabe für schizophrene Patienten. Das führte unweigerlich zu Stress. Und Ronnie wurde hier in der halboffenen Abteilung, weiß Gott, dauernd vor diese Aufgabe gestellt, ging Kohler durch den Kopf. Er musste ständig Entscheidungen treffen. Und selbstständig vorausplanen. Die Geborgenheit der Heilanstalt gab es nun für ihn nicht mehr. Er musste selbst mit den Dingen klarkommen, jeden Tag, von früh bis spät. Ein ständiges Ringen. Und Kohler erkannte mit beklommenem Herzen, dass der junge Mann den Kampf verlieren würde.
Draußen vor dem Fenster, nur undeutlich zu sehen in der Dunkelheit, erstreckte sich der Rasen. Den ganzen Sommer über hatten die Patienten ihn mit akribischer Sorgfalt gemäht, und jetzt, im Herbst, lasen sie mit der Hand jedes Blatt auf, das es gewagt hatte, sich auf ihren Rasen zu verirren. Er musterte, während er auf das dunkle Viereck des Fensters starrte, das Spiegelbild seines verhärmten Gesichts und überlegte – er hatte sich das dieses Jahr wohl schon hundertmal gefragt –, ob er sich nicht einen Bart wachsen lassen sollte, damit seine Züge ein wenig voller aussahen.
»Morgen«, versprach er seinem bekümmerten Patienten, »morgen werden wir irgendetwas dagegen unternehmen.«
»Morgen? Na, das ist ja phantastisch!«, fuhr Ronnie ihn an. Mit gefletschten Zähnen bleckte er den Mann an, dem er seinen Seelenfrieden verdankte, soweit man bei ihm von Seelenfrieden reden konnte, und darüber hinaus wahrscheinlich sogar sein Leben. »Könnte ja sein, dass ich morgen schon tot bin? Oder wenn Sie nun bis morgen tot umgefallen sind, Mister? Ich hoffe, Sie vergessen’s nicht bis morgen.«
Schon lange vor seinem Medizinstudium hatte Richard Kohler begriffen, dass man nie persönlich nehmen durfte, was ein Schizophrener tat oder sagte. Das Einzige, was ihn an Ronnies verbaler Attacke störte, war, dass er an der Wut seines Patienten ablesen konnte, wie weit der arme Kerl davon entfernt war, irgendwelche nennenswerte Fortschritte zu machen.
Eine seiner Fehlentscheidungen, musste Kohler sich eingestehen. Nach seiner Einlieferung ins Marsden State Hospital hatte Ronnie gut auf die dort übliche Behandlung angesprochen. Kohler hatte lange laboriert, um die richtige Medikation in der angemessenen Dosierung für ihn zu finden, und mit der psychotherapeutischen Behandlung begonnen. Als eine Patientin in der halboffenen Abteilung so weit gewesen war, dass man sie nach Hause entlassen konnte, hatte er dafür gesorgt, dass Ronnie den frei gewordenen Platz bekam. Und dort war dann schlagartig offenkundig geworden, dass Ronnies Leiden viel schwerer war, als Kohler geglaubt hatte. Das Leben in der kleinen Gruppe, unter ständigem Stress, hatte Ronnie weit zurückgeworfen. Er verfiel in dumpfes Brüten, sonderte sich von den anderen ab und zeigte deutlich Anzeichen von Paranoia.
»Ich trau Ihnen nicht«, fauchte Ronnie ihn an. »Es ist doch arschklar, was für ’ne Show hier abgezogen wird. Ich mag Ihre Spielchen nicht. Und damit Sie’s nur wissen: Heute Nacht kommt Sturm auf. Elektrischer Sturm, elektrischer Dosenöffner – kapiert? Ich meine, Sie erzählen mir dauernd, ich kann das verkraften und ich kann jenes verkraften. Aber das ist doch alles Kacke.«
Kohler notierte sich im Geiste, wie oft und in welchem Kontext Ronnie das Verb »verkraften« gebrauchte und was das auslösende Moment für seinen Panikanfall heute Abend gewesen war. Es war schon zu spät, um heute Abend noch etwas damit anzufangen, aber gleich morgen früh um sechs würde er sich in seinem Büro im Haupthaus in Marsden Ronnies Akte vornehmen und eine entsprechende Eintragung machen.
Er reckte sich und hörte, wie es irgendwo in seinen Knochen knackte. »Möchtest du lieber wieder drüben in der Heilanstalt sein, Ronnie?«, fragte er, obwohl seine Entscheidung im Grunde schon feststand.
»Und wie ich das möchte! Da drüben ist nicht so ’n Rummel wie hier.«
»Nein, dort geht es ruhiger zu.«
»Ich glaub, ich möchte gern wieder dahin zurück, Doktor. Ich muss zurück. Weil, weil …« Die Gründe, die er aufzählen wollte, hatte Ronnie vergessen. »Also, da gibt’s ’ne Menge Gründe, warum ich dahin muss.«
»Gut, dann machen wir’s so. Am Donnerstag. Und jetzt musst du ein bisschen schlafen.«
Ronnie – noch in der Kleidung, die er den ganzen Tag getragen hatte – rollte sich auf die Seite und zog die Knie an. Als Kohler darauf bestand, dass er den Pyjama anziehen und sich ordentlich zudecken sollte, gehorchte Ronnie ohne Murren. Aber er bestand darauf, dass das Licht anblieb. Und er sagte nicht gute Nacht, als der Arzt den Raum verließ.
Kohler machte seine Runde durchs Erdgeschoss. Einige Patienten waren noch wach, saßen im Gemeinschaftsraum vor dem Fernseher oder hielten ein Schwätzchen mit dem Wärter, der für die Nachtschicht eingeteilt war. Eine Brise strich durchs offene Fenster und lockte Kohler, so müde er auch war, ins Freie. Ein für November ungewöhnlich warmer Abend.
Das erinnerte ihn an einen Herbstabend im letzten Studienjahr an der Duke University. Er sah noch vor sich, wie er die Rolltreppe hinuntergelaufen war – eine 737, United Airlines, sogar das wusste er noch. Die tausend Meilen vom Flughafen Raleigh-Durham zum LaGuardia waren ihm wie ein Katzensprung vorgekommen, den größten Teil der Strecke hatte er sowieso fest geschlafen. Er wollte die freien Tage um Thanksgiving zu Hause verbringen. Tatsächlich hatte er allerdings die meiste Zeit im Murray Hill Psychiatric Hospital in Manhattan verbracht. Am Freitag, als die Ferien zu Ende gingen, hatte ihn sein Vater ins Büro zitiert und ihm die Leviten gelesen. Geradezu streitsüchtig bestand der alte Herr darauf, dass sein Sohn das Studienfach wechselte. Internist sollte er werden, nicht Psychiater. Er war so weit gegangen, dass er das zur Vorbedingung für die weitere finanzielle Unterstützung machte.
Am nächsten Morgen hatte sich Richard Kohler für die Gastfreundschaft zu Hause bedankt, einen Nachtflug zurück zum College gebucht und am Montag, als die Vorlesungen wieder anfingen, im Büro der Finanzverwaltung um Stundung der Studien- und Collegegebühren gebeten, damit er sein Studium der Psychiatrie fortsetzen könne.
Wieder spürte er, als er gähnen musste, Schmerzwellen durch seinen Körper fluten. Er dachte sehnsüchtig an sein Zuhause – ein kleines möbliertes Apartment, eine halbe Stunde weit weg. In dieser ländlichen Gegend hätte er sich mühelos ein Haus mit einem großen Grundstück leisten können. Er hatte aus Bequemlichkeit darauf verzichtet. Er wollte keinen Rasen mähen und keine verblühten Rosen schneiden und nicht dauernd mit dem Pinsel in der Hand herumlaufen. Was er wollte, war eine Fluchtburg, klein und übersichtlich. Zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Bad. Alles auf dem gleichen Stock, keine Treppe. Das musste ja nicht heißen, dass er sich nicht einen gewissen Luxus leistete. Sein Apartment hatte eine Warmwasserheizung – eine der wenigen, die es in dieser Gegend gab. Ein paar Ölgemälde von Kostabi und Hockney hingen auch darin. Die Maklerin hatte seinerzeit besonders betont, dass es sich bei der Einbauküche um eine »Designer-Küche« handle. Auf seine Gegenfrage, ob nicht jede Küche ein von irgendjemandem entworfenes Design haben müsse, hatte sie, sehr zu seinem Vergnügen, mit einem irritierten Lachen reagiert. Für ihn war die kleine Wohnung – von der der Blick tagsüber meilenweit über einen grünen Flickenteppich aus kleinen Waldstücken und Weiden und nachts bis zu den weit verstreuten Lichtern von Boyleston reichte – zu einer Insel der Vernunft inmitten einer vorwiegend von Irrsinn beherrschten Welt geworden. Und das stimmte in seinem Fall nicht nur im übertragenen Sinn.
Trotzdem, an diesem Abend fuhr er nicht nach Hause. Er ging zurück in das Gebäude, in dem die halboffene Anstalt untergebracht war, ging die knarrende Treppe hinauf und drückte in dem knapp drei mal vier Meter großen Zimmer mit dem Feldbett, dem Schrank und dem an die Wand geschraubten Metallspiegel die Tür hinter sich zu.
Er streifte sich die Jacke von den Schultern, lockerte den Schlips, legte sich aufs Feldbett und trat sich mit dem linken Fuß den rechten, mit dem rechten den linken Schuh von den Füßen. Er warf noch einen Blick aus dem Fenster. Ein paar schon halb verblasste Sterne schimmerten am Himmel, aber weiter hinten im Westen brauten sich dunkle Wolken zusammen. Der Sturm. Er sollte, hatten sie im Radio gesagt, ziemlich heftig werden. Er selbst mochte den Regen, aber er hoffte, dass es keinen Donner gab, das würde viele seiner Patienten in Angst und Schrecken versetzen. Die Sorge war freilich, sobald er die Augen geschlossen hatte, vergessen. Schlaf war alles, woran er noch denken konnte. Er schmeckte die Müdigkeit, sie wühlte wie ein dumpfer Schmerz in seinen Beinen, und als er gähnte, trieb sie ihm kalte Tränen in die Augen. Es dauerte nicht mal eine Minute, bis er eingeschlafen war.
Drei …
Ein Dutzend Unterschriften, und sie waren um etliche Millionen reicher.
Gut hundert Blatt Papier – in schön verschnörkelter Schrift handgeschrieben, gespickt mit Floskeln wie insoweit und wohingegen – lagen vor Lis und Portia auf dem Schreibtisch. Eidesstattliche Versicherungen, Empfangsbelege, Steuerrückerstattungen, Rechtsübertragungen, Vollmachtserklärungen. Owen, Anwalt vom Scheitel bis zur Sohle, reichte die Unterlagen Blatt für Blatt weiter, verfolgte mit ernster Miene, wie die Federhalter übers Papier kratzten, kommentierte jede geleistete Unterschrift mit der Feststellung »rechtmäßig vollzogen«, drückte sein Notariatssiegel daneben, zückte den Mont Blanc, um gegenzuzeichnen, und nahm das nächste Blatt von dem Stapel, der sich vor ihm türmte. Portia schien sich über sein feierliches Getue und die pingelige Genauigkeit zu amüsieren, Lis dagegen, seit sechs Ehejahren an Owens akribisches Gehabe gewöhnt, nahm keine Notiz von seiner aufgesetzten Würde.
»Ich komme mir vor wie der Präsident bei der Unterzeichnung eines Staatsvertrages«, meinte sie.
Sie saßen sich im Arbeitszimmer an jenem massiven, schwarzen Mahagonitisch gegenüber, den Lis’ Vater in den sechziger Jahren in Barcelona gekauft hatte. Anlässlich des heutigen Abends und der feierlichen Testamentsvollstreckung hatte sie die mit Lack überzogene Collage ausgegraben, die sie ihrem Vater bei der Party geschenkt hatte, mit der er – zehn Jahre war das nun her – den Verkauf des Geschäftes und den Eintritt in den Ruhestand gefeiert hatte. Auf die linke Seite des Posters hatte sie ein Foto vom ersten Firmenschild geklebt: ein schlichtes Brett mit der handgemalten Aufschrift L’Auberget et Fils Ltd. Anfang der fünfziger Jahre war das gewesen. Rechts prangte auf dem Poster ein Hochglanzfoto, das das prächtige Firmenschild zum Zeitpunkt des Verkaufs zeigte: L’Auberget Getränkeimport, Inc. Die Schmuckranke aus grünem Weinlaub und purpurroten Reben drumherum hatte Lis eigenhändig gemalt, mit sehr viel Liebe, wenn auch nicht ganz so viel Kunstfertigkeit. Der Lacküberzug hatte im Laufe der Jahre einen kleinen Gelbstich angenommen.
Über geschäftliche Dinge hatte der alte Herr nie mit seinen Töchtern gesprochen (männliche Nachkommen gab es nicht, das et fils hatte er nur dazugesetzt, weil er dachte, es mache was her). Erst als Erbschaftsverwalterin, nach Vaters Tod, hatte Lis begriffen, wie überaus erfolgreich er als Geschäftsmann gewesen war. Dass er mit Leib und Seele in seinen Geschäften aufging, hatte sie schon als Kind erfahren; er war ständig geschäftlich unterwegs gewesen. Aber bevor Mutter gestorben und das Erbe an sie und Portia übergegangen war, hätte sie nie gedacht, dass ihm seine harte Arbeit so ein enormes Vermögen eingebracht haben könnte: neun Millionen in bar, dazu das Haus, eine Filiale in der Fifth Avenue und ein Landhaus in der Nähe von Lissabon.
Owen sammelte die Papiere ein und ordnete sie zu verschiedenen Stapeln, die er sorgfältig bündelte und jeweils mit einem Versandvermerk versah. »Für dich, Portia, werde ich Kopien fertigen lassen.«
»Heb sie irgendwo gut verschlossen auf«, warf Lis ein.
Portias Mund wurde zu einem schmalen Strich, sie konnte es nicht leiden, wenn die ältere Schwester sie so bevormundete. Ehe Lis irgendeine Entschuldigung murmeln konnte, stellte Owen eine Flasche Champagner auf den Tisch, ließ den Korken knallen und schenkte drei Gläser ein.
»Also«, sagte Lis, »dann trinken wir …« Sie merkte, dass Portia und Owen sie gespannt ansahen. »… trinken wir auf Vater und Mutter.«
Die Gläser schlugen klingend aneinander.
Owen sagte: »Praktisch ist die Erbmasse damit verteilt. Die Überweisungen sind vorbereitet. Es bleibt nur das gemeinsame Konto der Erbengemeinschaft bestehen, aus dem noch fällige Gebühren und Anwalts- und Kontoführungskosten und so weiter bezahlt werden – und, äh … diese andere dumme kleine Geschichte.« Er warf Lis einen Blick zu. »Hast du’s ihr schon gesagt?«
Lis schüttelte den Kopf.
Portia suchte Owens Blick. »Was soll sie mir gesagt haben?«
»Wir haben es erst Freitag erfahren. Jemand will eine Klage anstrengen. Unter anderem gegen dich.«
»Was?«
»Das Testament wird angefochten.«
»Nein! Von wem?«
»Es gibt da ein Problem mit dem Vermächtnis deines Vaters.«