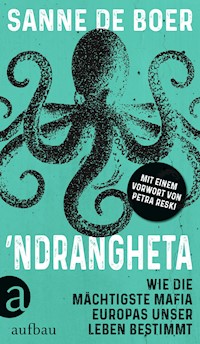
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das erste Buch über die organisierte Kriminalität der mächtigsten Mafia Europas
Momentan steht sie im Rampenlicht, obwohl sie lieber im Dunkeln arbeitet: Der bisher größte Prozess gegen die 'Ndrangheta, die mächtigste Mafia Europas, läuft seit Januar 2021 und zieht Aufmerksamkeit auf sich. Denn: Die 'Ndrangheta ist schon lange kein rein italienisches Problem mehr, sondern betrifft ganz Europa. Und damit unser aller Leben. Von der Lebensmittelproduktion bis zur Müllentsorgung – die 'Ndrangheta hat ihre Finger im Spiel. Mit unglaublichem Mut und Durchblick gelingt es der Journalistin Sanne de Boer, das System hinter dieser äußerst raffiniert agierenden Mafia zu durchdringen, die besonders von Krisenzeiten wie der jetzigen enorm profitiert. Ein ebenso enthüllendes wie erhellendes Buch!
»Ein eindringliches Porträt der größten kriminellen internationalen Organisation der Welt.« Volkskrant
»Ein ausgezeichnetes, mutiges und wichtiges Buch.« Bas Mesters, ehemaliger Italien-Korrespondent für NOS und das NRC Handelsblad
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Ähnliche
Über das Buch
Kurz nachdem die Journalistin Sanne de Boer in ein idyllisches Dorf in Süditalien zieht, wird in ihrer Nachbarschaft ein Mann erschossen. Es stellt sich heraus, dass das Opfer Mitglied der ’Ndrangheta war, der kalabrischen Mafia. Dieser Mord ist der Beginn einer jahrelangen Suche nach einer mysteriösen Gemeinschaft.
De Boer geht den Fragen nach, wie in einem so märchenhaften Winkel Italiens eine solch unaufhaltsame kriminelle Organisation entstehen konnte und was diese Mafia so altertümlich-provinziell und so modern-globaldenkend zugleich macht. Dafür taucht sie tief in Strukturen der Mafia ein, nimmt Kontakt zu Mitgliedern, Kläger:innen, Anwält:innen und Kronzeug:innen auf und fördert immer mehr Hinweise darauf zutage, welches System hinter den Machenschaften der ’Ndrangheta steckt und wie viel Macht sie weltweit bereits erlangen konnten. Sie zeichnet damit ein enthüllendes und schauderhaftes Bild dieser äußerst raffiniert agierenden Mafia, die in Deutschland, Europa und der ganzen Welt nachhaltig Fuß fassen konnte und von Krisenzeiten wie der jetzigen zusätzlich enorm profitiert.
»Neben ›Gomorrah‹ von Roberto Saviano eines der besten Bücher über die Mafia auf dem Markt.« NBD Biblion
Über Sanne de Boer
Sanne de Boer, geboren 1979, ist Journalistin für zahlreiche niederländische Zeitungen, Rundfunk und TV. Seit 2006 wohnt sie in Kalabrien in Süditalien und berichtet als erste ausländische Journalistin von dort über die ’Ndrangheta.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sanne de Boer
’Ndrangheta
Wie die mächtigste Mafia Europas unser Leben bestimmt
Aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt und Gerd Busse
Mit einem Vorwort von Petra Reski
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Ein Wort vorab
Vorwort von Petra Reski
1. : Zunächst einmal
2. : Wer sind hier die Mafiosi?
3. : Familiengefühl
4. : »Schreibst du in der Zeitung darüber?«
5. : Würde
6. : Die schlimmste Form des Gesichtsverlusts
7. : Der Duft von Mimosen
8. : Mafia-Bourgeoisie
9. : Peppinos Mafiopoli
10. : »Diese Gegend wird einst wunderbar werden«
11. : Etwas, was man isst oder trinkt?
12. : Reue und nochmals Reue
13. : Eine vielsagende Geste
14. : Die Geschichte der Omertà
15. : Eine stinknormale Familie
16. : Alles unter Kontrolle
17. : Sag’s mit Blumen
18. : In der Toga Krieg führen
19. : Die Schlacht um Riace
20. : Lügen, um die Wahrheit zu erzählen
21. : Wer suchet, der findet
22. : Die Unsichtbaren
23. : Stille Antimafia
24. : Zu guter Letzt
Nachwort zur deutschen Ausgabe
Zum aktuellen Stand der einzelnen Gerichtsverfahren
Literaturnachweis
Dank
Impressum
Für meinen Vater
Ein Wort vorab
Die Aussprache des kompliziert aussehenden Wortes ’Ndrangheta ist überraschend einfach. Man vergesse den n-Laut am Anfang, er wird nur ganz subtil ausgesprochen. Die Betonung liegt auf »drang« und das g von »gheta« klingt wie das englische g von get. Dráng-getta.
Der Apostroph ist ein Überbleibsel des a aus dem griechischen Wort andragathía, von dem der Name der kalabresischen Mafia abstammt. Der Begriff ’Ndrangheta verweist über dieses Wort (zu Unrecht) auf gute, tapfere Männer.
Vorwort von Petra Reski
Am Anfang steht die Italiensehnsucht: Eine junge Frau verlässt Amsterdam, »um eine Weile auf einem wunderschönen Hügel am Rande eines Dorfes zu leben und zu arbeiten«. Seitdem die Reisenden der Grand Tour den Aufenthalt in Italien zum Bestandteil der Persönlichkeitsbildung verklärten, zieht es uns Nordländer in den Süden. Und wer kennt sie nicht, diese Sehnsucht nach dem Meer und dem Duft selbstgepflückter Orangen? Sie war es, die Sanne de Boer dazu trieb, ungeachtet ihrer nur begrenzten Italienischkenntnisse, nach Italien zu ziehen. Allerdings zog Sanne de Boer nicht in die Toskana. Und auch nicht an den Gardasee. Sondern nach Kalabrien. Und das, ohne genau zu wissen, was die ’Ndrangheta ist.
Wobei sich Sanne de Boer mit dieser Unkenntnis in bester Gesellschaft befand: Bis es im August 2007 zum Mafiamassaker von Duisburg kam, wusste außerhalb von Italien praktisch niemand, dass sich hinter diesem schwer auszusprechenden Wort die reichste und auch beweglichste Mafiaorganisation Italiens verbirgt. Die ihren Aufstieg im Schatten der sizilianischen Cosa Nostra vollzogen hat, auf die sich seit der Attentatswelle 1992–1993 die Aufmerksamkeit der Ermittler und der Medien gerichtet hatte. Die Ermordung einer gewissen Maria Strangio in San Luca, einer Hochburg der kalabrischen Mafia, an Weihnachten 2006 war selbst italienischen Zeitungen nur eine Randnotiz wert: Gott, ja, wieder mal ein Rachefeldzug verfeindeter ’Ndrangheta-Clans, wen sollte das interessieren?
Sanne de Boers anfängliche Unkenntnis und Unbefangenheit ist ein Glücksfall, denn sonst hätte sie vermutlich niemals den Mut gehabt, nach Kalabrien zu ziehen – und offen zu sein für die Menschen und für eine Kultur, in der man nicht in Monaten denkt, sondern in Epochen. In einem Landstrich, in dem jedes Dorf von Homers Helden berührt worden ist.
Dieser Unbefangenheit ist es auch zu verdanken, dass Sanne de Boer genau die richtigen Fragen stellt und begreift, dass die scheinbar romantische Abgeschiedenheit dieses Landstrichs letztlich Ausdruck einer künstlich erzwungenen Unterentwicklung ist, in der die Mafia den Süden Italiens gefangen hält: Ohne diese forcierte Rückständigkeit würden keine europäischen Fördergelder mehr fließen, würde kein Boss mehr um einen Job angebettelt.
Und so ist Sanne de Boers Buch auch ein Entwicklungsroman, der den Erkenntnisprozess der Autorin beschreibt: Er beginnt mit der Italiensehnsucht und endet – dank vieler Gespräche mit Dorfbewohnern, Unternehmern, Staatsanwälten und wichtigen Zeugen – bei dem kriminellen multinationalen Konzern, der nicht nur Kalabrien im Klammergriff hält, sondern sich über den ganzen Erdball zieht. Und der in den Niederlanden und in Deutschland seit Jahrzehnten Fuß gefasst hat, ohne dass sich jemand dafür interessiert hätte.
Die ’Ndrangheta gilt als Erfolgsmodell für organisierte Kriminalität schlechthin: Sie ist nicht hierarchisch geordnet wie die sizilianische Mafia, sondern föderal organisiert – was sie flexibler macht. Wie den Islamisten gelingt es der ’Ndrangheta, das Mittelalter mit der globalisierten Gegenwart zu verbinden: Bosse, die sich in Wandschränken und Erdlöchern verstecken, im Netz mit Kokainbrokern in Kolumbien, Venezuela, Peru, Uruguay verhandeln und gleichzeitig »nur« eine Frau aus dem Dorf heiraten, weil die Familie heilig ist: Blutsverwandte verraten einander nicht.
Am Ende dieses Entwicklungsromans der anderen Art steht der veränderte Blick der Autorin auf das eigene Heimatland: »Indem ich mich in die Verbindungen der ’Ndrangheta vertiefte, lernte ich von Kalabrien aus die scheinbar so sicheren und vertrauenswürdigen Niederlande von einer ganz anderen Seite kennen«, schreibt Sanne de Boer. Sie wundert sich über einfühlsame Rotterdamer Richter, die milde über einen niederländischen Waffenhändler und Geschäftsfreund der ’Ndrangheta urteilen, der sich bester Beziehungen zur niederländischen Mafia-Bourgeoisie erfreuen konnte. Sie staunt darüber, wie lange die niederländische Polizei einen ’Ndranghetista gewähren lässt, der als Blumenhändler Kokain schmuggelt und mit Briefkastenfirmen im großen Stil Geldwäsche, Insolvenzbetrug und Steuerhinterziehung betreibt.
Sanne de Boer blickt heute anders auf die Niederlande, und ich blicke anders auf Deutschland, seitdem ich weiß, dass der Mafia bei ihrem Aufstieg in Deutschland kein Stein in den Weg gelegt wird. Manch deutscher Politiker hält die Investitionen der Mafia wohl auch heute noch für eine Art Konjunkturankurbelungsprogramm.
Dass mein Buch »Mafia. Von Paten, Pizzerien und falschen Priestern« nur mit richterlich erzwungenen geschwärzten Passagen verbreitet werden darf, hat die Italiener mehr erstaunt als die Deutschen. Weil Erstere sich vom deutschen Rechtsstaat mehr erwartet hätten. Bis heute gibt es in Deutschland keine wirksamen Gesetze gegen Geldwäsche, und die alleinige Zugehörigkeit zur Mafia ist in Deutschland immer noch kein Strafdelikt. All das beweist, dass die Mafia kein ausschließlich italienisches Problem ist, sondern ein europäisches.
Das wird besonders deutlich, wenn deutsche und niederländische Ermittler versuchen, zusammen gegen die ’Ndrangheta vorzugehen, wie 2018, bei der Operation »Pollino«, der größten gemeinsamen europäischen Polizeioperation, die es je gegen die ’Ndrangheta gegeben hat. Da zitiert Sanne de Boer den schönen Satz einer niederländischen Ermittlerin: »Geldwäsche fand man in Deutschland nicht so interessant, Drogen hingegen schon. Darum ging es bei uns eigentlich gar nicht, wir wollten endlich mal an die Finanzen ran.« Weil es keine europäische Antimafia-Gesetzgebung gibt, treten sich die einzelnen Staaten bei der Bekämpfung der Mafia gegenseitig auf die Füße. Kein deutscher Politiker hat jemals das Wort »Mafia« in den Mund genommen: Die Mafia liest aus diesem Schweigen eine frohe Botschaft.
»In den niederländischen Medien fasste man sich kurz, was die ’Ndrangheta anging, man hielt sich da raus«, schreibt Sanne de Boer. In Deutschland ist das nicht anders. Die Bosse wissen die deutschen Gesetze auf ihrer Seite: Jeder Journalist, der über die Mafia in Deutschland geschrieben hat und verklagt wurde, hat den Prozess verloren.
Und das ungeachtet der Tatsache, dass Journalisten, die Verdachtsberichterstattung leisten, sich auf sogenannte »privilegierte Quellen« stützen müssen, also auf Ermittlungsakten und Gerichtsurteile. Wie es auch italienische Journalisten tun. Die auch verklagt werden – aber ihre Prozesse gewinnen, anders als wir Journalisten in Deutschland. Viele Redaktionen scheuen inzwischen davor zurück, über die Mafia in Deutschland zu berichten – weil sie Angst vor Prozessen und den damit verbundenen Rechtskosten haben. Womit die Mafia ihr Ziel erreicht hätte: Einen treffen, Hunderte erziehen.
Wie sehr die Mafiaorganisationen die Medien fürchten, sieht man an den Morden an dem niederländischen Journalisten Peter R. de Vries und dem slowakischen Journalisten Ján Kuciak. Ihrer können wir am besten gedenken, indem wir Journalisten uns nicht durch Klagen einschüchtern lassen, indem wir nicht schweigen, sondern weiter über die Mafia schreiben – genau so, wie es Sanne de Boer in ihrem Buch tut. Auch wenn wir uns damit keine Freunde machen. Denn die Mafia ist mehr als Drogenhandel, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Es geht um unsere Demokratie, um die Regeln des fairen Wettbewerbs – es geht um Macht. Wir Europäer könnten von der italienischen Antimafia-Gesetzgebung lernen und auch von den schlechten Erfahrungen der Italiener: Seit Jahrzehnten sitzt die Mafia im italienischen Parlament – und dagegen kämpfen die ehrlichen Italiener. An ihrer Seite müssen wir Europäer stehen.
1.
Zunächst einmal
Am ersten Weihnachtstag 2006 trafen Maria, eine junge Mutter, zwei Kugeln in die Brust, die eigentlich für ihren Mann bestimmt waren. Es war halb fünf Uhr nachmittags, als ungeladene Gäste ins Haus ihrer Schwiegereltern eindrangen und die Feierlichkeiten unterbrachen. Mit einer Kalaschnikow, einem Jagdgewehr und Pistolen feuerten sie innerhalb kürzester Zeit vierzig Kugeln auf die Gesellschaft ab. Maria rettete ihre Kinder vor dem Kugelhagel, erlag aber selbst ihren Brustverletzungen. Ihr Mann, Anführer eines ’Ndrangheta-Clans im kalabresischen Dorf San Luca, überlebte.
Als ich vier Tage später in Kalabrien ankam, hörte ich dort nichts von diesem Familiendrama. Ich hatte Amsterdam hinter mir gelassen, um eine Weile auf einem wunderschönen Hügel am Rande eines Dorfes zu leben und zu arbeiten. Ich war mir keiner ’Ndrangheta bewusst und gab mich dem Duft selbstgepflückter Orangen, der Wärme von Holzöfen und dem Ausblick auf tiefgrüne Berge und knallblaues Meer hin.
Maria Strangios Tod schaffte es nicht in die Medien, war jedoch Vorbote eines Ereignisses, das die ’Ndrangheta, die kalabresische Mafia, plötzlich in ein grelles internationales Scheinwerferlicht rückte. Vor diesem Ereignis hatte sich die Weltpresse noch nicht mit den Verbrechen oder der lästigen Schreibweise der ’Ndrangheta auseinandergesetzt. Auch die großen italienischen Zeitungen ignorierten die kalabresische Mafia, die noch mehr oder weniger als ein lokales Häuflein rückständiger Hitzköpfe abgetan wurde. Dennoch war die ’Ndrangheta auch damals schon die mächtigste Mafia Italiens und weltweit am weitesten verbreitet.
Die andere, »klassische«, italienische Mafia, die sizilianische Cosa Nostra, war durch Filme wie Der Pate längst weltberühmt geworden. Was sich auf Sizilien in dem Zeitraum, in dem die mitreißende Geschichte über die Familie Corleone gedreht wurde, wirklich abspielte, war vielleicht nicht allen Filmfans bekannt. Während man in einem sichereren Teil von Sizilien den natürlichen Tod des tragischen Filmhelden im Garten einer pittoresken Villa in Szene setzte, erschossen die echten Mafiosi aus dem Dorf Corleone einen Feind nach dem anderen. Dabei war es egal, ob er Mafioso oder Journalist, Richter oder Polizist war. Aus Corleone stammte auch Totò Riina, der Boss der Bosse, der Hunderte von Toten auf dem Gewissen hatte und seine Gegner am liebsten eigenhändig erwürgte. Neben seinem Geburtsdorf hatte Totò Riina mit dem um einiges schickeren fiktiven Paten Don Vito Corleone jedoch wenig gemein – abgesehen von seinen Hängebacken vielleicht. Hängebacken und Freunde in der Politik.
1992, zwei Jahre nachdem der letzte Teil der Paten-Trilogie in die Kinos gekommen war, hatten diese Freunde in der Politik Totò Riina enttäuscht, und es zeigte sich, zu welch eiskalt inszenierter Kriegsgewalt die sizilianische Mafia unter seiner Führung imstande war. Zwei außergewöhnlich mutige ermittelnde Staatsanwälte, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, wurden durch Bombenattentate ermordet. Falcone war an einem Samstag im Mai auf dem Flughafen von Palermo gelandet und fuhr gerade mit sieben Leibwächtern in Kolonne Richtung Stadt, als in einem Tunnel unter der Schnellstraße Hunderte Kilos Sprengstoff explodierten. Der erste Wagen mit drei Leibwächtern flog nur so durch die Luft, und der zweite mit Falcone und seiner Frau prallte mit ebenfalls tödlichem Ausgang gegen die riesige Kraterwand, die sich aufgrund der Explosion gebildet hatte. Zwei Monate später drückte Paolo Borsellino an einem Sonntagnachmittag die Türklingel am Haus seiner Mutter, als eine schwere Autobombe explodierte, die ihn und fünf seiner Leibwächter tötete. Die Straße lag in Schutt und Asche, es sah aus wie nach einem starken Erdbeben. Während die Gewalt der Cosa Nostra in allen Zeitungen der Welt zur Sprache kam, baute die ’Ndrangheta, die noch nicht über Filme oder Bombenanschläge bekannt war, in aller Stille weiter ihr Imperium aus.
2.
Wer sind hier die Mafiosi?
Es war mein erster Sommer in Kalabrien, als die Nachricht um die Welt ging, dass die ’Ndrangheta in Deutschland ein Blutbad angerichtet hatte. Sechs junge Männer waren nachts vor dem Eingang eines beliebten italienischen Restaurants in Duisburg von Kugeln durchsiebt worden. Die Medien schrieben den sechsfachen Mord sofort einer Fehde zwischen ’Ndrangheta-Familien aus dem kalabresischen Dorf San Luca zu.
Ich hatte den Begriff ’Ndrangheta erst ein paarmal gehört und wusste nicht sehr viel mehr, als dass es der Name der kalabresischen Mafia war. Wenn ich meine Nachbarn danach fragte, sagten sie: »Nein, die gibt es nicht bei uns im Dorf. Die Mafia sitzt weiter im Süden.« Ich sah tatsächlich, dass San Luca, das Dorf, aus dem sowohl die Verdächtigen als auch die Opfer des Mordanschlags in Duisburg stammten, ungefähr zwei Autostunden weiter südlich lag. Warum hatten sie diesen Racheakt dann zweitausend Kilometer weiter nördlich verübt?
Die Blutrache schien für meine Nachbarn im Dorf ein vollkommen irrelevantes Thema zu sein. Wenn ich von ihrer Gleichgültigkeit ausging, war San Luca für sie fast ebenso weit entfernt wie Duisburg. Ich hätte gern mehr gewusst, musste aber Geduld aufbringen, denn mit meinen damals noch sehr begrenzten Italienischkenntnissen konnte ich keine lokalen Zeitungen lesen oder tiefschürfende Gespräche führen. Zugleich machte ich mir keine großen Sorgen, denn niemand von den Menschen, die ich kannte, machte einen mafiosen Eindruck auf mich. Sie alle führten ein einfaches, unauffälliges Leben.
Nichts im Dorf fand ich unheimlich, abgesehen vielleicht vom Kühlwagen, der jeden Samstag Eis und tiefgefrorene Lebensmittel brachte und mit einer Art Spieluhrmusik, die mich an Horrorfilme erinnerte, den Hügel hinauffuhr. Im Gegensatz zu vielen meiner betagten Nachbarn, die kein Auto hatten, aber ihr eigenes Obst und Gemüse anbauten, konnte ich selbst den Hügel hinunterfahren, um einzukaufen. In der Umgebung gab es zwar keinerlei Arbeit für mich, aber die suchte ich auch nicht – ich konnte meine Redaktionstätigkeit für niederländische Auftraggeber aus der Ferne erledigen. Ansonsten kümmerte ich mich um meine eigenen Angelegenheiten, so wie es sich hier gehörte. »Fare i cazzi propri« nennt man das in derbem Italienisch. Damit tut man allen einen Gefallen.
Kalabresen sind Fremden gegenüber oft etwas misstrauisch. Die Geschichte hat ihnen ausreichend Grund dafür geliefert. Eine Fremdherrschaft nach der anderen hat hier ihre Flagge in den Boden gerammt: Griechen, Römer, Normannen, Spanier, Franzosen, ganz zu schweigen von türkischen und anderen Eroberern aus der Ferne. Die Dörfer baute man nicht direkt am Meer, sondern auf den Hügeln, damit die Kalabresen schon von Weitem sehen konnten, wenn wieder der eine oder andere Feind herannahte.
Glücklicherweise war die ausländische Familie, von der ich ein kleines Haus gemietet hatte, im Dorf beliebt, respektiert und genoss einen guten Ruf. Die Leute sahen uns zusammen und assoziierten mich mit ihnen, also wurde ich schon bald immer herzlicher gegrüßt und von ihnen zu sich nach Hause eingeladen. Vom Arzt und seiner Frau, die in der Schule Englisch unterrichtete. Vom Anwalt und seiner Mutter, die mit ihren verführerischen Kochkünsten zu versuchen schien, einem eventuellen Auszug ihres Sohns aus dem Elternhaus vorzubeugen. Und von den auffallend munteren Rentnern, die auf dem Rückweg von ihrem Gemüsegarten oder dem Hühnerstall an meinem Haus am Rand des Dorfes vorbeikamen und mir manchmal Eier in die Hände legten oder eine Tüte mit knackigem Salat an die Tür hängten.
Ich hatte noch nie so viel herzliche Gastfreundschaft erlebt wie in diesem winzig kleinen kalabresischen Dorf. Erst dachte ich, dass ich mich weitab von jeder größeren Stadt vielleicht langweilen würde, doch das Leben hier war alles andere als öde. Bevor ich mich recht versah, hatte ich eine ganze Familie streunender Hunde in meiner Obhut, machte zusammen mit einem Imker Honig und sah meinen Nachbarn dabei zu, wie sie wie professionelle Metzger Wildschweine zerlegten. Mineralwasser konnte man sich hier selbst aus den Bergen holen, die mit Klee und Blumen in grellen Farben bewachsen waren. Ziegenherden kletterten auf steilen Felsen herum, und Schafe grasten zwischen Bäumen, die das ganze Jahr über ihr Blattwerk behielten. All dieser Romantik war ich nicht gewachsen: ’Ndrangheta hin oder her, ich ging ganz in dieser Idylle auf.
Die Monate vergingen, und ich war schon ein Dreivierteljahr in Kalabrien, als in einer warmen Septembernacht etwas Ernüchterndes geschah. Die gesamte Straße wurde aus dem Schlaf gerissen: Ein Auto stand in Brand. Alle kamen in ihrem Nachtzeug nach draußen, um beim Löschen zu helfen oder zu trösten. Das Auto gehörte einer jungen Frau, die bei der Gemeinde arbeitete. Sie wirkte erschrocken, reagierte aber ruhig und gelassen. Feuerwehr oder Polizei wurden nicht benachrichtigt.
Am nächsten Tag hörte ich an ihrem Küchentisch, dass sie eine starke Vermutung hatte, wer ihr Auto angezündet haben könnte. Sie war es gewohnt, bei jedem, der an ihrem Schalter eine Baugenehmigung beantragte, die gleichen Regeln anzuwenden, doch für eine Reihe von Dorfbewohnern war das offenbar inakzeptabel. Sie forderten bestimmte Freiheiten ein, und wenn sie die nicht bekamen, ließen sie auf diese Weise wissen, dass sie sich diese Freiheiten trotzdem nehmen würden, egal, was andere davon halten mochten. Ich fragte meine Nachbarin, ob sie wegen der Brandstiftung Anzeige bei der Polizei erstatten werde. Nein, sagte sie, das würde es nur noch schlimmer machen. Sie machte sich auf die Suche nach einer anderen Arbeit, denn in dem Wissen, dass sie sich würde fügen müssen, wollte sie ihre Stelle bei der Gemeinde nicht mehr behalten. Ihren Verdacht, wer die Täter gewesen waren, sprach sie nicht laut aus. Ich drängte sie nicht weiter und lieh ihr mein Auto.
Mehr als hundert deutsche und italienische Ermittler waren unterdessen damit beschäftigt, den sechsfachen Mord in Duisburg aufzuklären. Die Italiener hatten ihre deutschen Kollegen schon fünfzehn Jahre zuvor gewarnt, dass das Restaurant – keine einfache Pizzeria, sondern ein Etablissement, in dem man auch Hummer bestellen konnte – von einem kalabresischen Mafia-Clan betrieben wurde. Jetzt lagen die Beweise dafür in Hülle und Fülle vor. Beispielsweise in Form eines angesengten Andachtsbildchens des Erzengels Michael, eines Schutzheiligen der ’Ndrangheta. Es wurde in der Hosentasche eines der Opfer gefunden, eines gewissen Tommaso, der eine Koch-Lehre in diesem Restaurant absolvierte. In der Nacht war Tommaso 18 Jahre alt geworden, und alles deutete darauf hin, dass sein Geburtstag von seinem Arbeitgeber, Chefkoch Sebastiano, dazu genutzt worden war, ihn nach Schließung des Restaurants als neues Clan-Mitglied einzuweihen.
Tommaso hatte Blut aus seinem Finger auf das Bildchen tropfen lassen und es anschließend, den Regeln des Rituals folgend, angezündet. Doch er hatte das Andachtsbild nicht ganz verbrennen lassen, nur das Gesicht des Engels. Auf dem Bild war noch deutlich zu sehen, dass der Engel sein Schwert stoßbereit über ein Wesen hielt, das, halb Mensch, halb Drache, lang ausgestreckt auf ein paar schwelenden Felsbrocken lag. Vom Engel waren auch noch die großen, weißen Flügel und der lange, rote Umhang zu erkennen, die sich vor einem hellblauen Himmel und einer grünen Hügellandschaft abhoben.
Vielleicht hatte Tommaso sich ein Andenken an diesen Abend bewahren wollen und das Andachtsbildchen deshalb nach dem Abkühlen in sein Portemonnaie gelegt und dieses in die Gesäßtasche gesteckt. Um zwei Uhr nachts verließ er das Restaurant mit seinem neununddreißigjährigen Chef Sebastiano, dessen sechzehnjährigem Neffen und drei Männern in den Zwanzigern: zwei weitere kalabresische Kellner und Marco, der gerade erst aus Kalabrien nach Duisburg gekommen war. Die Polizei fand sie kurz danach alle sechs in einem schwarzen VW Golf und einem weißen Transporter, durchsiebt von zahlreichen Kugeln. Tommaso hatte vierzehn Schusswunden, darunter vier in den Kopf.
Eine deutsche Frau hatte den Notruf gewählt. Ihr waren auf der Straße zwei Männer begegnet, die sich in Richtung des Restaurantparkplatzes bewegten. Kurze Zeit später hörte sie etwas, das wie ein Feuerwerk klang, und als sie zurückging, sah sie dieselben zwei Männer in einer Gasse verschwinden. Ihre Zeugenaussage und die Aufnahmen der Überwachungskameras bildeten die Grundlage, auf der die Ermittler ihre Suche nach zwei Mördern aufnahmen. Dass sie dafür beim ’Ndrangheta-Clan der Familien Nirta und Strangio ansetzen mussten, war ihnen ziemlich schnell klar. Dieser Clan lag nämlich in einem heftigen Clinch mit dem der Familien Pelle und Vottari, die das Restaurant Da Bruno betrieben. Sechzehn Jahre lang war die Fehde ausschließlich in und um San Luca ausgetragen worden. Seitdem ein Karnevalsabend in einer ersten tödlichen Schießerei geendet hatte, gingen die Clans in Kalabrien regelmäßig mit Pistolen und Kalaschnikows aufeinander los.
Sebastiano Strangio, der Eigentümer und Chefkoch des Da Bruno, gehörte komplizierterweise trotz seines Nachnamens nicht dem Nirta-Strangio-Clan an. Er mochte in dieser Nacht zwar unbewaffnet mit seinen Leuten nach draußen gegangen sein, war aber durchaus auf ein neues Kapitel der Vendetta vorbereitet. In einem Lagerraum des Restaurants fand die Polizei ein automatisches Gewehr, das mit neunzig Kugeln geladen war, sowie einen beeindruckenden Vorrat an weiterer Munition. Wer hätte das hinter der anständigen Fassade des gut besuchten Restaurants im Silberpalais vermutet, dem größten nahe dem Hauptbahnhof gelegenen Bürogebäude Duisburgs und der eigenen Website zufolge ein idealer Standort, an dem »nationale wie internationale Unternehmen ihre geschäftliche Heimat« finden konnten?
Es stellte sich heraus, dass Da Bruno nicht nur als Waffenlager für den Pelle-Vottari-Clan, sondern auch als dessen feste Versammlungsstätte diente. Dafür war ein spezieller Raum eingerichtet worden: ein Raum ohne Fenster, der sich hinter einer verdeckten Schiebetür verbarg. Ein Raum, von dem nicht alle Kellner und erst recht nicht alle Gäste des Restaurants wussten. In ihm befanden sich eine kleine Statue des Erzengels Michael und ein massiver Holztisch mit zwölf imposanten Stühlen, von denen der am Kopfende des Tisches eine extra hohe Rückenlehne hatte. Der Raum war für wichtige Rituale eingerichtet worden, wie die Einweihung Tommasos.
Auch die beiden Schützen des Nirta-Strangio-Clans legten Wert auf Symbolik. Sie wussten wahrscheinlich nicht, dass Tommaso an dem Abend Geburtstag hatte, geschweige denn, dass er eingeweiht worden war, aber sie hatten das Datum ihrer Blutrache durchaus mit Bedacht gewählt. Es war die Nacht vom 14. auf den 15. August 2007, und bei Sonnenaufgang brach Mariä Himmelfahrt an, ein sommerlicher Feiertag, der für das Gemeinschaftsgefühl italienischer Familien ebenso wichtig ist wie Weihnachten. Die Mörder wollten das Fest für den Pelle-Vottari-Clan durch das Blutbad und den Verlust ihrer Jungen ein für alle Mal verderben. So wie für sie Weihnachten durch den Tod Maria Strangios, die am ersten Weihnachtstag in San Luca die Kugeln für ihren Mann, den Anführer des Clans, abgefangen hatte, nie mehr dasselbe sein würde. Sollten sie geglaubt haben, dass Marias Seele endlich in den Himmel kommen könne, nun, da ihr Tod durch sechs neue Seelen gerächt worden war?
3.
Familiengefühl
Die treueste Freundin, die ich in diesem ersten Jahr in Kalabrien gewann, war in ihren Siebzigern: Peppina, eine Frau aus einem Guss. Sie trank Kaffee aus winzig kleinen Bierkrügen aus Glas, und unter ihrem Kopftuch verbarg sie die Frisur eines Schuljungen. Ihre Kleidung wusch sie zwar nicht mehr im Fluss, wie noch vor vierzig Jahren, dafür aber am öffentlichen Wasserhahn. Da stand sie schön im Halbschatten des ummauerten Springbrunnens unter den frommen Blicken der Marienstatue, die sich über dem Becken in einer kleinen Nische befand.
Ihr Mann Antonio war schon eher Ende siebzig, spazierte aber noch jeden Morgen in aller Frühe mit ein paar leeren Plastiktüten und einer kleinen Hacke über der Schulter die Hügel hinauf zu seinem Gemüseacker. Nach ein paar Stunden kam er mit vollen Tüten wieder zurück.
Mindestens einmal in der Woche rief mich Peppina gegen zwölf Uhr in strengem, alarmierendem Ton zu sich. Nicht, dass etwas Schlimmes passiert wäre. Es hieß nur, dass ich bei ihnen zu Tisch erwartet wurde. »Komm, setz dich«, sagte sie, wenn ich an ihrer Haustür erschien, die direkten Zugang zur Wohnküche bot. »Wir wollen essen.«
Es gab auch Tage, an denen Antonio von ihrem Festnetztelefon auf meinem Handy anrief, und zwar mit der kurzen, aber vielsagenden Mitteilung: »Peppina hat minestra gemacht.« Minestra war keine Gemüsesuppe, sondern ein Codewort für wilden Chicorée mit weißen Bohnen, ein einfaches Gericht, das Peppina jedoch göttlich zubereitete. Antonio schenkte uns dazu seinen selbstgemachten Wein ein, orangefarben und ein bisschen trübe. Oft holte er auch eine hausgemachte Soppressata-Wurst hervor. Das Mittagessen endete fast immer mit einer typischen Handbewegung und einem stolzen Glanz in seinen Augen: »Perfetto.« Nach dem Bierkrüglein Kaffee mit einem Schuss Anislikör ruhte er sich auf der Bank oder am Holzofen aus.
Oft holte Peppina nach dem Essen Fotos von ihren Kindern und Enkeln aus der Vitrine. Wir hatten uns gerade erst kennengelernt, als aus Kanada die tragische Nachricht eintraf, dass ihr Sohn gestorben war. Er war schwerkrank gewesen, sie hatten ihn vor Kurzem noch ein letztes Mal besucht. Mit Nachbarn und Familienangehörigen saßen wir am Abend seines Todestags in ihrer Wohnküche in großem Kreis schweigend da. Von diesem Tag an trug Peppina stets einen schwarzen Rock, einen schwarzen Pulli und ein schwarzes Kopftuch über dem kurzen, schwarzen Haar.
Auch ihre Tochter war bereits als Teenager nach Kanada ausgewandert. In Kalabrien gab es zu wenig Arbeit, und die Berichte von Verwandten auf der anderen Seite des Ozeans hatten sich vielversprechend angehört. Nun flog sie jedes Jahr im August nach Italien zurück, um die Sommerferien zu Hause bei ihren Eltern zu verbringen. Es stimmte mich wehmütig, dass Peppinas Tochter in ihrem eigenen Heimatdorf etwas desorientiert wirkte. Sie war zum Kind einer anderen Welt geworden.
Einer der Söhne Peppinas war zum Glück in Kalabrien geblieben. Wenn er mit Frau und Kindern aus der Provinzhauptstadt Catanzaro zu Besuch kam, dauerte das sonntägliche Mittagessen bei Peppina und Antonio – so, wie es sich gehörte – fast den ganzen Tag.
Antonio hatte vor langer Zeit ebenfalls eine Weile in Kanada gearbeitet, bei einer Eisenbahnlinie. Den monatlichen Brief mit seiner kanadischen Rente ließ er von mir kontrollieren, denn er hatte nie so recht Lesen und Schreiben gelernt. Italienisch verstand er zwar, doch er sprach lieber im kalabresischen Dialekt. Antonio war kein großer, wohl aber ein sehr ausdrucksstarker Redner und somit ein guter Lehrer. Mit ihm und Peppina unternahm ich meine ersten Schritte ins Kalabresische.
Alle Fremdherrscher Kalabriens, von den Griechen bis zu den Spaniern und von den Franzosen bis zu den Deutschen, haben ihre Spuren im kalabresischen Dialekt hinterlassen. Daher klingt es wie eine Art Esperanto mit lauter Wörtern, die mir eine Führung durch mein Sprachgedächtnis bescheren. Am schönsten finde ich die ungeheuer lautmalerischen Verben. Scialarsi zum Beispiel, das mit zwei langen Aahs ausgesprochen wird und so viel wie »ausgiebig genießen« bedeutet. Oder spagnarsi, sich fürchten. »Ti spagni?« bedeutet: »Hast du Angst?« Irgendwie klingt es gleich vertraut und ist leicht zu merken, vor allem, wenn man an die niederländische Redewendung Het Spaans benauwd krijgen denkt, man also eine »spanische Beklommenheit« spürt. Furchterregende spanische Fremdherrscher haben wir mit den Kalabresen gemein.
Manchmal war es sogar noch einfacher, den kalabresischen Dialekt zu verstehen. Als Peppina zum ersten Mal fragte, ob ich geriebenen kasu auf meiner Pasta haben wolle, konnte ich nicht anders, als mit breitem Lächeln auszurufen: »Kasu? Formaggio? Käse!«.
Während der Mahlzeiten wurde ansonsten meist geschwiegen. Peppina mäkelte manchmal ein wenig an ihren Nachbarn herum oder warnte mich generell: Nicht alle seien so vertrauenswürdig wie sie. Wenn sie fluchte, wiederholte ich »cazzo?« Mit einem breiten Grinsen griff sie sich dann etwas verschämt an die Stirn. »È parlare, figghia.« So rede ich nun mal, Mädel, das musst du nicht ernst nehmen.
Was Peppina allerdings schon ernst nahm, war der Böse Blick. Ihr zufolge konnten neidische Blicke einen Menschen schwächen und krank machen. Wenn jemand müde war oder Kopfschmerzen hatte, blieb nur eine Möglichkeit: den Fluch des Bösen Blicks mit einem geheimen Spruch zu bannen. Während sie mit ihrem Daumen kleine Kreuze auf meine Stirn schrieb, murmelte sie ganz leise ihre magische Formel. Musste sie dann gähnen, sagte sie, das sei ein Zeichen, dass es funktioniere.
Den uralten Spruch durften Frauen einander von einer Generation zur nächsten weitergeben, aber nur an hohen Feiertagen: zu Weihnachten, Ostern oder an Mariä Himmelfahrt. An einem Weihnachtsabend habe ich die Formel von Peppina gelernt. Ich fühlte mich geehrt, mit diesem Ritual unter vielen in den Kreis ihrer Familie aufgenommen zu werden. Ihr esoterisches Erbe habe ich aufgeschrieben und bewahre es, doch ich werde keine Spielverderberin sein: Wenn jemand wissen möchte, wie die Formel lautet, werde ich den Regeln der Tradition gehorchen. Es würde die Magie zerstören, wenn ich mehr über sie erzählen würde, als dass sie von Rhythmus, Reim und katholischen Heiligen nur so strotzte.
Während mein Italienisch mit den Jahren besser wurde und ich mehr über die lokale Mafia erfuhr, wurde mir immer klarer, dass sich die ’Ndrangheta die wertvolle kalabresische Kultur auf eine perverse Art und Weise zunutze gemacht hat. Herzliche Gastfreundschaft kann sich in ’Ndrangheta-Kreisen in eine bedrückende Abhängigkeit verwandeln. Zurückhaltung wird zu omertà, zu absoluter Verschwiegenheit. Esoterik zu einem Blutschwur, den man bis an sein Lebensende nicht brechen darf. Und was die ’Ndrangheta aus der großen Bedeutung macht, die in Kalabrien der Familie beigemessen wird, deren Mittelpunkt die Mutter bildet, zeigt sich zum Beispiel an einem Telefonat, das die italienische Polizei am Tag des großen Blutbads in Duisburg abgehört hatte.
»Pronto!« Der junge Mann, der den Anruf in San Luca entgegennimmt, klingt fröhlich. Es ist kurz nach zwölf an Ferragosto, Mariä Himmelfahrt, dem Tag der ausgelassensten Familienpicknicks unter freiem Himmel.
»La mamma è jocu?«, fragt in kalabresischem Dialekt der ebenfalls junge Mann, der am anderen Ende der Leitung aus Duisburg anruft. »Ist Mama da?« Seine Stimme zittert.
»Nein. Was ist denn passiert?«, fragt die Stimme aus San Luca.
»Geh und erzähle es«, sagt die andere unter Tränen. »Mein Bruder ist tot, mein Neffe, dein Bruder, sie sind alle tot …«
Auf den ersten Blick ist an dem, was sich die von der Polizei abgehörten jungen Männer sagen, nichts auffällig – von der betrüblichen Nachricht einmal abgesehen. La mamma ist die Mutter, sollte man meinen. Doch bei der ’Ndrangheta ist es nicht immer so einfach. »La mamma« ist in diesem Fall Antonio Pelle, der Chef der beiden, Anführer des Pelle-Vottari-Clans. Er ist der Allererste, der in San Luca erfahren muss, welche seiner Männer in der letzten Nacht im Krieg gegen den feindlichen Clan der Nirta-Strangios gefallen sind. Noch vor deren eigenen Müttern.
Die Geheimsprache der ’Ndrangheta strotzt vor Metaphern. Vor allem religiöse Begriffe werden als beschönigender Deckmantel für kriminelle Traditionen benutzt. So heißt die Einweihung eines neuen Mitglieds »Taufe«. Für eine solche Taufe mit einigen Tropfen Blut auf einem Heiligenbild muss man mindestens vierzehn Jahre alt sein. Wird man als Junge in eine traditionelle ’Ndrangheta-Familie hineingeboren, kann man das erste Taufritual übrigens überspringen. Mit einem ’Ndranghetisten als Vater ist man nämlich automatisch ein giovane d’onore, ein »junger Ehrenmann«. Es ist ein Geburtsrecht oder besser gesagt, eine Geburtspflicht.
Für Töchter gibt es keinen Geburtstitel, und obwohl Frauen hinter den Kulissen eine wichtige Rolle in den Clans spielen können, dürfen sie nicht als ’Ndrangheta-Mitglied eingeweiht werden. Sorella d’omertà, die »schweigende Schwester«, ist der einzige und auch noch ziemlich passiv klingende Ehrentitel, den sie anstreben können. Viele Töchter aus einer ’Ndrangheta-Familie heiraten innerhalb des Clans oder werden, wenn es geschäftlich interessant sein sollte, gezielt mit einem Mann verheiratet, der einem anderen Clan angehört. Indem sie Kinder kriegen und sie nach den Sitten der ’Ndrangheta erziehen, tun Frauen das, was von ihnen erwartet wird.
Jungen, die außerhalb der Organisation geboren worden sind, legen bei ihrer »Taufe« den Eid ab, dass die Interessen des Clans für den Rest ihres Lebens schwerer wiegen werden als die Interessen der eigenen Eltern, Brüder oder Schwestern. »Von nun an seid ihr meine Familie«, schwören sie. »Wenn ich einen Fehler mache, werde ich mit dem Tod bestraft.«
Dieses Familiengefühl, ob genetisch oder kultiviert, ist der Grund für den Erfolg der ’Ndrangheta. Die eigene Familie verpfeift man nicht – und schon gar nicht, wenn man weiß, dass man dafür mit dem Tod bestraft wird.
Das, was Kalabresen mir als Erstes über die Verbrechen der ’Ndrangheta erzählten, handelte von den abscheulichen Entführungen in den Siebziger- und Achtzigerjahren. Vor allem das schwer zugängliche, beeindruckende Aspromonte-Gebirge im Hinterland von San Luca erlangte zweifelhafte Berühmtheit durch die Hütten und ausgehobenen Erdlöcher, in denen ein Entführungsopfer nach dem anderen, manchmal über Jahre hinweg, festgehalten wurde. Regelmäßig brachte man sie von einem Ort zum anderen, und wenn die Polizei kam und nach ihnen suchte, hatte keiner etwas gesehen. In San Luca, einem Dorf mit nur ein paar Tausend Einwohnern, leben seit jeher mehr als zehn traditionelle ’Ndrangheta-Familien. Indem sie mit Gewalt die Verschwiegenheit und Gefügigkeit der anderen Dorfbewohner erzwangen, gelang es diesen Familien, in Zusammenarbeit mit Clans aus anderen Regionen diese Art unvorstellbarer krimineller Machenschaften zu betreiben.
Der achtzehnjährige Cesare Casella, Sohn eines reichen Autohändlers, wurde Ende der Achtzigerjahre aus der norditalienischen Stadt Pavia entführt und mehr als zwei Jahre lang in Kalabrien gefangen gehalten. Für Cesares Freilassung verlangten die Entführer acht Milliarden Lire, ungefähr vier Millionen Euro, einen Betrag, den seine Eltern nicht hatten. Seine Mutter fuhr zweimal persönlich nach San Luca. Beim ersten Mal bat sie den Priester des Dorfes, sich während der Messe für die Freilassung ihres Sohns zu verwenden. Beim zweiten Mal ging sie direkt auf die Frauen von San Luca zu und flehte sie an, ihr zu helfen. Um Empathie für das Schicksal ihres Sohnes zu erzeugen, lief sie mit einer Kette um den Hals herum und schlief in einem Zelt auf dem Dorfplatz. Nach 743 Tagen und der Zahlung von einer Milliarde Lire (einer halben Million Euro) wurde Cesare endlich freigelassen.
Auch der siebzehnjährige Enkel des Ölmagnaten John Paul Getty wurde von den kooperierenden Clans der ’Ndrangheta entführt. Getty, einer der reichsten Männer der Welt, zeigte sich jedoch sehr viel weniger empathisch als Cesares Mutter. Von den geforderten siebzehn Millionen Dollar bekamen die Entführer letztlich nur ein Zehntel. Aufgrund der kühlen Verhandlungstaktik Gettys musste sein Enkelsohn Paul fünf Monate auf seine Freilassung warten und eine zusätzliche Tortur erleiden: Man schnitt ihm ein großes Stück von seinem rechten Ohr ab. Paul war für den Rest seines nicht allzu langen Lebens von Alkohol und Drogen abhängig.
Ironischerweise war es gerade der Drogenhandel, in den die ’Ndrangheta-Clans die mit den Entführungen verdienten Millionen investierten. Sie wurden die größten Kokainimporteure auf dem westlichen Markt. So verlief also die stille Eroberung der Welt durch die ’Ndrangheta: von verschwiegenen Meistern der Entführung zu verschwiegenen Meistern im Handel harter Drogen.
Verschwiegenheit ist nicht nur gegenüber der Außenwelt, sondern auch innerhalb der ’Ndrangheta selbst ein hohes Gut. Bei großangelegten und komplizierten Projekten wie dem internationalen Drogenschmuggel arbeiten mehrere Clans zusammen und müssen bestimmte Informationen miteinander teilen. Doch in der Regel kümmern sich die einzelnen Clans nur um ihr eigenes Territorium. Ein Clan, oder auch ’ndrina, erhält den Namen einer oder mehrerer Familien, die bereits über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten und, wie beim Pelle-Vottari-Clan, durch Heirat miteinander verbunden sind. Sie setzen sich zusammen aus Vätern, Großvätern, Söhnen und Enkelsöhnen, Brüdern, Cousins und Neffen sowie angeheirateten Familienangehörigen: strategisch ausgewählte Schwiegersöhne und Schwäger.
Je länger jemand dabei ist, desto mehr Macht und Verantwortung wird ihm in der Regel mit der Zeit übertragen. Der jeweilige Rang in der Hierarchie heißt dote, ein italienisches Wort, das sowohl Mitgift als auch Talent bedeutet. ’Ndranghetisten eines höheren Rangs kennen den Rang der unter ihnen stehenden Clanmitglieder, doch umgekehrt ist das Wissen begrenzt. So bleibt in den unteren Rängen stets im Vagen, wer genau die höchsten Machthaber sind, so dass diese weniger Gefahr laufen, verraten zu werden oder einem Coup zum Opfer zu fallen.
Zu jedem Aufstieg in einen neuen Rang gehört ein Ritual nach einem genauen Drehbuch und mit umfangreichen Formeln. Diese Formeln der ’Ndrangheta dürfen nicht schriftlich festgehalten, sondern müssen auswendig gelernt und von den Ranghöheren nach und nach an die Neulinge weitergegeben werden. Dennoch haben Ermittler in Scheunen, Villen und Bunkern flüchtiger ’Ndranghetisten bereits eine ganze Menge Zettel mit Verhaltenskodizes und Ritualen gefunden. In einigen Büchern über die kalabresische Mafia, mit denen ich in den letzten Jahren ein ganzes Regal gefüllt habe, sind zur Illustration einige dieser Zettel abgebildet. Die Skripte und Formeln, in krakeliger Handschrift niedergeschrieben, wimmeln oft von Rechtschreibfehlern. In Einzelfällen wurden sie jedoch geduldig in Geheimschrift aufgezeichnet und strahlen eine merkwürdige Ruhe und Selbstbeherrschung aus.
Die Grundregeln sind für alle Clans die gleichen. Ein ’Ndrangheta-Mitglied schwört seinem eigenen Clan und der Führungsebene die Treue. In dieser Führungsmannschaft sind die Anführer der mächtigsten Clans aus dem südlichsten Teil der Region Kalabrien, der Provinz Reggio Calabria, vertreten, die daher la Provincia, die Provinz, genannt wird. Ein weiterer, überraschend transparenter Name für die Spitze der Organisation lautet il Crimine, das Verbrechen. Eine Kommission, die jährlich in der Nähe von San Luca zusammentritt, wählt die Anführer, die ein Jahr lang über alle Angelegenheiten entscheiden dürfen, die die gesamte kriminelle Organisation betreffen. Ohne die Zustimmung der provinzialen Führungsebene ist es einem Clan nicht erlaubt, ein bestimmtes Territorium für sich einzufordern, auch nicht, wenn dieser Clan in einem anderen Teil Kalabriens, Italiens oder der Welt operiert. Kurzum: Alle Clans sind wie durch eine Nabelschnur mit der Provinz Reggio Calabria und der zeremoniellen Wiege San Luca verbunden. Dort werden sie gewissermaßen geboren. Daher kommt es also, dass das Hauptquartier in San Luca bei ’Ndranghetisten von außen la mamma genannt wird und der oberste Chef manchmal den Spitznamen mammasantissima, »allerheiligste Mutter«, bekommt.
Kann es sein, dass die ’Ndrangheta mit all diesen metaphorischen Mutterfiguren versucht, ihr Image bei den eigenen Leuten zu beschönigen? Faszinierend sind sie, all diese bewaffneten Männer mit einer Mutter, die sie gebiert und nährt, die Strafen erteilt, wenn sie ungehorsam sind, aber die ihre Söhne auch tröstet und zusammenbringt.
Der traditionelle Versammlungsort für ’Ndranghetisti befindet sich selbstverständlich in der Nähe von San Luca, und zwar bei einer der wichtigsten Schutzheiligen der ’Ndrangheta, der Madonna von Polsi, auch Madonna della Montagna, »Madonna vom Berge«, genannt. Diese Marienstatue mit Kind, die für alle Mitglieder konkreteste symbolische Mutter, steht in einer kleinen Kirche in einem abgelegenen Tal mitten im Aspromonte-Gebirge. Die Madonna trägt ein zartrosa Kleid und einen hellblauen Schleier, sie hat eine große, goldene Krone auf dem Kopf, ebenso wie das nackte Jesuskind auf ihrem Schoß, das zudem mit einer goldenen Erdkugel spielt. Überall dort, wo ’Ndranghetisten leben, arbeiten, sich verstecken oder versammeln, finden sich Nachbildungen dieser Statue. Nicht nur in abgelegenen kalabresischen Gehöften oder in unter Villen verborgenen Schutzbunkern, sondern beispielsweise auch im Speisesaal des Restaurants Da Bruno in Duisburg, einer Hafenstadt in einer der größten Industrieregionen Europas.
In Polsi, beim Heiligtum der »Madonna vom Berge«, besprachen die prominentesten ’Ndrangheta-Mitglieder auch die Blutrache von Duisburg, die die bisher so unauffällige kalabresische Mafia plötzlich ins europäische Scheinwerferlicht gerückt hatte. Eine kriminelle Organisation gedeiht jedoch nicht gut in grellem Licht, also mussten die Gemüter in Polsi rasch besänftigt werden. Kaum zwei Wochen, nachdem die Opfer des sechsfachen Mordes ein Stück weiter beerdigt worden waren, wurde beim Heiligtum der Madonna die zu dem Zeitpunkt mehr als sechzehn Jahre andauernde Fehde zwischen den Familien aus San Luca beigelegt. Es war wie ein Wunder. Die kalabresische Polizei hörte einen der anwesenden ’Ndrangheta-Anführer begeistert davon berichten: »Alle haben vor Zufriedenheit getanzt und sich die Hände geschüttelt. Die Freundschaft ist wiederhergestellt.« Seit der Versöhnung der beiden kriegführenden Clans aus San Luca ist es mit den Geschäften der ’Ndrangheta nur bergauf gegangen.
4.
»Schreibst du in der Zeitung darüber?«
Über die ’Ndrangheta ist noch sehr wenig bekannt, als eines ihrer am meisten gesuchten flüchtigen Mitglieder in den Niederlanden verhaftet wird: Giovanni Strangio aus San Luca, der im Verdacht steht, verantwortlich für die Blutrache in Duisburg zu sein. Er wohnt zum Zeitpunkt der Festnahme mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn bereits anderthalb Jahre in einem Reihenhaus in Diemen unweit von Amsterdam. Es stellt sich heraus, dass auch sein ebenfalls flüchtiger Schwager, der Ende der Neunzigerjahre wegen Kokainhandels und ’Ndrangheta-Mitgliedschaft verurteilt wurde, bei ihnen untergekommen ist. Die Polizei findet drei falsche Reisepässe, eine kugelsichere Weste, drei Perücken, elf Mobiltelefone, eine halbe Million Euro Bargeld und eine Geldzählmaschine im Haus. In einem Schuhschrank bei der Eingangstür liegt griffbereit eine geladene Waffe.
Ich selbst lebe zu der Zeit bereits seit zwei Jahren in Kalabrien. Eine feste Adresse in Amsterdam, zu der ich zurückkehren könnte, habe ich nicht mehr, denn meine Mietwohnung ist an Immobilienspekulanten verkauft worden. Die lauerten schon lange auf das Haus, in dem ich im obersten Stockwerk wohnte, um es in Eigentumswohnungen aufzuteilen, zu renovieren und mit hohem Gewinn zu verkaufen. Ich wollte dort nicht weg, denn die Wohnung war wunderbar, und außerdem waren dem erträumten unbefristeten Mietvertrag während meines Studiums schon viel zu viele Übergangs-Wohnmöglichkeiten vorausgegangen. Deshalb hielt ich daran fest, bis ich als einzige Mieterin dieses großen Hauses im Amsterdamer Stadtteil De Pijp übrig blieb und die strategisch geschickten Immobilienhaie immer häufiger auf ihren Motorrollern daran vorbeifuhren. Schließlich boten sie mir eine hübsche Summe an, um die Unannehmlichkeiten des erzwungenen Umzugs abzumildern. Ich betrachtete das als Startschuss für ein Auslandsabenteuer. Meine Expedition hätte im Rückblick ebenso gut in Brasilien oder Japan beginnen können, führte mich jedoch zufälligerweise in den äußersten Süden Italiens, an einen Ort, der mich so faszinierte, dass ich dort nicht mehr wegwollte. Von meiner Umzugsprämie hätte ich in Amsterdam vielleicht, wenn ich sehr lange und sehr intensiv gesucht hätte, noch eine Weile in einer anderen Mietwohnung wohnen können, doch ich beschloss, sie anders anzulegen. In Kalabrien konnte ich mir davon nämlich ein Haus mit unverstelltem Meerblick kaufen.
Das charmante Dorf, in dem ich mein Haus gekauft habe, liegt, über drei Hügel drapiert, auf gut dreihundert Meter Höhe. Mit dem Auto bin ich in wenigen Minuten am Meer. An der Küstenstraße befindet sich der modernere Teil des Dorfes, in dem die meisten der ungefähr zweitausend Einwohner leben. Oben, rund um das alte Zentrum, finden sich ein paar Minisupermärkte und Kneipen. Es gibt auch eine kleine, aber gutgehende Pizzeria mit einem humorvollen Eigentümer, eine Grundschule, ein Kloster und ein Seniorenheim.
Die Stille, die mein Haus umgibt, gefällt mir. Umso größer ist der Kontrast, wenn an hohen Festtagen mit Prozessionen Böller knallen, die Kirchenglocke länger und fröhlicher erklingt als sonst und die Blaskapelle, die durch die engen Gassen zieht, von allen Ecken des Dorfes aus zu hören ist. Oft setzen die Veranstalter eines kalabresischen Dorffestes alles gleichzeitig ein: Böller, Kirchenglocken und Blaskapelle. All das passiert tagsüber, es geht also eindeutig um den Lärm – von dem Feuerwerk sind am blauen Himmel nur ein paar Rauchwölkchen zu sehen.
An anderen Vormittagen hört man den traurig-getragenen Klang der Totenglocke, denn die meisten Dorfbewohner sind überdurchschnittlich alt. Ich denke nicht zu lange darüber nach, was das für die Zukunft bedeuten mag. Es gibt Internet, und ich stelle mir vor, dass diese Gegend im Laufe der Zeit von jüngeren Generationen und Fremden entdeckt werden wird, die wie ich von zu Hause aus arbeiten können.
Trotz der Entvölkerung macht das Dorf noch einen verhältnismäßig blühenden Eindruck. Natürlich frage ich mich, ob sich unter den Bewohnern meines Dorfes Mafiosi befinden. Niemand wird mir das von sich aus erzählen, so viel steht fest. Was ich allerdings weiß, ist, dass im Dorf noch kein fester ’Ndrangheta-Kern nachgewiesen wurde, es also nicht als Gemeinde bekannt ist, die in der traditionellen Einflusssphäre einer oder mehrerer spezieller Familien steht und darunter zu leiden hat. Ansonsten kann ich nicht sehr viel mehr tun, als mich, wie üblich, auf meine Intuition zu verlassen und mich von Leuten fernzuhalten, die verdächtig oder schlichtweg nach unangenehmen Zeitgenossen aussehen.
Es trifft sich gut, dass es in der lokalen Bevölkerung eine große Zahl an Bauarbeitern und -unternehmern gibt, denn mein Haus hat viele Mängel. Die Fenster müssen aufgearbeitet, Leitungen und Fußböden ausgetauscht und das Dach muss abgedichtet werden. Von den vielen Häusern, die zum Kauf standen, war meines von außen betrachtet nicht das schönste. Doch genau das fand ich sympathisch: Die Außenseite nimmt sich nicht wichtiger, als sie ist, aber von innen bieten alle Fenster eine wunderschöne Aussicht auf die Küste. Es ist ein heimeliges kleines Labyrinth aus aneinandergereihten Zimmern. Die vorherigen Bewohner, ein Schreiner und seine Frau, hatten die Wände in allerlei Farben gestrichen und mit Familienfotos behängt. Sie haben dort gewohnt, bis sie in den Achtzigern waren.
Einst, erzählen mir die Nachbarn, lebte in jedem dieser kleinen Räume eine ganze Familie. Manche hielten sich dort sogar noch ein Schwein. Die Gässchen des Dorfs wimmelten vor vierzig Jahren noch von Kindern und Werkstätten, bevor die Kalabresen massenweise nach Norditalien, Deutschland, Amerika und Australien auswanderten. Heute schwer vorstellbar, aber in meiner cantina, dem »Keller« im Erdgeschoss, stoße ich auf ein verstaubtes Erbe all dieser Betriebsamkeit. Ich finde alle möglichen Gerätschaften zur Weinherstellung, Malersachen und natürlich viel Holz und Werkzeug. Nägel in allen Größen und ein paar Eisenkreuze. Es lässt sich nicht leugnen: Hier wurden nicht nur Schränke, Tische und Betten hergestellt, sondern auch Särge zusammengezimmert.
Die Handwerker sind inzwischen nahezu ausnahmslos aus dem Dorf verschwunden. In dieser Region an der ionischen Küste Kalabriens bietet wirtschaftlich gesehen der Tourismus noch die größte Hoffnung. Zwei Monate im Jahr verwandelt sich die Gegend von einem entlegenen und vergessenen Winkel in eine beliebte Urlaubsregion. Strandmuscheln, Sonnenschirme und Liegestühle schießen Ende Juni aus dem Boden und verschwinden dann am ersten Septemberwochenende auch schon wieder, zusammen mit den meisten Feriengästen. Von außerhalb Italiens kommen fast keine Touristen hierher. Am Meer hört man im Juli und August neben dem Kalabresischen vor allem viel Mailänder und römischen Zungenschlag. Es sind die »ausgewanderten« Kalabresen, die jeden Sommer mit ihren Kindern an das sonnenüberflutete Meer ihrer Kindheit und Jugend zurückkehren.
Auf der Straße reagieren die Leute mit Stolz, wenn sie hören, dass ich nicht nur für den Sommer ganz aus dem fernen Norden hierhergekommen bin und mich für ihr Dorf entschieden habe. Ich grüße die neuen Gesichter und werde meist fröhlich zurückgegrüßt. Kalabrien gehört zu den Regionen mit den höchsten Arbeitslosenzahlen in ganz Europa. Viele Kalabresen in meinem Alter wohnen noch bei ihren Eltern, zumindest, wenn sie ihren Klassenkameraden nicht auf der Suche nach einem Job in den Norden gefolgt sind. Dass ich alleine lebe und mein eigenes Geld verdiene, spricht sich schnell herum, ich muss dafür nicht viel tun. »Poverina, lavora al computer« – »die Arme arbeitet am Computer«, höre ich eine Nachbarin der anderen erzählen.
In meinem Dorf bin ich die erste niederländische Bewohnerin, und bei meiner Anmeldung fragt die Frau am Gemeindeschalter nach meinem Beruf. Ich habe kein Wort dafür zur Hand und erzähle, dass ich vor allem freiberuflich mit Texten arbeite, das heißt Bücher und Artikel redigiere oder aus dem Englischen übersetze. Übersetzerin? Nein, nicht wirklich. Ich erwäge editrice, aber das ist ein nicht ganz eindeutiges Wort, das eher Verlegerin als Redakteurin bedeutet. Die Schaltermitarbeiterin sagt voller Überzeugung: »Giornalista«, Journalistin. Es fühlt sich an wie ein fremdes Etikett, aber es stehen Leute in der Schlange, und mir erscheint es nicht wichtig genug, um sie deshalb noch länger warten zu lassen. Ich stimme zu.
Italiener sind verrückt nach Titeln, gern rufen sie jovial »maestro!«, »dottore!« oder »avvocato!« Damit bestätigen sie den Status des anderen und zeigen Respekt. Es scheint fast so, als hätten sämtliche Bewohner meines Dorfes Zugang zum Meldesystem der Gemeinde, denn ich merke, dass die für mich noch etwas unbehagliche Berufsbezeichnung giornalista schon bald jedermann bekannt ist. Glücklicherweise werde ich nicht gleich als giornalista angesprochen, aber es gibt durchaus Leute, die von sich aus auf mich zukommen, um mir ihre Geschichte zu erzählen. Manchmal führt das zu außergewöhnlichen Gesprächen, so wie mit Totò, einem Mann Ende vierzig, der nach einem Autounfall lange im Koma lag und seither nur noch von Gott spricht.
Totò predigt gern draußen auf dem Dorfplatz und ist ein sehr viel fröhlicherer Botschafter des Glaubens als der grauhaarige Dorfpriester. Ob es sich nun um eine Beerdigung oder um einen Feiertag handelt – in der Kirche wirkt es stets so, als wäre der Tag des Jüngsten Gerichts angebrochen. Es verwundert mich, wie es dem sehr förmlich auftretenden Priester mit seinen donnernden Predigten Tag für Tag gelingt, unter der weiblichen Bevölkerung über fünfzig ein so treues Publikum bei der Stange zu halten. Vielleicht hilft ihm die Anziehungskraft der vier liebenswerten Nonnen, die von den Philippinen und aus Indien gekommen sind, um das alte Dorfkloster am Leben zu erhalten.
Totò kürzt meinen Namen mit »Sà« ab und kommt schon nach ein paar Begegnungen laut Hymnen singend auf mich zu. Umstehende schmunzeln, aber mich lässt seine Unbefangenheit aufatmen.
»Ich bin wie ein Kind, Sà. Gott hat mich wieder zum Kind gemacht. Als ich im Koma lag, habe ich ihn gesehen. Alle Heiligen waren da und meine Großeltern auch. Siehst du diesen Sonnenstrahl? Das ist Gott. Glaubst du an Gott, Sà?«
Ich wage nicht, ihm die ganze Wahrheit zu sagen, aber sein Sonnenstrahl spricht mich an, und ich nicke. »Du brauchst nur zu beten und die zehn Gebote zu befolgen. Sà, schreibst du in der Zeitung über das, was ich erlebt habe? Die Welt will es nicht erkennen, aber Gott ist das Licht der Welt. Schreibst du in der Zeitung darüber?«





























