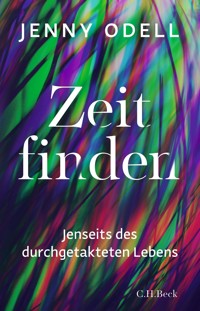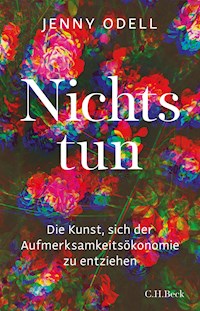
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
AN ALLE FOLLOWER UND INFLUENCER: EROBERT EUER LEBEN ZURÜCK!
Wir leben inmitten einer kapitalistischen Aufmerksamkeitsökonomie, die unsere Sinne und unser politisches Bewusstsein verkümmern lässt. "Nichts tun" ist der wohlüberlegte Aufruf, unser Leben fernab von Effizienzdenken und Selbstoptimierung zurückzuerobern. Ein provokatives, zeitgemäßes und glänzend geschriebenes Buch, das die Leser*innen aufrütteln wird.
Unsere Aufmerksamkeit stellt die wertvollste Ressource dar, über die wir verfügen. Im Effektgewitter kommerzieller Internetplattformen wie Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok wird sie jedoch permanent überspannt. Jenny Odell plädiert in ihrem Buch auf eindrückliche Weise für ein radikales Innehalten, statt unsere kostbare Freizeit weiter an die kurzfristigen Verlockungen der Aufmerksamkeitsökonomie zu verschwenden. Nur über bewusste Formen des Nichtstuns finden wir heute noch zu uns selbst: etwa wenn wir uns phasenweise wieder in unsere natürliche Umgebung zurückziehen lernen, die Kunst der Naturbeobachtung kultivieren und authentische Begegnungen mit anderen zulassen. Odell versteht ihre Anleitung zum Nichtstun gleichsam als Akt des politischen Widerstandes, um der notorischen Selbst- und Naturzerstörung im Kapitalismus etwas entgegenzusetzen und die Forderung nach demokratischer Partizipation und Solidarität mit Leben zu erfüllen.
- Eine fulminante Kritik an unserem Umgang mit sozialen Medien
- Wir wir uns leichtfertig von Twitter, Instagram und Co. instrumentalisieren lassen
- Auf der Liste von Barack Obamas "Favorite Books of 2019"
- THE NEW YORK TIMES-Bestseller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Jenny Odell
NICHTS TUN
Die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen
Aus dem Englischen übersetzt von Annabel Zettel
C.H.Beck
ZUM BUCH
Unsere Aufmerksamkeit stellt die wertvollste Ressource dar, über die wir verfügen. Im Effektgewitter kommerzieller Internetplattformen wie Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok wird sie jedoch permanent überspannt. Jenny Odell plädiert in ihrem Buch auf eindrückliche Weise für ein radikales Innehalten, statt unsere kostbare Freizeit weiter an die kurzfristigen Verlockungen der Aufmerksamkeitsökonomie zu verschwenden.
Nur über bewusste Formen des Nichtstuns finden wir heute noch zu uns selbst: etwa wenn wir uns phasenweise wieder in unsere natürliche Umgebung zurückzuziehen lernen, die Kunst der Naturbeobachtung kultivieren und authentische Begegnungen mit anderen zulassen. Odell versteht ihre Anleitung zum Nichtstun gleichsam als Akt des politischen Widerstands, um der notorischen Selbst- und Naturzerstörung im Kapitalismus etwas entgegensetzen und die Forderung nach demokratischer Partizipation und Solidarität mit Leben zu erfüllen.
«Sie weckt einen Sinn für Möglichkeiten, den ich lange nicht mehr gespürt habe.» Jia Tolentino, THE NEW YORKER
«Eine praktische Philosophie zum Innehalten und zur Vermeidung all jener destruktiven Kräfte, die unsere psychische Gesundheit und das langfristige menschliche Überleben gefährden.» Akiva Gottlieb, LOS ANGELES TIMES
«Zugänglich und scharfsichtig.»
Nicholas Cannariato, THE WASHINGTON POST
«Eine sprachmächtige Streitschrift gegen den vorherrschenden Effizienzkult.»
Jennifer Szalai, THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
«Der Weg zur Selbstbefreiung liegt zwischen diesen beiden Buchdeckeln.» Lauren Goode, WIRED
ÜBER DIE AUTORIN
Jenny Odell ist Künstlerin und Schriftstellerin. Sie lehrt an der Stanford University und war als Artist-in-Residence bei Facebook, dem Internet-Archiv und der Planungsabteilung der Stadt San Francisco tätig. Ihre Arbeiten erschienen u.a. in der New York Times, dem New York Magazine, The Atlantic, The Believer, The Paris Review und McSweeney’s. Sie lebt in Oakland, Kalifornien.
INHALT
EINLEITUNG: DAS NÜTZLICHSEIN ÜBERLEBEN
KAPITEL 1: PLÄDOYER FÜR DAS NICHTS
KAPITEL 2: DIE UNMÖGLICHKEIT DES RÜCKZUGS
KAPITEL 3: ANATOMIE EINER VERWEIGERUNG
KAPITEL 4: ÜBUNGEN IN AUFMERKSAMKEIT
KAPITEL 5: DIE ÖKOLOGIE DER FREMDEN
KAPITEL 6: DEM DENKEN WIEDER DEN BODEN BEREITEN
CONCLUSIO: «MANIFESTE RÜCKINSTANDSETZUNG»
DANK
ANHANG
ANMERKUNGEN
Einleitung Das Nützlichsein überleben
Kapitel 1 Plädoyer für das Nichts
Kapitel 2 Die Unmöglichkeit des Rückzugs
Kapitel 3 Anatomie einer Verweigerung
Kapitel 4 Übungen in Aufmerksamkeit
Kapitel 5 Die Ökologie der Fremden
Kapitel 6 Dem Denken wieder den Boden bereiten
Conclusio «Manifeste Rückinstandsetzung»
PERSONENREGISTER
EINLEITUNG
DAS NÜTZLICHSEIN ÜBERLEBEN
Die Rettung hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe.
WALTER BENJAMIN[1]
Nichts ist schwerer als das Nichtstun. In einer Welt, in der unser Wert an unserer Produktivität gemessen wird, erleben viele von uns, dass jede einzelne unserer Minuten erfasst, optimiert oder durch die Technologien, die wir täglich nutzen, als finanzielle Ressource in Dienst genommen wird. Wir unterwerfen unsere Freizeit numerischen Evaluationen, interagieren mit algorithmischen Versionen voneinander, bauen Personenmarken auf und pflegen sie. Einigen mag diese Rationalisierung und Vernetzung unserer gesamten gelebten Erfahrung so etwas wie die Befriedigung eines Ingenieurs verschaffen. Und doch bleibt eine Art nervöses Gefühl der Überreizung und der Unfähigkeit, einen Gedankengang zu Ende zu führen. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, dieses Gefühl zu fassen, bevor es hinter dem Schleier der Ablenkung verschwindet, ist es doch tatsächlich drängend. Wir begreifen noch immer, dass vieles, was dem eigenen Leben Bedeutung verleiht, durch Zufälle, Unterbrechungen und unverhoffte Begegnungen zustande kommt: durch die «Auszeit», die unsere heutige mechanistische Auffassung von Erleben immer mehr zu eliminieren droht.
Bereits 1877 betrachtete Robert Louis Stevenson «extreme Emsigkeit» als «Zeichen für mangelnde Lebenskraft» und beschrieb «ein paar lebendig-tote, abgediente Leute, die sich kaum ihres Lebens bewußt sind, außer in der Ausübung einer konventionellen Beschäftigung».[2] Und dabei leben wir doch nur einmal. In «Von der Kürze des Lebens» beschreibt Seneca das Grauen, zurückzublicken und zu begreifen, dass einem das Leben zwischen den Fingern zerronnen ist. Das klingt tatsächlich ganz so, als würde jemand aus dem Stupor einer auf Facebook vertanen Stunde wieder erwachen:
Wohlan, überschlage dein Leben und gib Rechenschaft davon …; frage dich … wieviel dir von deinem Leben durch andere weggenommen worden, ohne daß du den Verlust gewahr wurdest, wieviel dir vergebliche Trauer, törichte Freude, unersättliche Begierde, der Reiz der Geselligkeit Zeit geraubt, wie wenig dir von dem Deinigen geblieben – und du wirst einsehen, daß du stirbst ehe du reif bist.[3]
Auf kollektiver Ebene steht mehr auf dem Spiel. Wir wissen, dass wir in komplexen Zeiten leben, die komplexe Gedanken und Gespräche erfordern – und diese wiederum benötigen genau die Zeit und den Raum, die man nicht hat. Die Bequemlichkeit der grenzenlosen Konnektivität hat die Nuancen der persönlichen Konversation fein säuberlich zugepflastert und dabei allzu viel Information und Kontext amputiert. In einem unaufhörlichen Kreislauf, in dem die Kommunikation verkümmert und Zeit Geld ist, sind die Momente, in denen man sich davonstehlen kann, rar, und die Möglichkeiten, zueinander zu finden, noch rarer.
In Anbetracht dessen, wie jämmerlich Kunst in einem System überlebt, das nur den Profit wertschätzt, steht auch die Kultur auf dem Spiel. Was die Anschauung des neoliberal-technokratischen Manifest Destiny und die Kultur Trumps gemeinsam haben, ist die Unduldsamkeit gegenüber allem Differenzierten, Poetischen oder weniger Offensichtlichen. Solche Formen von «Nichts» können nicht toleriert werden, da man sie sich weder zu Nutze machen noch aneignen kann, und sie keine Leistung erbringen. (In diesem Kontext betrachtet, kommt es wenig überraschend, dass Trump dem National Endowment for the Arts die Finanzierung entziehen will.) Im frühen 20. Jahrhundert sah der surrealistische Maler Giorgio de Chirico bereits voraus, dass sich der Horizont für solch «unproduktive» Aktivitäten wie das Beobachten verengen würde. Er schrieb:
Angesichts der zunehmend materialistischen und pragmatischen Orientierung unseres Zeitalters … ist es nicht abwegig, künftig einen gesellschaftlichen Status ins Auge zu fassen, wo der Mensch, der einzig um geistiger Freuden willen lebt, kein Recht mehr haben wird, seinen Platz an der Sonne zu beanspruchen. Der Schriftsteller, der Denker, der Träumer, der Dichter, der Metaphysiker, der Beobachter …, wer Rätsel befragt, wertet, wird zur anachronistischen Figur, die bestimmt ist, wie Ichthyosaurus und Mammut vom Erdboden zu verschwinden.[4]
In diesem Buch geht es darum, wie man diesen Platz an der Sonne weiter erhalten kann. Es ist eine praktische Anleitung zum Nichtstun als Akt des politischen Widerstands gegen die Aufmerksamkeitsökonomie, mit all der Unnachgiebigkeit eines chinesischen «Nagelhauses», das eine Hauptverkehrsstraße blockiert. Es ist nicht nur für Künstler und Schriftsteller gedacht, sondern für jeden, der das Leben für mehr als nur ein Werkzeug erachtet und deshalb als etwas begreift, das nicht optimierbar ist. Eine einfache Weigerung motiviert meinen Standpunkt: die Weigerung zu glauben, dass unsere gegenwärtige Zeit und die Welt, in der wir leben, irgendwie nicht genug sind. Plattformen wie Facebook und Instagram funktionieren wie Staudämme, die sich unser natürliches Interesse an anderen und das zeitlose Bedürfnis nach Gemeinschaft zunutze machen, unsere ureigensten Sehnsüchte kapern, hintertreiben und aus ihnen Kapital schlagen. Zurückgezogenheit, Beobachtung und einfache Geselligkeit sollten nicht nur als Zweck an und für sich begriffen werden, sondern als unverzichtbare Rechte, die jedem zustehen, der das Glück hat, am Leben zu sein.
DIE TATSACHE, DASS das «Nichts», um das es mir geht, nur vom Standpunkt kapitalistischer Produktivität aus gesehen nichts ist, erklärt die Ironie, dass ein Buch mit dem Titel Nichts tun in gewisser Weise auch ein Aktionsplan ist. Ich möchte eine Reihe von Bewegungen nachzeichnen: 1.) einen Ausstieg, nicht unähnlich dem «Ausstieg» der 60er Jahre; 2.) einen Schritt zur Seite, raus zu den Dingen und Menschen, die uns umgeben; und 3.) eine Bewegung nach unten, zurück an Ort und Stelle, auf den Boden, auf dem wir stehen. Wenn wir nicht wachsam sind, dann wird uns das gegenwärtige Design unserer Technologie bei jedem Schritt unseres Weges blockieren, indem es bewusst falsche Ziele im Hinblick auf Selbstreflexion, Neugierde und das Verlangen, einer Gemeinschaft anzugehören, kreiert. Wenn Menschen sich nach einer Art Ausstieg sehnen, dann stellt sich die Frage: Was würde «zurück aufs Land» bedeuten, wenn wir Land als den Ort verstehen, an dem wir uns gerade befinden? Könnte «augmented reality» einfach bedeuten, dein Smartphone auszuschalten? Und was (oder wen) hast du dann vor dir, wenn du es endlich tust?
Inmitten der öden Landschaft des neoliberalen Determinismus sucht dieses Buch nach verborgenen Quellen von Mehrdeutigkeit und Ineffizienz. Das ist ein Vier-Gänge-Menü im Zeitalter von Soylent. Aber während ich hoffe, dass Sie durch die Einladung, einfach innezuhalten oder zu entschleunigen, eine Art von Befreiung erfahren, möchte ich dies hier nicht als Wochenend-Retreat oder einfach als Traktat über Kreativität verstanden wissen … Das Wesentliche am Nichtstun, so wie ich es definiere, ist nicht etwa, erfrischt und bereit zu gesteigerter Produktivität an die Arbeit zurückzukehren, sondern vielmehr zu hinterfragen, was wir derzeit als produktiv wahrnehmen. Meine Position ist natürlich antikapitalistisch, vor allem was Technologien anbetrifft, die einer kapitalistischen Wahrnehmung von Zeit, Ort, Selbst und Gemeinschaft Vorschub leisten. Sie ist außerdem ökologisch und historisch: Ich möchte darlegen, dass das Umlenken und die Konzentration der eigenen Aufmerksamkeit auf Ort und Stelle wahrscheinlich zum Bewusstsein der eigenen Teilnahme an der Geschichte und an einer mehr-als-menschlichen Gemeinschaft führen werden. Sowohl aus sozialer als auch aus ökologischer Perspektive besteht das ultimative Ziel des «Nichtstuns» darin, unseren Fokus der Aufmerksamkeitsökonomie zu entreißen und ihn im öffentlichen, physischen Raum neu zu verankern.
Ich bin nicht gegen Technologie. Schließlich gibt es Formen von Technologie – von Instrumenten, die es uns erlauben, die Natur zu beobachten, bis hin zu dezentralen, nichtkommerziellen sozialen Netzwerken –, die uns stärker in der Gegenwart verorten könnten. Viel eher bin ich gegen die Art und Weise, in der Unternehmensplattformen unsere Aufmerksamkeit kaufen und verkaufen, und ebenso gegen Technologiedesign und -gebrauch, die eine beschränkte Definition von Produktivität festschreiben und die lokalen Gegebenheiten, Körperlichkeit und Poesie ignorieren. Ich bin beunruhigt aufgrund der Auswirkungen, die die heutigen sozialen Medien auf unsere Ausdrucksformen – einschließlich das Recht, sich nicht zu äußern – haben, und aufgrund ihrer bewusst suchterzeugenden Eigenschaften. Aber der Übeltäter ist hier nicht das Internet oder gar die Idee der sozialen Medien; es ist die invasive Logik der kommerziellen sozialen Medien und ihr finanzieller Anreiz, der uns permanent in einem profitablen Zustand aus Angst, Neid und Zerstreuung hält. Außerdem erwachsen aus solchen Plattformen der Individualitätskult und das Personal Branding, die bestimmen, wie wir über unser Offline-Selbst und die Orte, an denen wir tatsächlich leben, denken.
ANGESICHTS MEINES BEHARRENS darauf, am Lokalen und Gegenwärtigen aktiv teilzuhaben, ist es bedeutsam, dass dieses Buch in der San Francisco Bay Area verwurzelt ist, wo ich aufgewachsen bin und derzeit lebe. Diese Gegend ist für zwei Dinge bekannt: Technologieunternehmen und die Pracht der Natur. Hier kann man von den Büros der Venture Capital-Gesellschaften auf der Sand Hill Road direkt nach Westen fahren bis zu einem Redwood-Wald über dem Meer, oder den Facebook-Campus hinter sich lassen und bis zu einer Salzwiese voller Küstenvögel laufen. Während meiner Kindheit in Cupertino nahm mich meine Mutter manchmal in ihr Büro bei Hewlett-Packard mit, wo ich einmal eine sehr frühe Version eines Virtual Reality-Headsets ausprobierte. Zugegebenermaßen verbrachte ich eine Menge Zeit drinnen am Computer. Aber an anderen Tagen unternahm meine Familie lange Wanderungen zwischen den Eichen und Mammutbäumen im Big Basin Redwoods State Park oder entlang der Klippen des San Gregorio State Beach. Im Sommer war ich oft unterwegs, um in den Santa Cruz Mountains zu zelten, wo sich mir die Bezeichnung Sequoia sempervirens für immer eingebrannt hat.
Ich bin Künstlerin und Autorin. Weil ich Computer benutzte, um meine Kunst zu schaffen, und vielleicht auch weil ich in San Francisco lebte, wurde ich in den 2010er Jahren in die äußerst dehnbare Kategorie «Kunst und Technologie» gesteckt. Aber mein einzig wirkliches Interesse an der Technologie bestand darin, wie sie uns mehr Zugang zur physischen Realität verschaffen kann, denn sie war es, der ich mich in Wahrheit verbunden fühlte. Das brachte mich in eine seltsame Lage, ich war jemand, den man zu Tech-Konferenzen einlud, der aber lieber draußen den Vögeln zusah. Das ist nur einer der merkwürdigen «Dazwischen»-Aspekte meiner Erfahrung, zunächst vor allem als gemischtethnischer Mensch, dann aber auch als jemand, der digitale Kunst im Bezug zur physischen Welt schafft. Ich war Artist in Residence an solch seltsamen Orten wie Recology SF (auch bekannt als «the dump» – die Deponie), im San Francisco Planning Department und im Internet Archive. Seit jeher hege ich eine Hassliebe gegenüber dem Silicon Valley als Ursprung meiner Kindheits-Nostalgie und zugleich der Technologie, welche die Aufmerksamkeitsökonomie hervorbrachte.
Manchmal ist es gut, im Dazwischen festzusitzen, auch wenn es unbequem ist. Viele der Ideen für dieses Buch entstanden, während ich über Jahre hinweg Werkstattkunst unterrichtete und deren Bedeutung mit den Studenten der Design- und Ingenieurswissenschaften in Stanford erörterte, von denen einige ihren Wert jedoch nicht sahen. Die einzige Exkursion, die ich mit meinem Digital-Design-Kurs unternehme, ist einfach eine Wanderung, und manchmal lasse ich meine Studenten draußen sitzen und 15 Minuten lang nichts tun. Ich habe erkannt, dass das meine Möglichkeiten sind, auf etwas zu insistieren. Da ich zwischen den Bergen und dieser hyperbeschleunigten Unternehmerkultur lebe, kann ich nicht umhin, mir folgende Frage zu stellen: Was bedeutet es, digitale Welten zu erschaffen, während die wirkliche Welt vor deinen Augen zerfällt?
Die seltsamen Aktivitäten meines Kurses gehen auch auf einen Ort zurück, der mich beschäftigt. Bei meinen Studenten und einer Menge Menschen, die ich kenne, sehe ich so viel Energie, so viel Intensität und so viel Angst. Ich sehe Menschen, die nicht nur in Mitteilungen, sondern auch in einer Produktivitäts- und Fortschrittsmythologie gefangen sind, nicht nur unfähig eine Pause zu machen, sondern auch ganz einfach unfähig zu sehen, wo sie sich überhaupt befinden. Und während des Sommers, in dem ich das hier schrieb, sah ich einen katastrophalen, nicht enden wollenden Waldbrand. Dieser Ort, ebenso wie der Ort, an dem Sie sich gerade aufhalten, ruft, um Gehör zu finden. Ich denke, wir sollten zuhören.
BEGINNEN WIR in den Hügeln über Oakland, der Stadt, in der ich momentan lebe. Oakland hat zwei berühmte Bäume: Der eine ist der Jack London-Baum, eine gigantische Küsten-Lebenseiche vor dem Rathaus, auf die das baumförmige Logo der Stadt zurückgeht. Der andere, der sich zwischen den Hügeln verbirgt, ist weniger bekannt. Mit Spitznamen «Großvater» oder «Old Survivor», Alter Überlebender, genannt, handelt es sich um Oaklands einzigen noch aus altem Waldbestand übrig gebliebenen Mammutbaum, ein wunderbares 500 Jahre altes Überbleibsel aus der Zeit, bevor alle alten Mammutbäume infolge des Goldrausches gefällt wurden. Dennoch sind viele der East Bay Hills mit Redwood-Wäldern bedeckt, es sind jedoch durchweg Sekundärwälder, gesprossen aus den Stümpfen ihrer Vorfahren, die einst die Größten der gesamten Küste waren. Vor 1969 dachten die Leute in Oakland, dass alle Bäume aus Primärbestand verschwunden seien, bis ein Naturforscher zufällig auf Old Survivor stieß, der die anderen Bäume überragte. Seither ist der alte Baum in die kollektive Vorstellung eingegangen, es werden Artikel über ihn geschrieben, Gruppenwanderungen organisiert, und man hat sogar einen Dokumentarfilm gedreht.
Bevor sie gefällt wurden, gab es unter den altgewachsenen Redwoods auch Navigationsbäume, die so hoch waren, dass Seeleute in der San Francisco Bay sich an ihnen orientierten, um den unter Wasser liegenden und gefährlichen Blossom Rock zu umschiffen. (Als die Bäume gefällt waren, musste das Ingenieurskorps der Armee Blossom Rock buchstäblich in die Luft jagen.) Auch wenn er nicht zu jenen Bäumen gehörte, denke ich, dass Old Survivor auf seine eigene Weise als Navigationshilfe dient. Dieser runzlige Baum hält einige Lehren für uns bereit, die mit dem Kurs übereinstimmen, den ich in diesem Buch abzustecken versuche.
Die erste Lehre handelt vom Widerstand. Der geradezu legendäre Status von Old Survivor verdankt sich nicht nur seinem Alter und seinem unerwarteten Überleben, sondern auch seinem mysteriösen Standort. Selbst Menschen, die von Kindesbeinen an in den East Bay Hills wandern, haben mitunter Schwierigkeiten, ihn zu finden. Wenn man Old Survivor entdeckt hat, kann man trotzdem nicht unmittelbar an ihn herankommen, weil er auf einem steilen, felsigen Abhang steht, den man regelrecht erklettern muss. Das ist ein Grund dafür, dass er die Abholzung überlebt hat; der andere Grund hat mit seiner krummen, schiefen Gestalt und mit seiner Höhe zu tun: 28 Meter, ein Zwerg, verglichen mit anderen Mammutbäumen aus Primärbestand. Mit anderen Worten, Old Survivor überlebte vor allem, weil er den Holzfällern als Nutzholz wertlos erschien.
Für mich klingt das wie die aus dem wirklichen Leben gegriffene Version einer – oft mit dem Titel «Der nutzlose Baum» übersetzten – Geschichte aus dem Buch Zhuangzi, einer Sammlung von Texten, die Zhuang Zhou, einem chinesischen Philosophen aus dem 14. Jahrhundert zugeschrieben werden. Die Geschichte handelt von einem Zimmermann, der einen Baum von eindrucksvoller Größe und Lebensdauer sieht (in einer Variante eine gezähnte Eiche, ein ähnlich aussehender Verwandter unserer Küsten-Lebenseiche). Aber der Zimmermann geht achtlos daran vorüber und bezeichnet ihn als «nutzlosen Baum», der nur so alt geworden ist, weil seine knorrigen Äste nicht als Nutzholz taugen. Bald darauf erscheint ihm der Baum im Traum und fragt: «Mit was für Bäumen möchtest du mich denn vergleichen?» Die Eiche weist ihn darauf hin, dass Obst- und Kulturbäume regelmäßig misshandelt und geplündert werden. Die Strategie dieses Baumes war indessen die Nutzlosigkeit: «So geht es überall zu. Darum habe ich mir schon lange Mühe gegeben, ganz nutzlos zu werden … Nimm an, ich wäre zu irgendetwas nütze, hätte ich dann wohl diese Größe erreicht?» Der Baum sperrt sich gegen die Bestimmung von Nützlichkeit und Wert durch einen Mann, der Bäume lediglich als potentielles Nutzholz betrachtet: «Wie sollte ein Geschöpf dazu kommen, das andere von oben her beurteilen zu wollen! Du, ein sterblicher unnützer Mensch, was weißt denn du von unnützen Bäumen!»[5] Ich kann mir gut vorstellen, wie Old Survivor diese Worte zu den Holzfällern aus dem 19. Jahrhundert spricht, die ihn, vor weniger als hundert Jahren, bevor wir allmählich begriffen, was wir verloren hatten, links liegen ließen.
Diese Formulierung – die Nützlichkeit der Nutzlosigkeit – ist typisch für Zhuang Zhou, der oft in scheinbaren Widersprüchen und unlogischen Folgerungen sprach. Aber wie bei seinen anderen Äußerungen handelt es sich hier nicht einfach um ein Paradoxon um des Paradoxons willen, sondern ganz einfach um die Beobachtung einer sozialen Welt, die selbst ein Paradox ist, bestimmt von Heuchelei, Ignoranz und Unlogik. In einer solchen Gesellschaft erschiene ein Mann, der versucht, ein bescheidenes und ethisches Leben zu führen, in der Tat «rückständig»: Für ihn wäre das Gute schlecht, oben wäre unten, Produktivität wäre Zerstörung, und Nutzlosigkeit wäre tatsächlich nützlich.
Wenn Sie mir erlauben, diese Metapher zu dehnen, dann könnten wir sagen, dass Old Survivor zu eigentümlich oder zu schwierig war, um einfach in die Sägemühle zu wandern. Auf diese Weise liefert mir der Baum ein Bild der «Resistance-in-place» – des «Widerstands an Ort und Stelle». An Ort und Stelle Widerstand zu leisten bedeutet, sich eine Form zu geben, die nicht so leicht durch ein kapitalistisches Wertesystem vereinnahmt werden kann. Das zu tun bedeutet, den Bezugsrahmen zu verweigern: in diesem Fall ein Bezugsrahmen, in dem Wert durch Produktivität, Karriere und individuelles Unternehmertum bestimmt wird. Es bedeutet, offen zu sein für unklarere oder verschwommenere Ideen und sich auf diese einzulassen: etwa, den Erhalt von Dingen als Produktivität zu werten, die Wichtigkeit nonverbaler Kommunikation anzuerkennen und das schiere Erleben des Daseins als höchstes Ziel zu betrachten. Das bedeutet das Begreifen und Zelebrieren einer Form des Selbst, die sich mit der Zeit verändert, über algorithmische Beschreibungen hinausgeht, und deren Identität nicht immer vor den Grenzen des Individuums Halt macht.
In einer Umwelt, die komplett auf die kapitalistische Aneignung selbst unserer winzigsten Gedanken ausgerichtet ist, erscheint das mindestens so unangenehm, als würde man zu einem Anlass mit Dresscode die falsche Kleidung tragen. Wie ich anhand verschiedener Beispiele von früheren Verweigerungen an Ort und Stelle zeigen werde, erfordert das Verharren in diesem Zustand Hingabe, Disziplin und Willensstärke. Nichtstun ist schwer.
DIE ANDERE LEHRE, die Old Survivor für uns bereithält, hat mit seiner Funktion als Zeuge und Denkmal zu tun. Auch der überzeugteste Materialist muss zugeben, dass Old Survivor anders ist als ein von Menschenhand gemachtes Denkmal, weil er trotz allem lebendig ist. In einer 2011 erschienenen Ausgabe der Lokalzeitung MacArthur Metro schrieben der verstorbene Gordon Laverty, damals pensionierter Angestellter der Stadtwerke des Bezirks East Bay, und sein Sohn Larry eine Hymne auf Old Survivor: «Da ist ein Gefährte, der hoch oben an einem Hang im nahe gelegenen Leona Park lebt und der Zeuge unseres Wahnsinns hier ist, seit es Menschen in Oakland gibt. Sein Name ist Old Survivor. Er ist ein Mammutbaum, und er ist alt.» Sie beschreiben den Baum als Zeugen der Geschichte, vom Jagen und Sammeln des Ohlone-Volkes über die Ankunft der Spanier und Mexikaner bis hin zu den weißen Profitjägern. Der Beobachtungspunkt des Baumes – unveränderlich, Auge in Auge mit den vielen aufeinanderfolgenden Torheiten der Neuankömmlinge – macht ihn für die Lavertys letztlich zum moralischen Symbol: «Old Survivor steht noch immer … wie ein Wächter, der uns gemahnt, unsere Entscheidungen weise zu treffen.»[6]
Ich sehe ihn genauso. Old Survivor ist vor allem ein physisches Faktum, der wortlose Beweis einer sehr realen, sowohl landschaftlichen als auch kulturellen Vergangenheit. Den Baum zu betrachten, bedeutet, etwas zu betrachten, das inmitten einer ganz anderen, uns heute eigentlich unbekannten Welt zu wachsen begann: eine Welt, deren menschliche Bewohner das lokale Gleichgewicht des Lebens bewahrten und nicht zerstörten, in der die Kontur der Küstenlinie sich noch nicht verändert hatte, in der es Grizzlybären gab, Kalifornische Kondoren und Silberlachse (die im 19. Jahrhundert allesamt aus der East Bay-Region verschwanden). Das sind keine Märchen. Tatsächlich ist es noch gar nicht so lange her. So sicher, wie die Nadeln, die Old Survivor hervorbringt, mit seinen alten Wurzeln verbunden sind, so erwächst die Gegenwart aus der Vergangenheit. Diese Verwurzelung ist etwas, das wir dringend brauchen, wenn wir uns in einer amnesischen Gegenwart wiederfinden, überflutet von der Warenhausketten-Ästhetik des Virtuellen.
Diese beiden Lehren sollten Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, worauf ich mit diesem Buch hinauswill. Die erste Hälfte des «Nichtstuns» besteht darin, sich von der Aufmerksamkeitsökonomie freizumachen; die zweite darin, sich auf etwas anderes einzulassen. «Etwas anderes» ist in diesem Fall nichts Geringeres als Zeit und Raum, eine Möglichkeit, die wir erst dann haben, wenn wir uns dort mit Aufmerksamkeit begegnen. Letztendlich möchte ich, entgegen der Ortlosigkeit eines optimierten Online-Lebens, für eine neue «Ortsfülle» eintreten, aus der Feingefühl und Verantwortung für das Historische (was passierte hier, an dieser Stelle) und das Ökologische (wer oder was lebt oder lebte hier) erwachsen.
In diesem Buch schlage ich den Bioregionalismus als Modell vor, wie wir vielleicht beginnen können, über den Ort neu nachzudenken. Der Bioregionalismus, dessen Grundsätze in den 1970ern durch den Umweltschützer Peter Berg formuliert wurden und der bei indigenen Völkern im Umgang mit Land weithin zu beobachten ist, hat zu tun mit einem Bewusstsein nicht nur für die vielen Lebensformen eines jeden Ortes, sondern auch dafür, wie sie miteinander, und auch mit den Menschen, in Beziehung stehen. Bioregionalistisches Denken umfasst Praktiken wie die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume und Permakultur-Landwirtschaft, enthält aber auch ein kulturelles Element, weil es uns dazu auffordert, uns genauso (wenn nicht sogar mehr) als Bürger der Bioregion wie des Staates zu begreifen. Unsere «Bürgerschaft» in einer Bioregion bedeutet nicht nur Vertrautheit mit der lokalen Ökologie, sondern auch eine Verpflichtung, sie gemeinsam zu pflegen.
Es ist mir wichtig, meine Kritik an der Aufmerksamkeitsökonomie an die Perspektiven des bioregionalen Bewusstseins zu knüpfen, weil ich glaube, dass Kapitalismus, kolonialistisches Denken, Einsamkeit und eine ausbeuterische Haltung gegenüber der Umwelt sich gegenseitig hervorbringen. Diese Verknüpfung ist mir außerdem wichtig aufgrund der Parallelen zwischen dem, was die Wirtschaft einem Ökosystem antut, und dem, was die Aufmerksamkeitsökonomie unserer Aufmerksamkeit antut. In beiden Fällen gibt es die Tendenz zu einer aggressiven Monokultur, in der die Komponenten, die als «nicht nützlich» beurteilt werden und die sich nicht in Besitz nehmen lassen (durch Holzfäller oder Facebook), zuerst weichen müssen. Weil diese Auffassung von Nützlichkeit von einem falschen Verständnis des Lebens als atomisiert und optimierbar ausgeht, kann sie das Ökosystem nicht als lebendiges Ganzes begreifen, das tatsächlich alle seine Teile braucht, um zu funktionieren. Praktiken wie Abholzung und Großflächenbewirtschaftung schwächen das Land – genauso wie eine Überbewertung von Leistung das, was einst eine dichte und blühende Landschaft individuellen und gemeinschaftlichen Denkens war, in eine Monsanto-Farm verwandelt, deren «Produktion» langsam den Boden zerstört, bis nichts mehr wachsen kann. So wie sie eine Gedanken-Spezies nach der anderen auslöscht, beschleunigt sie die Erosion der Aufmerksamkeit.
Woran liegt es, dass die moderne Vorstellung von Produktivität so oft ein Muster für das ist, was eigentlich die Zerstörung der natürlichen Produktivität eines Ökosystems bedeutet? Das klingt sehr nach dem Paradox in Zhuang Zhous Geschichte, die sich allem voran darüber lustig macht, wie beschränkt das Konzept der «Nützlichkeit» ist. Als der Baum dem Zimmermann im Traum erscheint, fragt er ihn vor allem: Nützlich wozu? Und das ist in der Tat genau die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir genug Zeit gebe, um Abstand zu nehmen von der kapitalistischen Logik unserer derzeitigen Definition von Produktivität und Erfolg. Produktivität, die was produziert? Auf welche Weise erfolgreich und für wen? Die glücklichsten und erfülltesten Momente meines Lebens waren die, in denen ich mir ganz und gar bewusst war, am Leben zu sein, mit all der Hoffnung, dem Schmerz und den Sorgen, die das für jedes sterbliche Wesen mit sich bringt. In jenen Momenten hätte die Vorstellung von Erfolg als teleologisches Ziel keinen Sinn ergeben; diese Momente trugen ihren Wert in sich selbst und waren nicht die Sprossen auf einer Leiter. Ich denke, die Menschen in Zhuang Zhous Zeit kannten dieses Gefühl.
Es gibt ein wichtiges Detail zu Beginn der Geschichte des nutzlosen Baumes. Mehrere Versionen davon erwähnen, dass die knorrige Eiche so groß und weitreichend war, dass sie «mehreren tausend Rindern» oder sogar «tausenden Pferdegespannen» Schatten spenden konnte. Die Gestalt des nutzlosen Baumes tut also mehr, als ihn nur vor dem Zimmermann zu schützen; es ist auch eine behütende Gestalt, die ihre Äste über die abertausend Zuflucht suchenden Tiere spannt und so den Boden bereitet für das Leben selbst. Ich möchte mir einen ganzen Wald voller nutzloser Bäume vorstellen, deren Äste dicht miteinander verwoben sind und die so einen undurchdringlichen Lebensraum für Vögel, Schlangen, Eidechsen, Eichhörnchen, Insekten, Pilze und Flechten bieten. Und irgendwann kommt vielleicht ein erschöpfter Reisender aus dem Land der Nützlichkeit durch diese üppige, schattige und nutzlose Umgebung, ein Zimmermann, der seine Werkzeuge beiseitegelegt hat. Vielleicht wandert er eine Weile verwirrt umher, aber dann folgt er dem Beispiel der Tiere und nimmt unter einer Eiche Platz. Und vielleicht, zum allerersten Mal überhaupt, rastet er.
SIE WERDEN MERKEN, dass dieses Buch – wie Old Survivor – etwas sonderbar «gewachsen» ist. Die Argumente und Beobachtungen, die ich hier anführe, sind keine akkurat ineinandergreifenden Teile eines logischen Ganzen. Vielmehr sah und erlebte ich viele Dinge im Laufe des Schreibens – Dinge, durch die ich meine Meinung änderte und dann wieder änderte, und die ich auf dem Weg mit einflocht. Ich ging in dieses Buch hinein und kam als eine andere heraus. Betrachten Sie es also nicht als abgeschlossene Informationsübermittlung, sondern stattdessen als offenen und ausgedehnten Essay im eigentlichen Sinne des Wortes (eine Reise, einen Versuch vorwärtszukommen). Es ist weniger ein Vortrag als die Einladung zu einem Spaziergang.
Das erste Kapitel dieses Buches ist eine Version eines Essays, den ich im Frühjahr nach den Wahlen von 2016 schrieb, über einen persönlichen Krisenzustand, durch den ich mich schließlich genötigt sah, nichts zu tun. In diesem Kapitel beginne ich, einiges von dem, was mir am meisten auf der Seele lastet, mit der Aufmerksamkeitsökonomie in Beziehung zu setzen, und zwar deshalb, weil sie sich auf Angst und Beunruhigung gründet und mit der Logik einhergeht, dass «Disruption» produktiver ist als das Bemühen um Aufrechterhaltung – das Bemühen darum, uns selbst und andere lebendig und gesund zu erhalten. Inmitten einer Online-Umwelt, in der für mich nichts mehr Sinn ergab, war dieser Essay eine flehentliche Bitte im Namen des räumlich und zeitlich eingebetteten Tieres Mensch. Wie der Technologie-Autor Jaron Lanier wollte ich ganz «auf das Menschsein setzen».
Eine mögliche Reaktion auf all das ist, einfach abzuhauen – dauerhaft. Im zweiten Kapitel werfe ich einen Blick auf verschiedene Menschen und Gruppen, die diesen Ansatz verfolgt haben. Die gegenkulturellen Kommunen der 60er Jahre haben uns vieles über die Herausforderungen des Vorhabens mitzuteilen, sich selbst komplett aus dem Gefüge einer kapitalistischen Realität herauszulösen, und auch über die mitunter fehlgeschlagenen Versuche, der Politik ganz zu entrinnen. Dies ist der Beginn einer fortlaufenden Unterscheidung, die ich treffe zwischen 1) «der Welt» (oder einfach nur anderen Menschen) gänzlich zu entfliehen und 2) an Ort und Stelle zu bleiben, während man sich dem Bezugssystem der Aufmerksamkeitsökonomie und dem blinden Vertrauen in eine gefilterte öffentliche Meinung verweigert.
Diese Unterscheidung schafft auch die Grundlage für die Idee des Widerstands an Ort und Stelle, dem Thema meines dritten Kapitels. Nach dem Vorbild von Herman Melvilles «Bartleby der Schreiber», der nicht etwa antwortet «Ich werde nicht», sondern «Ich möchte lieber nicht», blicke ich auf die Geschichte des Widerstands, um Antworten zu finden, die gegen die Bedingungen der Frage selbst protestieren. Und ich versuche zu zeigen, wie stark dieser kreative Raum des Widerstands bedroht ist in einer Zeit weitverbreiteter wirtschaftlicher Prekarität, in der jeder, vom Amazon-Angestellten bis zum Hochschulstudenten, seinen Widerstandsspielraum schwinden und den Druck mitzumachen wachsen sieht. Wenn ich darüber nachdenke, was dazu gehört, sich Widerstand zu leisten, dann gelange ich zu dem Schluss, dass wir den endlosen Kreislauf von angstbeladener, erzwungener Aufmerksamkeit und wirtschaftlicher Unsicherheit dann durchbrechen können, wenn wir lernen, unsere Aufmerksamkeit umzulenken und zu erweitern.
Kapitel 4 resultiert hauptsächlich aus meiner Erfahrung als Künstlerin und Kunstlehrerin, als die ich schon lange daran interessiert bin, wie die Kunst uns neue Dimensionen und Nuancen von Aufmerksamkeit vermitteln kann. Mit Blick sowohl auf die Kunstgeschichte als auch auf Sehstudien denke ich über die Beziehung zwischen Aufmerksamkeit und Willen nach – darüber, wie wir uns nicht nur aus dem Netz der Aufmerksamkeitsökonomie befreien, sondern auch lernen können, unsere Aufmerksamkeit absichtsvoller zu lenken. Dieses Kapitel basiert auch auf meiner persönlichen Erfahrung: Zum ersten Mal habe ich mich mit meiner Bioregion vertraut gemacht, mir ein neues Aufmerksamkeitsmuster angeeignet, das dem Ort entspricht, an dem ich mein ganzes Leben verbracht habe.
Wenn wir die Aufmerksamkeit nutzen können, um uns auf einer neuen Realitätsebene zu bewegen, dann folgt daraus, dass wir einander dort vielleicht begegnen, indem wir auf die gleichen Dinge und aufeinander achtgeben. In Kapitel 5 untersuche ich die Grenzen, die die «Filterblase» uns im Bezug auf die Wahrnehmung der Menschen um uns herum auferlegt hat, und versuche, diese aufzuheben. Dann werde ich Sie bitten, noch weiter zu gehen, und dieselbe Aufmerksamkeit auf die mehr-als-menschliche Welt auszuweiten. Schlussendlich trete ich für eine Wahrnehmung des Selbst und der eigenen Identität ein, die das Gegenteil einer Personal Brand ist: ein instabiles, gestaltwandlerisches Ding, das durch Interaktionen mit anderen und mit unterschiedlichen Arten von Orten bestimmt wird.
Im letzten Kapitel versuche ich, mir ein utopisches soziales Netzwerk auszumalen, das irgendwie all das in sich tragen könnte. Ich benutze den Blickwinkel des menschlich-körperlichen Bedürfnisses nach einem räumlichen und zeitlichen Kontext, um die Erschütterung eines online stattfindenden «Kontext-Kollapses» zu verstehen und eine Art «Kontext-Sammlung» an seine Stelle zu setzen. Mit der Einsicht, dass bedeutsame Ideen Inkubationszeit und -raum benötigen, blicke ich sowohl auf nichtkommerzielle, dezentrale Netzwerke als auch auf die kontinuierliche Bedeutung privater Kommunikation und persönlicher Zusammenkünfte. Ich schlage vor, dass wir unsere Aufmerksamkeit abziehen und sie stattdessen neu einsetzen, um die biologischen und kulturellen Ökosysteme wiederherzustellen, in denen wir sinnstiftende, sowohl individuelle als auch kollektive Identitäten schmieden.
WÄHREND DES SOMMERS, den ich praktisch jeden Tag damit zubrachte, dieses Buch zu schreiben, scherzten einige Freunde darüber, dass ich so hart an etwas arbeitete, das Nichts tun hieß. Aber die wahre Ironie ist, dass ich, als ich ein Buch mit diesem Titel schrieb, merkte, wie wichtig es war, etwas zu tun, und unweigerlich immer radikaler wurde. In meiner Eigenschaft als Künstlerin habe ich seit jeher über Aufmerksamkeit nachgedacht, aber erst jetzt begreife ich vollends, wohin ein Leben in nicht nachlassender Aufmerksamkeit uns leiten kann. Um es kurz zu machen, es führt zu einem Bewusstsein, nicht nur dafür, wieviel Glück ich habe, am Leben zu sein, sondern auch für fortlaufende Muster kultureller und ökologischer Verwüstung um mich herum – und für den unvermeidbaren Anteil, den ich selbst daran habe, ob ich mir das nun eingestehe oder nicht. Einfach gesagt, aus dem Bewusstsein erwächst die Verantwortung.
Irgendwann begann ich das hier als aktivistisches Buch im Gewand eines Selbsthilfebuchs zu betrachten. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt eins von beidem wirklich ist. Aber ebenso sehr, wie ich hoffe, dass dieses Buch Ihnen etwas zu bieten hat, so hoffe ich auch, dass es etwas zum Aktivismus beisteuern kann, vor allem indem es jenen, die dabei sind, den guten Kampf zu kämpfen, ein wenig Erholung spendet. Ich hoffe, dass der Begriff des «Nichtstuns», in Opposition zu einer produktivitätsbesessenen Umwelt, dabei helfen kann, Individuen wieder gesunden zu lassen, die dann wieder zur Genesung von Gemeinschaften (menschlichen und anderen Gemeinschaften) beitragen können. Und vor allem hoffe ich, dass dieser Begriff Menschen dabei helfen kann, Wege der Vernetzung zu finden, die substantiell, tragend und für Unternehmen absolut unrentabel sind, deren Metriken und Algorithmen nie etwas in den Gesprächen, die wir über unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Überleben führen, zu suchen hatten.
Eine Sache, die ich über die Aufmerksamkeit gelernt habe, ist, dass bestimmte Formen davon ansteckend sind. Wenn Sie genügend Zeit mit jemandem verbringen, der sich verstärkt mit etwas beschäftigt (wenn Sie sich mit mir herumtreiben würden, dann wären es die Vögel), dann beginnen Sie unweigerlich, auf die gleiche Art von Dingen zu achten. Ich habe außerdem gelernt, dass Aufmerksamkeitsmuster – was wir entscheiden zu beachten und was nicht – definieren, wie wir uns unsere eigene Realität erschaffen, und so direkten Einfluss darauf haben, was wir zu einem gegebenen Zeitpunkt als möglich erachten. Diese Aspekte zusammengenommen weisen meines Erachtens auf das revolutionäre Potential hin, das frei wird, wenn wir unsere Aufmerksamkeit wieder für uns beanspruchen. Der kapitalistischen Logik, die auf dem Nährboden der Kurzsichtigkeit und Unzufriedenheit gedeiht, mag etwas so Pedestrisches wie das Nichtstun tatsächlich gefährlich erscheinen: Wenn wir seitwärts entkommen und uns aufeinander zubewegen, dann werden wir vielleicht merken, dass alles, was wir uns wünschen, bereits existiert.
KAPITEL 1
PLÄDOYER FÜR DAS NICHTS
*aufgewacht und erster Blick aufs Smartphone* also mal sehen, was für neue Schrecken mich auf dem «Neue-Schrecken-Gerät» erwarten
@MISSOKISTIC IN EINEM TWEET VOM 10. NOVEMBER 2016
Anfang 2017, nicht lange nach Trumps Amtseinführung, wurde ich gebeten, auf der EYEO, einer Kunst- und Technologie-Konferenz in Minneapolis, eine Keynote zu halten. Ich war von den Wahlen noch immer erschüttert, und wie vielen anderen Künstlern fiel es mir schwer, überhaupt mit irgendetwas weiterzumachen. Darüber hinaus befand sich Oakland nach dem «Ghost Ship»-Brand, der viele Künstler und gemeinschaftlich engagierte Menschen das Leben gekostet hatte, im Trauerzustand. Als ich auf das leere Feld starrte, in das ich den Titel meiner Rede eingeben sollte, dachte ich darüber nach, was ich zu einem Zeitpunkt wie diesem vielleicht Sinnvolles sagen könnte. Ohne zu wissen, wovon mein Beitrag tatsächlich handeln würde, tippte ich einfach «Nichts tun» ein.
Danach entschied ich, die Rede an einem bestimmten Ort festzumachen: dem Morcom Amphitheatre of Roses in Oakland, Kalifornien, auch einfach der Rosengarten genannt. Ich tat das zum Teil, weil ich im Rosengarten begonnen hatte, Ideen für meine Rede zu sammeln. Aber ich hatte außerdem bemerkt, dass der Garten alles in sich barg, was ich behandeln wollte: die Praxis des Nichtstuns, die Architektur des Nichts, die Bedeutung des öffentlichen Raums und eine Ethik der Fürsorge und Erhaltung.
Ich wohne fünf Minuten vom Rosengarten entfernt, und seit ich in Oakland lebe, ist er automatisch der Platz, den ich aufsuche, um vom Computer wegzukommen, wo ich einen Großteil meiner Arbeit mache, Kunst und anderes. Nach den Wahlen begann ich, fast jeden Tag in den Rosengarten zu gehen. Das war keine wirklich bewusste Entscheidung; es war mehr ein intuitiver Drang, wie ein Reh, das zu einem Salzleckstein geht, oder eine Ziege, die auf den Gipfel eines Berges klettert. Was ich dort tat, war nichts. Ich saß einfach da. Und auch wenn ich mich angesichts dessen, wie unpassend das schien – schöner Garten versus erschreckende Welt –, ein wenig schuldig fühlte, kam es mir tatsächlich vor wie eine notwendige Überlebenstaktik. Ich erkannte dieses Gefühl in einer Passage von Gilles Deleuzes Unterhandlungen wieder:
… wir sind durchdrungen von unnützen Worten, von Unmengen dummer Bilder und Worte. Die Dummheit war noch nie stumm oder blind. Das Problem besteht nicht darin, die Leute zum Reden zu bringen, sondern ihnen leere Zwischenräume von Einsamkeit und Schweigen zu verschaffen, von denen aus sie endlich etwas zu sagen hätten. Die Mächte der Unterdrückung hindern die Leute nicht am Reden, im Gegenteil: sie zwingen sie dazu. Wohltat, nichts zu sagen zu haben, Recht, nichts zu sagen zu haben – denn nur so kann sich etwas Rares oder Seltenes bilden, das ein wenig verdiente, gesagt zu werden.[1]
Er schrieb das 1985, aber ich konnte mich 2016 mit eben jenem Gefühl bis zu einem fast schmerzhaften Grad identifizieren. Hier besteht die Funktion des Nichts – nichts zu sagen – darin, Wegbereiter dafür zu sein, dass man schließlich etwas zu sagen hat. «Nichts» ist weder Luxus noch Zeitverschwendung, sondern notwendiger Teil sinnvollen Denkens und Sprechens.
Als bildende Künstlerin wertschätze ich das Nichtstun – oder passender, das Nichts-Schaffen – natürlich schon lange. Ich war bekannt dafür, Dinge zu tun, wie etwa hunderte Screenshots von Farmen oder Chemiemüll-Teichen von Google Earth zu sammeln, sie auszuschneiden und in mandalaartigen Kompositionen zu arrangieren. Für The Bureau of Suspended Objects (Das Büro der ausgesetzten Dinge), ein Projekt, an dem ich arbeitete, als ich Artist in Residence bei Recology San Francisco war, verbrachte ich drei Monate mit Fotografieren, Katalogisieren und Recherchieren über die Herkunft von 200 ausrangierten Objekten. Ich präsentierte sie als durchsuchbares Archiv, in dem die Leute ein von Hand gestaltetes Schild neben jedem Objekt scannen konnten, um etwas über dessen Herstellung, Material und Entstehungsgeschichte zu erfahren. Bei der Eröffnung wandte sich eine irritierte und irgendwie aufgebrachte Frau an mich und sagte: «Warten Sie mal … haben Sie eigentlich irgendwas geschaffen? Oder haben Sie nur Dinge auf Regale gestellt?» Ich sage oft, dass mein Medium Kontext ist, also lautete die Antwort auf beide Fragen ja.
Ich arbeite unter anderem auf diese Weise, weil ich bereits existierende Dinge unendlich viel interessanter finde als alles, was ich möglicherweise erschaffen könnte. The Bureau of Suspended Objects war in Wahrheit nur ein Vorwand für mich, um mir die erstaunlichen Dinge in der Deponie genau anzuschauen – ein Nintendo Power Glove, ein Haufen von 7up-Dosen in der Jubiläumsedition zur Zweihundertjahrfeier, ein Bankkontobuch von 1906 – und um jedem Objekt die angemessene Aufmerksamkeit zu widmen. Diese fast schon paralysierende Faszination für die Gegenstände, mit denen man sich beschäftigt, habe ich den «Beobachtungs-Eros» genannt. Etwas Ähnliches kommt in der Einleitung von Steinbecks Straße der Ölsardinen vor, wo der Autor beschreibt, mit wieviel Geduld und Sorgfalt man bei der genauen Beobachtung von Exemplaren, die man sammeln möchte, vorgehen muss:
Es gibt Seegetier von so heikler Beschaffenheit, daß es einem unter den Händen zerbricht oder zerrinnt, wenn man es fangen will. Man muß ihm Zeit lassen, bis es von selbst auf eine Klinge kriecht, die man ihm hinschiebt, und es dann behutsam aufheben und in einen Behälter mit Meerwasser gleiten lassen. Auf ähnliche Art muß ich wohl dieses Buch schreiben: die Blätter hinlegen und es den Geschöpfen von Cannery Row überlassen, wann und wie sie darüber hinkriechen und sich darauf tummeln wollen.[2]
Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass eines meiner bevorzugten Kunstwerke im öffentlichen Raum von einer Dokumentarfilmerin geschaffen wurde. 1973 realisierte Eleanor Coppola ein öffentliches Kunstprojekt mit dem Titel Windows, das in materieller Hinsicht nur aus einem Stadtplan mit einem Datum und einer Liste von Standorten in San Francisco bestand. Folgen wir Steinbecks Anleitung, dann wäre das Fenster an jedem dieser Orte der Behälter, und was auch immer dahinter geschah, wären die Geschichten, die «hineingekrochen» kamen. Auf Coppolas Karte steht zu lesen:
Eleanor Coppola hat eine Reihe von Fenstern in allen Teilen von San Francisco zu visuellen Orientierungspunkten bestimmt. Ihr Ziel in diesem Projekt ist es, der Allgemeinheit eine Kunst ins Bewusstsein zu rufen, die in ihrem eigenen Kontext existiert, zu zeigen, wo diese zu finden ist, ohne verändert oder in eine Galerie-Situation umgesiedelt zu werden.[3]
Ich möchte dieses Werk in Kontrast dazu stellen, wie wir Kunst im öffentlichen Raum normalerweise erleben, in Kontrast zu den riesigen stählernen Objekten, die aussehen, als wären sie direkt aus dem Weltall auf einem Platz der Gemeinde gelandet. Coppola indessen legt ein feines Netz über die ganze Stadt selbst, eine zarte, aber vielsagende Spur, die bereits existierende Kunst an ihrem Platz wahrnimmt.
Ein jüngeres Projekt, das in einem ähnlichen Sinne funktioniert, ist Scott Polachs Applause Encouraged (Applaus erbeten), das 2015 am Cabrillo National Monument in San Diego stattfand. Auf einer Klippe über dem Meer ließ eine Empfangsperson Gäste in einen formell mit rotem Band abgesperrten Bereich mit einer Reihe von Klappstühlen ein. Die Besucher wurden zu ihren Plätzen geleitet und darauf hingewiesen, keine Fotos zu machen. Sie betrachteten den Sonnenuntergang, und als er zu Ende war, applaudierten sie. Danach wurden Erfrischungen gereicht.
DIE GENANNTEN PROJEKTE haben etwas Wichtiges gemeinsam. In jedem gibt der Künstler die Struktur vor – ob es eine Karte oder ein abgesperrter Bereich ist (oder gar ein bescheidenes Ensemble von Regalen!) –, die einen kontemplativen Raum bereithält und diesen behauptet, wider den Zwang der Gewohnheit, Vertrautheit oder Zerstreuung, die ihn permanent zu schließen drohen. Diese Aufmerksamkeit in sich tragende Architektur ist etwas, worüber ich im Rosengarten häufig nachdenke. Ganz anders als unsere typischen flachen Gartenquadrate mit simplen Rosenreihen, schmiegt er sich an einen Hügel, mit einem endlos verzweigten System von Pfaden und Treppen durch und um die Rosen, Rankengerüste und Eichen. Ich habe beobachtet, dass jeder sich dort sehr langsam bewegt, und ja, die Menschen halten wirklich buchstäblich inne und riechen an den Rosen. Es gibt vermutlich hundert mögliche Wege, um sich durch den Garten zu schlängeln, und ebenso viele Plätze, um sich niederzulassen. Architektonisch fordert der Rosengarten Sie auf, ein wenig zu verweilen.
Sie spüren diese Wirkung in den runden Labyrinthen, die zu nichts anderem als zu kontemplativem Gehen angelegt wurden. Labyrinthe funktionieren gemäß ihrer Erscheinungsform, sie ermöglichen eine Art dichte «Einfaltung» der Aufmerksamkeit; allein durch zweidimensionale Muster versetzen sie uns in die Lage, einen Raum weder direkt zu durchqueren noch einfach nur stillzustehen, sondern etwas ziemlich genau dazwischen. Ich fühle mich von dieser Art Raum – Bibliotheken, kleine Museen, Gärten, Kolumbarien – angezogen, aufgrund der Art und Weise, wie sie geheime und mannigfaltige Perspektiven sogar auf ziemlich kleiner Fläche entfalten.
Aber natürlich muss diese «Einfaltung» von Aufmerksamkeit nicht unbedingt verräumlicht oder visuell sein. Als akustisches Beispiel möchte ich Deep Listening heranziehen, das Vermächtnis der Musikerin und Komponistin Pauline Oliveros. In klassischer Komposition ausgebildet, lehrte Oliveros in den 1970er Jahren experimentelle Musik an der University of California in San Diego. Sie begann partizipatorische Gruppentechniken zu entwickeln – etwa Performances, in denen die Leute einander zuhörten und Antworten sowohl aufeinander als auch auf die atmosphärische Klangumgebung improvisierten – und fand dabei Wege, mit Klängen zu arbeiten, die inmitten der Gewalt und Ruhelosigkeit des Vietnamkrieges ein Stück weit inneren Frieden bringen konnten.