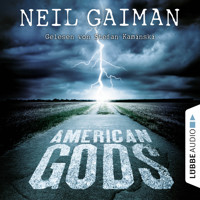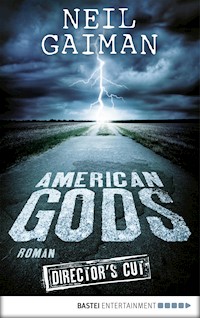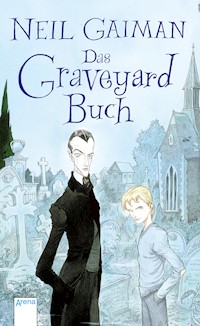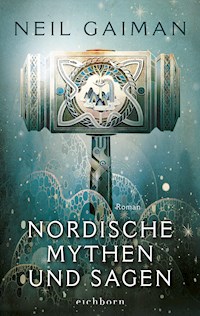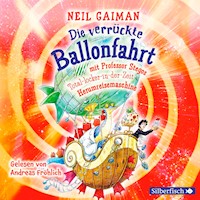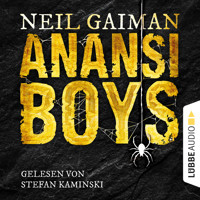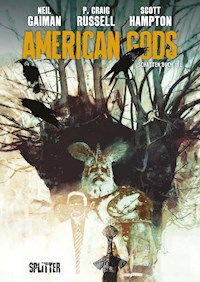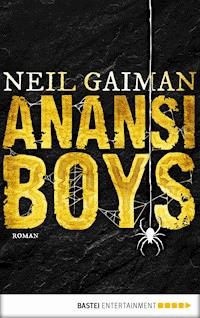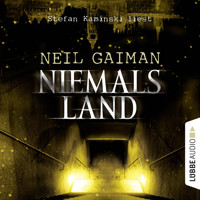
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Richard Mayhew führt ein unaufgeregtes Leben in London, bis ihm eines Tages ein verletztes Mädchen direkt vor die Füße fällt und ihn um Hilfe bittet. Richard willigt ein und gerät dadurch in ein Abenteuer, das er sich in seinen Träumen nicht hätte vorstellen können. Denn Door ist kein gewöhnliches Mädchen, sondern gehört zum verborgenen Reich von "Unter-London". Mit ihr landet Richard in einer Welt, die weit seltsamer und gefährlicher ist, als alles, was er vorher kannte.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:13 Std. 10 min
Sprecher:
Ähnliche
Inhalt
Neil Gaiman
Niemalsland
Roman
Ungekürzte Fassung
Übersetzung aus dem Englischenvon Tobias Schnettler
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Neverwhere«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1996, 1997 by Neil Gaiman
New version of the text copyright © 2005 by Neil Gaiman
Published by arrangement with Neil Gaiman
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Hanka Jobke
Innenillustrationen und Innenklappen: Saskia Wragge, Köln | www.saskiawragge.com
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Elm Haßfurth | www.elmstreet.org; shutterstock/Katflare
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3274-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Lenny Henry, meinen Freund und Kollegen,
ohne den es all dies nicht gäbe;
und für Merrilee Heifetz, meine Freundin und Agentin,
die alles stets zum Guten wendet.
Ich bin nie in St. John’s Wood gewesen.
Ich traue mich nicht.
Ich hätte Angst vor der unendlichen Nacht der Tannen,
Angst, einem blutroten Kelch zu begegnen,
und vor dem Schlagen der Adlerflügel.
G. K. Chesterton: Der Held von Notting Hill
If ever thou gavest hosen or shoon
Then every night and all
Sit thou down and put them on
And Christ receive thy soul
This aye night, this aye night
Every night and all
Fire and fleet and candlelight
And Christ receive thy soul
If ever thou gavest meat or drink
Then every night and all
The fire shall never make thee shrink
And Christ receive thy soul
Lyke-Wake Dirge – Englisches Volkslied
Einleitung zur vorliegenden Fassung
Selbst wenn du Niemalsland schon einmal gelesen hast, hast du wahrscheinlich nicht diese Version von Niemalsland gelesen.
Niemalsland begann, wie es manchmal so ist, als Fernsehserie, die ich für die BBC schrieb. Und obwohl die Serie nicht schlecht war, fiel mir immer wieder auf, dass das, was man auf dem Bildschirm sah, nicht das war, was ich im Kopf hatte. Ein Roman schien mir die einfachste Art zu sein, um das, was in meinem Kopf war, auch anderen Menschen in den Kopf zu setzen. Bücher können das.
Niemalsland nahm als Roman Gestalt für mich an, als wir mit der BBC-Fernsehserie desselben Namens loslegten, mehr oder weniger als eine Methode, nicht den Verstand zu verlieren. Bei jeder Szene, die herausgeschnitten wurde, jeder Zeile, die verschwand, allem, das einfach so geändert wurde, verkündete ich: »Kein Problem. Im Roman kommt’s wieder rein«, um so mein Gleichgewicht zu wahren. So ging es weiter, bis der Produzent schließlich auf mich zukam und sagte: »Wir schneiden die Szene auf Seite vierundzwanzig raus, und wenn du jetzt sagst, ›Im Roman kommt’s wieder rein‹, bring ich dich um.«
Von da an dachte ich es mir nur noch.
Was ich wollte, war, ein Buch zu schreiben, das für Erwachsene das ermöglichte, was die Bücher, die ich früher geliebt hatte, Bücher wie Alice im Wunderland oder die Narnia-Bücher oder Der Zauberer von Oz, für mich als Kind ermöglicht hatten. Und ich wollte von den Menschen erzählen, die durchs Raster fallen, zum allerersten Mal von den Besitzlosen erzählen – mit dem Spiegel der Fantasy, der uns manchmal Dinge zeigt, die wir schon so oft gesehen haben, dass wir sie nicht mehr wirklich sehen.
Ich fing am selben Tag an, den Roman zu schreiben, an dem wir mit dem Dreh der Serie begannen; im Januar, in der Küche der Wohnung in Südlondon, in der wir drehten. Fertig wurde ich im Mai, in einem Hotel in einer kleinen Stadt in Südkalifornien.
Er wurde im August desselben Jahres veröffentlicht, von der britischen BBC. Als der amerikanische Verlag Avon Books ihn veröffentlichen wollte, ergriff ich die Gelegenheit, im Grunde eine zweite Version des Romans zu schreiben. Ich schloss mich in einem Hotelzimmer im World Trade Center in New York City ein und schrieb eine Woche lang, fügte Material für Amerikaner hinzu, die vielleicht nicht wussten, wo die Oxford Street liegt oder auf was man stößt, wenn man sie entlangspaziert, und genoss es, den Text noch einmal zu überarbeiten, ihn zu erweitern und zu vertiefen, wo immer ich konnte. Meine Lektorin bei Avon Books, Jennifer Hershey, war eine hervorragende und scharfsichtige Leserin; das Einzige, worüber wir verschiedener Meinung waren, waren die Witze. Sie mochte sie nicht und war überzeugt, dass die amerikanischen Leser in einem Buch, das nicht bloß witzig sein sollte, nicht mit Witzen zurechtkommen würden. Sie wollte den zweiten Prolog loswerden, in dem wir zum ersten Mal Croup und Vandemar begegneten, bevor die eigentliche Geschichte begann, und obwohl ich ihn vermisste, entschied ich, dass sie recht hatte, und verschob ihre Beschreibung in den Text. (Der Prolog ist hier noch einmal abgedruckt, ganz hinten, in der ursprünglichen Fassung, für alle Neugierigen.)
Als ich fertig war, hatte ich rund zwölftausend Wörter hinzugefügt und mehrere Tausend andere Wörter gestrichen. Bei einigen dieser Wörter war ich froh, sie los zu sein. Andere fehlten mir.
Diese Version von Niemalsland, die mit Unterstützung von Pete Atkins von Hill House Publishers aus verschiedenen Fassungen zusammengesetzt wurde, ist eine Kombination aus dem ursprünglichen britischen und dem überarbeiteten amerikanischen Text. Zudem entfernte ich noch ein paar überflüssige Stellen und schuf so eine neue und – wie ich hoffe – endgültige Version von Niemalsland, und bereitete zugleich den Bibliografen Kopfschmerzen.
Ich schreibe keine Fortsetzungen. Trotzdem ist die Welt von Niemalsland eine, in die ich eines Tages zurückzukehren hoffe. In einem Buch mit dem Titel The Lost Rivers of London habe ich von einem Messingbettgestell gelesen, das eines Tages in der Kanalisation gefunden wurde. Bis heute weiß man nicht, woher es kam und wie es dorthin gelangte.
Ich wette, de Carabas weiß es.
NEIL GAIMAN
Prolog
An dem Abend, bevor er nach London ging, amüsierte sich Richard Mayhew nicht besonders.
Zu Beginn des Abends hatte er sich noch amüsiert: Es hatte ihm Spaß gemacht, die Abschiedskarten zu lesen und sich von verschiedenen nicht ganz unattraktiven Damen aus seinem Bekanntenkreis umarmen zu lassen; es hatte ihm Spaß gemacht, sich die Warnungen vor den Übeln und den Gefahren Londons anzuhören, und ihm hatte auch der weiße Regenschirm mit der Karte des Londoner U-Bahn-Netzes gefallen, für den die Jungs zusammengelegt hatten; er hatte die ersten paar Pints Ale genossen, aber dann wurde mit jedem weiteren Pint Ale klarer, dass er sich immer weniger amüsierte, bis er schließlich zitternd auf dem Gehsteig vor dem Pub in dieser kleinen schottischen Stadt saß und die jeweiligen Vor- und Nachteile des Sich-Übergebens und des Sich-nicht-Übergebens gegeneinander abwog und sich überhaupt nicht amüsierte.
Im Pub feierten Richards Freunde seinen bevorstehenden Weggang mit einer Begeisterung, die Richard langsam etwas unheimlich wurde. Er hockte auf dem Gehsteig, hielt den eingerollten Regenschirm fest umklammert und fragte sich, ob es wirklich eine gute Idee war, in den Süden, nach London zu ziehen.
»Pass bloß auf«, sagte eine krächzende alte Frauenstimme. »Die verjagen dich, bevor du Jack Robinson sagen kannst. Oder nehmen dich fest, würd mich nicht wundern.« Zwei scharfe Augen stierten aus einem vogelartigen, dreckverschmierten Gesicht. »Alles in Ordnung?«
»Ja, danke«, sagte Richard. Er war ein jugendlich aussehender Mann mit dunklem, leicht lockigem Haar und großen, haselnussbraunen Augen; er sah immer etwas zersaust aus, so als sei er gerade erst aufgestanden, was ihn für das andere Geschlecht attraktiver machte, als er je verstehen oder glauben können würde.
Das schmutzige Gesicht wurde weich. »Hier, armer Kerl.« Die Frau drückte Richard ein Fünfzigpencestück in die Hand. »Wie lang lebst du schon auf der Straße?«
»Ich bin nicht obdachlos«, erklärte Richard peinlich berührt und versuchte, der alten Frau die Münze zurückzugeben. »Bitte – nehmen Sie das Geld. Mir geht’s gut. Ich bin bloß rausgegangen, um ein bisschen Luft zu schnappen. Ich ziehe morgen nach London.«
Sie blickte misstrauisch auf ihn herab, dann nahm sie ihre fünfzig Pence zurück und ließ sie unter den Schichten aus Mänteln und Schals verschwinden, in die sie gehüllt war. »Ich war mal in London«, vertraute sie ihm an. »Ich war in London verheiratet. Aber er war ein mieser Kerl. Meine Mama hatte mich davor gewarnt, einen Fremden zu heiraten, aber ich war jung und hübsch, auch wenn man das heute nicht mehr glauben mag, und ich habe auf mein Herz gehört.«
»Ganz bestimmt«, sagte Richard beschämt. Ganz langsam ließ seine Überzeugung nach, dass er sich gleich übergeben würde.
»Herzlich wenig hat mir das gebracht. Ich war mal obdachlos, deshalb weiß ich, wie das ist«, sagte die alte Frau. »Deshalb hab ich gedacht, du wärst es auch. Wieso gehst du nach London?«
»Ich habe einen Job«, sagte er stolz.
»Als was denn?«, fragte sie.
»Äh, Wertpapiere«, antwortete Richard.
»Ich war Tänzerin«, sagte die alte Frau, und sie torkelte ungelenk auf dem Gehsteig herum und summte tonlos vor sich hin. Sie schwankte von rechts nach links, wie ein auslaufender Kreisel, und dann blieb sie stehen und blickte in Richards Gesicht. »Gib mir deine Hand, und ich sag dir die Zukunft voraus.«
Er gehorchte. Sie legte ihre alte Hand in seine und hielt sie fest, und dann blinzelte sie ein paar Mal wie eine Eule, die eine Maus verschluckt hatte, die wieder rauswollte.
»Du hast einen weiten Weg vor dir …«, sagte sie verwirrt.
»London«, erinnerte Richard sie.
»Nicht bloß London …« Die alte Frau zögerte. »Kein London, das ich kenne.«
Jetzt fing es leicht an zu regnen.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Es fängt mit Türen an.«
»Türen?«
Sie nickte. Der Regen wurde stärker, er prasselte auf die Dächer und auf den Asphalt. »An deiner Stelle würde ich auf Türen achten.«
Richard kämpfte sich ein wenig wackelig auf die Beine. »Alles klar«, sagte er, ohne zu wissen, was er mit einer solchen Information anfangen sollte. »Mach ich. Danke.«
Der Eingang des Pubs wurde geöffnet, und Licht und Lärm schwappten auf die Straße heraus. »Richard? Alles in Ordnung?«
»Ja, alles gut. Bin gleich wieder da.«
Die alte Dame schwankte bereits die Straße hinunter, in den prasselnden Regen hinein, und wurde immer nasser. Richard hatte das Gefühl, etwas für sie tun zu müssen; Geld konnte er ihr jedoch nicht geben. Er eilte ihr nach, die enge Straße entlang, und der kalte Regen durchnässte sein Gesicht und seine Haare.
»Hier.« Richard fummelte am Griff des Regenschirmes herum, um den Knopf zu finden, der ihn öffnete. Ein Klick, und er erblühte zu einer riesigen weißen Karte des Londoner U-Bahn-Netzes, jede Strecke durch eine andere Farbe gekennzeichnet, jeder Halt markiert und genau benannt.
Die alte Frau nahm den Schirm dankbar entgegen und lächelte Richard an. »Du hast ein gutes Herz. Manchmal reicht das, um sicher zu sein – egal wo man ist.« Dann schüttelte sie den Kopf. »Aber meistens nicht.« Sie presste den Regenschirm an sich, als ein Windstoß ihn ihr zu entreißen oder umzustülpen drohte. Sie schlang die Arme darum und krümmte sich gegen den Regen und den Wind zusammen. Dann ging sie unter dem Regen in die Nacht davon, eine runde weiße Form, die mit den Namen der Londoner U-Bahn-Stationen versehen war: Earls Court, Marble Arch, Blackfriars, White City, Victoria, Angel, Oxford Circus …
Richard erwischte sich dabei, dass er betrunken überlegte, ob es am Oxford Circus tatsächlich einen Zirkus gab: einen echten Zirkus mit Clowns und schönen Frauen und gefährlichen Tieren. Die Pub-Tür öffnete sich wieder und entließ eine Welle von Lärm, als hätte man den Lautstärkeregler im Inneren gerade voll aufgedreht. »Richard, du Wichser, das ist deine scheiß Party, und du verpasst alles.«
Er ging in den Pub zurück. Das Bedürfnis, sich zu übergeben, war in all der Seltsamkeit vergangen.
»Du siehst aus wie eine ersoffene Ratte«, sagte jemand.
»Du hast noch nie eine ersoffene Ratte gesehen«, gab Richard zurück.
Jemand anderes reichte ihm einen großen Whisky. »Hier, kipp runter. Der wärmt dich auf. Du weißt ja, in London wirst du keinen echten Scotch kriegen.«
»Den krieg ich ganz bestimmt«, seufzte Richard. Wasser tropfte ihm aus den Haaren in den Drink. »In London gibt es alles.« Und er kippte den Scotch herunter, und dann gab ihm jemand einen weiteren aus, und dann verschwamm der Abend und zerbrach in Fragmente. Anschließend erinnerte er sich nur an das Gefühl, dass er einen kleinen und vernünftigen Ort, der Sinn ergab, für einen riesigen und alten Ort verließ, der das nicht tat; und daran, endlos in eine Gosse zu kotzen, durch die Regenwasser strömte, irgendwann in den frühen Morgenstunden; und an eine weiße Form, die mit Symbolen in merkwürdigen Farben versehen war, wie ein kleiner runder Käfer, die sich im Regen von ihm entfernte.
Am nächsten Morgen stieg Richard in den Zug nach London, um die sechsstündige Fahrt in den Süden anzutreten, die ihn in die gotischen Turmspitzen und Bögen des Bahnhofs St Pancras bringen würde. Seine Mutter gab ihm einen kleinen Walnusskuchen mit, den sie für die Reise gebacken hatte, und eine Thermoskanne Tee; und Richard Mayhew fuhr nach London und fühlte sich beschissen.
1
Sie war jetzt vier Tage gerannt, eine überstürzte Flucht, Hals über Kopf durch endlose Gänge und Tunnel. Sie war hungrig und erschöpft, und müder, als ein Körper ertragen konnte, und jede Tür, an die sie kam, war schwieriger zu öffnen als die vorige. Nach vier Tagen Flucht fand sie ein Versteck, eine winzige steinerne Höhle unterhalb der Welt, wo sie sicher sein würde, jedenfalls betete sie darum, und dann endlich schlief sie.
Mr. Croup hatte Ross beim letzten Schwimmenden Markt angeworben, der in der Westminster Abbey stattgefunden hatte. »Betrachten Sie ihn«, erklärte er Mr. Vandemar, »als einen Kanarienvogel.«
»Er kann singen?«, fragte Mr. Vandemar.
»Das bezweifle ich; das bezweifle ich aufrichtig und absolut.« Mr. Croup fuhr sich mit der Hand durch das strähnige, orangefarbene Haar. »Nein, mein guter Freund, ich meinte das metaphorisch – eher im Sinne der Vögel, die man mit in die Minen nimmt.«
Mr. Vandemar nickte, langsam setzte das Verständnis ein: Ja, ein Kanarienvogel. Mr. Ross wies keinerlei Ähnlichkeit mit einem Kanarienvogel auf. Er war riesig – fast so groß wie Mr. Vandemar – und extrem schmutzig, und recht unbehaart, und er sprach sehr wenig, obwohl es ihm wichtig zu sein schien, ihnen beiden zu erklären, dass er gern Dinge tötete und dass er gut darin war. Das amüsierte Mr. Croup und Mr. Vandemar, so wie Dschingis Khan vielleicht die Prahlerei eines jungen Mongolen amüsiert hätte, der gerade sein erstes Dorf geplündert oder seine erste Jurte niedergebrannt hatte. Er war ein Kanarienvogel, und er wusste es nicht. Also ging Mr. Ross voran, in seinem siffigen T-Shirt und seiner dreckverkrusteten Jeans, und Croup und Vandemar folgten ihm in ihren eleganten schwarzen Anzügen.
Es gibt vier einfache Möglichkeiten für den Betrachter, Mr. Croup und Mr. Vandemar auseinanderzuhalten: Erstens ist Mr. Vandemar zweieinhalb Köpfe größer als Mr. Croup; zweitens ist die Farbe von Mr. Croups Augen ein verblasstes Kobaltblau, während Mr. Vandemar braune Augen hat; drittens trägt Mr. Vandemar an der rechten Hand Ringe, die er aus den Schädeln von vier Raben gefertigt hat, und Mr. Croup trägt keinen sichtbaren Schmuck; viertens mag Mr. Croup Worte, während Mr. Vandemar immerzu hungrig ist. Und außerdem sehen sie sich überhaupt nicht ähnlich.
Ein Rascheln in der Dunkelheit des Tunnels und Mr. Vandemars Messer war in seiner Hand, und dann war es nicht mehr in seiner Hand, sondern erzitterte sanft in gut neun Metern Entfernung. Er ging zu seinem Messer und nahm es am Griff auf. Eine graue Ratte war auf die Klinge gespießt, und ihr Mund ging kraftlos auf und zu, während das Leben aus ihr entwich. Er zerquetschte ihren Schädel zwischen Finger und Daumen.
»Das ist eine Ratte, die niemanden mehr verratten wird.« Mr. Croup schmunzelte über seinen eigenen Witz. Mr. Vandemar zeigte keine Reaktion. »Ratte. Verratten. Verstehen Sie?«
Mr. Vandemar zog das Tier von der Klinge und biss hinein, nachdenklich, in den Kopf.
Mr. Croup schlug sie ihm aus den Händen. »Hören Sie auf damit.«
Ein wenig missmutig steckte Mr. Vandemar sein Messer weg.
»Kommen Sie«, zischte Mr. Croup aufmunternd. »Die nächste Ratte folgt bestimmt. Jetzt: vorwärts. Dinge erledigen. Leuten wehtun.«
Drei Jahre in London hatten Richard nicht verändert, obwohl sie die Art und Weise verändert hatten, wie er die Stadt wahrnahm. Richard hatte sich London ursprünglich als eine graue Stadt vorgestellt, eine schwarze Stadt sogar, den zuvor gesehenen Bildern entsprechend, und war überrascht gewesen, dass sie voller Farben war. Es war eine Stadt aus roten Ziegeln und weißen Steinen, roten Bussen und großen, schwarzen Taxis (die zu Richards anfänglichem Erstaunen oft gold oder grün oder kastanienbraun waren), leuchtend roten Briefkästen und grasgrünen Parks und Friedhöfen.
Es war eine Stadt, in der das sehr Alte und das unbeholfen Neue aufeinanderstießen, nicht aggressiv, aber respektlos; eine Stadt der Läden und Büros und Restaurants und Wohnungen, der Parks und Kirchen, der unbeachteten Denkmäler und auffallend unpalasthaften Paläste; eine Stadt aus Hunderten von Bezirken mit komischen Namen – Crouch End, Chalk Farm, Earls Court, Marble Arch – und sonderbar ausgeprägten Identitäten; eine laute, dreckige, fröhliche, unruhige Stadt, die sich von Touristen ernährte, sie genauso sehr brauchte wie verachtete; in der sich die durchschnittliche Fortbewegungsgeschwindigkeit seit dreihundert Jahren nicht verbessert hatte, nachdem fünfhundert Jahre lang in unregelmäßigen Abständen die Straßen verbreitert und unbeholfene Kompromisse getroffen worden waren zwischen den Bedürfnissen des Straßenverkehrs – ob von Pferden gezogen oder unlängst motorisiert – und den Bedürfnissen der Fußgänger; eine Stadt, die von den verschiedensten Menschen sämtlicher Hautfarben nur so wimmelte.
Als er hergezogen war, war ihm London wie etwas Riesiges, Seltsames, ganz und gar Unbegreifliches vorgekommen, dem nur der U-Bahn-Plan, diese elegante, vielfarbige topografische Darstellung der unterirdischen Bahnlinien und Haltestellen, einen Anschein von Ordnung verlieh. Nach und nach begriff er, dass der U-Bahn-Plan eine nützliche Erfindung war, die das Leben einfacher machte, jedoch keinerlei Ähnlichkeit mit der Realität der Stadt darüber aufwies. Es war, wie einer politischen Partei anzugehören, hatte er einmal stolz gedacht – doch nachdem er auf einer Party versucht hatte, einem Haufen verwirrter Fremder die Ähnlichkeit zwischen dem U-Bahn-Plan und Politik zu erklären, hatte er beschlossen, politische Kommentare in Zukunft anderen zu überlassen.
Ganz langsam, durch einen Prozess der Osmose und des weißen Wissens (was so ähnlich wie weißes Rauschen ist, bloß informativer), fing er an, die Stadt zu verstehen, ein Prozess, der sich beschleunigte, als er begriff, dass die eigentliche City of London nicht größer war als eine Quadratmeile und sich von Aldgate im Osten bis zur Fleet Street und den Gerichtshöfen von Old Bailey im Westen erstreckte – ein winziger Bezirk, der jetzt Londons Finanzinstitute beheimatete und wo alles angefangen hatte.
Zweitausend Jahre zuvor war London ein kleines keltisches Dorf am nördlichen Ufer der Themse gewesen, das die Römer entdeckt und wo sie sich angesiedelt hatten. London war langsam gewachsen, bis es gut tausend Jahre später auf die winzige Königsstadt Westminster im Westen traf, und nachdem die London Bridge gebaut worden war, traf London auf die Stadt Southwark auf der anderen Seite des Flusses; und es wuchs weiter, Felder und Wälder und Marschland verschwanden langsam unter der florierenden Stadt, die sich weiter ausbreitete und im Wachsen mit anderen kleinen Orten und Dörfern zusammentraf, wie Whitechapel und Deptford im Osten, Hammersmith und Sheperd’s Bush im Westen, Camden und Islington im Norden, Battersea und Lambeth jenseits der Themse im Süden. Im Wachsen saugte London all diese Städte in sich auf, so wie eine Pfütze Quecksilber sich kleinere Tröpfchen Quecksilber einverleibt, denen sie begegnet, und schließlich blieben nur ihre Namen.
London wuchs zu etwas Riesigem und Widersprüchlichem. Es war ein guter Ort und eine feine Stadt, doch jeder gute Ort hat seinen Preis, und alle guten Orte haben einen Preis zu zahlen.
Nach einer Weile nahm Richard London als selbstverständlich hin; er fing an, darauf stolz zu sein, sich keine der Sehenswürdigkeiten Londons angesehen zu haben (bis auf den Tower of London, als seine Tante Maude für ein Wochenende in die Stadt kam und Richard sich in der Rolle ihres unfreiwilligen Begleiters wiederfand).
Jessica änderte das. Richard erwischte sich dabei, wie er sie an eigentlich ganz vernünftigen Wochenenden an Orte wie die National Gallery und die Tate Gallery begleitete, wo er die Erfahrung machte, dass langes Durchs-Museum-laufen den Füßen wehtat, dass die großen Kunstschätze dieser Welt nach einer Weile allesamt miteinander verschwammen, und dass es beinahe die menschliche Auffassungsgabe überstieg, welch unverschämte Summen die Museumscafés für ein Stück Kuchen und eine Tasse Tee verlangten.
»Hier ist dein Tee und dein Eclair«, sagte er. »Einen dieser Tintorettos zu kaufen wäre billiger gewesen.«
»Übertreib nicht«, sagte Jessica gut gelaunt. »Außerdem gibt es in der Tate gar keine Tintorettos.«
»Ich hätte den Kirschkuchen nehmen sollen«, sagte Richard. »Dann könnten sie sich jetzt noch einen van Gogh leisten.«
»Nein«, wies ihn Jessica zurecht, »könnten sie nicht.«
Richard hatte Jessica in Frankreich kennengelernt, auf einer Wochenendreise nach Paris zwei Jahre zuvor; er hatte sie tatsächlich im Louvre entdeckt, als er auf der Suche nach der Gruppe von Kollegen war, die den Ausflug organisiert hatten. Er blickte zu einer gewaltigen Skulptur auf und stieß rückwärts gegen Jessica, die gerade einen extrem großen und historisch bedeutenden Diamanten bewunderte. Er versuchte, sich auf Französisch bei ihr zu entschuldigen, was er nicht beherrschte, gab deshalb den Versuch auf und entschuldigte sich auf Englisch, und dann versuchte er, sich auf Französisch dafür zu entschuldigen, dass er sich auf Englisch entschuldigen musste, bis er bemerkte, dass Jessica ungefähr so englisch war, wie es ein einzelner Mensch nur sein konnte, und schon ließ sie sich von ihm als Wiedergutmachung ein teures französisches Sandwich und ein Gläschen überteuerte Apfelschorle kaufen, und, tja, so fing es an. Danach war es ihm nicht mehr gelungen, Jessica davon zu überzeugen, dass er nicht die Sorte Mensch war, die in Kunstgalerien ging.
Wenn sie an Wochenenden nicht gerade Kunstgalerien oder Museen besuchten, lief Richard hinter Jessica her, während sie shoppte, was sie zumeist im reichen Knightsbridge tat, einen kurzen Spaziergang und eine noch kürzere Taxifahrt von ihrer Wohnung in einem Hinterhaus in Kensington entfernt. Richard begleitete Jessica auf ihren Touren durch so riesige und einschüchternde Warenhäuser wie Harrods und Harvey Nichols, Geschäfte, in denen Jessica alles kaufen konnte, von Schmuck über Bücher bis hin zu Lebensmitteln für die kommende Woche.
Richard war von Jessica tief beeindruckt, denn sie war schön und oft ziemlich witzig, und sie würde ganz sicher ihren Weg gehen. Und Jessica sah in Richard ein enormes Potenzial, das ihn – von der richtigen Frau in die richtigen Bahnen gelenkt – zum perfekten Ehe-Accessoire machen würde. Wenn er doch bloß ein bisschen fokussierter wäre, murmelte sie oft vor sich hin und gab ihm Bücher mit Titeln wie Dress for Success und Einhundertfünfundzwanzig Regeln erfolgreicher Männer und Bücher darüber, wie man ein Unternehmen ähnlich einem militärischen Feldzug führte, und Richard bedankte sich jedes Mal und nahm sich jedes Mal vor, sie zu lesen. In der Abteilung für Herrenbekleidung bei Harvey Nichols suchte sie ihm die Art von Kleidung aus, von denen sie fand, dass er sie tragen sollte – und er trug sie, jedenfalls unter der Woche; und ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung sagte sie ihm, sie halte den Zeitpunkt für gekommen, dass sie einen Verlobungsring kauften.
»Wieso bist du mit ihr zusammen?«, fragte Garry von der Kundenbetreuung achtzehn Monate später. »Die macht einem doch Angst.«
Richard schüttelte den Kopf. »Sie ist wirklich nett, wenn man sie erst mal kennt.«
Garry stellte den Plastiktroll zurück auf Richards Schreibtisch. »Mich wundert, dass sie dich noch mit denen hier spielen lässt.«
»Darüber haben wir nie geredet«, sagte Richard und nahm eines dieser Wesen in die Hand. Es hatte eine neonorangene Mähne und einen leicht verwirrten Gesichtsausdruck, so als hätte es sich verlaufen.
Sie hatten sehr wohl darüber geredet. Doch Jessica hatte sich selbst überzeugt, dass Richards Trollsammlung Ausdruck einer liebenswerten Exzentrizität war, vergleichbar mit Mr. Stocktons Sammlung von Engeln. Jessica war gerade dabei, eine Wanderausstellung von Mr. Stocktons Engelsammlung zu organisieren, und zu dem Schluss gekommen, dass alle großen Männer irgendetwas sammelten. Eigentlich sammelte Richard gar keine Trolle. Er hatte auf der Straße vor dem Büro einen Troll gefunden und ihn in einem vagen und recht aussichtslosen Versuch, seiner Arbeitswelt eine persönliche Note zu geben, auf seinen Computerbildschirm gestellt. Die anderen waren im Laufe der nächsten paar Monate gefolgt, Geschenke von Kollegen, denen aufgefallen war, dass Richard eine Schwäche für diese hässlichen kleinen Wesen zu haben schien. Er hatte die Geschenke entgegengenommen und sie strategisch auf seinem Schreibtisch verteilt, neben den Telefonen und dem gerahmten Foto von Jessica. Heute klebte auf dem Foto ein gelbes Post-it.
Es war Freitagnachmittag. Richard war aufgefallen, dass Ereignisse Feiglinge waren: Sie traten nie allein auf, sondern trieben sich immer in Rudeln herum und stürzten sich alle gleichzeitig auf ihn. Nehmen wir beispielsweise diesen Freitag. Dieser war, wie Jessica ihm im letzten Monat mindestens ein Dutzend Mal erinnert hatte, der wichtigste Tag in seinem Leben. Natürlich nicht der wichtigste Tag in ihrem Leben. Der würde irgendwann in der Zukunft kommen, wenn man sie, daran hatte Richard keinen Zweifel, zur Premierministerin ernennen würde oder zur Queen oder zu Gott. Doch es war, ohne Frage, der wichtigste Tag in seinem Leben. Deshalb war es ungünstig, dass er es trotz des Post-it-Zettels, den Richard auf die Kühlschranktür zu Hause geklebt hatte, und des anderen Post-it-Zettels, den er auf das Foto von Jessica auf seinem Schreibtisch geklebt hatte, voll und ganz vergessen hatte.
Außerdem war da noch der überfällige Wandsworth-Bericht, der den Großteil seiner Aufmerksamkeit erforderte. Richard überprüfte eine weitere Spalte mit Zahlen; dann fiel ihm auf, dass Seite 17 verschwunden war, und er druckte sie erneut aus; eine weitere Seite war geschafft, und er wusste, wenn man ihn einfach nur in Ruhe weitermachen ließe … wenn auf wundersame Weise das Telefon nicht klingelte …
Es klingelte. Er drückte auf die Freisprechtaste.
»Hallo? Richard? Der Managing Director will wissen, wann er den Bericht bekommt.«
Richard sah auf seine Uhr. »In fünf Minuten, Sylvia. Er ist fast fertig, ich muss nur noch die Gewinn- und Verlustprognose anfügen.«
»Danke, Dick. Ich komme runter und hole ihn.« Sylvia war, wie sie gern betonte, »die PA des MD«, und sie umgab sich mit einer Aura forscher Effizienz.
Er schaltete die Freisprechanlage aus, und sofort klingelte es erneut.
»Richard«, sagte der Lautsprecher mit Jessicas Stimme, »hier ist Jessica. Du hast es nicht vergessen, oder?«
»Vergessen?« Er versuchte, sich daran zu erinnern, was er vergessen haben könnte. Er sah auf Jessicas Foto, um sich inspirieren zu lassen, und fand dort alle Inspiration, die er benötigte, in Form eines gelben Post-it-Zettels, der auf ihrer Stirn klebte.
»Richard? Nimm jetzt ab.«
Er nahm ab und las gleichzeitig, was auf dem Post-it-Zettel stand. »Tut mir leid, Jess. Nein, ich hab’s nicht vergessen. Sieben Uhr bei Ma Maison Italiana. Treffen wir uns da?«
»Jessica, Richard. Nicht Jess.« Sie hielt einen Moment inne. »Nach dem, was letztes Mal passiert ist? Wohl besser nicht. Du würdest dich in deinem eigenen Garten verlaufen, Richard.«
Richard erwägte, darauf hinzuweisen, dass es jedem hätte passieren können, die National Gallery mit der National Portrait Gallery zu verwechseln, und dass nicht sie den ganzen Tag im Regen gestanden hatte (was seiner Meinung nach genauso viel Spaß machte wie durch eines dieser Häuser zu laufen, bis ihm die Füße wehtaten), doch er verkniff es sich.
»Ich hol dich bei dir zuhause ab«, sagte Jessica. »Wir können zusammen hinlaufen.«
»Klar, Jess. Jessica – tut mir leid.«
»Du hast doch unsere Reservierung bestätigt, richtig, Richard?«
»Ja«, log Richard ernst. Das andere Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte schrill. »Jessica, pass auf, ich –«
»Gut«, sagte Jessica und unterbrach die Verbindung. Die größte Geldsumme, die Richard je für irgendetwas ausgegeben hatte, hatte er für Jessicas Verlobungsring gezahlt, achtzehn Monate zuvor an einem von Harrods zahlreichen Schmuckständen. Er hob das andere Telefon ab.
»Hi, Dick«, sagte Garry. »Ich bin’s, Garry.« Garry saß ein paar Tische von Richard entfernt und winkte ihm von seinem eigenen, gänzlich trollfreien Schreibtisch aus zu. »Wir gehen doch heute was trinken? Du hast gesagt, wir könnten den Merstham-Bericht besprechen.«
»Verdammt, leg auf, Garry. Ja, klar.« Richard legte auf.
Ganz unten auf dem Post-it-Zettel stand eine Nummer. Richard hatte das Post-it einige Wochen zuvor selbst geschrieben, und er hatte den Tisch reserviert, da war er sich beinahe sicher. Doch er hatte die Reservierung nicht bestätigt. Er hatte es vorgehabt, aber es hatte so viel zu tun gegeben, und Richard hatte gewusst, dass noch viel Zeit blieb. Doch Ereignisse treten immer in Rudeln auf …
Jetzt stand Sylvia neben ihm. »Dick? Der Wandsworth-Bericht?«
»So gut wie fertig, Sylvia. Warte, gib mir eine Sekunde, ja?«
Er tippte die Telefonnummer ein und seufzte erleichtert, als jemand antwortete: »Ma Maison. Kann ich etwas für Sie tun?«
»Ja«, sagte Richard, »ein Tisch für drei, für heute. Ich glaube, ich habe reserviert. Falls ja, bestätige ich hiermit die Reservierung. Und falls nicht, habe ich mich gefragt, ob Sie ihn für mich reservieren könnten. Bitte.« Nein, sie hatten in ihren Unterlagen keinen Tisch auf den Namen Mayhew vermerkt. Oder Stockton. Oder Bartram – Jessicas Nachname. Und was das Reservieren eines Tisches anginge …
Es waren nicht die Worte, die Richard so unangenehm fand – es war der Tonfall, mit dem die Information übermittelt wurde. Ein Tisch für heute Abend hätte eindeutig schon vor Jahren reserviert werden müssen, bestenfalls, so die unausgesprochene Forderung, schon von Richards Eltern. Ein Tisch für heute Abend war unmöglich. Falls der Papst, der Premierminister und der französische Präsident heute Abend ohne eine bestätigte Reservierung auftauchten, würde man sogar sie mit kontinentaleuropäischer Verachtung auf die Straße setzen.
»Aber es geht um den Chef meiner Verlobten. Ich weiß, dass ich hätte anrufen müssen. Wir sind nur zu dritt, könnten Sie nicht bitte –«
Sie hatte aufgelegt.
»Richard?«, sagte Sylvia. »Der MD wartet.«
»Glaubst du«, fragte Richard, »dass sie mir einen Tisch geben, wenn ich ihnen Geld biete?«
In ihrem Traum waren sie alle gemeinsam im Haus. Ihre Eltern, ihr Bruder, ihre kleine Schwester. Sie alle standen im Ballsaal und starrten sie an. Sie waren so blass, so ernst. Portia, ihre Mutter, berührte ihre Wange und sagte, sie sei in Gefahr. In ihrem Traum lachte Door und sagte, das wisse sie. Ihre Mutter schüttelte den Kopf: Nein, nein – jetzt sei sie in Gefahr. Jetzt.
Door schlug die Augen auf. Die Tür öffnete sich, leise, ganz leise; sie hielt den Atem an. Schritte, sacht auf dem Steinboden. Vielleicht bemerkt er mich nicht, dachte sie. Vielleicht geht er wieder. Und dann dachte sie verzweifelt: Ich hab Hunger.
Die Schritte zögerten. Sie war gut versteckt, das wusste sie, unter einem Haufen Zeitungen und Lumpen. Und es war nicht ausgeschlossen, dass der Eindringling ihr gar nichts Böses wollte. Kann er mein Herz schlagen hören? Und dann kamen die Schritte näher, und sie wusste, was sie zu tun hatte, und es machte ihr Angst. Eine Hand riss ihren Schutz weg, und sie sah in ein leeres, vollkommen haarloses Gesicht, das sich zu einem grausamen Lächeln verzog. Sie drehte sich zur Seite, und das Messer, das auf ihre Brust zielte, erwischte sie am Oberarm.
Bis zu diesem Moment hatte sie nie gedacht, dass sie dazu imstande wäre. Nie gedacht, dass sie tapfer genug sein könnte oder verängstigt genug oder verzweifelt genug, sich zu trauen. Doch sie streckte eine Hand zu seiner Brust aus und öffnete …
Er röchelte und fiel taumelnd auf sie. Es war nass und warm und glitschig, und sie wand sich von dem Mann weg und stolperte aus dem Raum.
In dem engen, niedrigen Tunnel dahinter verschnaufte sie und ließ sich, keuchend und schluchzend, gegen eine Wand sinken. Das hatte den Rest ihrer Kraft aufgebraucht; jetzt war sie ausgebrannt. Ihre Schulter fing an zu pochen. Das Messer, dachte sie. Doch sie war in Sicherheit.
»Sieh an, sieh an«, sagte eine Stimme aus der Dunkelheit rechts von ihr. »Sie hat Mister Ross überlebt. Das hätte ich nicht gedacht, Mister Vandemar.« Die Stimme triefte. Sie klang wie grauer Schleim.
»Das hätte ich auch nicht gedacht, Mister Croup«, sagte eine tonlose Stimme links von ihr.
Eine Lampe wurde angezündet und leuchtete flackernd auf.
»Nun denn«, sagte Mr. Croup, dessen Augen in der Dunkelheit unter der Erde leuchteten, »uns wird sie nicht überleben.«
Door rammte ihm das Knie hart in den Unterleib, und dann rannte sie einfach los, mit der rechten Hand ihre linke Schulter haltend.
Und sie rannte.
»Dick?«
Richard winkte die Unterbrechung weg. Er hatte sein Leben fast unter Kontrolle. Nur noch ein wenig mehr Zeit …
Garry wiederholte seinen Spitznamen. »Dick? Es ist halb sieben.«
»Es ist was?« Blätter und Stifte und Tabellen und Trolle flogen in Richards Aktenkoffer. Er klappte ihn zu und eilte los. Im Laufen zog er seinen Mantel über.
Garry kam hinter ihm her. »Gehen wir denn jetzt was trinken?«
»Trinken?«
»Wir wollten uns heute abend zusammensetzen, um über den Merstham-Bericht zu sprechen. Schon vergessen?«
Das war heute? Richard zögerte einen Moment. Falls Unorganisiertsein je eine olympische Disziplin werden sollte, könnte er darin für Großbritannien antreten. »Garry«, sagte er, »es tut mir leid. Ich hab’s versaut. Ich bin heute Abend mit Jessica verabredet. Wir laden ihren Chef zum Essen ein.«
»Mister Stockton? Von Stocktons? Den Stockton?«
Richard nickte, und sie eilten die Treppe hinab.
»Ihr habt bestimmt viel Spaß«, sagte Garry ironisch. »Und wie geht’s dem Schrecken vom Amazonas?«
»Jessica kommt aus Ilford, Garry. Und sie ist immer noch das Licht und die Liebe meines Lebens, danke der Nachfrage.« Inzwischen waren sie in der Lobby angelangt, und Richard sprang auf die automatische Tür zu, die sich auf spektakuläre Weise zu öffnen weigerte.
»Es ist nach sechs, Mister Mayhew«, sagte Mr. Figgis, der Wachmann des Gebäudes. »Sie müssen sich austragen.«
»Ich brauch das nicht«, sagte Richard, an niemand Bestimmten gerichtet, »wirklich nicht.«
Mr. Figgis roch vage nach einem medizinischen Einreibemittel, und es ging das Gerücht, dass er eine enzyklopädische Pornosammlung besaß. Er bewachte die Türen mit einer Sorgfalt, die an Wahnsinn grenzte, weil er nie so recht den Abend vergessen konnte, an dem die Computerausrüstung eines gesamten Stockwerks verschwunden war, zusammen mit zwei Topfpalmen und dem Axminster-Teppich des Chefs.
»Also gehen wir nichts trinken?«
»Tut mir leid, Garry. Passt dir Montag?«
»Klar. Montag ist gut. Bis Montag.«
Mr. Figgis begutachtete ihre Unterschriften und überzeugte sich davon, dass sie keine Computer, Topfpalmen oder Teppiche am Leib trugen, dann drückte er einen Knopf unter seinem Tisch, und die Tür öffnete sich.
»Türen«, sagte Richard.
Der Gang verzweigte und teilte sich; sie wählte ihren Weg willkürlich, duckte sich durch Tunnel, rannte und stolperte und taumelte. Hinter ihr spazierten Mr. Croup und Mr. Vandemar, so gelassen und munter wie viktorianische Würdenträger auf der Weltausstellung durch den Crystal Palace. Wenn sie an eine Kreuzung gelangten, ging Mr. Croup auf die Knie und suchte den nächsten Tropfen Blut, und dem folgten sie dann. Sie waren wie Hyänen, die ihre Beute bis zur Erschöpfung vor sich hertrieben. Sie konnten warten. Sie hatten alle Zeit der Welt.
Das Glück war zur Abwechslung mal auf Richards Seite. Er erwischte ein schwarzes Taxi, das von einem besonders enthusiastischen Fahrer gesteuert wurde, der Richard auf einer ungewöhnlichen Route nach Hause brachte, durch Straßen, die Richard nie zuvor aufgefallen waren, während er sich über Londons innerstädtische Verkehrsprobleme, den bestmöglichen Umgang mit Verbrechen und heikle politische Fragen ausließ, so wie es Richards Erfahrung nach alle Londoner Taxifahrer taten – sofern ein lebendiger, atmender, Englisch sprechender Fahrgast hinter ihnen sitzt. Richard sprang aus dem Taxi, ließ ein Trinkgeld und seinen Koffer zurück, winkte den Wagen noch einmal zurück, bevor er auf der Hauptstraße verschwand, und bekam so seinen Koffer wieder, dann rannte er die Treppe hinauf in seine Wohnung. Schon beim Betreten des Wohnungsflures warf er seine Kleider ab; sein Koffer segelte sich drehend durch den Raum und landete krachend auf dem Sofa; er nahm seine Schlüssel aus der Tasche und legte sie vorsichtig auf den Flurtisch, um sicherzugehen, dass er sie nicht vergessen würde.
Dann spurtete er ins Schlafzimmer. Die Türklingel ertönte. Richard, der seinen besten Anzug zu drei Vierteln angezogen hatte, stürzte zur Gegensprechanlage.
»Richard? Hier ist Jessica. Ich hoffe, du bist fertig.«
»Oh. Ja. Bin gleich unten.« Er zog einen Mantel über und rannte los, die Tür hinter sich zuknallend.
Jessica wartete am Fuß der Treppe auf ihn. Sie wartete immer dort auf ihn. Jessica mochte Richards Wohnung nicht; die Räume erinnerten sie auf unangenehme Weise daran, dass sie eine Frau war. Es bestand immerzu die Möglichkeit, dass sie, na ja, überall auf eine von Richards Unterhosen stieß, ganz zu schweigen von umherwandernden Klumpen erhärteter Zahnpasta im Badezimmerwaschbecken – nein, es war kein Ort nach Jessicas Geschmack.
Jessica war sehr schön; so schön, dass Richard sie gelegentlich anstarrte und sich fragte: Wieso ist sie mit mir zusammen? Und wenn sie miteinander schliefen – was sie in Jessicas Hinterhauswohnung im angesagten Kensington taten, in Jessicas Messingbett mit den frischen weißen Leinenbetttüchern (denn Jessicas Eltern hatten ihr beigebracht, dass Daunendecken dekadent waren) –, dann hielt sie ihn anschließend im Dunkeln ganz fest an sich gedrückt, und ihre langen braunen Locken fielen auf seine Brust, und sie flüsterte ihm zu, wie sehr sie ihn liebte, und er sagte ihr, dass er sie liebte und immer bei ihr sein wolle, und sie beide glaubten, dass es die Wahrheit war.
»Wir haben Glück, Mister Vandemar. Sie wird langsamer.«
»Wird langsamer, Mister Croup.«
»Sie muss sehr viel Blut verloren haben, Mister V.«
»Schönes Blut, Mister C. Schönes nasses Blut.«
»Nicht mehr lange.«
Ein Klicken: das Geräusch eines aufspringenden Schnappmessers, leer und einsam und düster.
»Richard? Was tust du da?«, fragte Jessica.
»Nichts, Jessica.«
»Du hast nicht schon wieder deinen Schlüssel vergessen, oder?«
»Nein, Jessica.« Richard hörte auf, sich abzuklopfen und schob die Hände tief in die Taschen seines Mantels.
»Also, wenn du heute Mister Stockton triffst«, sagte Jessica, »dann muss dir klar sein, dass er nicht bloß ein wichtiger Mann ist. Er ist eine juristische Person für sich.«
»Ich kann’s kaum erwarten«, seufzte Richard.
»Wie bitte, Richard?«
»Ich kann’s kaum erwarten«, sagte Richard, diesmal deutlich enthusiastischer.
»Ach, geh doch ein bisschen zügiger«, sagte Jessica, von der allmählich eine Aura ausging, die bei einer weniger starken Frau als Nervosität durchgegangen wäre. »Wir dürfen Mister Stockton nicht warten lassen.«
»Nein, Jess.«
»Nenn mich nicht so, Richard. Ich kann Spitznamen nicht ausstehen. Sie sind so herablassend.«
»Ein bisschen Kleingeld?« Der Mann saß in einem Eingang. Sein Bart war gelb und grau, und seine Augen hohl und dunkel. Ein handgeschriebenes Schild, das an einem ausgefransten Stückchen Schnur um seinen Hals hing und auf seiner Brust ruhte, verriet jedem, der lesen konnte, dass er obdachlos und hungrig war. Man brauchte kein Schild, um das zu erkennen. Richard, der die Hand bereits in der Tasche hatte, tastete nach einer Münze.
»Richard. Dafür haben wir keine Zeit«, sagte Jessica, die regelmäßig spendete und ihr Geld ethisch korrekt anlegte. »Ich möchte, dass du einen guten Eindruck machst, als Verlobter. Es ist entscheidend, dass ein zukünftiger Ehepartner einen guten Eindruck hinterlässt.« Und dann verzog sich ihr Gesicht, und sie umarmte ihn kurz und sagte: »Oh, Richard. Ich liebe dich wirklich. Das weißt du doch, oder?«
Und Richard nickte. Das tat er.
Jessica sah auf ihre Uhr und erhöhte das Tempo. Richard schnippte unauffällig eine Pfundmünze in Richtung des Mannes in dem Eingang, der sie mit einer schmutzigen Hand auffing.
»Es gab doch kein Problem mit der Reservierung, oder?«, fragte Jessica. Und Richard, der kein besonders guter Lügner war, wenn man ihn mit einer direkten Frage konfrontierte, sagte: »Äh.«
Sie hatte sich falsch entschieden. Der Gang endete an einer blanken Mauer. Normalerweise hätte sie das nicht aufgehalten, doch sie war so müde, so hungrig, hatte solche Schmerzen … Sie lehnte sich gegen die Wand, spürte die rauen Ziegelsteine an ihrem Gesicht, schnappte nach Luft, hickste und schluchzte. Ihr Arm war kalt und ihre linke Hand taub. Sie konnte nicht weitergehen, und die Welt fühlte sich plötzlich sehr weit entfernt an. Sie wollte anhalten, sich hinlegen und hundert Jahre lang schlafen.
»Oh, bei meiner kleinen schwarzen Seele, Mister Vandemar, sehen Sie, was ich sehe?« Die Stimme war leise, ganz nah; sie mussten dichter hinter ihr gewesen sein, als sie gedacht hatte. »Ich sehe was, was Sie nicht sehen, und das ist –«
»Gleich tot, Mister Croup«, sagte die tonlose Stimme direkt über ihr.
»Unser Auftraggeber wird erfreut sein.«
Und das Mädchen nahm zusammen, was sie in ihrer tiefsten Seele finden konnte, all die Qual und den Schmerz und die Furcht. Sie war erschöpft, ausgebrannt und vollkommen entkräftet. Für sie gab es keinen Ausweg, sie hatte keine Energie mehr, keine Zeit. Wenn das die letzte Tür ist, die ich öffne, betete sie still zu Temple und zu Arch. Irgendwohin … egal wohin … wo es sicher ist …, und dann dachte sie, rasend vor Angst, zu irgendjemandem.
Und während sie das Bewusstsein verlor, versuchte sie, eine Tür zu öffnen.
Als die Dunkelheit sie packte, hörte sie Mr. Croups Stimme wie aus großer Entfernung. »Verdammt.«
Jessica und Richard näherten sich dem Restaurant. Sie hatte sich bei ihm eingehakt und ging so schnell, wie es ihre hohen Absätze erlaubten. Er strengte sich an, mit ihr Schritt zu halten. Straßenlaternen und die Schaufenster geschlossener Geschäfte beleuchteten ihren Weg. Sie kamen an einer Reihe bedrohlich aufragender Gebäude vorbei, verlassen und einsam, von einer hohen Backsteinmauer umgeben.
»Du willst mir erzählen, dass du denen für unseren Tisch heute fünfzig Pfund extra versprechen musstest? Du bist ein Idiot, Richard.« Jessica, deren dunkle Augen aufblitzten, fand das überhaupt nicht lustig.
»Sie hatten meine Reservierung nicht mehr. Und sie haben gesagt, dass alle Tische vergeben waren.« Ihre Schritte hallten von den hohen Mauern wider.
»Wahrscheinlich setzen sie uns direkt neben die Küche«, maulte Jessica. »Oder die Tür. Hast du ihnen gesagt, dass es um Mister Stockton geht?«
»Ja«, antwortete Richard.
Jessica seufzte. Sie zog ihn hinter sich her, als sich plötzlich ein kurzes Stück vor ihnen in der Mauer eine Tür öffnete und jemand heraustrat, einen schrecklich langen Moment schwankend dastand und dann auf dem Asphalt zusammenbrach. Richard erschauerte und blieb wie angewurzelt stehen. Jessica zerrte ihn weiter.
»Also, wenn du dich mit Mister Stockton unterhältst, achte darauf, ihn auf keinen Fall zu unterbrechen. Oder ihm zu widersprechen – er mag es nicht, wenn man ihm widerspricht. Wenn er einen Witz macht, lachst du. Wenn du irgendeinen Zweifel hast, ob er etwas als Witz gemeint hat oder nicht, sieh mich an. Ich … hmm, tippe dann mit dem Zeigefinger auf den Tisch.«
Sie hatten die Person auf dem Gehsteig erreicht. Jessica stieg über die zusammengesackte Gestalt. Richard zögerte. »Jessica?«
»Du hast recht. Dann denkt er vielleicht, dass ich mich langweile.« Sie überlegte und sagte strahlend: »Ich weiß – wenn er einen Witz macht, reib ich mir das Ohrläppchen.«
»Jessica?« Er konnte nicht glauben, dass sie die Gestalt zu ihren Füßen einfach ignorierte.
»Was?« Es gefiel ihr nicht, aus ihrem Tagtraum gerissen zu werden.
»Guck mal.« Er zeigte auf den Gehsteig. Die Person lag mit dem Gesicht nach unten und war in unförmige Kleider gehüllt.
Jessica nahm seinen Arm und zog ihn an sich heran. »Ah. Verstehe. Wenn man denen Beachtung schenkt, Richard, dann lassen sie einen nie mehr in Frieden. Eigentlich haben die alle ein Zuhause. Wenn sie erst mal ausgeschlafen hat, geht’s ihr bestimmt wieder gut.« Sie? Richard sah genauer hin. Es war ein Mädchen. Jessica sprach weiter: »Also, ich habe Mister Stockton gesagt, dass wir –« Richard war auf ein Knie gesunken. »Richard. Was tust du da?«
»Sie ist nicht betrunken«, sagte er. »Sie ist verletzt.« Er sah auf seine Finger. »Sie blutet.«
Jessica schaute auf ihn herab, nervös und verwirrt. »Wir kommen zu spät.«
»Sie ist verletzt.«
Jessica sah wieder das Mädchen auf dem Gehsteig an. Prioritäten. Richard hatte keine Prioritäten. »Richard. Wir kommen zu spät. Jemand anderes wird vorbeikommen; jemand anderes wird ihr helfen.«
Das Gesicht des Mädchens war dreckverkrustet, und ihre Kleider waren nass vor Blut.
»Sie ist verletzt«, sagte er bloß. Auf seinem Gesicht war ein Ausdruck, den Jessica noch nie gesehen hatte.
»Richard«, warnte sie ihn, dann gab sie ein wenig nach und bot einen Kompromiss an. »Dann wähl die neun-neun-neun und ruf einen Krankenwagen. Aber mach schnell.«
Plötzlich öffneten sich die Augen des Mädchens, weiß und weit in einem Gesicht, das nicht viel mehr war als verschmierter Staub und Blut. »Kein Krankenhaus, bitte. Sie werden mich finden. Bringt mich irgendwohin, wo es sicher ist. Bitte.« Ihre Stimme klang schwach.
»Du blutest«, sagte Richard. Er versuchte zu erkennen, von wo sie gekommen war, doch die Mauer war blanker Backstein, ohne jede Lücke. Er fragte die reglose Gestalt: »Wieso kein Krankenhaus?«
»Helft ihr mir?«, flüsterte das Mädchen, und ihre Augen fielen zu.
Wieder fragte er sie: »Wieso willst du nicht in ein Krankenhaus?« Diesmal kam keine Antwort.
»Wenn du den Krankenwagen rufst«, sagte Jessica, »gib nicht deinen Namen an. Sonst musst du vielleicht eine Aussage machen oder so, und dann kommen wir zu spät, und ich lasse mir diesen Abend nicht ruinieren von … Richard? Was tust du?«
Richard hatte das Mädchen hochgehoben und hielt es in seinen Armen. Sie war überraschend leicht. »Ich bringe sie in meine Wohnung, Jess. Ich kann sie nicht einfach hier liegen lassen. Sag Mister Stockton, dass es mir wirklich leidtut, aber es war ein Notfall. Das wird er sicher verstehen.«
»Richard Oliver Mayhew«, sagte Jessica kühl. »Du legst jetzt diese junge Person ab und kommst auf der Stelle mit mir. Oder diese Verlobung ist jetzt und auf der Stelle beendet. Ich warne dich.«
Richard spürte, wie die klebrige Wärme von Blut in sein Hemd sickerte. Manchmal, wurde ihm klar, kann man einfach nichts machen. Er ging los.
Jessica stand dort auf dem Gehsteig, sah zu, wie er ihren großen Abend ruinierte, und Tränen brannten ihr in den Augen. Nach einer Weile war er außer Sicht, und jetzt, nur jetzt, entfuhr ihr, laut und deutlich, ein wenig damenhaftes »Scheiße!«, und dann knallte sie ihre Handtasche so hart sie konnte auf den Boden, so hart, dass sich ihr Mobiltelefon und ihr Lippenstift und ihr Kalender und eine Handvoll Tampons auf dem Asphalt verteilten. Und weil nichts anderes zu tun blieb, sammelte sie alles wieder auf und steckte es zurück in ihre Handtasche und lief zum Restaurant, um auf Mr. Stockton zu warten.
Später, als sie an ihrem Weißwein nippte, versuchte sie sich plausible Gründe auszudenken, wieso ihr Verlobter nicht mit ihr dort war, und sie erwischte sich dabei, wie sie verzweifelt erwog, einfach zu behaupten, Richard sei verstorben.
»Es kam ganz unerwartet«, flüsterte Jessica wehmutsvoll.
Richard blieb an keinem Punkt seines Marsches stehen, um nachzudenken. Sein Wille hatte keine Kontrolle über das, was er tat. Irgendwo in dem vernünftigen Teil seines Kopfes sagte ihm jemand – ein normaler, vernünftiger Richard Mayhew –, wie lächerlich er sich gerade verhielt: dass er einfach die Polizei hätte rufen sollen oder einen Krankenwagen; dass es gefährlich war, einen verletzten Menschen hochzuheben; dass er Jessica wirklich, ernstlich, voll und ganz vor den Kopf gestoßen hatte; dass er heute Nacht auf dem Sofa würde schlafen müssen; dass er gerade seinen einzigen guten Anzug ruinierte; dass das Mädchen ziemlich widerwärtig roch … doch Richard ertappte sich dabei, wie er einen Fuß vor den anderen setzte und mit krampfenden Armen und schmerzendem Rücken, die Blicke der Passanten ignorierend, einfach immer weiterging. Und irgendwann stand er vor der Eingangstür seines Hauses, und er stolperte die Treppe hinauf, und dann stand er vor der Tür zu seiner Wohnung, und ihm fiel ein, dass er die Schlüssel auf dem Flurtisch in der Wohnung vergessen hatte …
Das Mädchen streckte eine dreckige Hand in Richtung Tür aus, und sie schwang auf.
Hätte nie gedacht, dass ich mich mal freue, dass die Tür nicht richtig schließt, dachte Richard, trug das Mädchen hinein, schloss mit dem Fuß die Tür hinter ihnen und legte sie auf sein Bett. Die Vorderseite seines Hemdes war voller Blut.
Sie schien halb bei Bewusstsein zu sein; ihre Lider waren geschlossen, aber flatterten. Er schälte sie aus ihrer Lederjacke. Über ihren linken Oberarm und die Schulter zog sich eine lange Schnittwunde. Richard kam wieder zu Atem. »Pass auf, ich rufe jetzt einen Arzt«, sagte er leise. »Kannst du mich hören?«
Ihre Augen öffneten sich, weit und verängstigt. »Bitte, nein. Das wird wieder. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich brauche nur Schlaf. Keine Ärzte.«
»Aber dein Arm … deine Schulter …«
»Das wird wieder. Morgen. Bitte?« Es war nicht viel mehr als ein Raunen.
»Ähm, na dann, alles klar.« Und weil die Vernunft sich zurückzumelden begann, sagte er: »Darf ich fragen …?«
Doch sie schlief bereits. Richard holte einen alten Schulschal aus seinem Schrank und wickelte ihn fest um ihren linken Oberarm und die Schulter; er wollte nicht, dass sie auf seinem Bett verblutete, bevor er sie zu einem Arzt bringen konnte. Und dann schlich er auf Zehenspitzen aus seinem Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich. Er setzte sich aufs Sofa vor den Fernseher und fragte sich, was er da gerade getan hatte.
2
Er ist irgendwo tief unter der Erde: in einem Tunnel vielleicht oder einem Abwasserkanal. Licht flackert immer wieder auf und betont eher die Dunkelheit, anstatt sie zu vertreiben. Er ist nicht allein. Neben ihm gehen weitere Menschen, auch wenn er ihre Gesichter nicht sehen kann. Sie rennen mitten durch den Abwasserkanal, platschen durch den Schlamm und den Dreck. Wassertröpfchen fallen langsam durch die Luft, kristallklar in der Dunkelheit.
Er biegt um eine Ecke, und da wartet die Bestie auf ihn.
Sie ist riesig. Sie füllt den Kanal ganz aus; der gewaltige Kopf gesenkt, der Körper borstig und der Atem in der kühlen Luft dampfend. Eine Art Keiler, denkt er zunächst, und dann wird ihm klar, dass das Unsinn sein muss: Kein Keiler könnte je so groß sein. Die Bestie ist so groß wie ein Bulle, ein Tiger, ein Auto.
Sie starrt ihn an, und sie verharrt einhundert Jahre lang so, während er seinen Speer hebt. Er blickt auf seine Hand, die den Speer hält, und sieht, dass es nicht seine Hand ist; der Arm ist mit dunklem Pelz besetzt, die Nägel sind beinahe Krallen.
Und dann greift die Bestie an.
Er wirft seinen Speer, doch es ist zu spät, und er spürt, wie die Bestie seine Seite mit rasiermesserscharfen Hauern aufreißt, spürt, wie sein Leben in den Schlamm fließt, und er begreift, dass er mit dem Gesicht voran ins Wasser gefallen ist, das sich von zähen Strudeln erstickenden Blutes dunkelrot verfärbt. Und er versucht zu schreien, er versucht aufzuwachen, doch er atmet nur Schlamm und Blut und Wasser, er spürt nur den Schmerz …
»Schlecht geträumt?«, fragte das Mädchen.
Richard setzte sich auf der Couch auf und schnappte nach Luft. Die Vorhänge waren noch zugezogen, die Lampen und der Fernseher noch an, doch am blassen Licht, das durch die Lücken fiel, erkannte er, dass es Morgen war. Er tastete auf der Couch nach der Fernbedienung, die ihm im Laufe der Nacht ins Kreuz gerutscht war, und schaltete den Fernseher aus.
»Ja«, sagte er. »Irgendwie schon.«
Er wischte sich den Schlafsand aus den Augen und sah sich prüfend an, angenehm überrascht, dass er vor dem Einschlafen wenigstens Schuhe und Jacke ausgezogen hatte. Die Vorderseite seines Hemdes war voller getrocknetem Blut und Dreck. Das obdachlose Mädchen sagte nichts. Sie sah schlecht aus: blass, unter dem Schmutz und dem braun getrockneten Blut, und klein. Sie trug allerlei übereinandergeschichtete Kleidung: merkwürdige Stoffe, schmutziger Samt, dreckige Spitze, Risse und Löcher, durch die man weitere Schichten und Stile erblickte. Sie sieht aus, dachte Richard, als wäre sie nachts in die Abteilung »Geschichte der Mode« des Victoria and Albert Museums eingebrochen und trägt nun all das, was sie dort mitgenommen hat. Ihr kurz geschnittenes Haar starrte vor Schmutz, doch es schien, als versteckte sich unter dem Dreck ein dunkler Rotton.
Wenn es etwas gab, was Richard wirklich hasste, dann waren es Menschen, die Offensichtliches aussprachen: Menschen, die ihm Dinge mitteilten, die er selbst unmöglich übersehen konnte, wie zum Beispiel »Es regnet« oder »Ihre Einkaufstüte ist gerade gerissen, und Ihre Sachen sind in die Pfütze gefallen« oder auch »Oh je. Das hat bestimmt wehgetan«.
»Du bist wach«, sagte Richard, und hasste sich dafür.
»Wessen Baronie ist das?«, fragte das Mädchen. »Wessen Lehnsgut?«
»Äh. Wie bitte?«
Sie sah sich misstrauisch um. »Wo bin ich?«
»Wohnung vier, Newton Mansions, Little Comden Street …« Er sprach nicht weiter. Sie hatte die Vorhänge geöffnet und blinzelte ins kalte Tageslicht. Der recht gewöhnliche Ausblick aus Richards Fenster versetzte das Mädchen in Erstaunen, sie schaute mit aufgerissenen Augen auf die Autos und Busse und das winzige Angebot von Läden da unten – einen Zeitungskiosk, eine Bäckerei, eine Apotheke und ein Spirituosengeschäft.
»Ich bin in Oberlondon«, sagte sie mit leiser Stimme.
»Ja, du bist in London«, sagte Richard und wunderte sich. Wieso ober? »Ich glaube, du hattest gestern Abend eine Art Schock oder so. Das ist ein übler Schnitt an deinem Oberarm.« Er wartete, dass sie etwas dazu sagte, irgendeine Erklärung lieferte. Sie warf ihm einen Blick zu und sah dann wieder auf die Busse und die Ladengeschäfte hinab. Richard fuhr fort: »Ich, äh, hab dich auf dem Gehsteig gefunden. Da war ziemlich viel Blut.«
»Keine Sorge«, sagte sie ernst. »Das meiste Blut war von jemand anderem.«
Sie ließ den Vorhang zufallen. Dann fing sie an, den blutverschmierten und verkrusteten Schal von ihrem Arm zu wickeln. Sie untersuchte den Schnitt und verzog das Gesicht. »Hier müssen wir was unternehmen«, sagte sie. »Kannst du mir dabei helfen?«
Richard hatte allmählich das Gefühl, dass ihm die Sache über den Kopf wuchs. »Mit erster Hilfe kenne ich mich wirklich nicht gut aus.«
»Na«, sagte sie, »wenn du zimperlich bist, musst du nur die Bandagen halten und die Teile abbinden, an die ich nicht herankomme. Du hast doch Bandagen, oder?«
Richard nickte. »Natürlich. Im Verbandskasten. Im Badezimmer. Unter dem Waschbecken.« Und dann ging er in sein Schlafzimmer und zog sich um und fragte sich, ob diese Sauerei auf seinem Hemd (seinem besten Hemd, ein Geschenk von, oh Gott, Jessica, sie würde Zustände kriegen) jemals wieder rausgehen würde.
Das blutige Wasser erinnerte ihn an etwas, eine Art Traum vielleicht, den er einmal gehabt hatte, doch er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, was es war. Er zog den Stöpsel, ließ das Wasser aus dem Becken laufen und füllte es wieder mit sauberem Wasser, dem er einen trüben Spritzer Dettol Desinfektionsmittel hinzufügte: Der scharfe, antiseptische Geruch kam ihm absolut vernünftig und medizinisch vor, ein Heilmittel für die Merkwürdigkeit seiner Situation und seines Gastes. Das Mädchen beugte sich über das Waschbecken, und er spritzte ihr warmes Wasser über Arm und Schulter.
Richard war nicht so zimperlich, wie er selbst geglaubt hatte. Oder vielmehr war er erstaunlich zimperlich, wenn es um Blut auf dem Bildschirm ging: Ein guter Zombiefilm oder sogar eine explizite Arztserie brachten ihn dazu, sich hyperventilierend in eine Ecke zu kauern, mit den Händen vorm Gesicht, und Dinge zu murmeln wie: »Sag mir einfach, wenn’s vorbei ist.« Doch wenn es um echtes Blut ging, echten Schmerz, legte er einfach los und unternahm etwas dagegen. Sie säuberten und bandagierten die Wunde – die weniger schlimm war, als Richard aus der vorherigen Nacht in Erinnerung hatte –, und das Mädchen gab sich größte Mühe, dabei nicht zu zucken. Richard ertappte sich dabei, darüber nachzudenken, wie alt sie wohl sei und wie sie unter dem Schmutz aussehen mochte und wieso sie auf der Straße lebte und –
»Wie heißt du?«, fragte sie.
»Richard. Richard Mayhew. Dick.«
Sie nickte, als würde sie es sich einprägen.
Es klingelte an der Tür. Richard sah auf das Chaos im Badezimmer, auf das Mädchen, und fragte sich, wie all das für einen vernünftigen Außenstehenden aussehen musste. Wie zum Beispiel für … »Oh Gott«, sagte er, das Schlimmste ahnend. »Das ist bestimmt Jess. Die bringt mich um.« Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung. »Pass auf«, wies er das Mädchen an, »du wartest hier drin.«
Er schloss die Tür zum Badezimmer hinter sich und durchquerte den Flur. Dann öffnete er die Wohnungstür und stieß einen gewaltigen, von Herzen kommenden Seufzer der Erleichterung aus. Es war nicht Jessica. Es war – wer genau? Mormonen? Zeugen Jehovas? Die Polizei? Er wusste es nicht. Jedenfalls waren sie zu zweit.
Sie trugen schwarze Anzüge, die ein wenig speckig waren, ein bisschen abgetragen, und sogar Richard, der sich als kleidungstechnischen Analphabeten einschätzte, kam der Schnitt der Jacken irgendwie merkwürdig vor. Es war die Art von Anzügen, die ein Schneider vor zweihundert Jahren angefertigt hätte, wenn man ihm einen modernen Anzug beschrieben hätte, ohne dass er je wirklich einen gesehen hatte. Der Schnitt war falsch, und auch die Details.
Ein Fuchs und ein Wolf, dachte Richard unwillkürlich. Der Mann, der vorn stand, der Fuchs, war ein bisschen kleiner als Richard. Er hatte glattes, fettiges Haar in einem merkwürdigen Orangeton und eine bleiche Gesichtsfarbe; und als Richard die Tür öffnete, lächelte er breit – und einen Sekundenbruchteil zu spät – mit Zähnen, die an einen Autounfall auf dem Friedhof erinnerten.
»Einen guten Morgen, der Herr«, sagte er, »an diesem schönen, wunderbaren Tag.«
»Ah, hallo«, sagte Richard.
»Wir führen eine persönliche Erkundigung von gewissermaßen heikler Natur durch, von Tür zu Tür. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir einträten?«
»Na ja, es passt gerade nicht so gut«, sagte Richard und fragte: »Sind Sie von der Polizei?«
Der zweite Besucher, ein großer Mann, der ihn an einen Wolf erinnerte, mit borstenkurz geschnittenem, grau-schwarzem Haar, stand ein Stück hinter seinem Freund und drückte sich einen Stapel Fotokopien an die Brust. Er hatte bisher nichts gesagt – bloß gewartet, riesengroß und ungerührt. Jetzt lachte er, einmal, tief und dreckig. Dieses Lachen hatte etwas Ungesundes.
»Von der Polizei? Ach«, sagte der kleinere Mann, »dieses Glück können wir nicht für uns beanspruchen. Eine Karriere im Dienste von Recht und Ordnung, zweifellos verlockend, stand nicht in den Karten, die Fortuna meinem Bruder und mir zugeteilt hat. Nein, wir sind bloß Privatpersonen. Erlauben Sie mir, uns vorzustellen: Ich bin Mister Croup, und dieser Gentleman ist mein Bruder, Mister Vandemar.«
Sie sahen nicht aus wie Brüder. Sie sahen überhaupt nicht wie irgendetwas aus, das Richard je gesehen hatte.
»Ihr Bruder?«, fragte Richard. »Müssten Sie dann nicht denselben Nachnamen haben?«
»Ich bin beeindruckt. Welch Verstand, Mister Vandemar. Wach und präzise wird dem nicht ansatzweise gerecht. Manche von uns zeichnet eine solche Schärfe aus …«, sagte der Fuchsige, wobei er sich vorbeugte und auf Zehenspitzen ganz nah an Richards Gesicht herankam. »Wir könnten uns glatt daran schneiden.«
Richard trat unfreiwillig einen Schritt zurück.
»Dürfen wir eintreten?«, fragte Mr. Croup.
»Was wollen Sie?«
Mr. Croup seufzte, auf eine, wie er offenbar zu denken schien, ausgesprochen wehmutsvolle Weise. »Wir suchen nach unserer Schwester. Ein widerspenstiges Mädchen, böswillig und eigensinnig, das unserer armen, verwitweten Mutter beinahe das Herz gebrochen hat.«
»Weggelaufen«, sagte Mr. Vandemar leise und steckte Richard ein fotokopiertes Blatt Papier in die Hand. »Sie ist ein wenig … komisch«, fügte er hinzu, und dann ließ er einen Finger vor seiner Schläfe kreisen, um anzudeuten, dass das Mädchen komplett wahnsinnig war.
Richard sah sich das Blatt an.
Darauf stand:
HABEN SIE DIESES MÄDCHEN GESEHEN?
Darunter war ein kopiertes, graues Foto eines Mädchens abgedruckt, das für Richard recht eindeutig wie eine ordentlichere, sauberere, längerhaarige Version der jungen Dame aussah, die er in seinem Badezimmer zurückgelassen hatte.
Darunter stand:
HÖRT AUF DEN NAMEN DOREEN. BEISST UND TRITT. WEGGELAUFEN.
SAGEN SIE UNS BESCHEID, WENN SIE SIE GESEHEN HABEN. WOLLEN SIE ZURÜCK. BELOHNUNG.
Und darunter wiederum eine Telefonnummer. Richard sah sich noch einmal das Foto an. Es war definitiv das Mädchen in seinem Badezimmer.
»Nein«, sagte er. »Die habe ich nicht gesehen. Tut mir leid.«
Mr. Vandemar hörte ihm nicht zu. Er hatte den Kopf gehoben und schnupperte, wie ein Mann, der etwas Sonderbares oder Unangenehmes roch. Richard streckte die Hand aus, um ihm das Blatt Papier zurückzugeben, doch der große Mann schob sich einfach an ihm vorbei und trat in die Wohnung, ein Wolf auf der Jagd.
Richard lief hinter ihm her. »Was machen Sie denn da? Lassen Sie das! Raus! Nein, Sie können da nicht rein –« Mr. Vandemar steuerte geradewegs auf das Badezimmer zu. Richard hoffte, dass das Mädchen – Doreen? – geistesgegenwärtig genug gewesen war, die Badezimmertür abzuschließen. Doch nein; die Tür öffnete sich, als Mr. Vandemar dagegendrückte. Er ging hinein, und Richard, der sich wie ein kleiner und untauglicher Hund vorkam, der die Fersen des Postboten ankläffte, folgte ihm.