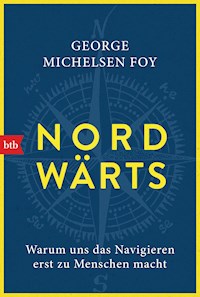
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Sich orientieren zu können ist eine der wichtigsten menschlichen Eigenschaften überhaupt, ob im dunklen Hausflur oder als Pilot eines Jumbojets. Doch wie beeinflusst das Navigieren unsere Gehirne, unser Gedächtnis und unseren Alltag? In einer faszinierenden Mischung aus persönlicher Erzählung und wissenschaftlichen Fakten begibt sich George Michelsen Foy auf die Suche nach dem Geheimnis um den tragischen Tod seines Ur-Ur-Großvaters, der 1844 bei einem Schiffsunglück ums Leben kam. Durch seine Geschichte zeigt uns Foy letztlich, wie die Orientierung unseren Alltag bestimmt – und dass diese besondere Fähigkeit heute bedrohter ist denn je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Ähnliche
Zum Buch
Sich orientieren zu können ist eine der wichtigsten menschlichen Eigenschaften überhaupt, ob im dunklen Hausflur oder als Pilot eines Jumbojets. Doch wie beeinflusst das Navigieren unsere Gehirne, unser Gedächtnis und unseren Alltag? In einer faszinierenden Mischung aus persönlicher Erzählung und wissenschaftlichen Fakten begibt sich George Michelsen Foy auf die Suche nach dem Geheimnis um den tragischen Tod seines Ururgroßvaters, der 1844 bei einem Schiffsunglück ums Leben kam. Durch seine Geschichte zeigt uns Foy letztlich, wie die Orientierung unseren Alltag bestimmt – und dass diese besondere Fähigkeit heute bedrohter ist denn je.
Zum Autor
GEORGE MICHELSEN FOY, Jahrgang 1952, lehrt Kreatives Schreiben an der New York University und ist Autor zahlreicher Romane und Sachbücher. Er war Stipendiat des National Endowment for the Arts und schreibt u. a. für den »Rolling Stone«, »Boston Globe«, »Harper’s« und die »New York Times«. Als passionierter Segler, der bereits als Maat auf Frachtern in der Nordsee und als Kapitän eines eigenen Fangschiffs vor der Ostküste Nordamerikas zur See fuhr, lag es für ihn nahe, sich irgendwann auch dem Thema Seefahrt zu widmen. George Michelsen Foy lebt mit seiner Familie in Cape Cod, Massachusetts, und in New York.
George Michelsen Foy
NORDWÄRTS
Warum uns das Navigieren erst zu Menschen macht
Aus dem Amerikanischen von Leon Mengden
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Finding North«im Verlag Flatiron Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe August 2019
Copyright © 2016 by George Michelsen Foy
Copyright © 2019 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by arrangement with Flatiron Books. All rights reserved.
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Shutterstock/Mariia Burachenko; Shutterstock/arigato
Redaktion: Joern Rauser, Rauser & Madlung Lektorate
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-19394-2V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für meine Familie
Inhalt
1 Angst
2 Die Stavanger Paquet
3 Die Vögel, die Erinnerung und die Londoner Taxifahrer
4 Auf den Spuren meines Ururgroßvaters
5 An der Kultstätte der Götter der Navigation
6 Das »Entdecker-Gen«
7 Abenteuer im GPS-Handel
8 Stellares Kuddelmuddel
9 Navigation und Sex
10 Schlechte Breite
11 Colorado: Das dunkle Herz des GPS
12 Entdeckungen auf der Seekarte
13 Odysseus in Haiti
14 Der Aufbruch
15 Die Schattenseite der Cybernavigation
16 Auf See
17 Navigieren oder sterben?
18 Die Reise – und was es davon zu berichten gibt
19 Die Politik der Navigation
20 Halvors Hochzeit
21 Nordwärts
Danksagung
Anmerkungen
1 Angst
Am Anfang dieser Geschichte steht, wie bei so vielen Geschichten, die Angst – die Urangst, die auf jenen Augenblick vor einer so endlos langen Zeit zurückgeht, als wir aus dem Mutterleib hervorgezogen wurden und uns in einer gänzlich unvertrauten Umgebung wiederfanden, deren grelle Helligkeit uns blendete und in der wir uns, umgeben von lauter fremden Wesen, irgendwie zurechtfinden mussten.
»Wohin« lautet die vordringlichste Frage einer jeden Kreatur, wenn es darum geht, dem Angriff eines Widersachers entweder zu entgehen oder sich ihm durch Gegenwehr zu stellen – und eben nicht »wann«, »wie« oder »wer«. Die Beantwortung dieser Frage ist seit jeher der erste Schritt zum Überleben. Vom Anbeginn unseres Daseins war die Navigation, die Kunst der Bestimmung des eigenen Standorts und der Entscheidung, in welcher Richtung es nun weitergehen sollte, unser Schlüssel zum Selbsterhalt.
Ich weiß nur zu gut, dass ich Schwierigkeiten damit habe, mich zu orientieren. Erst neulich wieder ist es mir gegen Ende einer langen nächtlichen Autofahrt, die mich von New York City über die Interstate 195 in den Südosten von Massachusetts führte, passiert, dass ich auf einmal merkte, wie mir die Augen zuzufallen drohten; also steuerte ich den nächsten Rastplatz an, schaltete den Motor aus und schlief sofort ein. Als ich wieder aufwachte, hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wo ich mich befand oder wie ich dort hingekommen war: Warum saß ich in tiefster Dunkelheit zusammengekrümmt in diesem engen, kalten Raum? In diesem Augenblick hätte ich sonst wo sein können: von Außerirdischen entführt – oder das Gedächtnis verloren haben und nach Turkmenistan verschleppt worden sein. In gewisser Weise war ich wieder so hilflos wie ein neugeborenes Kind. Und da ergriff urplötzlich eine ganz eigentümliche Angst Besitz von mir, die mich mehrere Minuten lang davon abhielt, um Hilfe zu rufen oder mich von der Stelle zu rühren – oder jedenfalls kam es mir so vor; in Wirklichkeit mögen wahrscheinlich bloß ein paar Sekunden vergangen sein. Aber diese Panikattacke wurde noch durch die unvermittelt aufflackernde Erinnerung an ähnliche Situationen verschlimmert, in denen es mich an Orte verschlagen hatte, die zwar nicht von dem Dunstschleier einer bleiernen Müdigkeit weichgezeichnet waren, an die ich mich aber nur noch undeutlich erinnern konnte.
Dieses Gefühl korrespondierte mit dem jähen Entsetzen, mit dem ich blitzschnell eine Bestandsaufnahme dessen vornahm, was ich erkennen oder ertasten konnte, nachdem die Panik das motorische Zentrum meines Nervensystems lahmgelegt hatte: das Lenkrad, die Windschutzscheibe und dahinter den hoch aufragenden Pfosten der Straßenbeleuchtung und den dunklen Schatten eines Kiefernwäldchens. Ich weiß noch genau, welche Erleichterung mich durchströmte, als sich auf meiner geistigen Landkarte geophysikalische Anhaltspunkte miteinander verknüpften, anhand derer ich eine zuverlässige Positionsbestimmung vornehmen konnte. So setzte auch die damit verbundene Erinnerung wieder ein – an das Auto, an den Rastplatz und an die Straße. Die Umgebung kam mir vertraut vor; ich konnte also nicht mehr allzu weit von meinem heimischen Herd entfernt sein, und wie sich denn auch bald herausstellte, trennte mich bloß noch eine knappe Dreiviertelstunde in östlicher Richtung von dem Haus, in dem mein todkranker Bruder auf mein Eintreffen wartete.
Das Leben bringt ständige Veränderungen – und darum Bewegung – mit sich; und da es sich beim Navigieren um die Kunst der Berechnung des Punktes handelt, an dem wir uns befinden, ferner des Weges, der uns an diesen Punkt geführt hat, und schließlich der Strecke, auf der wir unseren Weg fortsetzen werden, scheint es keineswegs übertrieben, wenn wir behaupten, dass Navigation in ihren unendlich vielfältigen Formen nicht bloß ein immens wichtiges Überlebenswerkzeug, sondern sogar den Dreh- und Angelpunkt des Lebens an sich darstellt. Unter den gängigen Vorstellungen von dem, was das Leben ausmacht, steht das Wissen um unseren Standort darin und den einzuschlagenden Weg zur Erreichung eines bestimmten Zieles an vorderer Stelle. »Das Gehirn hat sich nicht entwickelt, um die Welt wahrzunehmen und zu denken. Wir haben unser Gehirn aus einem einzigen Grund, nämlich, um anpassungsfähige und komplexe Bewegungen auszuführen«1, hat Daniel Wolpert, Neurowissenschaftler an der Universität von Cambridge, einmal gesagt. Indem man Bewegung erzeugt, findet man zu einer Position und einer Richtung. Durch das Navigieren hat sich unser Gehirn erst entwickelt.
Navigation ist ein so unabdingbarer Bestandteil unseres Lebens – und dabei in allen seinen Entwicklungsphasen so selbstverständlich –, dass wir sie nur selten als das erkennen, was sie ist. Darin geht es uns ähnlich wie den sprichwörtlichen Blinden, die einen Elefanten an verschiedenen Stellen berühren und dann zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen, um was es sich dabei handelt – einen Torbogen, eine Mauer oder einen Feuerwehrschlauch. Wir navigieren, wenn wir das Büro des Kollegen Smith in einem Flügel des Firmengebäudes suchen, in dem wir noch nie gewesen sind; wir navigieren, wenn wir an der Ostküste der Vereinigten Staaten vorhaben, einem Freund in San Francisco eine E-Mail zu schicken und ihn uns dabei im Dunkel der einsetzenden Abenddämmerung dreitausend Meilen weit entfernt in Massachusetts vor unserem geistigen Auge vorstellen. Selbst wenn wir um drei Uhr morgens an einem uns vertrauten Ort aufwachen, weil uns der Sinn nach einem Glas Wasser steht, setzen wir automatisch unsere navigatorischen Fähigkeiten ein, um nach und nach die dazu erforderlichen Schritte auszuführen: Wir rollen uns vom Bett herunter, stolpern an der Kommode vorbei und über die im Zimmer verteilten Joggingschuhe hinweg, verlassen das Schlafzimmer durch die Tür und biegen dann nach links ab, wobei wir einen Arm ausgestreckt halten, um uns im dunklen Flur mit den Fingern an der Wand entlangzutasten, bis wir den Wasserhahn in der Küche erreicht haben. Dieser Vorgang läuft so unbewusst ab, dass wir für denjenigen, der nun behaupten wollte, wir würden uns durch unsere eigenen vier Wände navigieren, vermutlich nur ein mitleidiges Lächeln übrig hätten.
Und doch führen während der kurzen Reise von unserem Bett zum Spülbecken das Bewegungs- und das Speicherzentrum unseres Gehirns eine ganze Reihe von Berechnungen durch, die die Entfernung, den Kurs und – anhand von passierten Wegpunkten – die voraussichtliche Restdauer des Weges betreffen. Ihre Komplexität wird nicht etwa dadurch gemindert, dass wir uns ihrer überhaupt nicht bewusst sind; sie entsprechen – auch, was, jedenfalls relativ gesehen, ihre Zuverlässigkeit anbelangt – weitgehend denen, die ein Navigator im Zweiten Weltkrieg mit Hilfe von Kursdreieck, Bleistift und Generalstabskarte anstellte, um die Flugroute eines Bombers von Südengland nach Berlin und zurück zu berechnen.
Mein Erlebnis auf der Route 195 hat mich einigermaßen mitgenommen, obwohl ich während der bisherigen etwas mehr als dreißig Jahre meines Erwachsenenlebens allerhand herumgekommen und an vielen ungewöhnlichen Orten aufgewacht bin: in einem Maisfeld im Südwesten Frankreichs; in einem indonesischen Bordell; auf dem Dach eines Hauses in Damaskus sowie nach einer leichtsinnigerweise durchfeierten Nacht in einem U-Bahn-Waggon in der Bronx; doch generell kann man sagen, dass ich mir stets bewusst gewesen bin, was oder wen ich vorfinden würde, sobald ich meine Augen öffnete.
Wenn ich heute an dieses Erlebnis zurückdenke, sehe ich es so, dass es nicht der Augenblick des Erwachens war, der mir so sehr zugesetzt hatte, sondern vielmehr der damit verbundene panische Schrecken. Denn ich war schon bei zwei früheren Gelegenheiten in eine solch extreme, geradezu lähmende Panik versetzt gewesen, und beide Male war sie dadurch ausgelöst worden, dass ich die Orientierung verloren hatte.
Die darauffolgenden Monate sind von aufgewühlten Gefühlen und von Verlustschmerz geprägt. Mein Bruder stirbt, und meine Frau und die Kinder und ich müssen nicht nur mit dem emotionalen Schock, sondern auch mit den rechtlichen und finanziellen Folgen seines Todes fertigwerden. Wenn ich mich bisweilen gedanklich von den alltäglich notwendigen Tätigkeiten, die unser Leben bestimmen, losreiße und mir vor Augen führe, dass Louis nicht mehr bei uns ist, bekomme ich das Gefühl, mich zu verlieren – so wie damals auf der Route 195. Rührt daher vielleicht meine zunehmende Entschlossenheit, nicht bloß der Ursache für meine Neigung zu navigatorischen Zusammenbrüchen auf die Spur zu kommen, sondern möglichst alles über die Kunst der Navigation, die so bestimmend für unser Leben ist, in Erfahrung zu bringen? Oder sollte man im Gegensatz dazu meinen, dass ich mich trotz jener Erfahrung nicht von meinem Vorhaben abbringen lassen will?
Ich finde die Vorstellung, nach den Gründen für ein solches persönliches Defizit zu forschen, allerdings nicht übermäßig erhebend. Also beschließe ich stattdessen, meine Nachforschungen an einem Punkt zu beginnen, der so weit als nur möglich vom Spektrum unseres Bewusstseins entfernt ist, und zwar auf der Ebene einer Zelle, die noch in der Entwicklung begriffen ist und nicht einmal weiß, in welchem Teil des Körpers sich der ihr zugewiesene Platz befindet. Während ich diverse wissenschaftliche Abhandlungen aus Deutschland, Israel und Taiwan sichte, stelle ich zufällig fest, dass eine der bedeutendsten Koryphäen auf dem Gebiet der Zellforschung an derselben Hochschule lehrt wie ich; also mache ich mit Dr. Stephen Small von der New York University in Manhattan einen Termin aus.
Um zu Dr. Small zu kommen, muss ich mich auf den Weg zu ihm machen, also navigieren. Von unserem Haus im Südosten von Massachusetts ausgehend folge ich zunächst der Interstate 195, um dann in Providence, Rhode Island, auf die Interstate in Richtung New York zu wechseln. Ich habe kein Navigationsgerät in meinem Wagen, also orientiere ich mich an dem in meinem Jeep eingebauten Kreiselkompass und am Stand der Sonne auf ihrem Weg gen Südwesten. Sobald ich in Manhattan bin, kenne ich mich auch schon wieder aus und finde problemlos zu einer Straße in der Nähe der White Horse Tavern in Greenwich Village. Dort suche ich mir einen Parkplatz und gehe zu Fuß weiter in südöstlicher Richtung auf den Campus der New York University zu, der sich auf mehrere Gebäude in den Straßen um den Washington Square herum verteilt. Ich finde den Weg zu meinem Ziel, indem ich bestimmte Orientierungspunkte und geografische Muster wiedererkenne und sie dann mit einer Landkarte oder einem Stadtplan in meinem Kopf abgleiche. Diesen Vorgang bezeichnet die Wissenschaft als »Vektororientierung« oder auch als »Pfadintegration«; er ist die Grundlage dessen, was man gemeinhin als Orientierungsgabe bezeichnet.
Auch Stephen Smalls Arbeit befasst sich mit dem Orientierungssinn, allerdings auf einer etwas grundlegenderen Ebene. Als Leiter der biologischen Fakultät der NYU untersteht ihm ein Forschungslabor, in dem man hinter das Geheimnis zu kommen sucht, wie sich eine beliebige Zelle ihren Weg durch den Fötus sucht, um Teil des linken Auges, der Leber oder eines Zehs am rechten Fuß zu werden.
Small ist ein drahtiger Typ, misst stolze einsneunzig und sprüht nur so vor Energie; er verfügt über ein Lächeln, das einen sofort für ihn einnimmt, hat ein umgängliches Wesen und trägt sein graues Haar kurz geschnitten. Er empfängt mich in seinem Eckbüro in der obersten Etage des Silver Building der Universität von New York City. Von diesem geradezu göttlichen Aussichtspunkt beobachte ich, wie die stecknadelkopfgroßen Touristen unten durch den Washington Square Park schlendern.
Small führt mich in das Forschungszentrum für Entwicklungsbiologie im angrenzenden Brown Building. Schwere Stahltüren schützen das Institut vor unerwünschten Besuchern; sieht man dann die grau und weiß getünchten Wände dahinter, kommt man sich erst recht wie in einer Anstalt vor. Bis an die Decke reichende Regale sind mit Glasbehältern, Glasröhrchen und Flaschen vollgestellt, allesamt nummeriert und mit farbigen Etiketten gekennzeichnet; an den Arbeitsplätzen davor stehen Mikroskope, Computer und weitere Glasröhrchen. An winzigen Apparatschaften blinken Kontrolllämpchen in unterschiedlichen Rhythmen; Dutzende von Doktoranden sind eifrig damit beschäftigt, irgendwelche Justierungen vorzunehmen, die mir natürlich nichts sagen.
Viele seiner Experimente führt Small mit der Drosophila melanogaster durch, der gemeinen Obstfliege, einem Insekt aus der Familie der Taufliegen. Diese Fliegen entstehen nämlich aus relativ großen Larven, an denen es sich gut herumdoktern lässt. Regelmäßig sind Millionen Exemplare davon als unfreiwillige Rekruten Bestandteil der Forschungsarbeit des Institutes. In einer Kammer mit einer konstanten Raumtemperatur von vierundsechzig Grad Fahrenheit – knapp achtzehn Grad Celsius – wird der durchschnittliche Lebenszyklus der Insekten verkürzt; von einem der Regale in diesem Raum nimmt Small ein ungefähr sechs Zentimeter langes Glasröhrchen.
Darin sind die entscheidenden Entwicklungsstadien im Leben einer Obstfliege kondensiert. Obstfliegen im Teenageralter – kaum einen Millimeter lange, winzige braune Maden – krabbeln rebellisch unterhalb des Verschlusses herum. »Sehen Sie diese winzigen weißen Pünktchen?«, fragt Small und zeigt dabei auf den Boden des Röhrchens. »Das sind die Embryonen.« Dann wendet er sich an einen seiner Assistenten: »Haben Sie mal ein Präparat für mich?« Nachdem er eine Weile in allerhand Kästchen herumgesucht hat, reicht ihm der junge Mann ein durchsichtiges Rechteck, das Small unter das Objektiv eines der Mikroskope schiebt. Dann winkt er mich zu sich heran. »Schauen Sie mal hier«, sagt er. »Ist das nicht schön?«
Es ist in der Tat hübsch anzusehen. Mehrere Hundert Obstfliegenembryos schwimmen auf der wässrigen Lösung des Objektträgers, und jedes einzelne stellt ein mit Tausenden von winzigen Flecken durchsetztes ovales Gebilde dar, und jedes einzelne dieser Fleckchen ist ein Zellkern. Und jeder dieser Zellkerne enthält wiederum eine bestimmte Menge eines Proteins namens Bicoid, wobei die Zellkerne an dem einen Ende des Embryos so viel Bicoid in sich gespeichert haben, dass sie beinahe schwarz erscheinen; allerdings verdünnt sich diese Konzentration zum anderen Ende hin zunehmend, sodass ein bemerkenswert gleichmäßiger Übergang von hell zu dunkel entsteht. Der Effekt erinnert an einen winterlichen Sonnenuntergang, bei dem die Schneewolken so dicht sind, dass die Färbung des Himmels allmählich von einem lichten Silberschein am oberen Rand, wo die Sonnenstrahlen ihre Wirkung noch entfalten können, zu einer zunehmenden Verdunkelung dort, wo am Horizont die Nacht hereinbricht, übergeht – das Bild einer Winterlandschaft, wie der Pointilist Seurat sie gemalt haben könnte, und so, wie seine einzelnen Farbtupfer zusammengenommen erst ein Gemälde bilden, so hat auch hier jedes Fleckchen seine ganz entscheidende Aufgabe zu erfüllen.
»Was Sie da vor sich sehen, ist ein Morphogengefälle, auch Morphogengradient genannt«, erklärt mir Small. Es könne wohl kaum ein anschaulicheres und überzeugenderes Beispiel für eine Positionsbestimmung auf der Grundlage des Erkennens von verschieden hohen Proteinkonzentrationen geben. Morphogen ist ein Signalstoff, ein Molekül, das sich in benachbartes Gewebe ausbreitet; abhängig von seiner Konzentration in den umgebenden Gewebezellen vermittelt das Morphogen durch das Maß seiner Entfernung von der Quelle eine Art Positionsinformation, sodass die sich entwickelnden Zellen, quasi dem in ihrer DNA gespeicherten Navigationssystem folgend, zur Außenseite, der Peripherie des Embryos wandern, wo bereits unterschiedliche Grade an Bicoid konzentriert sind – entsprechend hoch nahe der Quelle und weniger hoch in zunehmender Entfernung von ihr.
Man muss sich die Zelle wie den Besucher eines Wirtshauses vorstellen, der einen Platz am Tresen ergattern möchte; dieser Tresen ist an dem einen Ende ziemlich belagert, während sich der Andrang der Gäste zum anderen Ende hin zunehmend in Maßen hält; der Erfolg auf der Suche nach einem Platz wird also von der Konzentration der Gäste an dem Punkt des Bartresens abhängen, an dem sich der neu hinzugekommene Gast gerade befindet. Und auf die gleiche Weise wird die Position, die die Zelle an der Peripherie findet – und somit die exakte Konzentration von Morphogen –, bestimmen, welche Strukturen in der Zelle des sich entwickelnden Insekts an exakt dieser Stelle der Zellmembran, mit der sich die Zelle von ihrer Umgebung abgrenzt, entwickelt werden.
Der Blick in das Okular eines weiteren Mikroskops offenbart Embryonen an einem weiter fortgeschrittenen Punkt ihrer Entwicklung. Hier sieht man in jedem Embryo eine Reihe schwarzer Furchen, die im rechten Winkel von der Längsachse des Embryos, also quasi seiner Bauchseite, abgehen. Dies sind Zellen, die ihren Weg zu einer bestimmten Position des Morphogengradienten – oder, um bei unserem Bild zu bleiben, am Bartresen – gefunden haben und sich von hier aus zu einem Flügel, einem Auge oder einem Fühler weiterentwickeln, je nachdem. Das dadurch entstehende Muster erinnert an einen Strichcode, der in einem durchsichtigen Ballon eingeschlossen ist.
Die Forschungen von Wissenschaftlern wie Small und seinen Kollegen sind von ebenso essenzieller Wichtigkeit wie die Orientierung eines jeden Lebewesens in seiner Umgebung überhaupt. Wenn sich entwickelnde Zellen so bewegen, wie es sein sollte, nämlich auf die verschiedenen Sektoren des Morphogengradienten zu, entsteht aus dem Embryo eine ganz gewöhnliche Obstfliege – oder eben ein Hund oder ein Mensch. Geht das jedoch nicht seinen vorgeschriebenen Weg, können monströse Fehlentwicklungen die Folge sein. In dieser sehr frühen Phase des Lebens können eine schiefgegangene Navigation oder ein derangierter »Strichcode« gravierende genetische Defekte zur Folge haben; Smalls Forschungen aber dienen dazu, uns eines Tages zu einem Verständnis dessen zu führen, wie solche Defekte zustande kommen und wie sie verhindert werden können.
Der Zelle ist es egal, ob aus ihr eine Larve, ein Embryo oder ein Monstrum erwächst, denn die Zelle weiß nicht, was sie tut und hat auch kein Mitspracherecht dabei, was aus ihr wird.
Als ich Smalls Institut verlasse, verlaufe ich mich – wie es einem halt passiert. Das Silver Building und das Brown Building waren ursprünglich zwei nebeneinanderliegende, aber separate Gebäude, und obwohl sie inzwischen miteinander verbunden sind, befinden sich die jeweiligen Stockwerke doch nicht auf ein- und derselben Ebene, sodass die oberste Etage des Silver sechs Fuß über der entsprechenden Etage des Brown liegt. Aus reiner Bequemlichkeit entschließe ich mich, nicht wieder die Stufen zurück und hinauf in das Silver Building zu steigen, von wo wir gekommen waren, sondern mich stattdessen eine Etage tiefer zu begeben – wo ich vor einer verschlossenen Tür stehe, die mir den Weg zurück ins Nachbargebäude versperrt. Also gehe ich noch eine Treppe tiefer in das darunterliegende Stockwerk, wo ich zwar eine unverschlossene Tür finde, hinter der ich aber wiederum auf eine verwirrende Anordnung verschiedener Korridore mit lauter verriegelten Türen stoße, sodass ich schon sehr bald überhaupt keine Ahnung mehr habe, in welche Richtung ich mich wenden soll.
In diesem Moment fällt mir etwas ein: Bevor die NYU die Räume übernahm, beherbergten die obersten Stockwerke des Brown Building die Triangle Shirtwaist Factory. Und diese Erkenntnis versetzt mir so etwas wie einen kleinen Schock, denn wäre ich auf der Suche nach einer Örtlichkeit, die wie keine andere ein Inbegriff dafür ist, wie gefährlich es sein kann, die Orientierung zu verlieren, hätte ich mir kein passenderes Beispiel aussuchen können.
Triangle Shirtwaist war nämlich ein Sweatshop, ein »Schwitzraum«, also ein Billiglohnbetrieb, in dem fast fünfhundert Arbeiterinnen und Arbeiter, hauptsächlich junge Frauen und Mädchen, manche davon erst dreizehn Jahre alt, ausgebeutet wurden, indem man sie – im Schweiße ihres Angesichts – Männerbekleidung herstellen ließ. Als am Nachmittag des 25. März 1911 um 16 Uhr 15 in den Räumen der Textilmanufaktur ein Feuer ausbrach, breiteten sich die Flammen, die in den überall zuhauf herumliegenden Baumwollresten reichlich Nahrung fanden, mit erschreckender Geschwindigkeit auf den drei obersten Stockwerken des Gebäudes aus, das heute unter dem Namen Brown Building bekannt ist.
Max Blanck und Isaac Harris, die Eigentümer von Triangle Shirtwaist, wussten in den Räumlichkeiten ihres Unternehmens gut genug Bescheid, um sich mitsamt ihren Kindern, deren Gouvernante und dem Vorarbeiter auf das Dach retten zu können, von wo aus sie sich in einem angrenzenden Gebäude in Sicherheit brachten. Aussagen von Überlebenden zufolge wäre es durchaus möglich gewesen, dass auch eine gewisse Anzahl von Arbeiterinnen und Arbeitern vor den Flammen und dem Rauch hätten fliehen können, indem sie auf das Dach kletterten, doch war ihnen in ihrem Betrieb nie etwas anderes gezeigt worden als ihr unmittelbarer Arbeitsplatz, sodass nur sehr wenige von ihnen überhaupt wussten, wo ein Fluchtweg zu suchen war. Zwar waren die beiden Notausgänge durchaus als solche gekennzeichnet, doch waren deren Türen verschlossen, um die Arbeiter und Arbeiterinnen daran zu hindern, eine unerlaubte Pause einzulegen oder eventuelles Diebesgut hinauszuschaffen. Da es ihnen nicht möglich war, sich in dem brennenden Gebäude so weit zu orientieren, dass sie einen Ausweg aus den Flammen hätten finden können, ließen 146 Angestellte ihr Leben, weil sie entweder im Haus verbrannten oder den Tod fanden, als sie sich aus den Fenstern stürzten, um dem Feuer zu entkommen: Man fand sie entweder grässlich verstümmelt auf dem Straßenpflaster oder aufgespießt und durchbohrt auf dem Stacheldrahtzaun, der das Grundstück in jenen Jahren umschloss.
Ich für mein Teil finde dann schließlich doch wieder den Weg zurück zum Treppenhaus und hinüber ins Silver Building, wo ich in den Fahrstuhl steige. Ich glaube nicht an übersinnliche Dinge und auch nicht an Geister oder Gespenster, aber ich werde den Gedanken an diesen verheerenden Brand nicht los, und die verzweifelten Schreie der Mädchen, die die Vorstellung davon evoziert, hallen in meinem Kopf wider, als ich in das spätsommerliche New York hinaustrete, das in Sonnenlicht getaucht und von Autohupen und lebhaftem Treiben erfüllt ist. Hier schlägt mir die schweißige Hitze ins Gesicht, und der Geruch von Hot Dogs steigt mir in die Nase. Auf dem Washington Square finde ich eine freie Parkbank, auf der ich mir die Aufzeichnungen noch einmal durchlese, die ich während meines Gesprächs mit Small hastig notiert habe – und um darüber nachzusinnen, was sie mir sagen mögen.
Morphogene haben keine Vorstellung davon, ob sie gut oder schlecht gesteuert werden oder wie die Konsequenzen einer misslungenen Navigation aussehen würden. Zellen, denen natürlich jegliches Bewusstsein abgeht, können nicht über ihr Tun bestimmen und wissen somit auch nichts von der noch so latenten Furcht, die einen überkommt, wenn man sich vor die Entscheidung gestellt sieht: Soll man nach links oder nach rechts rennen, um den Flammen zu entkommen? Soll man oder soll man nicht einen heftigen Wind von Norden einplanen, der das Flugzeug in südliche Richtung abtreiben könnte, wenn man als Pilot die Flugroute nach Berlin berechnet?
Wir Menschen haben uns – im Gegensatz zu den Morphogenen – immer wieder in weitgehendem Maße durch das Wissen definiert, das man braucht, um seine Position zu bestimmen und sich zu unbekannten Gestaden hinauszuwagen – sei es zu Forschungszwecken, um Handel zu treiben oder um Krieg zu führen. Dieses Wissen wurde von Menschen erlangt, die neue Länder oder Erdteile oder Möglichkeiten, aus der Beobachtung der Sterne Erkenntnisse zu ziehen, entdeckt haben – und dies oft um eines hohen Preises willen. Die auf diesem Weg gewonnenen Einsichten vermehrten dann das überlieferte Gesamtgut dessen, was wir über Navigation wissen – sei es durch schriftliche Niederlegung oder durch mündliche Weitergabe der Kunde. Und diese Überlieferung wiederum ermöglichte es der nächsten Generation, weitere Entdeckungen zu machen. Obwohl dieser ganz bewusste, von Abenteuerlust bestimmte Aspekt des Navigierens eigentlich keiner weiteren Erläuterung zu bedürfen scheint, dient er doch dazu, den gewaltigen Unterschied zwischen der drei Meter von mir entfernt sitzenden französischen Mutter, die sich intensiv mit der GPS-Funktion ihres Smartphones beschäftigt, und den Tauben, die ihr Dreijähriger vor sich herjagt, zu beleuchten.
Die Orientierungsgabe, wie sie zum Beispiel Brieftauben, aber auch unzähligen weiteren Lebewesen – wie etwa Seeschwalben und Aalen – zu Eigen ist, funktioniert so differenziert wie präzise und dabei gänzlich instinktiv – so mechanisch und verinnerlicht wie die des Morphogens. Sie dient Lebensformen, die keine Ahnung haben, wieso, ob überhaupt und auf welche Weise sie navigieren, als Leitstern, während wir Menschen mit unseren gewichtigen Gehirnen und unserem ausgefeilten vernunftbegabten Denken unsere natürliche Orientierungsfähigkeit längst eingebüßt haben – und ganz gewiss haben wir eine solche auf einer früheren Stufe unserer Evolution einmal besessen.
Ich frage mich manchmal, ob der Preis, den unsere Spezies dafür bezahlen musste, ein Bewusstsein zu erlangen, nicht in dem Verlust unserer Fähigkeit, uns instinktiv zurechtzufinden, bestanden hat. Oder war – um die Kausalgleichung einmal umzudrehen – der Verlust unserer instinktiven Fähigkeiten und die daraus erwachsene Notwendigkeit, uns Navigationswerkzeuge zuzulegen, der Grund dafür, dass wir überhaupt je ein Bewusstsein erlangt haben? Könnte es sein, dass die Angst, sich zu verlaufen, die verkehrte Richtung einzuschlagen, nicht bloß ein linkisches Nebenprodukt unserer Psyche ist, sondern eine wichtige Komponente unseres Bedürfnisses, uns fortzubewegen?
Falls dies der Fall ist, könnte es meiner Meinung nach erforderlich sein, den Effekt solcher Hilfsmittel wie dem mit GPS ausgestatteten Mobiltelefon, von dem die Maman am Washington Square immer noch wie besessen war, neu zu bewerten. GPS und ähnliche Technologien haben während der vergangenen zwanzig Jahre die hart erkämpften navigatorischen Fähigkeiten des Menschen überflüssig werden lassen. Jeder Einzelne von uns ist, ohne dass uns dies groß aufgefallen wäre und ohne umfängliche Unterweisung, zu einem Navigator geworden, dem Größen auf diesem Gebiet – wie etwa Ferdinand Magellan, James Cook oder Sacajawea, die indianische Sklavin, die seinerzeit die berühmte Expedition von Lewis und Clark westwärts bis zur Pazifikküste geführt hat – kaum das Wasser reichen können. Für den Preis eines Smartphones oder einer Internetverbindung können wir uns mit erstaunlicher Präzision zu jedem Punkt des Globus leiten lassen und brauchen dabei nichts, aber auch gar nichts, darüber zu wissen, wie das möglich geworden ist.
Aber muss für solche Annehmlichkeiten nicht auch ein Preis bezahlt werden? Vergeben wir uns in gewisser Weise etwas, wenn wir all unser Vertrauen auf das GPS und verwandte Technologien setzen? Unterminiert die mit diesen Errungenschaften einhergehende Unmöglichkeit, verloren zu gehen, nicht unsere Fähigkeit, neue Wege zu suchen und zu finden, sowohl topografisch als auch im übertragenen Sinne? Und ist das Unbehagen angesichts unvertrauter Orte – wie etwa die Panik, die mich auf dem Rastplatz ergriff oder sogar die Urangst des Neugeborenen – nicht etwas, dessen wir bedürfen, um unserem Forschungsgeist auch weiterhin frönen zu können oder zu wollen, ob der sich nun auf die Weiten des Weltraumes oder die Dynamik von Quarks richtet? Es scheint mir ausgesprochen wichtig, dass wir einmal untersuchen, wie diese Veränderungen unser Leben beeinflussen.
Langsam senkt sich der Abend über den Washington Square. Die Sonne, die in einer Stunde untergehen wird, dehnt die Schatten der Häuser gen Westen, und die bald einsetzende Dunkelheit sorgt dafür, dass es die Sonnenanbeter aus dem Park zurück nach Brooklyn treibt. Auch mich hält es nicht mehr auf meiner Parkbank, denn ich verspüre ein Bedürfnis zu handeln, das seine Dringlichkeit zu einem gewissen Teil aus der Angst schöpft, die ich einmal empfunden habe.
2 Die Stavanger Paquet
Ich unterrichte Kreatives Schreiben, und wenn mich meine Studenten fragen, worüber sie denn schreiben sollen, sage ich ihnen: »Malt euch eure schwärzesten Ängste aus und fangt damit an.« Das wäre nicht als therapeutische Maßnahme gedacht, füge ich dann rasch hinzu, sondern ein Weg, um zum Kern dessen zu gelangen, was gutes Schreiben ausmacht. Und auf diesem Weg müsse man Grenzen überwinden, sowohl persönliche als auch andere, um zu verstehen, wie man selber tickt und dies dann auch anderen vermitteln zu können. Ein solcher Ratschlag ist leicht dahingesagt; die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es schon etwas schwieriger ist, ihn auch zu befolgen.
Die Furcht vor Orientierungsverlust war es, die mich auf dieses Projekt gebracht hat, und ich komme nicht viel weiter, wenn ich mich nicht mit ihr auseinandersetze. Zumindest in dieser Hinsicht habe ich einen fest umrissenen Ausgangspunkt.
Also fahre ich nach Hause, und das bedeutet in Richtung Nordosten, zu dem Haus an der Südseite von Cape Cod, in dem ich mit meiner Familie lebe. Wenn man sich die Halbinsel als einen drohend erhobenen Arm vorstellt, mit Provincetown ganz oben im Norden als einer geballten Faust, die dem Atlantik Paroli bietet, und dem Festland als der dazugehörigen Schulter, findet man uns an der Unterseite des Oberarms. Das Haus blickt auf den Nantucket Sound hinaus, eine im Norden von der Halbinsel Barnstable und im Südosten bzw. Südwesten von den Inseln Martha’s Vineyard und Nantucket begrenzte Wasserfläche.
Der Nantucket Sound ist ein kleines Meer, das es in sich hat: Sein Wasser ist flach und damit nicht leicht schiffbar; es wimmelt darin nur so vor lang gezogenen Sandbänken, und außerdem wird es von Gezeitenströmen durchgespült und oft von böigen Winden durchgepustet; man muss hier schon aufpassen. Mit seinem vom Meer gebrochenen Licht, dem filternden Effekt der Sandstrände mit ihren Kiefernwäldchen und den dahinter liegenden Salzwiesen bildet der Nantucket Sound ein so schönes Warmwasserhabitat, dass es seinesgleichen sucht – und doch kann seine lichte Anmut nur allzu trügerisch sein.
Als ich zu Hause angekommen bin, schenke ich mir erst einmal einen Drink mit Rum ein und setze mich neben den Kamin in den Lieblingssessel meines Vaters. Über dem Kamin befindet sich ein granitenes Sims, in das mein Großvater ein Flachrelief gemeißelt hat, das schilderbewehrte Wikinger zeigt, die sich auf ihrem mit Drachenköpfen verzierten Drakken durch ein aufgewühltes Meer kämpfen, wobei ihnen die historische Fehlerhaftigkeit ihrer Darstellung vermutlich besonders zu schaffen macht. Dies ist das Haus, in dem mein Bruder und ich aufgewachsen sind, nachdem wir ein paar Meilen östlich von hier im Krankenhaus von Cape Cod auf die Welt gekommen waren. Auf der ans Wohnzimmer angrenzenden, verglasten Veranda ist vor sechs Monaten mein Bruder gestorben – in seinem Krankenbett mit dem hochgestellten Kopfteil hatte er um jeden Atemzug gekämpft, während ihm Tina, seine Pflegerin, mit äußerster Sorgfalt und Teilnahme flüssiges Morphium aus einer Pipette in den Mund träufelte. Kurz bevor er schließlich ins Koma fiel, hätte er noch den Seemöwen zuschauen können, wie sie auf der Suche nach Krebsen über den blauen, sanft dahinplätschernden Wellen, von denen das Sonnenlicht abstrahlte, ihre Runden über unserem Heimatgewässer drehten – aber ich bezweifle, dass er überhaupt einen Blick für sie übrig hatte.
Mein erster Sohn Olivier, der im Alter von nur einem Monat an einer solchen Herzschwäche gestorben ist, wie sie durch fehlgeleitete Morphogene hervorgerufen werden kann, wurde unter einer Zeder hinter dem Haus begraben. Seine letzte Ruhestätte befindet sich gleich neben zwei Torpfosten aus Zement, die aus unerfindlichen Gründen den Antlitzen von Ramses II und Nofretete nachgebildet worden sind. Ich frage mich, inwieweit man davon sprechen kann, dass ein Verlust sich quasi navigatorisch bemerkbar macht, wenn man eines geliebten Menschen gedenkt und sich der Stelle zuwendet, an der man sie oder ihn zum letzten Mal gesehen hat – in einer Wohnung, einem Café, einer Intensivstation oder einem Grab?
Aber das ist bloß eine durch den Rum ausgelöste Spekulation. Meine Augen, deren Blick normalerweise von einem über dem Kamin hängenden großen Ölgemälde angezogen wird, das ein vom Sturm aufgewühltes Meer inmitten des Atlantik zeigt und sonst nichts weiter, wandern weiter zu einem wesentlich kleineren Bild auf der anderen Seite des Raumes, dem Tintenstrahldruck eines Schiffes, das durch Wellen stampft, die denen auf dem Ölgemälde um nichts nachstehen.
Es ist ein schwarz gestrichenes Holzschiff mit einem einzelnen Mast, vielleicht an die hundert Fuß lang, mit zwei Rahsegeln und einem rechteckigen Hauptsegel. Der Wind scheint so heftig zu wehen, dass er die norwegische Flagge, die über dem Hauptsegel knattert, jeden Augenblick in Fetzen reißen könnte. Winzig kleine Männer mit Zylinderhüten auf den Köpfen stehen an Deck Wache und wirken ziemlich beunruhigt – obwohl ich, der ja bereits weiß, welches Schicksal ihnen bestimmt ist, mir das möglicherweise auch nur einbilde. Oder machen sie sich Sorgen, dass der Sturm ihnen die Hüte vom Kopf blasen könnte? Der Name des Schiffes steht mit gelber Farbe am Heck geschrieben, und unter dem Bild wird er noch einmal wiederholt: Stavanger Paquet, und gleich daneben steht in gebrochener Frakturschrift: Capt. H. Michelsen.
In diesem Bild verbirgt sich meine zutiefst verwurzelte Urangst. Und das ist die Geschichte, die dahintersteht.
In der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bediente die Stavanger Paquet die regelmäßige »Paketroute« zwischen Südnorwegen und Deutschland. Dabei beförderte sie nicht nur sämtliche Arten von Fracht, sondern auch Passagiere – zumeist Emigranten, die von deutschen Häfen nach Amerika aufbrechen wollten. Halvor Michelsen, der Kapitän des Schiffes, war mein Ururgroßvater. Auf einer ihrer Reisen, nämlich 1844 – und hier muss ich mich ganz auf die Überlieferung in unserer Familie verlassen, die sich eigentümlicherweise dadurch auszeichnet, dass sie zwar einerseits sehr farbig, andererseits aber auch weitgehend unbewiesen ist, wobei sich diese beiden Eigenschaften gegenseitig zu bedingen scheinen – soll sie dann, vermutlich im Nebel oder durch einen Sturm verursacht, vom Kurs abgekommen sein. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter an dieser Stelle immer eine effektvolle Pause machte, wenn sie Louis und mir diese Geschichte erzählte, als wir beide noch ziemlich klein waren und das alles uns wie ein Märchen à la Hänsel und Gretel vorkam. Danach fuhr sie dann damit fort, dass das Schiff, möglicherweise aufgrund eines Navigationsfehlers von Halvor (wobei sie sogleich andeutete, dass man ihm daraus aber keinen Vorwurf machen dürfe; solche Dinge passierten eben auf See) wohl vom stürmischen Meer verschlungen worden oder an Klippen zerschellt wäre, da es sich zu weit entfernt von einem Hafen befunden hätte, um dort Schutz suchen zu können. Jedenfalls hätte die Mannschaft ein Rettungsboot zu Wasser gelassen, während Halvor noch in seine Kabine gelaufen sei, um das Logbuch zu retten; dort wäre er dann vom Wasser eingeschlossen worden und mit seinem Schiff untergegangen, sodass nichts von ihm geblieben wäre außer seiner Seemannskiste, die einige Zeit später an Land gespült worden sei.
Genau am Tag seines Todes packte Halvors Frau, meine Ururgroßmutter, ihr gutes Porzellan in Kisten, zog ein schwarzes Kleid an und ließ alle wissen, dass ihr Mann ihr im Traum erschienen wäre und ihr gesagt hätte, er wäre tot. Und als dann ein Schiff mit den Überlebenden an Bord und der Flagge auf Halbmast im Hafen von Stavanger festmachte, bestätigte sich diese Vision.
Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Die Michelsens konnten vielleicht nicht von sich behaupten, die besten Navigatoren der Welt zu sein, aber stur waren sie allemal: Die Männer der Familie waren seit jeher zur See gefahren, und so wurde es selbstverständlich auch von den Söhnen erwartet. Also folgte Halvors einziges Kind, sein Sohn Thomas, der Familientradition und wurde Offizier auf dem größten Schiff, das in Stavanger seinen Liegeplatz hatte, einem Dreimast-Rahsegler namens Drot, der die Südasienroute fuhr. Wie unsere Mutter uns erzählte, wurde Thomas während eines Sturms auf der Nordsee von einer Woge über Bord gespült. Aus diesem Anlass beschloss Halvors Schwiegertochter, Thomas’ Witwe, dass ihr die Familientradition den Buckel runterrutschen konnte – ihre Söhne würden nicht zur See fahren. Und so besorgte sie für Frederic Michelsen, meinen späteren Großvater, eine Anstellung bei einer örtlichen Werft. Und weil er erst fünfzehn Jahre alt und eher schmächtiger Statur war, eignete er sich vorzüglich für die Arbeit in den engen Stahlröhren, in denen sich die Schraubenwellen drehten. Und als er es leid war, den Schraubenaffen zu spielen, bestieg er kurzerhand ein Schiff und emigrierte nach Amerika.
Während ich mich dicht vor das Bild stelle, um mir die Paquet ganz aus der Nähe zu betrachten, sinne ich darüber nach, wie sonderbar es doch erscheint, dass ich als Junge immer zur See fahren wollte. Und ich habe dann tatsächlich auf Schiffen und Fischerbooten gearbeitet; doch zu meinem Beruf habe ich das nicht gemacht. Sollte es in den Genen der Michelsens etwa einen pervertierten genetischen Code geben, der uns empfänglich dafür macht, uns hinaus auf das weite Meer zu wagen, um zu schauen, ob wir uns dort zurechtfinden?
Mir wird klar, dass auch ich von Kalamitäten wie jenen, in die Halvor und Thomas geraten waren – von dem tödlichen Ausgang einmal abgesehen, bisher jedenfalls –, auf See nicht immer verschont geblieben bin. Ich habe navigatorisch gepatzt; und ich war ganz nahe dran, über Bord zu gehen, einen einsamen Tod in der brodelnden Gischt, die sich auf so vielen Bildern in diesem Haus findet, zu sterben.
Daher wird es kaum verwundern, dass die Wurzeln meiner Angst vor dem Aufbruch ins Unvertraute in den Geschichten von Halvor und Thomas zu suchen sind, die zu Legenden verschmelzen und dann, vor allem in der kindlichen Fantasie, zu einem Ursprungsmythos von verzweifelter Desorientiertheit inmitten eines Ozeans ohne feste Wege werden; zu einer Urangst, einsam vom Meer verschlungen zu werden.
Die beste Methode, diese Geister auszutreiben, besteht wohl darin zu ergründen, was der Paquet tatsächlich widerfahren war; wo sie gesunken ist und aus welchem Grund; und vielleicht sogar ihr Wrack zu finden. Wir haben immer noch Verwandte in Norwegen, die unter Umständen etwas Näheres über die Ereignisse von damals wissen – obwohl das Verschwinden des Schiffes nun schon weit mehr als ein Jahrhundert zurückliegt.
Ich besitze einen Sextanten, den meine Mutter mir – möglicherweise, um meiner Großmutter eins auszuwischen – zum Collegeabschluss geschenkt hat. Also fasse ich den Entschluss, dass ein Selbstversuch Teil meines Bemühens sein soll, mich von meinen Dämonen zu befreien: Ich werde die Reise nachstellen, die Halvor regelmäßig als Kapitän eines Lastenseglers unternommen hat. Ich werde aufs Meer hinaussegeln, vielleicht von Cape Cod nach Maine – zur Isle au Haut möglicherweise oder nach Mount Desert Island. Und ich werde dabei nur die Hilfsmittel verwenden, die auch Halvor gehabt hat: Kompass, Seekarte und Sextant.
Mir steht zwar kein Hunderttonnen-Küstenfahrer aus Holz zur Verfügung, aber ich verfüge über ein Segelboot, das als Versuchsschiff herhalten soll.
Am darauffolgenden Nachmittag rudere ich zu meinem Segelboot. Es liegt in North Bay vertäut, knapp eine Meile von dem nächsten Bootsliegeplatz in meinem Heimatort entfernt. Das ist eine recht lange Strecke, wenn man sie in einem einfachen Ruderboot zurücklegt, doch das stört mich nicht. Es ist einer jener frühen Herbsttage in New England, an denen eine gewisse Spannung in der Luft liegt, wenn sich einerseits das Herz erwärmt angesichts der warmen Palette der Farben, in denen die Salzwiesen und die Wälder schillern, andererseits jedoch ein leise aufkommendes Kältegefühl, die kürzer werdenden Stunden des Lichts und die verhältnismäßig kleine Anzahl der ringsumher noch festgemachten Boote bereits daran gemahnen, dass der Winter vor der Tür steht und alles Lebende nun gut daran täte, sich von der faulen Haut zu erheben, wenn es die Härten der nahenden Jahreszeit gut überstehen will. Gelbschwänze und Fischadler sind bereits aus den Salzwiesen verschwunden, und pfeilspitzenförmige Formationen von Wildgänsen stoßen ihre Schreie aus, während sie hoch droben vorüberziehen – noch nicht gezielt gen Süden hin.
Beim Liegeplatz angekommen lasse ich den Motor eine Weile laufen, damit sich die Batterien wieder aufladen. Ich habe keine Zeit, ein richtiges Segel zu setzen, aber einem Impuls folgend binde ich meinen Segler los und fahre unter Motor in südlicher Richtung, etwa zwei Meilen weit durch schmale Meerengen hindurch zu einem mit Strandhafer bewachsenen Sandstreifen namens Sampson’s Island, der die Hafeneinfahrt vom Meer trennt. Hier werfe ich in neun Fuß tiefem, klarem Wasser Anker und beginne, eine Bestandsaufnahme des Bootes vorzunehmen; nicht wie sonst üblich im Hinblick darauf, über Nacht im Hafen von Nantucket oder Oak Bluffs zu bleiben, sondern eher, um mir ein Bild davon zu verschaffen, was alles noch getan werden muss, ehe ich, gewappnet mit den Gerätschaften meines Ururgroßvaters und seine Navigationsmethoden nutzend, der Küste den Rücken kehre und aufs offene Meer hinausfahre.
Ich nehme mir nun ein wenig Zeit, mein Schiff näher zu beschreiben, denn wir beide haben schon allerhand miteinander erlebt, was für diese Geschichte von Bedeutung ist. Ihr Name lautet, um damit anzufangen, Odyssey. Das ist ein ziemlich gängiger Name für ein Boot und durchaus auch ein Name, den ich für mein eigenes Boot gewählt haben könnte. Aber tatsächlich habe ich die Odyssey gebraucht gekauft und zudem von meiner Mutter und meinem Onkel allerlei seemännischen Aberglauben geerbt – dass zum Beispiel niemals an Bord das Wort Schwein ausgesprochen werden darf; dass man niemals an einem Freitag die Segel setzen sollte – und dass man sein Schiff eben nicht umtaufen soll. Auf jeden Fall habe ich nichts gegen die Assoziation mit Homer und der heroischen Irrfahrt, die seinem Helden Odysseus von diversen Göttern und Meerhexen auferlegt worden war.
Die Odyssey ist ein Kunststoffboot; sie ist fünfunddreißig Fuß, also rund zehneinhalb Meter, lang und zehn Fuß breit; gebaut wurde sie 1971 von der Morgan Yacht Company in Saint Petersburg, Florida. Der Rumpf ist weiß mit rotem Unterwasserschiff. Um es ganz einfach zu sagen: Sie ist ein Einmaster, ein gut proportioniertes Segelboot mit einem scharf zulaufenden Bug, einem schräg nach innen geneigten flachen Spiegelheck und einer geräumigen Kajüte. Will man sich von der Plicht am Heck aus von hinten nach vorn begeben, geht man zunächst die kurze Niedergangstreppe hinunter, die in die Kajüte führt. Von hier aus zieht sich auf beiden Seiten des Bootes eine schmale »Hundekoje« bis unter das Heck.
An der Backbordseite der Kajüte, also in Fahrtrichtung links, befindet sich der Arbeitsbereich für die Navigation mit dem Kartentisch und dem UKW-Sprechfunkgerät; daneben steht ein breiter hölzerner Salontisch, um den eine dreiviertelkreisförmige gepolsterte Sitzbank herumgezogen ist; auf der gegenüber befindlichen Seite gibt es eine kleine Pantry mit Propangasherd, Spülbecken und einem Schränkchen für Vorräte und Kochutensilien. Noch weiter nach vorn in Richtung Bug wird die Kajüte durch ein aus Holz gefertigtes Schott, also eine Querwand, mit einem kleinen Holzofen daneben, in zwei Hälften geteilt. An diesem Schott habe ich als Hommage an den Namen meines Bootes ein auf Holz gemaltes Bild von Odysseus befestigt, auf dem er, am Mast seines Schiffes festgebunden, sehnsüchtig dem Gesang der nackt auf dem Strand ihrer Insel tanzenden Sirenen lauscht. Seine Männer tragen allesamt Kopfhörer, aus denen vermutlich Bouzoukiklänge dröhnen, wie Alexis Sorbas sie gemocht hat, und zwar mit voller Lautstärke, während sie Odysseus außer Hörweite der verführerischen Gesänge rudern. Hinter der Zwischenwand befinden sich ein Kleiderschrank, der Waschraum und schließlich unter dem Bug eine V-förmig angelegte Doppelkoje.
Das war jetzt die offizielle Version. Inoffiziell ist die Odyssey eine notdürftig ausgebaute, verbrauchte und ziemlich langsame Schaluppe mit minimaler Teakholzverkleidung und einem so alten Großsegel, dass es vor lauter Löchern seiner Aufgabe, das Boot voranzubringen, nur noch mit Mühe nachkommen kann. Der einzig moderne Bestandteil ist der fast neue 30-PS-Yanmar-Diesel, den ich vor zwei Jahren als Ersatz für den völlig verrotteten Originalmotor gekauft habe. Doch nichtsdestotrotz ist die Odyssey theoretisch groß genug, um mit ihr den Atlantik zu überqueren, und somit dürfte sie höchstwahrscheinlich auch die eher küstennahen Seereisen bewältigen, die das tägliche Brot des Seglers gewesen sind, der meinem Vorfahren gehörte.
Ich beginne mit einer Begehung des Decks. Das Tauwerk scheint mir in guter Verfassung zu sein, und die Wanten, die den Mast abstützen, glänzen und wirken nirgendwo korrodiert. Nur die Decksnaht zwischen Schiffskörper und Deck leckt – trotz meiner allergrößten Bemühungen, sie mit seewasserfester Dichtmasse trocken zu bekommen. Solche Undichtigkeiten machen mir immer Sorgen. Boote wie das meine bestehen für gewöhnlich aus Schichten von glasfaserverstärkten Polyesterharzmatten, die auf ein Rumpfskelett aus Balsaholz gelegt werden. Und wenn das Holz nicht absolut trocken bleibt, quillt es auf und gammelt und schwächt das Ganze.
Ich gehe den Niedergang hinunter und mache mir dabei in einem schwarzen Skizzenbuch, das als Logbuch der Odyssey dient, Notizen. Das Sprechfunkgerät ist ganz neu, funktioniert aber nicht, weil die Verbindung mit der Antenne oben am Mast noch nicht hergestellt ist. Der Marineelektriker, der diese Arbeit eigentlich schon im vergangenen Sommer hatte durchführen sollen, hat sich vorzeitig in den Winterschlaf begeben und seitdem nichts mehr von sich hören lassen – eine Arbeitseinstellung, an die man sich hier auf Cape Cod gewöhnen muss. Aber Fäulnis und Korrosion sind ohnehin meine größeren Sorgen. Ich bin zwar nicht in der Lage, den Zustand des hölzernen Kerns im Rumpf zu kontrollieren, weil er in Kunststoff eingebettet ist, aber wenigstens das Schott in der Mitte der Kajüte kann ich mir ansehen – es ist ein wichtiger Bestandteil, der der Struktur des Rumpfes die benötigte zusätzliche Festigkeit verleiht. Vorsichtig schlage ich mit einem Hammer dagegen – alles scheint solide. Dann nehme ich die Bodenbretter unter dem Tisch im Wohnteil der Kajüte heraus und finde den reinsten Albtraum vor.
Zwischen den Menschen, die auf einem Boot in See stechen und dem Fahrzeug, das sie über das Wasser trägt, entsteht eine innige Verbindung; und das trifft ganz besonders auf Leute wie mich zu, die als Einhandsegler auf einem alten knarrenden, knirschenden Kahn unterwegs sind. Man kann seine Reise noch so sorgfältig planen – irgendwann schlagen die Wellen höher und blasen die Winde stärker, als es vorhergesagt war, und unversehens findet man sich mutterseelenallein inmitten einer aufgepeitschten See wieder – wie jener, die über dem Kamin meines Großvaters dargestellt ist; und der Sturm brüllt, der Rumpf ächzt in seinem Elend, jadegrünes Meerwasser wäscht über das Deck, die Wanten klingeln bedrohlich und man sieht sich unwillkürlich vor die Frage gestellt, wie lange dies alles wohl noch halten wird. Oder wird gleich irgendetwas laut knackend den Geist aufgeben – das Ruder, der Mast, der Kiel? Und man selber fuchtelt verzweifelt mit den Armen, gerät völlig aus der Fassung angesichts der Kettenreaktion, die dann einsetzt und in der eine Stresssituation die nächste auslöst und jedes neue Problem die Zeit zum Handeln weiter beschneidet. So lange, bis schließlich nur noch Fehlentscheidungen getroffen werden, von denen die eine kolossaler ausfällt als die andere – bis plötzlich kein Boot mehr da ist und man in ein Wasser geschleudert wird, das viel zu kalt ist, um darin überleben zu können, während sich rettendes Land meilenweit entfernt befindet.
Das ist die Schreckensvision, die auf mich einstürmt, wenn ich in den Kielraum der Odyssey starre. Das Deck ruht auf mehreren Winkelträgern, und wenn ich mit der Hand tief in die schwarze Höhle unter den Planken greife, um nach diesen Winkeleisen zu fassen, schält sich rostiger Schorf in untertassengroßen Placken von ihnen ab. Und was von dem Metall noch übrig ist, fühlt sich spröde und brüchig an; einer der Träger ist sogar vollständig durchgerostet und hängt als erzener Stalaktit senkrecht hinunter.
Weiter zum Bug hin treten lange, dreifach durch Stahlblech verstärkte Winkeleisen an die Stelle der einzelnen Tragelemente. Obwohl ich natürlich nur deren Oberfläche ertasten kann, kommt es mir doch so vor, als wäre bereits ein gutes Drittel des Metalls weggerostet. Und das könnte ein ernsthaftes Problem darstellen, weil diese Verstärkungen nämlich auch den Mastschuh halten, ein Metallteil, in dem der Mast gelagert ist; denn ohne diesen Mastschuh würde die ganze vierzig Fuß hohe Stange inklusive sämtlicher Wanten und Segel glatt wegknicken und dabei vermutlich ein gutes Stück des Decks mit sich reißen.
Wie ich also auf den Knien rutschend mit meinen Händen – um es metaphorisch auszudrücken – in den dunkelsten Tiefen der Intimsphäre meiner Odyssey herumstöbere, kommt mir plötzlich die Frage in den Sinn, wie viel von unserem Zurechtfinden in der Welt, sei es nun auf See oder an Land, wohl damit zu tun hat, dass wir uns Gedanken darüber machen, was wohl wäre, wenn … Das heißt, dass wir uns solche Fragen stellen wie die, wo wir wohl landen würden, wenn wir bei Einbruch der Dunkelheit noch einen Berg überqueren, anstatt um ihn herumzugehen. Oder wenn wir Kurs nach Norden halten anstatt nach Nordosten oder in einem Sturm kein Segel wegnehmen, sondern mit Karacho in diese Vorstufe des großen Unbekannten hineinfahren? Mit anderen Worten: Wird das Verderben immer geografisch ins Auge gefasst? Ist es im eigentlichen Sinne immer eine Frage der Navigation?
Ich bin am Ende meiner Checkliste angelangt und klappe das Logbuch zu; dann nehme ich mir vor, demnächst meinen Freund Ned anzurufen. Er ist der jüngste Spross einer Familie von Bootsbauern hier auf Cape Cod; sie sind schon seit meines Ururgroßvaters Zeiten im Geschäft. Ich koche mir in der Pantry einen Kaffee und nehme den Becher danach mit nach oben aufs Deck, wo ich mich neben das Steuerrad setze. Es ist inzwischen später Nachmittag, und die Sonne hängt tief über den ungeschlachten Pompvillen, die überall an den Stränden dieser Bucht aus dem Boden gestampft werden.
Ich muss also Vorkehrungen für einen Transport des Bootes treffen; das ist immer eine komplizierte Angelegenheit. Aber die Sache kann sowieso nicht von heute auf morgen angegangen werden, denn zunächst habe ich soeben spontan eine weitere Erkundungsreise eingeplant. Sie wird mich ein ganzes Stück weiter fortführen als bloß mal eben mit dem Auto nach New York. Während sich in meinem Kopf noch alles um die bevorstehende Bootsreparatur dreht, bin ich gleichzeitig mit meinen Gedanken schon wieder bei den Reisevorbereitungen; aber dann verfärbt sich der Himmel im Osten indigofarben und malt ein immer tiefer werdendes Blau ans Firmament, das einen purpurnen Sonnenuntergang verheißt.
Dabei fallen mir frühere Gelegenheiten ein, bei denen ich an dieser Stelle Anker geworfen habe; heiße Sommertage, an denen ich mit Liz beim Picknick saß, während die Kinder ins warme Wasser hüpften, es – als fielen kreischende Kanonenkugeln hinein – aufspritzen ließen und über uns unter Protestgeschrei die Seeschwalben kreisten. Diese Seeschwalben, die in jedem Sommer auf Sampson’s Island nisten, gehören zu den vorzüglichsten Navigatoren der gesamten Tierwelt. Jedes Jahr fliegen sie von ihren Futterplätzen in der Arktis einmal um die Welt in die Antarktis, um hier nach Krill zu suchen; eine Rundreise von weit über zwanzigtausend Meilen. Sie sind die einzigen Tiere auf der Welt, die jedes Jahr zwei Sommer erleben, zwischen denen sie zu dem kurzen Küstenstreifen zurückkehren, auf dem sie gebrütet haben – in diesem Fall eben Sampson’s Island. Und das war immer so und wird bei jeder neuen Generation Seeschwalben nicht anders sein.
Aber die Schwalben sind um diese Zeit des Jahres längst fort; auch ihre Jungen sind geschlüpft und haben sich auf den Weg in den Süden gemacht. Und nun erscheinen schon die ersten Sterne am Himmel, und ich trage mich mit dem Gedanken, meinen Suchscheinwerfer hervorzukramen, denn die Fahrt zurück zu meinem Liegeplatz wird in der Dunkelheit stattfinden, also werde ich Licht brauchen, um mir meinen Weg durch die verschiedenen Fahrwasser zu suchen.
Und mit einem Mal hält mich hier nichts mehr; ich will los, mich bewegen, werfe den Motor an, stecke den Scheinwerfer in seine Halterung und beginne den Anker einzuholen.
3 Die Vögel, die Erinnerung und die Londoner Taxifahrer
Während der Passagierjet in Richtung Ostnordosten fliegt, werfe ich einen Blick aus dem Kabinenfenster und sehe, wie die Küste von Massachusetts unter einem Sonnenuntergang ähnlich dem, den ich gerade erst vor einer Woche auf der Odyssey beobachtet habe, sich mit der einsetzenden Abenddämmerung in ein geometrisches Muster aus lauter kürbisfarbenen Lichterketten auflöst. Ich muss mich gegen den Impuls zur Wehr setzen, den Sicherheitsgurt zu lösen, mich von meinem Platz zu erheben, durch eines der Fenster auf Cape Cod zu zeigen und allen zuzurufen, dass sie einmal hinausschauen sollten, denn von dort, von da unten, käme ich her! Aber niemand von meinen Mitreisenden interessiert sich dafür, was jenseits von seinem oder ihrem Kabinenfenster vor sich geht; sie sind alle vollkommen vertieft in die Spiele auf ihren Smartphones und die Tabellen auf ihren Laptops, oder sie gehen mit dem von der Konserve eingespielten Lachen des Studiopublikums im bordeigenen Unterhaltungsprogramm mit seinen blassen Farben mit. Nicht einmal für ihre Sitznachbarn haben sie einen Blick übrig.
Und doch sehe ich unter mir mehr als nur ein Lichtermeer – wenn auch nur vor meinem geistigen Auge: Von der Cape Cod Bay bis nach Plymouth und noch weiter nördlich erstreckt sich das unübersichtliche Gewirr von Buchten und Meeresarmen, von Sumpfland und Küstenstrichen, von wo aus die Schwalben, über die ich auf meinem Boot nachgedacht habe, zu ihrem Kontinente überspannenden Pilgerflug aufbrechen. Ich bin immer noch von dem Paradox fasziniert, dass Tiere und sogar Insekten, denen wir doch gemeinhin eine weitaus geringere Intelligenz und viel weniger praktische Befähigungen als uns Menschen zuschreiben, über ein navigatorisches Können verfügen, das dem unseren so weit überlegen ist, dass wir im Vergleich dazu wie geistig Minderbemittelte ohne jegliches räumliches Vorstellungsvermögen dastehen.
Sieben Stunden später befinde ich mich auf einem internationalen Flughafen in der Nähe von Paris, von dem aus es nach London weitergehen soll, und wir geistig Minderbemittelten trotten schön brav hintereinander her die Gangways hinauf und neonbeleuchtete Korridore hinunter, wobei wir an den gleichen Cafés, Zeitungsläden, Bankreklamen und Duty-free-Shops vorbeikommen, die wir schon auf dem JFK Airport in New York gesehen haben; wir folgen artig den Schildern, werden wie Vieh zur Zollabfertigung gescheucht, defilieren von dort zur Gepäckausgabe und werden auf Fahrsteigen zu anderen Flugzeugen befördert. Und hier trifft mich noch einmal wie ein Schlag die herbe Erkenntnis, dass es den meisten Leuten gleichgültig ist, wo sie sich befinden. Sie machen sich überhaupt keine bewusste Vorstellung davon, dass sie mithilfe des technischen Wunderwerks Düsenflugzeug, das nur ungefähr dreihundert Stundenkilometer langsamer ist als der Schall, nach einer sieben- oder auch zwölfstündigen Reise, also einer Reise, für die ihre Ururgroßeltern Monate oder gar Jahre gebraucht hätten, sicher wieder gelandet sind. Und auch dem Ort dieser sicheren Landung können sie augenscheinlich nichts abgewinnen, obwohl doch von Hongkong bis Sao Paulo, von Helsinki nach Sydney und von Honolulu nach Stuttgart alles genau geplant ist, damit die Reisenden der heutigen Zeit so mühelos wie ein Expresspaket von Punkt X nach Punkt Y expediert werden. Man braucht nicht einmal den Blick vom Laptop oder vom Smartphone zu erheben, um schon umfänglich über den Ort, an dem man sich gerade befindet, informiert zu sein. Und ebenso verhält es sich auch mit dem Eurostar-Terminal, in dem ich einen Hochgeschwindigkeitszug nach London besteige, denn alles ist hier genau so angelegt wie in einem Flughafen.
Was für einen enormen Unterschied stellt all dies doch zu der Umgebung dar, an der sich meine Augen laben, als ich an der Untergrundbahnstation South Kensington nach oben auf die Straße gelange und den Weg zum Royal Institute of Navigation einschlage, das sich irgendwo in den weit ausgedehnteren Räumlichkeiten der Royal Geographical Society verbirgt. Die RGS residiert in einem gewaltigen neugotisch-viktorianischen Baujuwel (oder in einer neugotisch-viktorianischen Monstrosität, je nachdem, was für architektonische Vorlieben man hat), einem viergeschossigen roten Ziegelbau mit hoch aufragenden Schornsteinen, steilen Giebeldächern, Mansarden und hohen Bleiglasfenstern gleich gegenüber dem Alexandra-Gate-Eingang des Hyde Park; sowohl die Arroganz des architektonischen Designs als auch die der Ortswahl verraten einiges über die Persönlichkeit seiner Erbauer, von denen die meisten Kolonisatoren, Imperialisten und Militaristen waren. Aber es waren halt auch Menschen, die an das Konzept des »wohin« glaubten; auch wenn »wohin« in diesem Fall nicht mehr als ein weiterer weißer Fleck auf dem Globus war, den Großbritannien entdecken, vermessen und ausbeuten konnte.
Das Royal Institute of Navigation wurde erst am Ende dieses Entdeckungsprozesses gegründet, und sein heutiger Direktor, Captain Peter Chapman-Andrews, nimmt mich in der Eingangshalle in Empfang. Er ist ehemaliger Offizier der Royal Navy und hat als Navigator auf Großbritanniens letztem Flugzeugträger und auf der Jacht der englischen Königsfamilie gedient. Er führt mich durch Gänge, die so aussehen, als wären sie eigens für die Krönung von Georg V., dem Urenkel von Königin Victoria, renoviert worden – vorbei an einem Display elektronischer Instrumente, die vermutlich von einem Zerstörer aus der Zeit der Suez-Krise stammen. Schließlich führen sie in eine altmodisch anmutende Büroetage, die das Institut beherbergt. Während wir zusammensitzen und einen Kaffee trinken, hören wir, wie sich draußen auf dem Flur etwas tut, Stimmen, die zur Begrüßung erhoben werden, und dann betritt das magische Stacheltier der animalischen Orientierungsgabe mit wichtiger Miene den Raum.
Ein magisches Stacheltier mag vielleicht ein etwas eigentümliches Bild abgeben, aber das ist genau das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich Air Vice-Commodore Douglas »Pinky« Grocott, Offizier der Royal Air Force im Ruhestand, vor mir sehe … man könnte auch an ein künstliches Wesen mit der Dynamik des Energizer-Hasen denken. Grocott ist zweiundneunzig Jahre alt, und das Erreichen dieses biblischen Alters scheint sich auf zweierlei Weise bei ihm ausgewirkt zu haben: Einerseits hat der Alterungsprozess seinen Körper so weit gebeugt und schrumpfen lassen, dass er die kompakten Maße eines kleinen Säugers angenommen hat; andererseits hat er aber auch seinen Verstand geschärft und seinen Wissensdurst ins Unermessliche gesteigert. Und außerdem hat Pinky ein spitz zulaufendes Gesicht mit rosigen Wangen, die sich die meiste Zeit zu einem Lächeln bauschen. Sein dünnes weißes Haar trägt er akkurat nach hinten gekämmt und zu seinem grauen Anzug eine Krawatte mit dem Emblem des RIN; seine Schuhe sind auf Hochglanz gewienert, und er spricht das Englisch der oberen Mittelklasse, wie man es in den Grafschaften um London herum antrifft – und was er zu sagen hat, bringt er mit Elan und voller Enthusiasmus vor; trotzdem kann seine Stimme manchmal nicht mit der Schnelligkeit seiner Gedanken mithalten. Ich war in der Hoffnung hergekommen, einer Versammlung der Animal Navigation Group beiwohnen zu können, deren Vorsitzender Pinky ist; denn die Liste der wissenschaftlichen Abhandlungen aus der Feder ihrer Mitglieder hatte mich beeindruckt – bei denen es zum Beispiel darum geht, den blinden mexikanischen Höhlenfisch als Vorbild bei der Erprobung der Möglichkeiten zu verwenden, eine dreidimensionale Karte des Weltalls zu entwerfen. Nun aber stellt sich heraus, dass die Versammlung praktisch nur aus Pinky besteht, denn die ANG ist eine virtuelle Vereinigung von Wissenschaftlern und begeisterten Amateurforschern aus allen Ecken der Welt, die über das Internet, aber auch durch das Organisationstalent ihres Vorsitzenden, der von einem vom Royal Institute of Navigation zur Verfügung gestellten Büro aus operiert, miteinander vernetzt sind und in täglichem Kontakt zueinander stehen.
Wenn ich Pinky dabei zusehe, wie er ganze Festplatten mit gesammelten Daten und teilweise noch unveröffentlichten Forschungsergebnissen durcharbeitet, wird mir klar, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters eine neue Form der Wissenschaft repräsentiert, bei der er auf eine verschworene Schar von Kollegen und Mitstreitern zurückgreifen kann, die miteinander in Beziehung stehen, gleichzeitig aber auch die traditionellen, bei britischen Philosophen hochgeschätzten Werte wie Skeptizismus, Empirismus und wissenschaftliche Integrität verkörpern. Das sind Werte, die auch ich hochschätze und ganz besonders mit P. F. Dawson, meinem ehemaligen Tutor an der University of London, in Verbindung bringe.





























