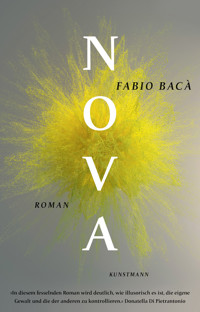
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wie geht man mit Gewalt um, wenn man im Alltag damit unvermittelt konfrontiert wird? Flüchten oder standhalten, das ist die große Frage, die dieser mit feiner Ironie erzählte Roman aufwirft, und so die Werte unserer Gesellschaft auf den Prüfstand stellt. Der Neurochirurg Davide Ricci weiß alles über das menschliche Gehirn und die menschliche Psyche. Glaubt er. Aber stimmt das? Mit seiner Frau und seinem Sohn lebt er in einem schicken Holzhaus am Stadtrand von Lucca. Wäre da nicht der Nachbar Massimo Lenci mit seiner Bar und dem ständigen nächtlichen Lärm, gäbe es nichts zu klagen. Aber als seine Frau und sein Sohn in einem Restaurant von einem Betrunkenen angegriffen werden und er sich, anstatt ihnen zur Hilfe zu kommen, hinter einer Gruppe von Touristen versteckt und zuschaut, wie ein anderer Gast eingreift, ändert sich sein Leben schlagartig. Hat er sich bis dahin als jemand gesehen, der »genetisch nicht zur Gewalt fähig ist«, muss er sich nun eingestehen, dass er schlicht feige ist. Und so kann es nicht weitergehen. Er freundet sich mit Diego an, dem Mann, der den Angreifer im Lokal spontan gestoppt hat, und lässt sich von ihm coachen. Mit durchaus zweifelhaftem Erfolg. Gewalt im Alltag ist allgegenwärtig, aber zum Glück wird man selten so direkt damit konfrontiert wie der Protagonist in diesem großartig erzählten Roman. Wie es Bacà gelingt, ein gesellschaftlich brisantes und gerne verdrängtes Thema zu einer nahezu »persönlichen» Erfahrung zu machen, ist verstörend und spannend bis zur letzten Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Ähnliche
FABIO BACÀ
NOVA
Roman
Aus dem Italienischen von Christine Ammann
Verlag Antje Kunstmann
Für Daniele Rossiund Provino Vagnoni
INHALT
PROLOG
TEIL EINS
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
TEIL ZWEI
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
TEIL DREI
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
PROLOG
DENK MAL AN KABOBO. Erinnerst du dich? Mailand, vor drei oder vier Jahren? Genau. Der Wahnsinnige mit der Spitzhacke. Der Ghanaer, der drei Leute ermordet hat, die ihm in Niguarda zufällig über den Weg liefen. Ja. Genau der, ein Flüchtling mit Stimmen im Kopf, der anderen den Kopf eingeschlagen hat. Die Strafe fiel relativ gering aus, weil der psychiatrische Gutachter sehr umstrittene mildernde Umstände vorgebracht hat. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach, was ein paar Stunden vorher passiert ist. Weißt du es noch? Wahrscheinlich nicht. Das haben fast alle vergessen. Kein Wunder, es war auch nur ein zweitrangiges Detail, doch sozusagen emblematisch für die Ungeheuerlichkeit des Ganzen, ein Einunddreißigjähriger klaut auf einer unbewachten Baustelle eine Spitzhacke, um damit die tödlichen Stimmen in seinem Kopf zum Schweigen zu bringen. Ein paar Stunden vorher, um drei Uhr früh, hat Kabobo nämlich schon drei andere angegriffen, mit bloßen Händen: Nahe Piazza Belloveso ist ihm eine junge Frau im letzten Moment entkommen, weil sie um die Ecke wohnte und blitzschnell die Haustür aufschließen konnte, aber nur eine halbe Stunde später hatte ein anderer weniger Glück und hat eine Faust ins Gesicht bekommen. Das Seltsame ist, bei keiner Polizeiwache ging eine Anzeige ein. Ist das nicht komisch? Zwei friedliche Bürger entrinnen nur knapp den potenziell tödlichen Wahnvorstellungen eines offenbar Geistesgestörten und nehmen sich nicht die halbe Minute Zeit für einen Anruf bei der Polizei. Zwischen fünf und sechs besorgt sich Kabobo dann eine Eisenstange und verletzt zwei Passanten schwer. Ein dritter, der gerade mit dem Hund Gassi geht, verfolgt ihn, gibt aber nach ein paar Metern auf. Und weißt du was? Wieder kommt keiner auf die Idee, die Polizei zu verständigen. Einer von denen, die die Stange abgekriegt haben, lässt sogar seinen Arm in der Notaufnahme versorgen, aber gibt nur vage Erklärungen ab. Warum die Ärzte es nicht, wie von Gesetz und Gelöbnis vorgeschrieben, melden, keine Ahnung. Kabobo hat jedenfalls mittlerweile das Werkzeug gefunden, das die Grausamkeit seiner Taten exponentiell steigert. Den Wirbel, den die Presse nach der Tat veranstaltet hat, kannst du dir kaum vorstellen. Fünf Angegriffene, null Anzeigen. Fünf Menschen wurden fast erwürgt oder totgeschlagen, aber kein einziger Anruf bei Carabinieri oder Polizei. Soziologen, Psychoanalytiker, Philosophen und berufsmäßige Hetzer geben mal wieder die üblichen Erklärungen ab: allgemeiner Egoismus, emotionaler Autismus, Werteverfall, Mangel an Gemeinsinn, Empathie, Solidarität. Alles sehr vernünftig, aber ich meine, da ist noch was anderes. Etwas, das weniger mit elementarer Logik oder erodiertem Mitgefühl zu tun hat. Ich glaube, die meisten von uns sind einfach nicht auf ein traumatisches Erlebnis wie einen brutalen Angriff vorbereitet. Angesichts der Gesellschaft, in der wir heute leben, geht vermutlich jeder davon aus, dass er theoretisch Opfer einer Gewalttat werden könnte, aber glaub mir, zwischen dieser Erkenntnis und der emotionalen Verstoffwechslung dieser unangenehmen Tatsache klafft ein Abgrund. Ich wette, keiner von denen, die Kabobos Wut entkommen sind, hatte so viel Erfahrung mit Aggressivität, dass er sie erkennen und auf einer tieferen rationalen Ebene damit umgehen konnte. Nein, ich sage damit nicht, dass der Durchschnittsbürger für die seelischen Folgen einer versuchten Spitzhackenattacke unempfänglich geworden ist. Dann wäre das Problem ja Gleichgültigkeit. Nein. Ich will etwas ganz anderes sagen, nämlich, dass Gewalt uns fast allen gefühlsmäßig fremd geworden ist. Der Normalbürger ist nicht immun gegen den psychischen Niederschlag eines Angriffs geworden, aber er kann keinen produktiven Zusammenhang mehr zwischen der rationalen Konfrontation und ihren emotionalen Folgen herstellen. Das entscheidende Wort hier ist »produktiv«. Wir haben den Kontakt zu etwas Wesentlichem in unserem Innern verloren. Überleg doch mal. Wie kann es sein, dass sich eine junge Frau vor ihrer eigenen Haustür mit knapper Not vor einem Wahnsinnigen in Sicherheit bringen kann, aber nicht auf die Idee kommt, das nächste Opfer könnte jemand aus der Nachbarschaft sein, den sie womöglich kennt? Wieso ist es ihr zu mühsam, die 112 zu wählen, wo sie ihr Viertel doch mit dem Gefühl der Erleichterung vor einer tödlichen Gefahr bewahren könnte? Vielleicht wohnen dort ihre Eltern, enge Bekannte oder ihr Freund. Wieso kommt ihr nicht in den Sinn, dass sie beim Öffnen der Fenster am nächsten Morgen vielleicht auf den Bürgersteig blickt und mit weit aufgerissenen Augen einen Haufen Sägespäne entdeckt, durchtränkt vom Blut und der Hirnflüssigkeit eines unschuldigen Opfers?
Wenn das wirklich passieren würde, was glaubst du, wie sie reagieren würde?
Und du?
Das frage ich dich, Doktor.
Aber wie würdest du reagieren?
TEIL EINS
1
WORAN DENKT EIN MANN ALS ERSTES, wenn er morgens aufwacht? Was wird ihm von Realität und Unbewusstem einvernehmlich zugetragen? Wem oder was gelten seine ersten, wirren Gedanken, während er die Deutungshoheit langsam zurückerlangt? Welche Bilder, Geräusche und geflüsterten Worte schwirren ihm durch den Kopf?
Vermutlich denkt er über sich nach oder die Frau, die neben ihm schläft.
Vielleicht denkt er an seine Kinder oder seine Eltern, seine Geliebte, an das Frühstück, einen Freund, der Probleme hat, die Steuererklärung, das Essen mit Freunden am nächsten Samstag, Rückenschmerzen, Politik, berufliche Probleme, das Leasingfahrzeug, das ihm sein Händler neulich angeboten hat, an Gott, die Tore vom Vorabend, sein Haus auf dem Land, frühere Ambitionen, verloren im Nirgendwo, an die Waden einer Kollegin, einen Film von Christopher Nolan, an die Mahnung zum Beischlaf, Nachhall der Morgenerektion mit ihrer flüchtigen Lüsternheit.
Anders Davide.
Davide denkt an den Tod.
Um kurz nach sechs. Dann schlägt er die Augen auf, erlangt das Minimum an geistiger Klarheit, das er braucht, um sich der Aussicht auf das ewige Nichts zu stellen, und starrt an die Decke.
Nein, er ist nicht verrückt.
Auch nicht schwer krank.
Nicht einmal depressiv.
Klar, er hat ein paar Probleme mit seinem direkten Vorgesetzten, Doktor Martinelli, dem toskanischen Fürsten der Medizin; der virtuose Neurochirurg hat ihn seit einiger Zeit offenbar im Visier.
Und ja, es gibt etliche Schwierigkeiten mit seinem Nachbarn Massimo Lenci. Nachdem dessen Nachtclub ein gutes Jahr lang den Frieden im ruhigen Wohnviertel am südlichen Stadtrand von Lucca gestört hat, konnte erst eine rettende behördliche Abmahnung die Ruhe wiederherstellen.
Nichts, womit man nicht leben könnte, klar. Nichts, womit man sich notwendigerweise in die Schar der ewig Betrübten, Thanatophilen oder Selbstmordkandidaten einreihte.
Aber Davide denkt trotzdem an den Tod.
Das ist für ihn gewissermaßen ein Ritual, ein Allheilmittel gegen die schwierigen Zeiten, denen er sich seit über fünfzehn Jahren regelmäßig gegenübersieht. Er schlägt die Augen auf, starrt an die Holzdecke und denkt an die Implikationen des Lebensendes.
Nicht unbedingt seines eigenen. Oft denkt er an den Tod nicht einmal als das Ende aller irdischen Erfahrungen. Er liegt im Bett, neben seiner Frau, schlägt die Augen auf, wird sich seiner bewusst, lauscht auf die von der Sonne erwärmten, knackenden Holzbalken, auf den leicht röchelnden Atem von der anderen Bettseite und führt sich vor Augen, dass bei allen Organismen, ob lebende, soziale, maschinelle oder virtuelle, die Tätigkeit von Grund- und Nebenfunktionen irgendwann eingestellt wird.
Angefangen hat es kurz nach Tommasos Geburt. In den folgenden Jahren kam Davide dann zu dem Schluss, dass seine Gedanken an den Tod das logische Gegengewicht zu dem eklatanten Lebensüberschuss waren, der dem ruhigen Alltag eines jungen berufstätigen Paars durch die Pflege eines kleinen, quengeligen Wesens mit unvorstellbaren Bedürfnissen aufgedrängt wird. Ein Hund, zwei Katzen und ein Kind: Es gab genügend Gründe, warum er nach dem Aufwachen als Erstes an die beruhigende Aussicht auf ewige Ruhe dachte.
Der Hund war übrigens ein Jack Russel namens Fred Feuerstein, die beiden getigerten Kater, aus demselben Wurf, hießen Epaminondas und Cochise. Sie waren misstrauisch und kaum geneigt, Freds enthusiastische Hyperkinese zu teilen, sie beäugten ihn meist von einem erhobenen Wohnzimmerplatz aus, schlichen nur manchmal in Küche oder Flur um ihn herum und rangen ihm die kleinen, demütigenden Tribute ab, die der angeborene Sadismus ihrer Art erfordert.
Doch während sich die Tiere als Allheilmittel gegen ein Zuviel an häuslicher Ruhe erwiesen, das sich ein- und aus- oder abschalten ließ – wenn Scharmützel, Jaulen, Miauen und Sofajagden überhandnahmen, konnte man sie in den Garten verbannen –, war ein Neugeborenes allgegenwärtig. Im Haus verbreitete sich eine Art Heilserwartung: Mit Spannung wurden Aufwachen, Stimmung, Hunger, Verdauung, Quantität und Qualität des Stuhlgangs, Zeichen der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit des Säuglings erwartet. Davide, in sein Arbeitszimmer im Obergeschoss verbannt, versuchte, sein Spezialisierungssemester am Londoner Guy’s Hospital zu rekapitulieren. Er war rechtzeitig zurückgekehrt, um der Geburt beizuwohnen, argwöhnte aber, aufgrund der langen Reihe schlafloser Nächte, die den Vaterfreuden beigesellt waren, nicht im Geringsten von den Londoner Erfahrungen profitieren zu können.
Nachts kam er kaum zum Schlafen. Tagsüber sank sein Kopf auf die Bücher, er döste auf den Armstühlen der Fakultät ein oder lief, im Strudel einer ewigen Abgestumpftheit, über die Korridore. Nach dem Sommer würde er in die neurochirurgische Abteilung der Klinik Campo di Marte eintreten, aber damals bezweifelte er, ob er die ersten zehn Wochen der Vaterschaft überleben würde.
Tatsächlich hatte er nur nach dem Aufwachen ein paar wirklich ruhige Minuten, und die nutzte er, um über die ungeahnten Vorteile der Sterblichkeit nachzudenken. Über die Auslöschung mit ihren schmeichelnden Verlockungen, dem barmherzigen Ende aller Mühsal. Über die zauberhafte Schwere der Wendung »ewiger Schlaf« (vor allem das Wunderbare des Substantivs), die Verherrlichung von Flucht, Verzicht, Abschied. Obwohl nicht gläubig, ertappte er sich manchmal sogar dabei, sich den heiteren Aufstieg post mortem in den Strom der Seelen auszumalen, die wohl zu Recht etwas verblüfft über die Weltläufe wachten.
Die wenigen Minuten dieser Morgengedanken empfand er als dermaßen erleichternd, dass er an dem Ritual auch noch festhielt, als wieder annehmbare Lebensumstände eingekehrt waren. Ihm fiel auf, dass er das Kind eigentlich gar nicht so sehr verabscheute, durch das er immerhin die tröstende Dimension des Leben/ Tod-Dualismus entdeckt hatte.
Und nachdem er sich seinem eigenen Ende gewidmet hatte, wanderten seine Gedanken zu dem seiner nächsten Angehörigen, einschließlich Knaben. Dann zu dem entfernter Verwandter. Von Freunden. Den Haustieren. Seinen Kollegen. Von seinen Patienten im Krankenhaus und Unbekannten, denen er zufällig begegnete. Schließlich wandte er sich den Filmstars und Celebrities aus Sport und Musik zu.
Aber es ging nicht besonders grausam zu: Normalerweise malte er sich einen heiteren, ruhigen Abgang im tröstenden Kreis der Liebsten aus.
Anschließend beschäftigte er sich mit dem Ende der politischen Institutionen (dem zermürbenden Zerfall des Imperium Romanum, der schroffen Ablation aus der Geschichte von Romanows oder Bourbonen), dem Ende von Autos, Moden, sprachlichen Klischees.
Er verfolgte keine bestimmte Strategie oder ein Projekt. Wenn er aufwachte, dachte er über das nach, was ihm gerade in den Sinn kam. Nach einer Weile war er sogar davon überzeugt, einen wohlwollenden apotropäischen Einfluss auf das Leben des jeweils Sterbenden zu nehmen.
Nachdem das Spiel gut sechs Monate angehalten hatte, wurden seine morgendlichen Gedanken von Drängenderem in Beschlag genommen. Doch wenn er in den folgenden Jahren erneut in einen der unvermeidlichen Lebensstürme geriet, tröstete er sich jedes Mal mit der seltsamen Gewohnheit, nach dem Aufwachen ein paar Minuten dazuliegen, an die Decke zu starren und über die ewige Ruhe nachzudenken.
Das Ende aller Probleme.
Barbara schlief auf der Seite, mit dem Rücken zu ihm. Wie meist hatte sich ihr linkes Bein über seines geschoben und verankerte sein Fußgelenk in der Matratze, als könne er sonst davonschweben.
Epaminondas döste auf der Kommode. Alle Haustiere hatten, quasi als endgültiger Beweis der magischen Kraft seiner Gedanken, bravourös das sechzehnte Lebensalter erreicht.
An diesem Morgen sollte Davide ein Gliom aus dem Hirn eines Mädchens entfernen, pflichtgemäß widmete er einige Minuten dem Tod der Schwann-Zellen.
Da weckte etwas seine Aufmerksamkeit. Ein großer, plumper, schwarz glänzender Käfer krabbelte hinter dem Schrank hervor. Er starrte ihn an, eigentlich kaum überrascht. Die Balkontür ging auf den Garten, ein unerschöpfliches Einfallstor für alles Mögliche.
Epaminondas, von Gehör, Geruchssinn, Katzeninstinkt gewarnt, hatte die Augen bereits geöffnet.
Der Kater hob das Köpfchen und nahm den Eindringling, der mit rührender Entschlossenheit über das Parkett krabbelte, ins Visier. Der Mann wartete auf einen unvorhergesehenen Nachtrag zu seinen Gedankengängen: nach dem würdigen Ende einer Zelle nun der gewaltsame Tod eines großen Insekts.
Doch Epaminondas beschloss, weiterzuschlafen. In zehn Minuten würde sein Herrchen aufstehen und seinen Napf befüllen. Warum sollte er sich da noch um etwas bemühen, das augenscheinlich weniger appetitlich aussah?
Epaminondas war mindestens zehn Jahre lang der wildeste, verwegenste Kater im Viertel gewesen, mit goldgelben Augen, furchterregendem Gang, beeindruckenden Reflexen. Er erklomm Vorhänge, baumelte an Lampenschirmen, sonnte sich in prekärem Gleichgewicht auf schmalen Erkerfenstern, erkundete das Revier mit kühnen Dachsprüngen, zettelte aus eitlen Gründen sexueller Überlegenheit historische Raufereien mit Nachbarskatern an, die Widersacher waren sämtlich kastriert. Im Sommer rundete er seine Ernährung mit entomologischen Ergänzungsmitteln aller Art ab, Grillen, Bienen, Schmetterlingen, Fliegen, Käfern, Zikaden. Ein Serienkiller, ein vierbeiniger Völkermörder, eine demografische Kontrollinstanz des faunischen Ökosystems im halben Viertel.
Und jetzt? Jetzt verbrachte er seinen letzten Lebensabschnitt im Zeichen eines unglaublich faulen, entspannten Laissez-vivre. Er hatte einen Zustand kluger Besonnenheit erreicht, in dem er keine Lebenskraft mehr vergeudete und die Dimensionen umsichtiger Weisheit vermaß.
Der Glückliche, dachte Davide.
Später kam auch Barbara in die Küche, barfuß.
»War ich nicht mit dem Kaffee dran?«, fragte sie.
»Ich bin schon eine Weile auf.«
Barbara überprüfte irgendetwas an der Decke, kratzte sich an der Brust, setzte sich schließlich auf einen Hocker an der Kücheninsel. Es folgte das übliche Spiel mit Fußgelenk und Ferse, um Epaminondas, der sich an ihren Waden reiben wollte, auf Abstand zu halten.
»Ist Tommaso schon wach?«, fragte sie.
»Ich denke. Ich höre ihn schon eine Weile rumoren.«
»Ehe ich es vergesse, Schatz. Gestern ist ein Brief vom Anwalt gekommen.«
»Von welchem Anwalt?«
»Dreimal darfst du raten.«
Davide stellte die Espressokanne auf den Induktionsherd.
Barbara strich mit beiden Händen an ihren Kopfseiten entlang, fasste die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und zog ein rotes Gummiband, das unversehens zwischen ihren Fingern auftauchte, darüber. Fred Feuerstein, der auf dem Küchenteppich kauerte, beobachtete sie aufmerksam. Nicht selten richtete sich sein Frauchen die Haare, wenn anderes als das übliche Futter oder Streicheln anstanden. Baden, Besuch beim Tierarzt oder so.
»Was machst du für ein Gesicht?«, fragte Barbara. »Er hat gesagt, wir würden von seinem Anwalt hören, und er hat Wort gehalten. Wenigstens das könnten wir anerkennen, wenn es schon sonst nicht viel Anerkennenswertes gibt.«
»Und was meint dieser Anwalt?«
»Nichts, was uns Sorgen machen müsste. Eigentlich verlangt er nur von unserem Anwalt, nichts mehr von seinem Mandanten zu verlangen.«
Davide ging zum Kühlschrank, öffnete ihn, studierte den Inhalt und griff schließlich nach einer Packung Hafermilch und einem Marmeladenglas. Er stellte die Marmelade auf die Kücheninsel, goss Milch in eine Keramikschale und rückte diese, nachdem er daran gerochen hatte, neben die Marmelade. Dann drehte er sich um, öffnete die linke Küchenschranktür und nahm eine Schachtel Zwieback heraus.
»Ich hab Paolo schon alles geschickt«, sagte Barbara.
»Gut.«
Da kam Tommaso die Treppe herunter, lautlos gefolgt von Cochise. Unermüdlich und diskret wie der Bursche eines südamerikanischen Generals ließ ihn der Kater nicht einen Moment aus den Augen.
»Hallo«, sagte Tommaso.
»Hallo, mein Schatz«, antwortete Barbara.
»Ich hab dir schon Hafermilch eingegossen«, sagte Davide.
Tommaso öffnete das oberste Fach seines Rucksacks, kramte nach seinem Handy, wischte über das Display und begutachtete die Folgen seines Daddelns, mit dem üblichen Repertoire mikromimetischer Unzufriedenheit, das er seit einiger Zeit zeigte. Schließlich ging er zur Kücheninsel, setzte sich, legte das Handy neben die Schale und langte mit den Fingern in die offene Zwiebackschachtel.
»Wäschst du dir nicht die Hände?«, fragte Barbara.
»Habe ich oben gerade gemacht«, antwortete Tommaso, streckte den Arm aus, griff nach dem Marmeladenglas, überprüfte das Etikett, stellte das Glas zurück.
»Was machst du heute?«, fragte Davide.
»Ich fahr zu Marco«, antwortete er und tauchte einen Zwieback in die Milch. »Mit dem Bus«, präzisierte er, um einem vermuteten väterlichen Verlangen nach Klärung zuvorzukommen.
»Und mit wem?«, fragte Barbara.
»Maureo. Anna. Claudo. Vielleicht Penna. Francesca. Giorgio. Vielleicht kommt auch Lenny.«
Barbara schaute ihren Mann an. Lenny?, fragte sie tonlos. Davide zuckte mit den Schultern, als habe er es längst aufgegeben, den befremdlichen Namen in Tommasos Freundeskreis näher nachzugehen.
»Ich kann dich mitnehmen«, sagte er. »Die Villa der Callipos ist nicht weit von der Klinik.
»Wenn du willst.«
»Ich trink den Kaffee aus, zieh mich an, dann können wir los.«
»Ich hab’s nicht eilig.«
»Ich schon.«
Cochise, auf den Hinterbeinen sitzend, wartete demütig und mit einem Anflug von Schmollen zu seinen Füßen. Sein Charakter und der Epaminondas’ verhielten sich geradezu spiegelverkehrt, kaum zu glauben, dass sie aus einem Wurf waren. Auf einmal machte er einen Satz, landete mit einem dumpfen Ton auf den Schenkeln seines Herrchens und richtete sich auf dessen Jeans ein.
Die Espressokanne zischte.
»Was machst du heute Mittag?«, fragte Davide Barbara.
»Ich weiß nicht. Wieso?«
»Ich würde gern das kleine Restaurant in der Viale Puccini ausprobieren, von dem alle so begeistert erzählen. Kommst du hin? Wir werden schon was für dich finden.«
»Ja, warum nicht?«
Dann wandte er sich an Tommaso.
»Kommst du auch, mein Schatz?«
»Ich weiß nicht«, sagte er. »Um wie viel Uhr denn?«
»Das hängt von deiner Mutter ab. Für mich würde ein Uhr passen.«
»Ich muss heute Nachmittag zu meinen Eltern«, sagte Barbara. »Halb vier habe ich meiner Mutter gesagt. Aber das reicht ja für ein Hochzeitsmahl.«
»Ja, wieso nicht ein Hochzeitsmahl?«
Eine halbe Stunde später stiegen Davide und Tommaso in den BMW. Das elektrische Einfahrtstor glitt mit einem Surren auf, das nicht ganz so lieblich klang wie sonst. Davide schaute an der Hausfassade hoch. Bis zum Jahresende würden dort wohl einige Instandsetzungsarbeiten nötig sein, hatte Barbara prophezeit, aber das Quietschen des Tors kündete wohl eher von umfassenderen kostspieligeren, konservativen Eingriffen. Soweit er wusste, war das zweistöckige Haus das erste in ganz Lucca, das nur aus Holz gebaut war. Als Barbara ihre Schwangerschaft bemerkt hatte, hatte sie ihren Ehemann kaum eine Woche später schon von einem alternativen Bauunternehmen zum nächsten geschleppt. Dort hatten sie Kataloge gewälzt, die luxuriöse, ökologisch-nachhaltige Fertighäuser zeigten, mit jedem Komfort, aber ohne das lästige Schuldgefühl, seinen exzentrischen Launen auf Kosten des Planeten nachzugeben. Gebieterisch prankte auf den Hochglanzbroschüren das Akronym NZEB: Nearly Zero Emission Building. Barbara, gesprächig und voller Zuversicht, prägte sich jedes Detail ein. Davide stand blinzelnd, mit verschränkten Armen, dabei, als Mann der Wissenschaft misstraute er der radikalen Abkehr von tief verwurzelten Konzepten. Die Vorstellung, wie Überlebende einer Naturkatastrophe in einem Holzhaus zu leben, entsetzte ihn.
Nach der Heirat hatten sie das obere Stockwerk im düsteren Haus seiner Eltern, auf den Hügeln nordöstlich der Stadt, bezogen. Dann hatten sie Tommaso gezeugt, und Barbara verlangte ebenso energisch wie sanft, sich aus der Obhut der Schwiegereltern zu befreien und eine winzige Innenstadtwohnung zu mieten. Nicht nur das düstere Haus störte sie. Denn schon länger wurde die familiäre Harmonie durch eine ideologische Auseinandersetzung zwischen Davide und seinem Vater erschüttert, der ebenfalls Neurochirurg war. Als ödipaler Vorwand diente der epochale Streit zwischen den Anhängern der Lokalisations- und Plastizitätstheorie.
Barbara hatte sich damals gerade erst der Logopädie zugewandt, bei der es höchstens am Rande um das tiefere Verständnis zerebraler Vorgänge ging. Um den Aussprachefehler eines Kindes zu korrigieren, brauchte man keine einheitliche neurologische Theorie. Allerdings hatte sie Sacks gelesen, auch ein wenig Kandel, und wollte gern herausfinden, wie unüberwindbar die theoretische Kluft zwischen Ehemann und Schwiegervater tatsächlich war.
Als Davide eines Abends zerstreut vorm Fernseher saß, rückte sie näher und bat ihn, ihr das Problem zu erklären.
»Tja, am Anfang glaubte die Neurologie, dass alle Hirnfunktionen von vornherein und unabänderlich in einem festgelegten Bereich des Gehirns angesiedelt sind.« Er reckte sich. »Aber dann entdeckte man, dass bei Bedarf alle Aufgaben auch von Nachbarbereichen übernommen werden. Das Gehirn ist also plastisch, veränderbar, anpassungsfähig. Doch wenn mein Vater das hört, reagiert er leider bis heute nur mit Achselzucken.«
»Und darum musst du auf ihn sauer sein?«
»Er ist ja auf mich sauer.«
Bald darauf hatten sie den zweiten Stock eines dreistöckigen Gebäudes in der Via Sant’Andrea gemietet. Über ihnen wohnte eine Familie mit vier Kindern, unter ihnen ein wunderbares älteres Paar. Beide Parteien bemühten sich redlich, bestimmte Tageszeitenmit Lärm zu füllen, wobei diese so streng voneinander getrennt waren, als habe man sie ihnen bei einem speziell anberaumten Mietertreffen zugewiesen. Vormittags waren die trostlosesten staatlichen Fernsehprogramme an der Reihe, von den zwei Leutchen inbrünstig kommentiert. Nachmittags drang dann Kindergeschrei nach unten, vom Familienhund mit begeistertem Herumtollen quittiert. Entgegen der offenbar geltenden Regelung kläffte und jaulte der große, honigfarbene, dumme, hyperaktive Cockerspaniel zu jeder Tageszeit.
Davide und Barbara hielten bis zum zweiten Herbst durch. Im Sommer hatte Barbara von ihren Großeltern ein kleines Grundstück in der Via Tofanelli, südlich der Stadtmauer, geerbt. Nach mehrfacher Inaugenscheinnahme hatte sie Davide vorgeschlagen, dort ein Holzhaus zu errichten.
Ein Holzhaus? Ja, er habe richtig verstanden, jedoch mit innovativen technischen Lösungen und lächerlichem energetischen Fußabdruck.
Es gab bereits einen Entwurf von einem befreundeten Architekten, Partner in einer undurchsichtigen, utopistischen Bio-Architektengruppe: zwei Stockwerke, ein mit Glyzinien begrünter Vorbau, eine Dachterrasse mit Whirlpool für vier Personen. Und die Nachbarn? Die würde man mit Weiden und Olivenbäumen im Garten, mit schwarzen Steinen und Klee auf Abstand halten, das Wort »Nachbar« sei seiner Bedeutung quasi entkleidet.
Schluss mit Cockerspanieln, unruhigen Kindern und Quizsendungen.
Schließlich hatte Davide Ja gesagt, wenn auch schweren Herzens. Wozu war er denn Arzt geworden, mit hunderttausend im Jahr, wenn er wie die Polynesier im Pfahlbau wohnte?
Tommaso zog ein Skript aus dem Rucksack, der zwischen seinen Beinen klemmte.
»Was ist das?«, fragte Davide.
»Ein Merkblatt«, antwortete er. »Für die Arbeit, die wir Samstag abgegeben haben.«
»Ich dachte, es wären Ferien.«
»Erst ab übermorgen.«
»Also rechtzeitig für das große Ereignis. Bist du aufgeregt?«
»Hm. Sollte ich?«
Sie standen an einer Ampel, Davide beobachtete, wie sein Sohn sorgfältig etwas Beigefarbenes vom Sitz kratzte, unter seinem Oberschenkel. Ein schüchterner Junge, ein Ass in der Schule, mit dem Steckenpferd Astronomie. Gerade fand er aus einer schwierigen Zeit heraus, nach einer vernachlässigbaren Phase jugendlicher Pseudorebellion, die vermutlich nicht die letzte sein würde, eine dieser zahllosen leichten Ordalien, durch die die Entwicklung westlicher Jugendlicher strukturiert wurde.
»In deinem Alter«, sagte er, »hätte ich nachts kein Auge zugetan. Stell dir vor, Aerosmith.«
»Danke, ich schlaf auch so schon schlecht genug.«
»Im Rolling Stone stehen sie auf Platz neunundfünfzig der hundert größten Musiker aller Zeiten.«
»Platz neunundfünfzig?«
»Okay. Aber Steven Tyler wurde zur größten Popikone aller Zeiten gewählt. Aller Zeiten. Mit Elvis. Freddie Mercury. Bono. John Lennon.
»Wer ist Elvis?«
Davide blickte ihn leicht verwirrt an. Tommaso befand sich offenbar in einer Phase, in der man sich gegen die wachsenden Forderungen, die die Erwachsenenwelt, kaum hat sie die Kindheit für beendet erklärt, begierig an einen herantrug, nur durch deutliches Desinteresse gegenüber zweitrangigen Fragen wehren konnte. Davide hatte das nicht gekannt. Er hatte in seiner gesamten Jugend alle Anregungen dankbar aufgenommen. Bis heute erinnerte er sich daran, wie bestürzt er am Studienbeginn gewesen war, als der Professor für Embryologie eine jener unüberprüfbaren Aussagen formulierte, die bei den Erstsemestern unvermeidlich eine Woche lang verwunderten Widerwillen auslösten: Die Welt, die wir wahrnehmen, sei eine Illusion, sagte er, Blumen, Bäume, Himmel, Wolken, Meere, Häuser, Autos, Bücher, Tiere, das Gesicht der Eltern oder der Freundin seien gar nicht real oder zumindest nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Die Welt sei eine stumme aschfarbene Architektur aus farb-, geruch-, geschmack- und temperaturlosen Molekülen, die jedes Gehirn durch elektrische Potenziale zu einer eigenen Wahrnehmung zusammensetze, die mit den fahlen konkreten Fakten wenig gemein habe.
Der BMW war eine kurze Auffahrt hinaufgekrochen. Inmitten einer langen Backsteinmauer tauchte ein kleines Tor auf.
»Wir sehen uns im Restaurant«, sagte Davide, als Tommaso die Autotür öffnete. »Viale Puccini, 1524.«
»1524, ist das der Name?«
»Nein, die Hausnummer.«
»Und der Name?«
»Weiß ich nicht mehr.«
Tommaso schwang den Rucksack über die linke Schulter. Davide schaute ihm nach, als er auf das Törchen zuging, leicht gebeugt, wie von den kürzlichen körperlichen Veränderungen noch ein wenig betäubt. Wegen eines winzigen hormonellen Ungleichgewichts hatte sich seine sexuelle Reife um ein Jahr verzögert, peinliches Bärtchen, Gelenkschmerzen, Stimmbruch, Hodenschmerzen, diverse akute Androgenausschüttungen. Als fürchte er weitere unangenehme Überraschungen, unterhielt Tommaso seitdem eine extrem vorsichtige, distanzierte Beziehung zu sich selbst.
Fünf Minuten später parkte Davide auf dem reservierten Klinikparkplatz.
Martinellis Wagen stand nicht da.
Umso besser, sagte er sich, stellte den Motor ab und blickte zum Klinikgebäude.
Die Drehtür oberhalb der Freitreppe kreiste träge um sich selbst. Seitdem er am Campo di Marte arbeitete, hatte er noch nicht ein Mal gesehen, dass ihre schlaffen Umdrehungen eine Pause eingelegt hätten.
Er griff nach seiner Tasche und stieg aus.
Je nach seelischer Verfasstheit, dachte er, hallen in den geheimen Winkeln unseres Geistes die beliebigsten Symbolismen wie dumpfe Glockenschläge wider.
2
ALS ER SICH IM UMKLEIDERAUM der Abteilung gerade das T-Shirt über den Kopf zog, klingelte sein Handy. Beim hektischen Versuch, sich zu befreien, landete er mit einem Arm im Kopfausschnitt, schaffte es aber schließlich, mit der freien Hand die Tasche zu erreichen, ganz unten im Spind. Er schaute nicht mal, wer dran war.
»Hallo?«, sagte er.
»Hallo Davide, ich bin’s, Paolo. Stör ich?«
»Nein, nein. Ich hätte dich ohnehin vor dem Mittagessen angerufen.«
»Du atmest schwer? Angenehm beschäftigt?«
»Ach was. Ich versuch nur, das Oberteil auszuziehen. Das wird langsam kompliziert. Ich hab wohl wirklich ein paar Kilo zugelegt.«
»Wo bist du?«
»In der Klinik. Gerade angekommen.«
»Deine Frau hat das Schreiben abfotografiert und mir geschickt.«
»Und? Was hältst du davon?«
»Nicht viel. Blendfeuer von einem kleinen Anwalt, der wenig in der Hand hat.«
»Bist du sicher?«
»Er blufft: ein Schreiben, höchstens zwei. Die Asse haben wir auf der Hand.«
»Das heißt?«
»Nichts. Wir setzen uns ans Ufer und warten ab, bis dein Nachbar vorbeitreibt, am besten mit dem Gesicht nach unten. In ein paar Wochen kannst du die Autopsie vornehmen.«
»Ich hab noch nie eine Autopsie vorgenommen.«
»Weil du ein Snob bist. Wie hieß noch mal der Arzt, der im 19. Jahrhundert bei einer Amputation Patient, Assistent und einen Zuschauer umgebracht hat?«
»Mmh … Robert Liston?«
»Er galt, wie ich gelesen habe, als der weltweit beste Chirurg. Und? Wann können wir das von dir sagen?«
»Könnte schwierig werden. Patient und Zuschauer, geschenkt, doch bei dem chronischen Personalmangel dürfte ich nicht mal die ungeschickteste Pflegekraft umbringen.«
Er beendete das Telefonat, schob das Handy zurück in die Tasche, wand sich aus dem T-Shirt und kleidete sich rasch fertig um. Als er auf den Flur trat, bemerkte er, dass der linke Kittelsaum ein wenig abstand. In der Eile hatte er den Kittel falsch geknöpft. Der Aufzug öffnete sich mit einem hydraulischen Zischen und spuckte zwei junge Krankenschwestern aus. Davide verlangsamte seine Schritte und grüßte, die Hände wie ein Kommunionkind beim Empfang der Hostie zwischen Schenkeln und Schambein; die beiden grüßten beinah unhörbar zurück, perfekt passend zur klösterlichen Atmosphäre der Abteilung. Er öffnete die Tür zum Arztzimmer, ging zum Schreibtisch, nahm das Diensthandy aus der Ladestation und ließ es in die Kitteltasche gleiten.
Als er sich bückte, um am Computer den Startknopf zu drücken, klopfte es.
»Guten Morgen, Chef.« Ein junger Arzt trat ein und blieb direkt hinter der Türschwelle stehen.
Davide richtete sich auf.
»Hallo Lucio«, antwortete er. »Wie geht’s?«
»Prächtig. Und dir?«
»Ich bin spät dran und hab einen schwierigen Vormittag vor mir.«
»Dein Kittel ist falsch geknöpft.«
»Ich hab’s gemerkt.«
»Du weißt ja, die ersten Symptome für kognitiven Abbau sind Fehler bei der Durchführung einfacher automatisierter Abläufe.«
»Sehr witzig.«
Er knöpfte den Kittel rasch auf und dann umgekehrt wieder zu. Schließlich zog er ein Taschentuch aus der Packung, die auf dem Schreibtisch lag, nahm die Brille ab und wischte sie, unter mehrmaligem Anhauchen, sauber.
»Wer hat heute die Visite gemacht?«, fragte er.
»Pieri.«
»Irgendwelche Neuigkeiten?«
»Bei dem Jungen auf 64 haben wir ein EEG gemacht. Wie erwartet, epileptogener Herd im Frontalbereich.«
»Und die Gehirnentzündung von 67?«
»Sieht gut aus. Siebenunddreißig acht heute Morgen.«
»Und sonst? Ein Schaudern an der Wirbelsäule verrät mir, dass es Neues gibt.«
»Es wurde ein junges Mädchen mit Verdacht auf TIA eingeliefert. Sie ist gerade in der Radiologie. Woher wusstest du das?«
»Übersinnliche Kräfte.«
»Das hab ich befürchtet.«
»Nach zehn Jahren hier drinnen ist das normal. De Angelis arbeitet seit ’92 hier und hat sogar telekinetische Fähigkeiten. Er kann Besteck allein durch die Kraft der Gedanken gerade biegen. Allerdings nicht verbiegen. An Uri Geller kommt er also nicht ganz heran.«
»Aber Geller hat gemogelt.«
»De Angelis nicht. Es gibt fünf mehr oder weniger nüchterne Zeugen, die alle gesehen haben, wie er Silvester eine Inox-Schöpfkelle gerade bog. Aber jetzt bring mir bitte den Wagen mit den Krankenakten und sag mir Bescheid, wenn sie das Mädchen raufbringen.«
»Okay.«
»Und Martinelli? Sein Raumschiff steht nicht auf dem Parkplatz.«
»Keine Ahnung, ob er heute kommt.«
»Okay, bis später dann.«
Der Computer war noch nicht hochgefahren. Er bückte sich noch einmal und betätigte die On-Taste.
Nichts.
Er zog das Handy aus der Tasche und betrachtete es, nichts Gutes ahnend.
Aus.
Einige Sekunden lang drückte er auf dem Display herum, auf den Seitentasten, nichts. Funktionierte es etwa nicht mehr? Es war ziemlich neu, kein billiges Gerät, ausschließlich durch den Vizeprimar der Abteilung zu nutzen, also ihn.
Er beugte sich über den Schreibtisch und begutachtete die Steckdosenleiste, in der die Netzkabel von Computer und Ladegerät steckten. Der Stecker mit den bikuspiden Polen lag am Boden, wie das fossile Köpfchen eines winzigen Drachen.
Fast musste er lächeln.
»Das wird bestimmt ein super Tag«, murmelte er.
3
BARBARA GRIFF NACH DEM BADEMANTEL, der über dem Handtuchwärmer hing, und stieg aus der Dusche. Fred Feuerstein, der unter dem Waschbecken saß, blickte sie unverwandt an. Während Cochise ausschließlich Tommaso zu seinem Objekt spiritueller Fürsorge erwählt hatte, begleitete und tröstete Fred jeden. Als junger Hund hatte er so hektisch mit den Beinen gerudert, dass er auf dem Parkett ausrutschte. Es sah aus wie bei seinen namensgebenden Zeichentrick-Vorfahren, die ihre Autos per Beinarbeit vorwärtsbewegten. Erst mit den Jahren eignete er sich die vorsichtige Gangart einer Minderheitenspezies an, die den wechselhaften Launen psychotischer Mitbewohner ausgesetzt war.
Barbara stellte sich vor den Spiegel und schlug den Bademantel zurück. Seit einigen Tagen juckte die kleine Narbe am Bauch. Ein Kaiserschnitt, hatte sie vor Jahren gelesen, könne aufgrund des schlechten Gewissens, seinem Kind die immunologischen Vorteile der natürlichen Geburt vorenthalten zu haben, zu psychosomatischen Konflikten führen. Der Gynäkologe hatte bei ihr eine Placenta praevia diagnostiziert, eine klassische Geburt, so der eindringliche Rat, käme überhaupt nicht infrage. Manchmal malte sie sich daher aus, wie sie den Kleinen an diesem schicksalhaften Tag in die Arme nahm, anlegte, ihm, während der Schnitt unter dem Bauchnabel genäht wurde, sinnlose Worte zuflüsterte, schließlich die Arme ausstreckte und das faltige Gesichtchen, um es mit rettenden Bakterien zu überschwemmen, über Muschi und Damm rieb. Einmal hatte sie sich, im Bett, mit Davide darüber unterhalten, einige Monate nach Tommasos Geburt.
»Warum hast du mir das nicht gesagt?«, griff sie ihn an. »Ich hatte ja keine Ahnung.«
»Ich dachte, der Gynäkologe würde dir das erklären.«
»Wo er eine natürliche Geburt ausgeschlossen hat?«
»Schatz, mach dir keine Sorgen. Tommaso entwickelt auch so genug Antikörper.«
Sie presste den Finger auf die Lippen.
»Glaubst du, ein wenig Reiben nach der Geburt hätte dieselbe Wirkung gehabt?«
»Reiben?«
»An meiner Muschi.«
»Wie meinst du das?«
»Wie ich das meine? Was wäre passiert, wenn ich Tommaso genommen und zwischen meine Beine gehalten hätte?«
Davide kratzte sich an der Stirn.
»Tja, seine Lymphozyten hätten zweifellos davon profitiert«, antwortete er. »Aber du hast nicht an die Zeugen gedacht.«
»Zeugen?«
»Ärzte, Krankenschwestern. Stell dir mal die Schlagzeile im Tirreno am nächsten Morgen vor: ›Inzest und Blasphemie in privater Geburtsklinik‹.«
»Ach komm.«
»Natürlich. ›Studentin vollführt obszönes Ritual mit neugeborenem Sohn‹.
»Meinst du?«
Zwei Wochen später war Barbara mit zwei Kätzchen nach Hause gekommen. »Antikörper für den Kleinen«, hatte sie Ehemann und Hund erklärt.
Sie betrachtete ihre Schamhaare. Zeit für einen radikalen Schnitt? In nicht einmal einem Monat wurde sie vierzig, und sie hatte sich noch nie komplett rasiert. Davide würde das gefallen, aber er würde ihr seine üblichen deontologischen Zweifel entgegenhalten: Er würde angesichts der Schutzfunktion der Schamhaare niemals zulassen, dass seine Frau ihrer Intimgesundheit wegen seiner – höchst banalen – erotischen Fantasien schadete.
Vierzig, dachte Barbara. In weniger als einem Monat.
Gerade wollte sie sich tristen Gedanken hingeben, da bemerkte sie einen vagen Schatten im Spiegel.
War jemand im Garten?
Sie drehte sich abrupt um. Den Bademantel mit einer Hand zuhaltend, trat sie zum Fenster.
Ihr Blick schweifte prüfend über die linke Gartenseite.
Nichts.
Über die rechte.
Neben der Hecke stand jemand, mit dem Rücken zu ihr. Es sah aus, als suche er etwas.
Wie war er hereingekommen?
Barbara zog den Gürtel fest zu, verließ das Badezimmer, durchquerte das Wohnzimmer, öffnete die Tür und stand auf der Veranda. Auf dem schmiedeeisernen Tisch lag der alte Prince-Tennisschläger. Sie griff danach, ging ein paar Schritte, lehnte sich gegen die Hausecke und reckte Kopf und Oberkörper vor.
Zwischen den Glanzmispeln und dem blauen Mini Countryman stand noch immer jemand, mit dem Rücken zu ihr.
Ein Jugendlicher, der Kleidung nach zu urteilen. Kappe verkehrt herum auf dem Kopf, violettes Muscleshirt, knielange Hose, Sneakers. Über die Hecke gebeugt, zerteilte er das Blattwerk.
Barbara machte noch ein paar Schritte, zeigte sich.
»Hallo«, sagte sie. »Kann ich dir helfen?«
Der Junge richtete sich wie vom Blitz getroffen auf und drehte sich leicht verlegen, mit halb offenem Mund, um. Er war groß und kräftig, aber jünger, als er von hinten gewirkt hatte.
»Hast du etwas verloren?«, fragte Barbara.
Er schluckte ein paar Mal, hob eine Hand und richtete die Kappe. Zu beiden Seiten des Schirms quollen blonde Haarbüschel hervor. FREMANTLE FOOTBALL CLUB stand auf dem Shirt.
Barbara nahm den Tennisschläger über die Schulter.
»Also?«
Der Junge zeigte mit dem Daumen auf die Glanzmispeln.
»Mein Bumerang«, sagte er. »Der ist da reingefallen.«
Barbara blickte auf das rötliche Gewirr aus Zweigen und Blättern und fragte sich erneut, wie der Junge hereingekommen war. War er über das Tor geklettert? Hatte er dem Heckenschlund ein paar Hautzentimeter geopfert? Kam man so einfach in ihren Garten? Vielleicht sollten sie die Taxonomie der Tiere im Hause Ricci um einen kampflustigen, revierbewussten Hund erweitern.
»Soll ich dir suchen helfen?«, fragte sie.
Der Junge nickte.
Barbara trat näher, der Tennisschläger baumelte in ihrer Rechten. Ihr Haus lag in dem ruhigen Viertel einer verschlafenen Provinzstadt, aber man konnte nie wissen. Sie beugte sich über die Hecke und durchsuchte sie mit gebührendem Sicherheitsabstand.
»Wo ist er denn hingefallen?«, fragte sie, während sie weiter zwischen den Glanzmispeln stöberte, den Jungen wiederholt misstrauisch beäugend. Winzige Pickel blühten auf Stirn und Wangen. Insgesamt wirkte er harmlos, der Tennisschläger war als Abschreckungswaffe wohl unverhältnismäßig. Darum spreizte sie nun, um seinen einschüchternden Zweck zumindest ein wenig zu kaschieren, die Zweige damit auseinander. Doch dann fiel ihr ein, dass der Junge sie gesehen haben musste, als sie nackt vorm Spiegel stand.
»Ich bin Tommasos Mutter«, sagte sie, ohne bestimmte Absicht. Oder vielmehr, um auf meldebehördlicher Kluft und Mutterschaft die Pfeiler ihrer sexuellen Nichtverfügbarkeit zu errichten. Doch eine Sekunde später erinnerte sie sich, dass das M in dem bekannten Akronym MILF ausgerechnet für Mother stand, und verabschiedete sich leicht wehmütig von diesem Bollwerk.
Außerdem war klar, dass eigentlich gar nichts in der Hecke war.
Wie lange würde der Junge noch brauchen, um eine würdige Rückzugsstrategie vorzubringen, fragte sie sich und griff den Tennisschläger ein wenig fester. Doch ganz gleich, wie unglaubwürdig oder demonstrativ ungehörig seine Entschuldigung ausfallen würde, im Grunde wusste sie eine fantasievolle Ausrede wie einen Bumerang durchaus zu schätzen.
»Tommaso?«, fragte der Junge.
»Ja, das ist mein Sohn. Kennst du ihn?«
»Nein. Ich kenne hier keinen. Ich bin erst seit einer Woche hier.«
»Ach ja, wo kommst du denn her?«
»Aus Australien.«
»Echt? Und wo wohnst du jetzt?«
Der Junge hob den Kopf, zog den Arm aus der Hecke und zeigte auf ein niedriges Haus auf der anderen Straßenseite.
»Dort«, sagte er. »Im ersten Stock. Darunter ist der Club von meinem Vater, das Labyrinth.«
Barbara beugte sich tiefer über die Hecke und schloss die Augen.
Scheiße, dachte sie, während sie so tat, als würde sie nach dem Fantasie-Bumerang suchen.
Der Lenci-Sohn. Ausgerechnet. Sein Vater hatte sie in den letzten zwölf Monaten vier Tage die Woche um den nächtlichen Schlaf gebracht und versuchte jetzt, sie mit anwaltlichen Drohbriefen einzuschüchtern.
»Und wie heißt du?«, murmelte sie.
»Giovanni.«
Am liebsten hätte sie bis tief in die Nacht in dieser Position verharrt, aber sie atmete tief durch, öffnete die Augen und wollte sich schon aufrichten, als sie den Bumerang sah.
Er war viel kleiner als gedacht, und mit seiner Farbe zwischen den Glanzmispelblättern und –zweigen perfekt getarnt. Sie griff danach, zog ihn heraus und reichte ihn dem Jungen.
»Hier ist er«, sagte sie.
»Oh«, antwortete er, mit einem Anflug von Lächeln.
»Ich hab ja davon keine Ahnung«, sagte Barbara. »Aber ich hatte ihn mir viel größer vorgestellt.«
»Es gibt verschiedene Bumerangs«, sagte Giovanni und hielt ihn an den beiden Enden, damit sie ihn besser sehen konnte. »Das hier ist ein Original, von einem Noongar bemalt. Das sind Aborigines, die in der Wüste leben, östlich von Perth.«
»Und wie bist du da drangekommen?«
»Ich hab da die letzten vier Jahre gelebt.«
»In der Wüste?«
»Nein, nein. In Perth.«
»Ach ja, natürlich, wie dumm.«
»Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
»Keine Ursache.«
Dann stand sie, den Tennisschläger in der Rechten baumelnd, reglos da und schaute zu, wie der ein wenig unbeholfene Junge ohne viel Aufhebens über die Hecke kletterte und dorthin zurückkehrte, wo er hergekommen war.





























