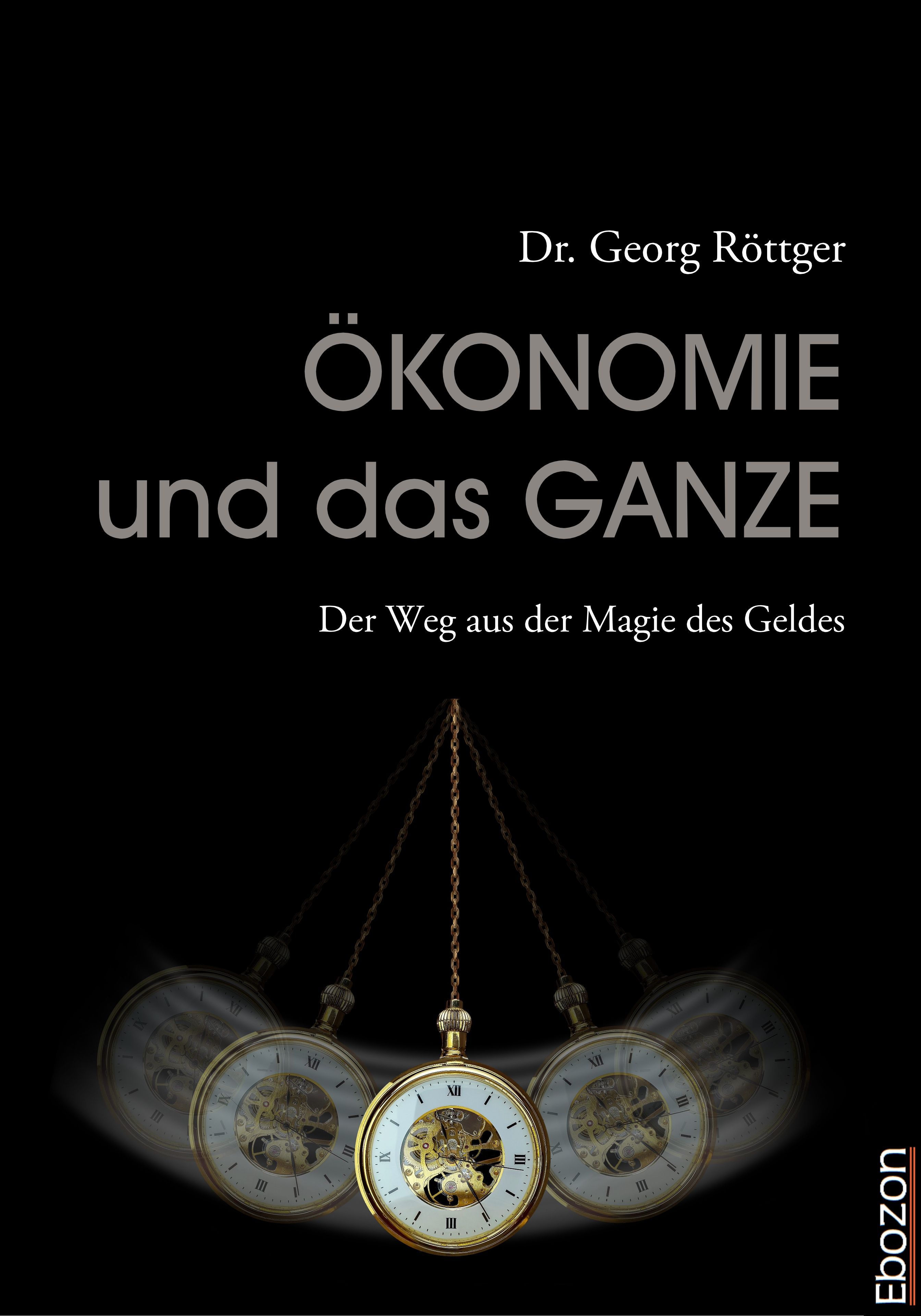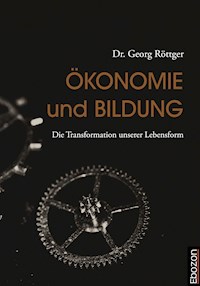Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ebozon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Unsere Gesellschaft wird in zunehmendem Maße von Angst durchzogen. Angst sozial abgehängt zu werden. Angst den Arbeitsplatz zu verlieren. Angst vor Überfremdung. Angst vor Klimakatastrophen und terroristischen Attacken. Schon in der Schule beginnt die Angst vor den Noten, die sich in der Hochschule fortsetzt. Die Reaktion hierauf ist Kontrolle und Überwachung als Steuerungsinstrument der Gesellschaft. Hinzu kommt ein weiteres Steuerungsinstrument, das GELD, das immer weitere Bereiche der Gesellschaft erfasst. Das Medium GELD hat aber keinerlei direkten Zugriff zum wirklichen ökonomischen Geschehen. Dass GELD dies leisten könnte, ist ein tiefsitzendes Vorurteil des Mainstreams der Ökonomik. Nur in den Medien ZEIT und WERT ist überhaupt ein direkter Zugriff auf die Realwirtschaft möglich. Der Autor zeigt in diesem Buch: (1) Wie es zu diesem eindimensionalen Blick auf die Ökonomie im Medium GELD kommen konnte (2) Wie sich die Ökonomie in die zusätzlichen Medien ZEIT und WERT ausdifferenzieren konnte (3) Dass erst mit Hilfe dieser zusätzlichen Medien die Ökonomie als Ganzes verstanden werden kann (4) Dass sich erst durch die Medien ZEIT und WERT das Finanzsystem im Medium GELD verselbständigen konnte und nun die Gesellschaft als ganze bedroht (5) Dass sich zugleich durch die Ausdifferenzierung von ZEIT und WERT aber auch die Ökonomie wieder in die Gesellschaft integrieren lässt (6) Dass das GELD dann nicht mehr das die Gesellschaft dominierende Medium sein wird, sondern von ZEIT und WERT abgelöst werden kann (7) Dass sich so erst das Soziale bilden kann, das sich dann auch sozial anfühlt (8) Dass dies ein Transformationsprozess unserer Gesellschaft ist, der nur vergleichbar ist mit dem der Neolithischen Revolution vor 12.000 Jahren
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage Dezember 2018
Copyright © 2018 by Ebozon Verlag
ein Unternehmen der CONDURIS UG (haftungsbeschränkt)
www.ebozon-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung: media designer 24
Coverfoto: Pixabay.com
Layout/Satz/Konvertierung: Ebozon Verlag
ISBN 978-3-95963-546-2 (PDF)
ISBN 978-3-95963-544-8 (ePUB)
ISBN 978-3-95963-545-5 (Mobipocket)
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors/Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Veröffentlichung, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Dr. Georg Röttger
ÖKONOMIE
ohne GELD?
Warum ZEIT und WERT das Geld als dominierendes Medium der Gesellschaft ablösen werden
Ebozon Verlag
1. Einleitung
Unsere Gesellschaft wird in zunehmendem Maße von Angst durchzogen. Angst, sozial abgehängt zu werden. Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Angst vor Überfremdung. Angst vor Umweltkatastrophen. Angst vor Terror- und Cyber-Attacken. Schon in der Schule beginnt die Angst vor den Noten, die sich in der Hochschule fortsetzt. Die Reaktion hierauf ist Kontrolle und Überwachung als Steuerungsmedium der Gesellschaft.
Hinzu kommt ein weiteres Steuerungsmedium, das Geld, das immer weitere Bereiche der Gesellschaft erfasst. Das Medium Geld hat aber keinerlei direkten Zugriff zum wirklichen ökonomischen Geschehen. Dies ist nur in den Medien Zeit und Wert möglich. In diesen Medien hat sich die Ökonomie intern nochmals ausdifferenziert, in die Systeme Logistik und Qualitätswesen. Diese beiden Systeme sind dabei, sich autopoietisch zu schließen, neben dem in Geld operierenden Finanzsystem. Weil die Realwirtschaft sich in den Medien Zeit und Wert ausdifferenziert hat, existiert heute ein im Medium Geld operierendes Finanzsystem bzw. eine Geldwirtschaft. In diesem System kann aus Geld Geld gemacht werden, ohne in der Realwirtschaft Werte schaffen zu müssen.
Dass es im Medium Geld unmöglich ist, Herstellprozesse zu steuern, zeigen der VW-Diesel-Betrug, der Bau des Berliner Flughafens, der Bau der Hamburger Elbphilharmonie. Hier fehlt es an Logistik und Qualität. Aber dies ist nur die Spitze eines Eisberges. Unsere ganze Gesellschaft ist hiervon durchdrungen. In definitorischer Begrifflichkeit ist dies jedoch nicht zu erkennen. Sie macht ein Verstehen systematisch unmöglich. Und hier verbindet sich nun Geld mit Angst. Denn Unverstandenes aber bedrängendes Geschehen macht Angst: Finanzkrise, selbstverursachte Umweltkatastrophen, Migration, sich unaufhaltsam öffnende Schere zwischen Arm und Reich, drohender sozialer Abstieg etc.
Das ist aber noch nicht die ganze Wirklichkeit. Denn durch die definitorische Begrifflichkeit der Ökonomik haben wir es nur mit der „Geltung“ zu tun, nicht mit ihrer Genesis. Durch die definitorische Begrifflichkeit wird die Herkunft der Begriffe und damit die Zeit stillgestellt. Das Ergebnis ist das, was Hartmut Rosa „rasender Stillstand“ nennt. D. h. geistiger Stillstand bei rasender wirklicher Veränderung. Begrifflich können wir das nicht mehr erfassen, was sich in der Wirklichkeit ereignet. Das macht Angst vor jeder Veränderung. Die Menschen spüren, dass das, was ihnen die Eliten in ihrer definitorischen Begrifflichkeit, die jede Entwicklung und damit die Zeit stillstellt, erzählen, nicht mehr stimmen kann. Durch das Stillstellen der Zeit wird uns eine selbstbestimmte Entwicklungsmöglichkeit genommen.
Die – in definitorischer Begrifflichkeit unerkennbare – interne Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems in den Medien Zeit und Wert zeigt uns jedoch, dass die wirkliche Wertschöpfung schon immer in diesen Medien stattfand. Nun können wir dies erst erkennen, weil sich in diesen Medien Logistik und Qualitätswesen als Systeme schließen. D. h., die Medien Zeit und Wert haben das Medium Geld freigelegt. Es ist nun als OBJEKT erkennbar. Bisher ist Geld lediglich ein „Übergangsobjekt“. Als OBJEKT bleibt uns das Geld auch in Zukunft erhalten. Es wird jedoch nicht mehr das dominierende Medium der Gesellschaft sein. Dies übernehmen in Zukunft die Medien ZEIT und WERT. Nur sie haben eine direkte Verbindung zum empfindsamen Individuum, zur Gesellschaft und zur Natur.
Geld kann den Produkten im Prozess der Herstellung erst nachträglich zugeordnet werden. Jedes Ereignis in der Ökonomie ist erst vollständig beschrieben in den drei Medien Zeit, Wert und Geld. Da der Mainstream der Ökonomen ihren Gegenstand jedoch nur im Medium Geld erfasst, sieht er die Wirklichkeit nicht. Aufgrund seiner definitorischen Begrifflichkeit kann er sie gar nicht sehen. Aber er versucht das Unmögliche, ein Geschehen in einem Medium zu steuern, das keinen Zugriff zu diesem Geschehen hat.
Aber die Geschichte, die ich erzähle, geht noch weiter. Da nur die Reichen die Möglichkeit haben, aus Geld Geld zu machen, um sich so aus der Realwirtschaft Eigentum anzueignen, öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter, ohne dass dies aufgrund der definitorischen Begrifflichkeit verstanden werden kann. Produktiv ist aber nur die Realwirtschaft. Vor ca. 100 Jahren begann mit Taylor die wissenschaftliche Betriebsführung. Zu jener Zeit begann erst die in den Medien Zeit und Wert betriebene Ausdifferenzierung von Logistik und Qualitätswesen. Dies ist jedoch die Bedingung der Möglichkeit eines im Medium Geld ausdifferenzierten Finanzsystems. So ist es tatsächlich möglich, ohne Werte zu schaffen, aus Geld Geld zu machen und sich damit Eigentum anzueignen.
Zu Beginn dieses Ausdifferenzierungsprozesses konnte in der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung noch jedem Ereignis Geld über die Medien Zeit und Wert zugeordnet werden. Dieser klassische Bereich der industriellen Fertigung schrumpft aber immer mehr, so dass das Geld keinen Zugang mehr zu den „wirklichen Treibern“ (Horváth) der ökonomischen Entwicklung hat. Denn dies sind Zeit und Wert. Unsere Eliten in Ökonomie, Politik und Wissenschaft steuern aber die Ökonomie immer noch über das Medium Geld. Also einem Medium, das keine Verbindung mehr zur Wirklichkeit des Geschehens hat. Diese Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit der Eliten spüren die Menschen, ohne es jedoch geistig fassen zu können. AFD, Pegida, Brexit etc. sind die Folgen.
Einsichtig wird dies nur durch die Erweiterung unserer definitorischen Begrifflichkeit in eine dialektische Begrifflichkeit. In ihr ist ihr eigener Ursprung „aufgehoben“ (Hegel). Nur eine dialektisch verstandene Systemtheorie kann die selbst erzeugten Paradoxien – auf die der Mainstream der Systemtheorie noch stolz ist – auflösen. Der heutige Mainstream von Ökonomen und soziologischen Systemtheoretikern stellt durch ihre definitorische Begrifflichkeit die ZEIT still. Ihr zentraler Begriff, die Autopoiesis, die Bewegung, schrumpft zum definierten Begriff. Somit wird aber der Geist selbst stillgestellt, ihm fehlt der eigene Ursprung, die Natur.
In diesem Buch erzähle ich die Geschichte, wie aus dem Willen des Lebens, den wir schon beim Einzeller erkennen können, die Liebe zur Menschheit entstehen kann. Die Menschheit hat schon längst die Lösung unserer Probleme erarbeitet. Dies gilt es nur zu erkennen.
Freiheit und Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Solidarität, ja, die Liebe zur Menschheit sind keine Illusion. Die gesamte Menschheit vor uns hat die Möglichkeit ihrer Verwirklichung schon längst erarbeitet. Wir müssen uns nur aus unserer „selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien“ (Kant). Dazu bedarf es Mut. Auch das wusste Kant.
Wir befinden uns heute – ohne es begrifflich fassen zu können – bereits in einem gewaltigen Transformationsprozess unserer Lebensform. In dieser neuen Lebensform werden Bildungsprozesse die Herstellprozesse dominieren. Die menschliche Produktivität kann erst jetzt voll zur Entfaltung kommen. Das bisher dominierende äußere Wachstum kann so in ein inneres Wachstum übergehen. Äußeres Wachstum ist messbar. Inneres Wachstum, also subjektiv empfundene Werte, wie ein glücklich geführtes Leben und soziale Werte, wie Gerechtigkeit und Solidarität, die sich dann auch sozial anfühlen, sind hingegen nicht messbar. Äußeres Wachstum und inneres Wachstum sind jedoch nur zugleich steigerbar. Effizienz, Gerechtigkeit und ein glückliches Leben bedingen sich wechselseitig. Bildung ist inneres Wachstum. Herstellung ist äußeres Wachstum.
Wir werden erkennen, dass die Maschinen, Automaten und Roboter, also das, was in der Bilanz als Kapital erscheint, nur die hochverdichtete Verkörperung der Produktivität unserer Vorfahren ist. Nicht die Maschinen sind produktiv, auch nicht Roboter. Produktiv kann nur Leben sein, das einen Willen hat. Vor zweieinhalbtausend Jahren kam durch das Reflexivwerden des Denkens die Vernunft hinzu. Diese Vernunft ist erst eine späte Errungenschaft der Menschheit. Sie hat sich aus dem Willen des Lebens ausdifferenziert. Dort liegt ihr Ursprung, den die Vernunft nie verlieren wird. Der Roboter ist ein Produkt von Milliarden von Jahren produktiven Lebens. Ein Produkt ist aber immer abhängig von seinem Prozess. Einen Roboter können wir heute nur herstellen, weil die gesamte Menschheit vor uns hierzu die Voraussetzungen geschaffen hat.
Habermas hat Recht, wenn er sagt, dass sich unsere Zukunft an unseren Grundbegriffen entscheidet. Sie stehen uns jedoch schon längst zur Verfügung. Es mangelt uns an der dialektischen Auffassung der vorhandenen Begriffe. Daher ist uns ihre Bedeutung nicht klar. In unseren Begriffen ist bei dialektischer Auffassung ihre operationale Struktur, das eigentlich Bewegende, „aufgehoben“, ihr Ursprung, also das Leben. Unsere definitorischen Begriffe aber sind leblos und tot. In ihnen ist aufgrund der definitorischen Bestimmung die ZEIT abgeschnitten und damit stillgelegt.
2. Ausdifferenzierung der Begriffe: Wahrnehmung, Vernunft, Wille
2.1 Ausdifferenzierung der VERNUNFT
Die Begriffe, die uns heute zur Verfügung stehen, sind nicht schon immer dagewesen. Sie sind erst im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden. Besser, sie haben sich erst gebildet. Mit ihrer Hilfe erklären und deuten wir die Welt. Für jeden Fachwissenschaftler sind sie unhinterfragt einfach da. Die wichtigsten Begriffe jeder Wissenschaften sind definiert und werden in dieser Bedeutung benutzt. Dabei ist die jeweilige Bedeutung selbst wiederum weder konstant noch in ihrem Umfang begrenzt. Im Wesentlichen orientiert sie sich inhaltlich an ihrem Gegensatz. Aber der ist ebenso wenig eindeutig fassbar wie der ursprüngliche Begriff selbst. Was ist Gerechtigkeit? Alles, was nicht ungerecht ist? Was ist sozial? Alles, was nicht unsozial ist? Was ist Vernunft? Alles, was nicht unvernünftig ist?
Die Philosophie ist die „Wissenschaft“, die sich mit der Klärung von Begriffen auseinandersetzt. Aber auch sie hat es nicht immer gegeben. Die Philosophie ist aus Erzählungen (Mythen) hervorgegangen, in denen es noch keine Trennung von Ideellem und Materiellem gab. Alles, was wir heute unhinterfragt trennen, Körper und Geist, Natur und Kultur, war eine undifferenzierte Einheit. Wobei selbstverständlich der Begriff „Einheit“ nicht existierte. Und damit natürlich auch nicht sein Gegensatz, die „Vielheit“. All dies stand den ersten Philosophen noch bevor, die aus dem Mythos den Logos, die Vernunft, haben entstehen lassen. Dabei war diese Vernunft noch lange nicht das, was wir Heutige unter Vernunft verstehen. Auch nehme man nicht an, dass wir heute wüssten, was vernünftig ist. Die Bedeutung eines Begriffes liegt nie fest und kann sich sogar in sein Gegenteil verwandeln oder in anderen Bereichen etwas ganz anderes bedeuten. Hierfür stehen z. B. die Begriffe Subjekt und Substanz. Darüber hinaus verwenden wir Begriffe auch metaphorisch bzw. analogisch. Dies ist auch der „Mechanismus“, über den Bedeutungen sich verändern können. Ein anderer „Mechanismus“ ist die Dialektik, auf die wir gleich zu sprechen kommen. So ist es möglich, dass das Profane heilig werden kann und das Heilige profan. Die Säkularisierung ist ein solcher Vorgang.
Wer waren die ersten Philosophen und was haben sie gedacht? Aber ist es überhaupt von Bedeutung für unser heutiges Leben uns mit ihrem Denken zu beschäftigen? Die Antwort ist ganz eindeutig, Ja! Denn hier liegen die Ursprünge der Begriffe, die wir heute noch benutzen. Mit ihnen erklären wir die Welt, unsere Welt. Und diese unsere Welt befindet sich in einem Transformationsprozess ihrer Lebensform. Dieser Transformationsprozess findet in eben diesen Begriffen statt. Nur in diesen Begriffen können wir ihn daher auch verstehen. Verstehen können wir ihn aber nur, wenn wir ihre Geschichte kennen.
2.1.1 Heraklit
Die ersten Philosophen kamen aus den aufstrebenden Handelsstädten Griechenlands. Die erste bedeutende Person war Thales von Milet (624–546). Als Seemacht benötigte Milet, an der Westküste der heutigen Türkei gelegen, „Techniker“ und „Ingenieure“. Thales war auch als Philosoph in diesen Disziplinen bewandert. Eine ausdifferenzierte Naturwissenschaft gab es noch nicht. Natur, Kosmos und Gesellschaft waren nach denselben Prinzipien organisiert. So sahen es auch Anaximander (610–546), Anaximenes (585–528), Pythagoras (570–510) und Xenophones. Alles Vorläufer von Heraklit (520–460) und Parmenides (520/15–460/55), denen ich mich jetzt etwas tiefer widmen möchte. Heraklit und Parmenides konnten in ihrem Denken auf das schon von ihren Vorläufern Gedachte zurückgreifen und weiterentwickeln.
Heraklit und Parmenides haben für uns Heutige grundlegende Probleme in ihrer Gegensätzlichkeit auf den Begriff gebracht: Veränderung und Ruhe. Schon Anaximander und Anaximenes haben sich mit dem Problem der Veränderung auseinandergesetzt. Heraklit fasste es jedoch tiefer, philosophischer, indem er gleichzeitig zu klären versuchte, wie etwas in der Veränderung dennoch seine Identität behalten konnte. Unsere Kinder wachsen heran zu Erwachsenen. Wir sehen jedoch diese Veränderung nicht. Dennoch findet eine Veränderung statt. Wesentlich für die Vorstellung von Veränderung ist, dass das Ding oder hier die Person, die/das sich verändert, ihre Identität beibehält. Für Heraklit gab es keine Stabilität, für ihn war alles im Fluss. Die Dinge sind nicht wirklich stabile Dinge, sondern Prozesse. Wir leben offensichtlich in einer Welt der Dinge, deren Veränderungen sich jedoch unserer Wahrnehmung entziehen. Unsere Vernunft sagt uns jedoch, dass sie sich verändern. Das Problem hat sich damit verdoppelt. Wir haben offensichtlich ein Problem der Veränderung und ein Problem der Erkenntnis.
Das Problem der Veränderung führt Heraklit also zum Problem der Erkenntnis. Offensichtlich gibt es hinter der Erscheinung die eigentliche Wirklichkeit. Nur dem Anschein nach sind die Dinge Gegensätze. In Wahrheit jedoch sind alle Dinge eins. Uns Menschen erscheint etwas als gegensätzlich, was für Gott eins ist. Heraklits Theorie der Veränderung beruft sich auf den Logos, die Vernunft. Der Logos ist für Heraklit überindividuell. Für ihn war er göttlich. Dennoch ist Heraklit davon überzeugt, dass er einigen wenigen Menschen zugänglich ist. Ihm war er zugänglich, davon war Heraklit überzeugt. Denn wer den Logos erforscht, erforscht die Welt. Die Welt war für ihn und die Griechen der Kosmos und der Mensch zugleich.
Die Welt war für Heraklit eine Einheit. Allerdings eine Einheit von Gegensätzen, aus denen heraus Harmonie entsteht, eine verborgene Harmonie. Alles ist durch seinen Gegensatz bedingt. Das, was ist, enthält schon seinen Gegensatz und führt hierdurch zur Veränderung. Heraklit war der erste Dialektiker. Ein Begriff, den erst Platon hundert Jahre später einführte.
Mit Heraklit sind, in seiner kritischen Auseinandersetzung mit seinen Vorläufern, wesentliche begriffliche Differenzen in die Welt gekommen: Wirklichkeit und Erscheinung, Veränderung und Ruhe, Ding und Prozess, Harmonie und Dialektik, Vielheit und Einheit, Vernunft und Wahrnehmung. In und mit diesen Begriffen versuchen wir noch heute die Welt zu verstehen. Deutlich wird dabei, dass ein Begriff wie Veränderung nur im ersten Anlauf durch seinen Gegensatz überhaupt in die Welt kommen kann, jedoch noch nicht wirklich verstanden wird. Um einen Begriff dem Verständnis näher zu kommen, bedarf es einer Vielzahl vernetzter Begriffe.
Mit Heraklit trat dabei auch die Differenz von Vernunft und Wahrnehmung begrifflich in die Welt. Diese Trennung unserer zentralen Begriffe war den Menschen erstmals in der von Karl Jaspers so genannten Achsenzeit Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. möglich. Im Folgenden werde ich den Begriff Vernunft nicht von dem Begriff Verstand unterscheiden. Diese Differenz wurde erst mit Kant im 18. Jahrhundert geläufig. Mit dem Begriff Wahrnehmung ist die Wahrnehmung unserer nach außen gerichteten Sinne gemeint. Wie wir noch sehen werden, gibt es auch so etwas wie eine innere Wahrnehmung. Diese Differenz ist uns bis heute nicht so recht bewusst, aber von zentraler Bedeutung.
Der 1994 verstorbene Philosoph und Begründer des „Kritischen Rationalismus“ Karl Popper sieht im Denken Heraklits und dem des gleich zu besprechenden Parmenides den Ursprung seiner Wissenschaftstheorie bereits angelegt. Ihr Wesen ist die Kritik der Rationalität. Die Kritik der Rationalität, wie ich sie hier auffasse, geht jedoch über Popper hinaus. Popper ist in der Welt der empirischen Wissenschaften aufgewachsen und von ihr so beeindruckt wie von Heraklit und Parmenides. In den empirischen Wissenschaften ist das Prinzip der Induktion, also der Schluss vom Einzelnen (der sinnlichen Wahrnehmung) auf das Allgemeine (dem geistig Gefassten), maßgeblich. Basis hierzu ist wiederum das Experiment. Letzteres kannten die Griechen noch nicht. Was sie jedoch kannten, war die Deduktion, die auf den gleich zu besprechenden Parmenides zurückgeführt wird. Dabei handelt es sich um die Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen. Dies hat zur Folge, dass man sich lediglich im Denken bewegt, ohne die sinnliche Wahrnehmung zu benötigen. Hier geht es um rein logische Schlussfolgerungen. D. h. der Logos, die Vernunft, bleibt bei sich selbst. Und genau dies ist die zentrale Entdeckung in der Achsenzeit. Diese Entdeckung ist zugleich eine Fähigkeit. Nämlich die Fähigkeit des Denkens, sich auf seine eigenen Gedanken zu beziehen: Das Denken des Denkens. Damit wird das Denken erstmal in der Menschheitsgeschichte reflexiv. Mit dem begrifflichen Denken wird das Denken Gegenstand des Denkens. Man muss sich über die praktischen Konsequenzen im Klaren sein, was diese neue Errungenschaft der Menschheit zur Folge hat. Wir können nun geistig neue Welten konzipieren und hiervon abhängig die reale Welt verändern.
Die Entdeckung des reflexiven Denkens ist jedoch etwas anderes als die Entdeckung Amerikas. Vor der Entdeckung Amerikas gab es Amerika schon. Vor der Entdeckung des reflexiven Denkens gab es dieses noch nicht. Diese Fähigkeit ist die Einheit von Entdeckung und Erfindung. Sie hat sich erst mit ihrer Entdeckung in diesem Prozess selbst gebildet. Heute würden wir sagen, diese Fähigkeit hat sich selbstorganisatorisch ausdifferenziert. Popper verlässt sich zu sehr auf diese Fähigkeit der Vernunft, obwohl er sie weit über Heraklit und Parmenides hinaus mittels Experiment und Induktion mit der sinnlichen Wahrnehmung (Beobachtung) verknüpfen kann. Das Kritische an seinem Rationalismus ist nun seine Einsicht, dass jede wissenschaftliche Feststellung immer nur eine Hypothese bleiben kann. Eine endgültige Wahrheit kann die Wissenschaft nicht liefern, trotz wissenschaftlicher Verknüpfung von Vernunft und Wahrnehmung. Popper geht letztlich nur kritisch mit seiner Rationalität um, in der er die Wahrnehmung verarbeitet. Die Frage ist jedoch – kritisch zu Ende gedacht – ist das rationale Denken alles, selbst bei Einbezug der Wahrnehmung? Kann sich die Rationalität, der Logos und die Vernunft auf diese Weise selbst aufklären? Ein halbes Jahrtausend nach Heraklit und Parmenides wird auch dies schon zum Problem. Aber ich greife schon weit vor. Zunächst zu Parmenides.
2.1.2 Parmenides
Heraklit lebte in Ephesos unweit von Milet an der Westküste der heutigen Türkei. Parmenides (520/15–460/55) war ein Zeitgenosse, lebte jedoch in Süditalien, in der Nähe des heutigen Salerno, in der Stadt Elea, einer griechischen Kolonie. Für Heraklit wie für Parmenides ist göttliches Wissen die Wahrheit. Beide sind davon überzeugt, am göttlichen Wissen teilzuhaben. Heraklit trennt noch nicht scharf zwischen Vernunft und Wahrnehmung. Parmenides nimmt hier als erster eine scharfe Trennung vor. Ebenso zwischen den Gegensätzen allgemein. Gegensätze können nicht identisch sein. Parmenides denkt tiefer als Heraklit. Sein und Nichtsein können nicht zugleich sein. Dieses Gegensatzpaar hat Heraklit nicht denken können. Im reinen Denken ist dieser Gegensatz unmöglich. Unerschütterliches Wissen, also Wahrheit, gibt es jedoch nur im Denken. Alles andere sind nur Vermutungen. Wahres Wissen muss begründet werden. Nur die Vernunft kann rechtfertigen und beweisen, durch Ableitung von Prämissen, die sicher sind. Bloße Wahrnehmung wird von ihm abgelehnt, da sie nicht beweisbar ist. Hierauf basiert Parmenides‘Intellektualismus bzw. Rationalismus. Parmenides ist der Entdecker der Deduktion aus sicheren Prämissen, die nicht alleine der Wahrnehmung unterliegen.
Parmenides postuliert das Unveränderliche, das dann später zur Suche nach Prinzipien, z. B. der Erhaltung der Energie, aber auch ganz allgemein nach Naturgesetzen, geführt hat. Eine Schlussfolgerung seines deduktiven Denkens ist, dass das Seiende mit dem Denken identisch sein muss, da es ein Nichtseiendes nicht geben kann. Also – so eine andere, insbesondere später von Platon vollzogene Schlussfolgerung – kann ich mit dem Denken unmittelbar in die Welt eingreifen.
Auf der Basis seiner starken Annahmen für die Vernunft kommt Parmenides zu der Aussage, dass es keine Bewegung geben kann. Sein deduktiver Beweis verläuft nach Karl Popper (2014: 195) wie folgt:
Nur was man weiß, kann wahrhaft der Fall sein (also existieren).
Was nicht existiert, kann daher nicht sein.
Nichtsein, und damit das Leere, kann nicht sein.
Daraus folgt, dass die Welt voll und unteilbar ist.
Da die Welt voll ist, kann es keine Bewegung geben!
Leukipp (Lehrer Demokrits) und Demokrit (470–380) übernahmen daraus die Unteilbarkeit ihrer Körper (Atome). Seine Schlussfolgerung jedoch verwarfen sie wegen der Falschheit der Prämisse. Noch aus anderen Gründen ist Parmenides einer der bedeutendsten Philosophen. Denn bleibend waren die von ihm eingeführte deduktive Methode und der Beweis, das Prinzip der Ruhe und des Unveränderlichen. Aus Letzterem entwickelten sich so wichtige Begriffe für die Naturwissenschaft wie Substanz, Invarianz, Erhaltungssätze und für das Christentum über Platon und Plotin vermittelt das Eine.
2.2 Antiker Intellektualismus
2.2.1 Platon
Nach der Trennung von Denken und Sinnlichkeit, von Vernunft und Wahrnehmung durch Heraklit und endgültig durch Parmenides, erhielt die geistige Welt vor der sinnlichen Welt den Vorrang. Für beide Denker gab es nichts definitiv Gesichertes in der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Platon baute auf ihrem Denken auf und entwickelte mit seiner Ideenlehre dieses Zwei-Welten-Modell weiter. Hier die täuschende und vergängliche Sinnenwelt. Dort die ewige und unveränderliche Ideenwelt. Wahrheit konnte es daher nicht in den Einzeldingen geben, sondern nur im Allgemeinen. Platon leugnete nicht die Dinge, die wir wahrnehmen, jedoch war das nicht die Wahrheit und damit die Wirklichkeit. Die Ideen sind die eigentliche Welt. Ideen lassen sich nicht mit den Sinnen erfassen. Für Platon ist das Finden der Ideen ein Wiedererinnern. Ideen sind daher unkörperlich und ortlos. Mit Hilfe der Ideen ist es jedoch den Menschen überhaupt nur möglich, etwas zu erkennen. Über zweitausend Jahre später wurden sie bei Kant zu Kategorien. Die Vorlage hierzu lieferten ihm die Kategorien des Aristoteles. Im Gegensatz zu Aristoteles waren sie wie Platons Ideen, jedoch vor aller Erfahrung, also a priori, gegeben. Das Wissen um die Ideen ist ein Wissen außerhalb des Werdens, es ist ein Wissen vom Ganzen.
Für Platon lebten die Menschen in einem Verblendungszusammenhang. Er sah es als ihre Pflicht an, sich aus diesem zu befreien. Dies ging jedoch nur dadurch, die Aussagen über die Welt zu begründen. Insbesondere mussten die Sachverhalte in der Polis begründet werden. Für Aristoteles war Sokrates der Erste, der ethisch-politische Grundfragen stellte. Die Antworten konnten nur in einer begründeten Rede gegeben werden. Platon führte dies meisterhaft in seinen Dialogen vor. Diese bestanden aus Argument und Gegenargument. Das Ziel war ein erhöhter Erkenntnisgewinn. Platon nannte dieses Vorgehen Dialektik. Diese Dialektik sollte zum Wesen der Dinge vorstoßen. Das Wesen der Dinge war unveränderlich und sinnlich nicht fassbar. Nur der Intellekt, eine geistige Schau, konnte dies ermöglichen. In dieser Wesensschau war es jedoch nur wenigen Menschen möglich, die Ideen zu erkennen. Dabei ist es bemerkenswert, dass für Platon nicht die Wahrheit, sondern das Gute die höchste Idee darstellte. Damit war es ihm möglich, zu der bei den Griechen wichtigen Vorstellung des Guten Lebens zu finden.
Aber die Idee des Guten ist vollkommen immateriell. Was das Materielle zusammenhält ist nicht wiederum etwas materielles, sondern etwas Geistiges oder Spirituelles. Aus dem Urstoff (Feuer, Wasser, etc.) der ersten Denker wurde das Urprinzip, das alles eint. Das Ordnungsmodell war die Einheit, das Absolute, aus dem das Relative hervorgehen konnte. Platon nahm wie schon Parmenides vor ihm an, dass unser Handeln durch unser Denken direkt beeinflussbar ist. Daher sollten auch die Philosophen die Lenker der Polis sein. Nur so war ein gutes Leben in der Polis gewährleistet. Da das Denken, vermittelt über die Ideen, die Wahrheit und damit die Wirklichkeit ist, war dies in sich stimmig. Was dem antiken Denken jedoch fehlte, war neben der Theorie der Vernunft (Logos) eine Theorie des Willens. So war Platon tatsächlich überzeugt, er könne mit seinen politischen Lehren Dionysios von Syracus in seinem Sinne beeinflussen. Hiermit ist er grandios gescheitert und hätte dabei fast sein Leben gelassen. Im Übrigen glauben wir dies heute noch. Unser ganzes Bildungssystem ist intellektualistisch aufgebaut. Wir stellen uns den Schüler wie einen Trichter vor, in den der Lehrer Wissen abfüllen kann. Dass die Schüler auch einen Willen haben, ist den Lehrern weitgehend unbekannt. Falls es dennoch sein sollte, muss er dem Curriculum untergeordnet und angepasst werden. Das Bildungssystem wird in objektivierender Einstellung wie ein Unternehmen über Kennzahlen qualitätsgesteuert. Der Kern der Veranstaltung, der Bildungsprozess, ist dabei nicht mehr im Blick. Bildung, das sich Bildende, wird wie ein Herstellungsprozess behandelt. Ich komme hierauf zurück.
Platon kennt auch eine Seele. Im Gegensatz zum sterblichen Körper ist sie unsterblich und kann, wohl in Anlehnung an Pythagoras, in einem anderen Leib weiterleben. Diese Unsterblichkeitslehre ist jedoch nicht so leicht zu fassen. Denn Platon kennt drei Seelenteile: die begehrende Seele, die leidenschaftliche Seele und die Vernunftseele. Alle drei Teile sind aufeinander angewiesen. Jedoch ist nur die Vernunftseele unsterblich. Das Begehren und die Affekte gehen mit dem Körper unter. Diese Dreiteilung führt erst Platon ein und ist bis heute Gegenstand von Spekulationen. Auch für uns ist diese Dreiteilung von Bedeutung, ja, zentraler Gegenstand. Haben sie nicht Ähnlichkeit mit unseren Begriffen: Vernunft, sinnliche Wahrnehmung und Wille? Wir werden sehen.
2.2.2 Aristoteles
Wie Platon war auch sein Schüler Aristoteles (384–322) intellektualistisch eingestellt. Im Gegensatz zu Platon ließ er jedoch auch die Wahrnehmung zur Erkenntnisfindung zu. Beide eint jedoch, dass das, was man erkennt, auch tatsächlich die objektive Welt ist. Doch während Platon das Wesen der Dinge in einer transzendenten rein geistigen Sphäre erkundet, hat Aristoteles eine andere Art die Welt zu erfahren. Er erkundet das Wesen der Dinge in der Struktur der Welt selbst. Für die Naturwissenschaft sollte dies bis heute bestimmend bleiben. Seine Kategorien wie Quantität, Qualität, Relation, Zeit, Ort etc. sind grundlegende Merkmale des Seins der Dinge. Die Bedeutungen stammen nicht von den Menschen, sondern von den Dingen selbst. Dies sollte sich zweitausend Jahre später mit Kant umdrehen.
Nachdem sich aus dem Mythos der Logos die Vernunft ausdifferenziert hatte, fragte sich Aristoteles, wie er denn funktioniert. Wie funktioniert vernünftiges Denkens? Mit seinen Antworten begründet er die Logik. Er unterscheidet die Deduktion (Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere) von der Induktion (Schluss vom Besonderen auf das Allgemeine). Seither sind aus logischer Sicht alle Annahmen oder Bedingungen, die diese Welt betreffen, Prämissen. Aus diesen Prämissen leiten wir dann logisch einen Schluss, die Konklusion, ab. Haben wir z. B. die beiden Prämissen: „Alle Wesen, die vernünftig Denken, sind Menschen“ und „Aristoteles denkt vernünftig“, dann folgt hieraus: „Aristoteles ist ein Mensch“.
Aristoteles arbeitet nun, für uns höchst bedeutend, eine neue Differenz heraus. Er unterscheidet die „Logik“ von der „Dialektik“. Die Dialektik erzeugt im Gegensatz zur strengen Logik, der jeder vernünftig denkende Mensch zustimmen muss, Plausibilität, der man zustimmen kann. Eine plausible Erklärung muss jedoch auch in sich logisch schlüssig sein. Dies gilt nicht mehr unbedingt für eine dritte Disziplin, die Rhetorik. Hier spielt auch die Beziehung zwischen Redner und Zuhörer eine Rolle. Ein Rhetoriker kann ein Publikum für sich einnehmen und hierdurch Glaubwürdigkeit erzeugen. Die Dialektik steht so gesehen zwischen strenger Logik und Rhetorik.
Aristoteles ist überhaupt der Philosoph der Begriffe. In seinen Begriffen denken wir noch heute. Die Bedeutungen haben sich allerdings häufig sehr stark gewandelt. Er selbst hat schon wesentliche Begriffe, die er von seinem Lehrer Platon übernommen hat, anders gedeutet. So auch die Begriffe Zeit und Raum und die damit im Zusammenhang stehenden Begriffe Bewegung und Veränderung. Für Platon waren dies Ideen, die allerdings sinnlich wahrgenommen werden konnten. Für Aristoteles galt dies so nicht. Die Zeit war für ihn unbegrenzt und ewig, nicht geschaffen und absolut. Etwas Unbegrenztes und Ewiges lässt sich nicht wahrnehmen und ist nicht erfahrbar. Die Zeit ist für Aristoteles jedoch messbar bei einer Bewegung. Anders liegt es beim Raum. Der Raum ist für Aristoteles begrenzt. Körperliche Begrenztheit ist ein Merkmal des Raumes. Dennoch gibt es den Raum nicht, wie es Dinge gibt. Die Form eines Dinges resultiert aus der Bewegung. Als Philosoph fragt er natürlich weiter. Woher kommt aber die Bewegung, die alles formt? Die Antwort ist: Durch den „unbewegten Beweger“. Dieses geistige Wesen, das zugleich eine Kraft ist, ist für Aristoteles kein Gott, erst recht kein Schöpfergott, denn die Welt ist ewig. Das interessante für uns ist nun, dass dieser „unbewegte Beweger“, diese Einheit aus ewiger Beharrung und Bewegung, nur sich selbst zuwendet. Ein solches Konzept nennen wir heute Selbstorganisation oder Autopoiesis.
Während das Konzept der Selbstorganisation erst seit einigen Jahrzehnten wieder an Bedeutung in der „Systemtheorie“ gewinnt, hat sich die Bedeutung des Begriffes Zeit vollkommen gedreht. In den Naturwissenschaften gibt es seit der Relativitätstheorie von Einstein keine absolute Zeit mehr, in der sich die Dinge bewegen. Die Zeit selbst ist eine Variable geworden und damit ein Konstrukt. Eine Variable wie andere auch in der Physik. Sie ist relativ geworden und damit selbst abhängig und dabei eine Einheit mit dem Raum eingegangen. Sie ist zur relativen Raumzeit geworden. Dennoch ist sie messbar und nur als solche objektiv. Ich komme hierauf zurück. Denn die Welt ist nicht nur objektiv messbar. Alles objektiv Messbare lässt sich vollkommen logisch abhandeln. Aber schon Aristoteles hatte mit seinen Differenzen von Logik, Dialektik und Rhetorik gezeigt, dass es mehr gibt in dieser Welt. Und hatte nicht auch Platon schon die Seelenfähigkeiten in Vernunft, Begehren und Affekt differenziert? Und überhaupt, wenn schon in der Physik das Absolute sich als das Relative herausstellt, sollten dann nicht auch andere – vielleicht sogar alle – Begriffe ihre Bedeutungen ändern können?
Nehmen wir den weiter oben schon erwähnten Begriff Substanz. Im Griechischen bedeutet er das Zugrundliegende, Selbstständige. Für Platon waren Ideen daher Substanzen. Für Demokrit waren Substanzen materielle Dinge, Atome. Aus ihnen ging alles hervor. Dieser Atomismus ist bis heute Grundlage der Physik, ja der Naturwissenschaften insgesamt. Wir verstehen heute unter Substanz auch etwas Materielles. Und doch benutzen wir diesen Begriff auch in einer Bedeutung für etwas Immaterielles, wenn wir sagen „der hat aber nichts Substantielles gesagt“. Wir meinen dann im Sinne der Griechen dass dem Gesagten nichts Bedeutsames zugrunde liegt, nichts Substanzhaftes.
Die letztere Bedeutung des Substanzbegriffes kommt der aristotelischen Bedeutung sehr nahe. Für Aristoteles war die Substanz „das zugrunde Liegende“. Damit stimmte er mit Platon überein. Doch war sie für Aristoteles die „erste Ursache des Seins“ der Einzeldinge. Sein Substanzbegriff war von der sichtbaren Welt nicht abgetrennt. Die Ideenlehre Platons lehnte er ab, weil sie zum Dualismus führte. Im natürlichen Werdeprozess gab es für Aristoteles keine Trennung von Erzeuger und Erzeugtem. Das erste Bewegende, der „unbewegte Beweger“, ist für Aristoteles ein Prinzip. Dieses Prinzip löst jedoch durch sein reines Dasein eine Bewegung aus, „wie etwas, das man liebt“. Das nannte Aristoteles „Gott“ und setzte es mit „Wirklichkeit“ gleich. Denn für ihn galt, „die Wirklichkeit des Denkens ist Leben“. Die Substanz, also „das zugrunde Liegende“ des Denkens, ist Leben. Unsere heutige definitorische Begrifflichkeit hat sich vom Leben entfernt. Sie ist leblos und kalt. Sie wird daher für die Menschen in immer stärkerem Maße als substanzlos empfunden und daher unglaubwürdig.
Aber es ist noch krasser, wie Jugendliche heute sagen. Nach der Entdeckung der Quantentheorie sind sich selbst die Physiker nicht mehr sicher, ob es Materie eigentlich gibt, in dem Sinne, dass sie das unserer Welt Zugrundeliegende ist. Man muss nun zugleich wissen, dass der Mainstream der Ökonomen sich noch die alte klassische Newtonsche Physik zum Vorbild nimmt, obwohl ihr Grundbegriff das Geld inzwischen als realer Gegenstand ihrer Betrachtungen auch vollkommen immateriell geworden ist. Es ist in der Tat im Gegensatz zum Münz-, ja auch zum Papiergeld, nur noch ein Begriff mit Bedeutung. An seiner Bedeutung hängt das Ganze der ökonomischen Theorie! Ich komme hierauf zurück.
Für Aristoteles sind im Gegensatz zu Platon Allgemeinbegriffe wie „Menschheit“, „Schönheit“ aber auch „Tier“, „Mensch“ keine göttlichen Ideen, sondern menschliche Bezeichnungen und nicht a priori, also vor aller Erfahrung, gegeben. Worte sind für ihn nicht nur Worte wie später im Mittelalter, sondern bilden die reale Welt ab. Immer vorausgesetzt, sie werden richtig gebraucht. Als sinnlich wahrnehmbares Wesen gibt es für ihn „den Menschen“ allerdings nicht, wohl jedoch den Menschen Platon. Dennoch sind Allgemeinbegriffe wichtig, nur sind sie nicht sinnlich wahrnehmbar. Ohne Allgemeinbegriffe würden wir die Welt, und das, was es in ihr gibt, nicht verstehen. Jedoch, sie sind menschlicher, nicht göttlicher Art und uns nicht vor der Erfahrung gegeben. Im Hochmittelalter werden die Nominalisten im Begriff „Menschheit“ nur ein Wort sehen und kein sinnvolles Konzept wie noch Aristoteles. Doch es war ein Nordafrikaner, der dem schon Jahrhunderte früher vorgearbeitet hatte, wie wir gleich sehen werden.
Aristoteles ist der erste Biologe und sollte auch die nächsten zweitausend Jahre der bedeutendste bleiben. Während für Platon die Seele etwas vollkommen vom Körper Getrenntes darstellte, ist für Aristoteles die Seele das Prinzip des Lebens. Sie ist daher nicht vom Körper zu trennen. Die Seele ist die Form des Körpers und formt ihn zugleich. Aristoteles betrachtet die Seele nicht in Begriffen von Empfindung, Schuld und Gewissen. Er denkt auch nicht an das Bewusstsein eines Subjektes. Er geht naturwissenschaftlich vor. Alles, was lebt, hat eine Seele, auch Tiere, sogar Pflanzen. Jedoch in abgestuftem Maße. Ohne Seele kein Lebewesen. Die Seele hat Gestaltungskraft, die einem Ziel zusteuert, das der Seele selbst zugehört. Die Seele als Prinzip des Lebens vollendet sich selbst. Aristoteles nennt dies Entelechie. Auch hier erscheint schon bei Aristoteles das moderne Prinzip der Selbstorganisation. Andererseits hat die Seele (psyché) des Aristoteles mit dem, was wir heute unter Seele bzw. Psyche verstehen, nicht viel gemeinsam. Und dennoch ist seine unzertrennliche Einheit mit dem Leib sehr modern. Durch diese Abhängigkeit, ja Einheit von Leib und Seele, ist jedoch die Seele nicht mehr wie bei Platon unsterblich.
2.3 Ehre – Eigentum – Vernunft
Das Individuum, so wie wir es heute begreifen, hat es in der Antike nicht gegeben. Platons Vernunftseele war göttlich. Hieran konnten die Menschen teilhaben. Dabei war Mensch ein Allgemeinbegriff. Alles Denken hat so angefangen, immer vom Ganzen her, ohne dass dies bewusst gewesen wäre. Der Mensch lag noch nicht analytisch zerlegt vor uns. Das kam erst später. Es wäre auch viel zu mühsam, ja unmöglich gewesen, den Menschen erst jedes Mal aus Elementen geistig aufzubauen, wenn ich „Mensch“ sage. Am Anfang war das Ganze. Das Einzelne macht nur aus der Sicht des jeweils Ganzen überhaupt Sinn und wird nur daher verständlich. Platons Ideen waren jeweils ein Ganzes. Ohne diese Ideen war ein vernünftiges Denken nicht möglich. Aristoteles holte diese Ideen aus der spirituellen Sphäre auf die Erde und erklärte die Welt auf der Grundlage neuer Ganzheiten, seinen Kategorien. Ohne Kategorien, also Begriffen, war kein verstehen möglich. Diese Kategorien erkannte er im Gegensatz zu Platon in den Dingen selbst. Erst mit Kant, über zweitausend Jahre später, sehen wir dies genau um 180° Grad gedreht. Die Kategorien finden wir nicht im Objekt, sondern in uns, dem Subjekt. Kant selbst nannte dies eine „Kopernikanische Wende“. Diesen Weg möchte ich nun mit Ihnen gehen.
2.3.1 Familie – Polis
Die Religion der antiken Griechen wie auch der Römer war eine Religion der Vorfahren. Jede Familie hatte einen Hausaltar. Auf ihm wurde geopfert. Der Familienvater war zugleich der Priester. Die Angehörigen der Familie, Frau, Kinder und Sklaven, waren von ihm sozial, ökonomisch und rechtlich vollkommen abhängig. Jede Familie opferte ihren Vorfahren. Verbanden sich Familien zu Phratien oder Kurien, heute würden wir Clans sagen, opferte man gemeinsam einem Heroen dieses Clans. Ein Heroe war jemand, der sich besondere Ehre im Kampf erworben hatte. Gekämpft wurde i. d. R., um Sklaven zu erhalten. Die antike Welt war eine Sklavenhaltergesellschaft. Auch für Platon und Aristoteles war dies selbstverständlich und nicht anders denkbar.
In der griechisch-römischen Antike gehörten drei Dinge untrennbar zusammen: die Familie, das Eigentum und die häusliche Religion. Die Idee des Privateigentums, über das der Familienvater herrschte, entstammt der religiösen Welt. Diese Ideen lebte in ihrem Grundsatz auch weiter, als sich in Griechenland und Rom Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. Städte bildeten. Die antike Stadt war kein Zusammenschluss von Individuen. Je größer die Städte wurden, umso weniger waren die Götter jedoch familienfixiert. Die Götter wurden nun mehr mit Naturkräften verknüpft. Poseidon war der Gott des Meeres, Apollo der Gott des Lichts, Demeter die Göttin der Fruchtbarkeit. Die Götter stellten zugleich die Ordnung des Kosmos dar. Ihre Sozialordnung war ein Abbild der menschlichen Gesellschaft. So nimmt es kein Wunder, dass sich in der Antike Natur und Kultur strukturell entsprachen. Sie waren nach den gleichen Ordnungsprinzipien strukturiert. Diese waren Hierarchie und Ungleichheit. So wie bei Aristoteles die Natur vom Prinzip des Lebendigen zweckorientiert aber hierarchisch, von der Pflanze über die Tiere zum Menschen, strukturiert ist, so auch die Gesellschaft. Kinder, Sklaven und Frauen hatten keine oder eine entsprechend abgestufte Vernunft. Wirkliche Vernunft kam nur dem Familienvater mit Eigentum zu. Und nur, wer Eigentum und damit auch über Sklaven verfügte, brauchte nicht zu arbeiten. Arbeit war der Aristokratie verpönt. Zugleich ermöglichte diese soziale Stellung den Erwerb von Logik und Rhetorik. Dies wiederum zu beherrschen war Grundvoraussetzung, um sich im Polikbetrieb des Staates zu bewähren. Dies war die Transformation des Kriegeradels, der nach Ehre strebte und als Heroe später angebetet werden konnte, zum Aristokraten, dessen heroische Taten durch Vernunft im politischen Bereich belohnt wurden. Dies alles vollzog sich begrifflich in dem altgriechischen Wort timé (Ansehen). Eine Timokratie ist die Herrschaft der Ehrenwertesten oder Angesehensten. Die Bedeutung des Begriffs timé hat sich vom Tun des Kriegeradels auf den Besitz- bzw. Vernunftadel verschoben. Das Wort, die Buchstabenfolge, ist das gleiche geblieben, seine Bedeutung ist jedoch eine andere.
Zweitausend Jahre später gibt es weiterhin die antike Einheit von Eigentum und Vernunft. Diese Einheit ist jedoch in einem ganz anderen Netz von Begriffen aufgehoben. In der Antike erkennt man noch deutlich den Zusammenhang von Eigentum und Religion. Eigentum und Vernunft hatte jemand, der einem Haushalt (oikos) mit einem Opferaltar vorstand. Zweitausend Jahre später gehörten Eigentum und Vernunft weiterhin unzertrennlich zusammen. Doch nun war die Verbindung zur Religion verloren gegangen. Eigentum erwarb man nun durch Arbeit. In der Antike war Arbeit verpönt. Dafür hatte man seine Sklaven. Wer keine Sklaven hatte, hatte keine Vernunft. Nun hatte nur der Vernunft, der durch Arbeit Eigentum erworben hatte. Eigentum zu besitzen, war ein Zeichen für Vernunft. Und noch etwas wandelte sich komplett. Händler, Kaufleute und Handwerker, also Menschen, die für Geld arbeiten, waren minderen Ranges. Ganz anders in der beginnenden Neuzeit. Da Geld, Gold und Silber gelagert werden können, war es für John Locke (1632–1704) unbegrenzt in seiner Anhäufung. John Locke ist der Vater des Wirtschaftsliberalismus. In der Achsenzeit war dies unvorstellbar. Aber schon damals begannen sich mit Bildung der Städte die Dinge ganz allmählich zu ändern. Die Veränderung selbst sieht man nicht in ihrer Aktualität, dies wusste schon Heraklit. Nur, für ihn war das ein Problem. Für uns Heutige sollte dies nicht mehr zutreffen.
2.4 Ausdifferenzierung des Willens
2.4.1 Entdeckung des Willens(Paulus)
Im 1. Jh. v. Chr. war der gesamte Nahe Osten bis an die Grenzen Indiens hellenisiert. Im Süden bis Ägypten. Seine geistige und auch ökonomische Metropole war Alexandria. Sein Begründer Alexander der Große hatte diesen Hellenisierungsprozess eingeleitet. Im Nahen Osten sprach man in den Städten griechisch. Das änderte sich auch nicht, als die römische Macht diese Weltregion besetzte. Die Autonomie der Regionen, insbesondere der Städte, wurde jedoch mehr und mehr ausgehöhlt. Rom war nun das Zentrum. Seiner militärischen Macht war alles unterworfen. Dies hatte nicht nur tiefgreifende Folgen bezüglich des sozialen Status der alten Aristokratie und der Bürger der Städte. Es hatte auch tiefgreifende intellektuelle Konsequenzen. Selbstzweifel am Vernunftkonzept waren die Folge. Dies führte auch dazu, dass Mysterienkulte wie der Mitras- und Osiriskult Zulauf fanden. Dagegen verblassten die alten Familiengötter. Man suchte nun mehr und mehr nach persönlichem Seelenheil. Der antike Intellektualismus bekam Risse. Die Suche nach einer Kraft jenseits des Verstandes gab der Philosophie eine mystische Richtung. Es schien so, als habe das Gefühl, von der fernen Macht Roms gelenkt zu werden, einen nicht unbedeutenden Einfluss gehabt. Der Wille Roms war bis in den Alltag hinein zu spüren. Dagegen kam kein Vernunfthandeln mehr an.
In den Städten rund ums Mittelmeer gab es eine nicht unbedeutende jüdische Diaspora, die Griechisch und Latein sprach. Sie vertraten einen Monotheismus, der für die anderen Stadtbewohner zunehmend interessant wurde. Es war wohl einerseits die Ähnlichkeit mit ihrer sozialen Situation, den staatlichen Gesetzen einer Zentralmacht unterworfen zu sein. Andererseits war es aber auch die Bedeutung des jüdischen Gesetzes. Es wurde von den Juden nicht als Logos oder Vernunft verstanden, sondern als Jahwes Wille. Es wurde zunehmend zur gesellschaftlichen Erfahrung, sich einem äußerenWillen zu unterwerfen. Der Wille des jüdischen Gottes ließ sich nicht durch Vernunft ergründen. Sein Wille war frei, er ließ sich nicht festlegen oder deduktiv erschließen. Er bestimmte die Zukunft. Er war es, der sein Volk ins „gelobte Land“ geführt hatte. Seinem freien Willen entsprach auch eine andere Zeitwahrnehmung der Juden. Die Juden nahmen die Zeit linear war. Bei den Griechen war die Zeit zyklisch. Und noch eins zerbracht: die griechische Einheit von Denken und Sein.
Das Gebot Jahwes war nicht mit der Vernunft zu begreifen. Der Erkenntnisweg drehte sich um 180° Grad. Man musste sich erst dem Gebot unterwerfen, um zur Erkenntnis zu gelangen. Das war intellektuell eine vollkommene Kehrtwendung, eine Revolution. Gehorsam war nun die Voraussetzung zur Erkenntnis. Dem antiken Bürger schwand der Boden unten den Fußen. Die antike Welt stand an der Schwelle zu einer tiefgreifenden Veränderung. Der griechische Intellektualismus schien am Ende zu sein und dem jüdischen Denken Platz machen zu müssen. Doch die Entwicklung verlief nicht in diese Richtung. Dass die Geschichte einen anderen Verlauf nahm, lag vor allem an einem griechisch geschulten Juden aus Tarsus. Die Stadt Tarsus liegt im südlichen Teil Anatoliens, also der heutigen Türkei. Auch sie stand unter römischer Macht.
Diese neue geopolitische Lage, nach der vorangegangenen Hellenisierung, führte zur Vermischung von Kulturen. Verunsicherung war wie schon oben angedeutet die Folge. Dies war der Nährboden für messianische Bewegungen. Nicht wenige Juden erwarteten in naher Zukunft die Ankunft eines nationalen Erlösers. Jesus erzeugte eine solche Bewegung. Wahrscheinlich war es ein Anhänger von Johannes dem Täufer. Doch dann begann er selbst zu predigen und erwarb eigene Anhänger. Er predigte Liebe und Barmherzigkeit und nannte seinen Gott Vater. Dieser Gott liebte alle seine Kinder, vor allem die Armen und Benachteiligten. Dieser Gott versprach auch den Sündern Vergebung, wenn sie aufrichtig bereuten. Auch sie konnten auf die Gnade dieses Gottes vertrauen. Er nahm die Gläubigen in sein Reich auf. Dass ein Gott sich vor allem der Sünder annahm, war neu. Es schien ein sehr menschlicher Gott zu sein. Eben ein Vater, der seine Kinder liebte. Nach Joseph Ratzinger hat aber Jesus von sich nie als Gottes Sohn gesprochen. Er selbst sprach von sich, so Ratzinger, als Menschensohn. Das christliche Mysterium der Trinität ist erst in den folgenden Jahrhunderten aufgekommen. Dass dann zu Vater und Sohn noch der Geist hinzukam, ist dem griechischen Denken geschuldet.
Wie schon oben erwähnt vermischten sich im 1. Jh. v. Chr. im Nahen Osten alte orientalische Mysterienkulte mit jüdischem und griechischem Denken. Nur vor diesem Hintergrund ist das Auftreten des Paulus von Tarsus zu verstehen. Er konnte den zutiefst verunsicherten Menschen einen neuen festen Halt geben. Aber dieser Halt war nicht alleine intellektualistisch zu begreifen. Er berührte nicht nur die Vernunftseele. Es war die Berührung selbst, die empfunden wurde, die Liebe des Vaters. Die Vision, die er auf dem Wege nach Damaskus hatte, entwickelte sich zur Christusidee: Christus lebt in mir. Und damit auch die Liebe Gottes. Diese mystische Vereinigung mit Christus wandelte den Rationalitätsbegriff. Der Glaube an Christus in mir erzeugte eine bisher unbekannte Motivationstiefe als Grundlage zur Erkenntnis. Der Vernunft selbst wurde damit eine Grundlage gegeben. Paulus predigte nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Heiden, zur ganzen Menschheit. Das war neu. Denn damit kam die antike Idee der natürlichen Ungleichheit zu Fall. Die Menschen waren in moralischer Hinsicht alle gleich. Mehr noch, durch die Vereinigung der menschlichen Seele mit dem freien Willen Gottes wurde auch die individuelle Seele frei. Hier ereigneten sich drei Dinge zugleich. Der liebende Gott in mir sprach die individuelle Seele aller Menschen an und ermöglichte damit persönliche, menschliche Freiheit.
Der griechisch geschulte Paulus brachte damit zugleich eine Abstraktheit ins jüdische Denken, die bisher nicht bekannt war. Das jüdische Denken war nicht universal, sondern noch tribal. Jahwe war der Gott Israels. Der neue Gott liebte alle Menschen. Die christliche Gemeinschaft war ein freier Zusammenschluss moralisch gleichgestellter Personen. Es war eine mystische Vereinigung, die auf den individuellen Willen einwirkte. Paulus benutzte hierzu die Metapher „Leib Christi“. Dies sollte andeuten, dass alle jene, die dieser Gemeinschaft angehörten, mit dem Ursprung ihres Seins verbunden sind. Der Glaube hieran war ein individuelles Ereignis. Dieser Glaube erst führte zur Wahrheit und Wirklichkeit. Die Erfahrung dieser Wirklichkeit war ein inneres Ereignis. Der Blick war nach innen gerichtet, nicht wie bei Aristoteles nach außen auf die Dinge, um auf Erkenntnis zu stoßen. Doch dies betraf auch den sozialen Status und die Rollen in der Gesellschaft. Bisher wurde menschliches Handeln wie natürliches Handeln durch Zwecke bestimmt. Jetzt war es das Gewissen. Paulus schaute in die menschliche Seele, die bei Gott war. Wenn soziale Rollen nicht mehr die bisherige gewaltige Definitionsmacht hatten, erweiterte dies das menschliche Identitätsbewusstsein. Zugleich wurde damit aber auch das jüdische Gesetzesdenken gesprengt. Bloße Regelbefolgung wurde damit unterlaufen. Regeln wurden durch caritas ersetzt, das Gesetz durch Liebe. Zwischen Denken und Handeln schiebt sich der Wille.
Dies ist die Entdeckung Paulus‘. Die mystische Vereinigung der individuellen Seele mit dem göttlichen freien Willen macht nicht nur die individuelle Seele frei, sondern gibt ihm auch den höchsten Halt, um frei handeln zu können. Larry Siedentop bezeichnet diesen menschlichen Willen auch als vorsozial. Dies ist eine bemerkenswerte Einschätzung. Wir werden auf diesen Gedanken wieder, weit über tausend Jahre später, bei Meister Eckhart und dann nochmals Jahrhunderte später bei Kant stoßen.
2.4.2 Einordnung des Willens(Augustinus)
Als Augustinus (354–480) geboren wurde, war das Christentum durch Kaiser Konstantin schon Staatsreligion. Es ist aber nicht durch diesen Akt so stark geworden. Dies ist es aus sich selbst heraus geworden. Zur Zeit Augustins war ca. ein Drittel der Einwohner des römischen Reiches schon christlich orientiert. Wie kam es dazu? Grundsätzlich war es wohl so, dass die Gefühlslage der Menschen für die Gedanken des Christentums empfänglich wurde, wie schon oben dargestellt. Hinzu kam, dass die Schicht derer, die zu Steuereinnahmen herangezogen wurde, vergrößert wurde. Durch diese Erweiterung der höheren Schicht gerieten die Privilegien in Gefahr. Geburt, Etikette, Rhetorik und rationalitätsbasiertes Verhalten verloren an Bedeutung. Statusängste der Oberschicht waren die Folge.
Auch ein nicht unerheblicher Teil der Oberschicht war zum Christentum übergegangen. Diese Personen bewarben sich nun mit einer neuen Rhetorik um die Positionen, die die Städte zu vergeben hatten. Diese Rhetorik sprach die unteren Schichten an. Zentraler Inhalt dieser neuen Rhetorik war Barmherzigkeit und Liebe zu den Armen. Dies wiederum beförderte Bündnisse zwischen den Bischöfen der Stadt und den christlichen Patriziern. Durch diese Konstellationen fand zugleich ein Wandel der Werte statt. Geburt, Eigentum und Vernunft, die alten Werte der Aristokratie, wurden mehr und mehr ersetzt durch eine neue Rhetorik, der Liebe zu den Armen und durch demokratischeres Verhalten. Letzteres resultierte aus der Erfahrung der Bischofswahlen. Die Bischöfe wurden von der Gemeinde gewählt. Die neue Rhetorik konnte sich der Rhetorik als solcher bedienen. Sie musste nur ihre Inhalte ändern, nicht ihre Struktur. So konnte das Neue aus dem Alten hervorgehen. Das ist Dialektik. Ich komme hierauf mit Hegel zurück. Heraklit hatte sie schon grundgelegt.
Ein Weiteres hatte sich ereignet. Aus den ersten Mönchen, die in Askese in der Wüste als Eremiten lebten, waren Gemeinschaften geworden. Die Gemeinschaften gründeten auf der neuen Idee der Gleichheit der Seelen. Die Mönche entwickelten eine neue Lebensform. Sie war geprägt von Meditation, Gebet und Arbeit. Damit wurde Arbeit befreit von dem Gedanken der Sklaverei. Nicht mehr der äußere Status war es, der beeindruckte, sondern die innere Überzeugung. Das neue Mönchtum war in der Bevölkerung hoch angesehen.
Als Augustinus im Jahre 354 geboren wurde, hatte sich das Weltbild der Menschen durch die neue Rhetorik des Christentums fundamental geändert. Auf der anderen Seite waren die meisten Aussagen des Christentums, so wie wir es heute kennen, noch gar nicht ausformuliert. Es lag noch keine Theologie im heutigen Sinne vor. Ja, auch das, was wir heute Neues Testament nennen, gab es noch nicht schriftlich fixiert. Erst recht war noch nicht geklärt, ob Jesus nur ein Mensch oder Gott war oder gar beides zugleich. War er eine Person oder gab es drei Personen, Vater, Sohn und den Hl. Geist? Wenn Letzteres, wie war das zu verstehen? All dies hat Jesus nicht gesagt, sondern wurde erst in den ersten 4–5 Jahrhunderten nach Christus von den führenden Kirchenmännern festgelegt. Manches ist noch heute umstritten. In diese Fragen griff nun Augustinus ein. Er ist wohl der bedeutendste Kirchenvater und hat mit Paulus, dem er gedanklich sehr nahe stand, das Christentum geprägt.
Augustinus war sein Leben lang auf der Suche nach der Wahrheit. Dies hat er eindrücklich dokumentiert in seiner Autobiografie „Bekenntnisse“. Im Gegensatz zu Aristoteles hat er die Wahrheit jedoch nicht im Äußeren gesucht, sondern im Inneren, in sich selbst. Wie schon Paulus suchte er Christus in seinem Innersten. Der Glaube an Christus, zu dem er erst sehr spät gefunden hatte, musste nun gefestigt werden. Nicht nur für sich selbst, sondern für die christliche Kirche. Zu Beginn des Christentums war wie gesagt noch Vieles umstritten. Auch während der Zeit des Augustinus. Es gab eine Vielzahl von abweichenden Vorstellungen. Augustinus sah es daher, nachdem er zum Bischof geweiht war, als eine seiner Hauptaufgaben an, die Häresien zu bekämpfen.
Eine der hartnäckigsten war der Arianismus. Ihn gibt es noch heute. Seine Anhänger vertreten die Ansicht, dass Christus nicht gottgleich ist und auch nicht ewig. Also, Jesus war nur ein Mensch. Allerdings ein besonderer. Das vornehmste Geschöpf Gottes. Die Einheit von Gott und Mensch ist nun nicht einfach zu vermitteln. Erst recht nicht in Verbindung mit einem weiteren Mysterium, dem der Trinität. Hier sind die drei Personen Vater, Sohn (also der Mensch gewordene Gott) und der Heilige Geist zugleich das Eine, der christliche Gott. Mit Vernunft alleine war dies nicht möglich. Aber die Vernunft brauchte man schon dazu, wenn man es nicht nur glauben, sondern auch verstehen wollte. Diese Verbindung hat Augustinus in genialer Weise geschaffen. Wenn er Gott in sich suchte, musste er seine Erkenntnisinstrumente studieren. Dabei fand er eine analoge Trinität in sich selbst. Die Einheit von Gedächtnis, Vernunft und Wille. Niemand wird bestreiten, dass wir eine Person sind und dass diese Identität unser ganzes Leben lang von unserem Gedächtnis trotz aller Veränderungen wiedergegeben wird. Hierzu benötigen wir jedoch zugleich unsere Vernunft und unseren Willen, um uns zu verändern, d. h. für Augustinus, um Christ zu werden. Christ sein heißt, die Verbindung zu Gott gefunden zu haben. Und dies bedeutet Einssein mit/in Christus.
Wenn ich also Christ werden will, muss ich in mein Innerstes schauen. Dort finde ich Gott. Um Gott zu finden, muss ich folglich meine Erkenntnisinstrumente studieren. Zumindest dann, wenn ich auch verstehen will, was ich glaube. Aber dies ging für Augustinus eben nicht mit der Vernunft alleine. Die antike intellektualistische Aufstiegsmetapher, also durch Schulung des Verstandes Gewissheit zu erreichen, zerbrach aus mindestens zweierlei Gründen. Die Menschen waren abhängig von Gewohnheiten, die im Gedächtnis aufbewahrt werden und so das Leben steuern. Zum anderen aber vor allem wurde mit Augustinus der Aufstieg zugleich auch ein Abstieg in unser Innerstes. Augustinus hat als erster die Beteiligung der Gefühle an der Motivation unseres Handelns systematisch erforscht. Es war der gefühlsbasierte Wille, der uns letztlich zu einer bestimmten Handlung veranlasst, nicht die Vernunft.
Während der christliche Presbyter aus Alexandrien Arius (260–336), der Begründer des Arianismus, zu Lebzeiten des Augustinus schon tot war, war ein weiterer Häretiker, Pelagius, ein Zeitgenosse Augustinus. Pelagius war wie Arianus gläubiger Christ. Nur verstanden sie das Christentum anders, besser, sie legten das Christsein anders aus. Pelagius war der Meinung, dass man dem Willen Gottes gegenüber nur gehorsam sein müsse. Dann ist die Vollkommenheit des Menschen möglich. Augustinus deutete die Argumente des Pelagius als Rückfall in den Rationalismus und Intellektualismus der Antike. Dies bedeutete, der Wille Gottes ist mit der Vernunft erkennbar. Vernunft hatten aber nicht alle Menschen gleichermaßen. Dies stand gegen die Gleichheit der Seelen. Für Augustinus war der Pelagianismus ein elitäres Denken. In seinen Augen sind alle Menschen fehlbar. Und diese Fehlbarkeit erst erzeugt das egalitäre Bewusstsein, die Gleichheit der Menschen. Wir müssen versuchen, uns zu vervollkommnen. Doch dies ist nach Augustinus ein „Sollen“ und kein „Können“. Für Pelagius war Vollkommenheit durch Gehorsam des Menschen, den Geboten Gottes gegenüber, möglich. Nach Augustinus verfügte der fehlbare Mensch nicht über diese Handlungsmacht. Eine vollkommene Christenheit konnte es daher für Augustinus nicht geben. Die Gnade Gottes wirkte anders.
Mit Jesus wurde die jüdische Gesetzestreue Jahwe gegenüber durch den liebenden Gott, der für alle Menschen da war, abgelöst. Das Gesetz wurde nicht beseitigt, aber durch die Liebe überhöht. Mit Augustinus wurden die Begriffe nun auf dieser Grundlage vollkommen