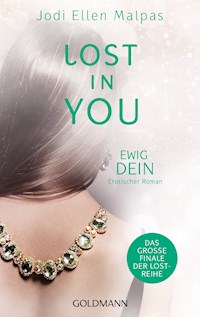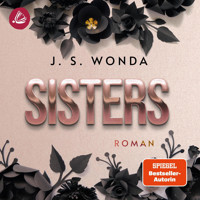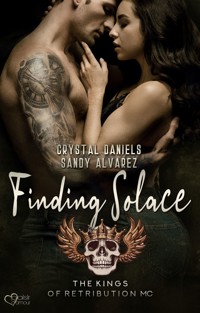9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Die One Night-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Livy kann auf ein aufregendes Leben verzichten: Sie ist glücklich damit, in einem kleinen Café zu kellnern und die Abende mit ihrer geliebten Großmutter zu verbringen. Doch als sie M begegnet, soll sich alles verändern. Er ist arrogant, reich und mit seinen strahlend blauen Augen gefährlich attraktiv – und er macht Livy ein Angebot, das ihre heile Welt komplett auf den Kopf stellt: Er will eine Nacht mit ihr verbringen, eine leidenschaftliche Nacht ohne Verpflichtungen, ohne Gefühl. Irgendetwas an M lässt Livy alle Vorsicht vergessen, und sie willigt ein, obwohl sie weiß, dass ihr Herz sich nach mehr sehnt. Und M verbirgt ein Geheimnis, das Livy in Gefahr bringt, nicht nur ihre Herz zu verlieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 714
Ähnliche
Buch
Livy kann auf ein aufregendes Leben verzichten: Sie kellnert in einem kleinen Coffee Shop und lebt bei ihrer geliebten Großmutter. Doch an dem Tag, an dem der mysteriöse Miller Hart das Café betritt, nimmt ihr ruhiges Leben ein jähes Ende. Er ist arrogant, reich und mit seinen strahlend blauen Augen gefährlich attraktiv. Und er macht Livy ein Angebot, das ihre heile Welt auf den Kopf stellt: Er möchte eine Nacht mit ihr verbringen, eine leidenschaftliche Nacht ohne Verpflichtungen, ohne Gefühl. Irgendetwas an Miller lässt die Mauer, die Livy um sich herum errichtet hat, bröckeln. Irgendetwas an ihm kann sie einfach nicht widerstehen, und sie willigt ein. Die unvergesslichen, gemeinsamen Stunden wecken eine Sehnsucht in Livy, die sie bisher nicht kannte. Doch hinter dem Luxusleben, den maßgeschneiderten Anzügen und den schnellen Autos, verbirgt Miller ein düsteres Geheimnis, das Livy unwiderruflich zerstören könnte …Weitere Informationen zu Jodi Ellen Malpas sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Jodi Ellen Malpas
One Night
Die Bedingung
Roman
Aus dem Englischenvon Nicole Hölsken
Die englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
»One Night. Promised«
bei Orion, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd., London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung August 2017
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Jodi Ellen Malpas
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Antje Steinhäuser
MR · Herstellung: kw
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-21051-9V003www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Assistentin, Siobhan. Ihr kennt sie alle als die Hüterin der wichtigen Dinge. Ich kenne sie als meine kleine Schwester.
Prolog
Er hatte sie zu sich zitiert. Sie hatte gewusst, dass er es herausfinden würde – er hatte seine Augen und Ohren überall, aber das hatte sie nie davon abgehalten, ungehorsam zu sein. Er gehörte zu ihrem Plan, um das zu bekommen, was sie wollte.
Sie stolperte den dunklen Gang des Londoner Unterwelt-Clubs zu seinem Büro und war sich ihrer Unvernunft kaum bewusst. Dazu war sie viel zu entschlossen und viel zu berauscht vom Alkohol. Zu Hause hatte sie eine fürsorgliche Familie, Menschen, denen sie etwas wert war und die sie liebten, die ihr das Gefühl gaben, erwünscht und geschätzt zu werden. Tief im Inneren wusste sie, dass es keinen guten Grund gab, sich körperlich und geistig dieser schäbigen und zwielichtigen Unterwelt auszusetzen. Und doch tat sie es heute Abend wieder. Und morgen Abend würde sie es ebenfalls tun.
Ihr drehte sich der Magen um, als sie sich der Tür zu seinem Büro näherte, sie konnte ihr alkoholbenebeltes Hirn kaum dazu bringen, die Hand zu heben und nach der Türklinke zu greifen. Noch eine kleine Welle der Übelkeit und ein Taumeln, und sie fiel in Williams Büro.
Er war ein gutaussehender Mann Ende dreißig mit dichtem, an den Schläfen bereits ergrauendem Haarschopf, was ihm ein distinguiertes Aussehen verlieh, das zu seinem Anzug passte. Sein markantes Kinn hatte etwas Brutales, aber sein seltenes Lächeln war freundlich. Seine männlichen Kunden sahen dieses Lächeln nie. William legte Wert auf diese harte Fassade, sodass alle Männer in seiner Gegenwart erzitterten. Aber seine Mädchen sah er stets freundlich an, und sein Gesicht war milde und beruhigend. Sie verstand es nicht, und sie versuchte es auch gar nicht. Sie wusste nur, dass sie ihn brauchte. Und sie wusste, dass William ebenfalls eine gewisse Zärtlichkeit für sie entwickelt hatte. Diese Schwäche verwendete sie gegen ihn. Für seine Mädchen hatte dieser kalte Geschäftsmann immer ein Herz, und bei ihr konnte er erst recht nicht Nein sagen.
William sah zur Tür, als sie hineinstolperte, und hob die Hand, um den verschlagen wirkenden Typen, der vor seinem Schreibtisch stand und auf ihn einredete, am Weitersprechen zu hindern. Eine seiner Regeln lautete, dass man klopfen und die Aufforderung zum Eintreten abwarten sollte, aber das tat sie nie, und William tadelte sie nicht deshalb. »Wir sprechen uns noch«, sagte er und entließ seinen Handlanger, der ohne zu zögern oder zu protestieren das Büro verließ und die Tür leise hinter sich schloss.
William erhob sich, strich sich das Jackett glatt und trat hinter seinem riesigen Schreibtisch hervor. Sogar durch den Alkoholnebel hindurch konnte sie die Sorge auf seinem Gesicht deutlich erkennen. Außerdem schien er verärgert zu sein. Er näherte sich ihr langsam, mit Bedacht, als ob er befürchtete, dass sie die Flucht ergreifen würde, und packte sie sanft am Arm. Er drückte sie in einen der Ledersessel, die seinem Schreibtisch gegenüberstanden, goss sich dann einen Scotch ein und gab ihr etwas eisgekühltes Wasser, bevor er selbst wieder Platz nahm.
Sie hatte in Gegenwart dieses mächtigen Mannes keine Angst, nicht mal in einem so verletzlichen Zustand wie jetzt. Seltsamerweise hatte sie sich bei ihm immer sicher gefühlt. Für seine Mädels würde er alles tun. Und jeden Mann, der die Grenze überschritt, hätte er eigenhändig kastriert. Er hatte eiserne Regeln, und kein Mann, der noch ganz klar im Kopf war, wagte es, sie zu brechen. Damit setzte man unweigerlich sein Leben aufs Spiel. Das hatte sie schon erlebt, und es war alles andere als schön.
»Ich hab doch gesagt, jetzt ist Schluss«, sagte William in dem Versuch, verärgert zu klingen, aber seine Stimme war mitfühlend.
»Wenn du mir keine mehr organisierst, such ich mir eben selber welche«, sagte sie schleppend, und ihre Trunkenheit schien ihrer schmalen Gestalt Energie zu verleihen. Sie schleuderte ihre Tasche auf den Schreibtisch vor ihm, aber William ignorierte ihre Respektlosigkeit und schob sie ihr wieder zu.
»Brauchst du Geld? Dann geb ich dir welches. Ich will dich in dieser Welt nicht mehr sehen.«
»Das hast nicht du zu entscheiden«, konterte sie furchtlos, denn sie wusste verdammt gut, was sie tat. Er presste die Lippen aufeinander, und seine grauen Augen verdunkelten sich. Sie hatte also Erfolg. Sie würde ihn zwingen.
»Du bist erst siebzehn. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir.« Er stand auf und ging um den Schreibtisch herum, setzte sich vor ihr auf die Tischkante. »Du hast mir in Bezug auf dein Alter nicht die Wahrheit gesagt, du hast sämtliche Regeln gebrochen, und jetzt weigerst du dich, dir von mir helfen zu lassen, damit wir dein Leben wieder auf die Reihe kriegen.« Er legte die Hand unter ihr Kinn und hob ihr trotziges Gesicht nach oben, damit sie ihn ansah. »Du respektierst mich nicht, aber noch schlimmer: dich selbst auch nicht.«
Darauf wusste sie keine Antwort. Sie hatte ihn in die Irre geführt, ihn getäuscht, nur um ihm nahe zu sein. »Tut mir leid«, murmelte sie leise und riss sich los, um einen großen Schluck Eiswasser zu trinken. Sie wusste nicht, was sie sonst noch hätte sagen sollen. Auch wenn sie die Worte hätte finden können, es wäre nie genug gewesen. Sie wusste, dass Williams Mitleid mit ihr den Respekt schmälern konnte, den er sich in der Unterwelt verdient hatte, und ihre Weigerung, ihn die Situation regeln zu lassen – eine Situation, für die er sich verantwortlich fühlte –, gefährdete seinen Ruf umso mehr.
Er kniete vor ihr nieder, seine großen Hände ruhten auf ihren nackten Beinen. »Welcher meiner Klienten hat diesmal die Regeln gebrochen?«
Sie zuckte die Achseln, nicht bereit, ihm den Namen des Mannes zu nennen, den sie in ihr Bett gelockt hatte. Sie wusste, dass William sie alle angewiesen hatte, sich von ihr fernzuhalten. Sie hatte ihn genauso sehr in die Irre geführt wie William. »Spielt keine Rolle.« Sie wünschte sich, dass William wütend auf ihre beständige Respektlosigkeit reagierte, aber er blieb ruhig.
***
»Du wirst nicht finden, wonach du suchst.« William kam sich wie ein Mistkerl vor, weil er so grob zu ihr war. Er wusste, wonach sie suchte. »Ich kann mich nicht um dich kümmern«, sagte er leise und zog den Saum ihres kurzen Kleides herunter.
»Ich weiß«, flüsterte sie.
William tat einen langen und erschöpften Atemzug. Er wusste, dass sie nicht in diese Welt gehörte. Er wusste nicht einmal, ob er selbst noch hierhergehörte. Er hatte nie zugelassen, dass Mitleid sich ins Geschäft mischte, hatte sich nie auf Situationen eingelassen, die seine Position unterminieren konnten, aber diese junge Frau walzte alles platt. Es waren diese saphirblauen Augen. Er hatte Gefühle und Geschäft nie vermischt – das konnte er sich nicht leisten –, aber diesmal war er gescheitert.
Er hob die große Hand, um ihre weiche, porzellanfarbene Wange zu streicheln, und die Verzweiflung in ihren Augen stach ihm mitten ins Herz. »Hilf mir doch, das Richtige zu tun. Du gehörst nicht hierher, zu mir«, sagte er.
Sie nickte, und William atmete erleichtert aus. Dieses Mädchen war zu schön und zu waghalsig – eine gefährliche Kombination. Sie würde sich in Schwierigkeiten bringen. Er war wütend auf sich selbst, dass er das zuließ, obwohl sie ihn hintergangen hatte.
Er kümmerte sich um seine Mädchen, respektierte sie, sorgte dafür, dass seine Klienten sie ebenfalls achteten, und hielt mit Adleraugen nach Gefahren Ausschau – seelischen und körperlichen. Er wusste, wie sie sich verhalten würden, noch bevor es ihnen selbst klar war. Doch bei dieser hier war es ihm entgangen. Die hier hatte ihn zum Narren gehalten. Doch daraus konnte er ihr keinen Vorwurf machen. Nur sich selbst. Er hatte sich von der Schönheit dieser jungen Frau zu sehr ablenken lassen – einer Schönheit, die sich für immer in ihn eingebrannt hatte. Er würde sie wieder fortschicken, und diesmal würde er dafür sorgen, dass sie ihm auch wirklich fernblieb. Er mochte diese Frau zu sehr, um sie behalten zu wollen. Und das verursachte einen dumpfen Schmerz in seiner dunklen Seele.
Kapitel 1
Eine perfekte Tasse Kaffee ist etwas Großartiges. Und noch großartiger ist eine perfekte Tasse Kaffee aus einem dieser neumodischen Raumschiff-Apparate wie dem, der gerade vor mir steht. Ich habe Tage damit zugebracht, meiner Kollegin Sylvie dabei zuzusehen, wie sie ihn mit Leichtigkeit handhabte, dabei schwatzte, einen Becher nahm, ihn füllte und nebenbei auch noch die Kasse bediente. Aber ich veranstalte mit dem Gerät immer noch eine Mordsschweinerei. Ich versaue nicht nur den Kaffee, sondern auch die komplette Umgebung des Kaffeeautomaten.
Leise fluchend ruckele ich an dem verklemmten Filter herum. Er gleitet mir aus der Hand, sodass sich das Kaffeepulver überall verteilt. »Nein, nein, nein«, murmele ich leise und ziehe ein Wischtuch aus der Vordertasche meiner Schürze. Der feuchte Putzlumpen ist schon braun, ein verräterischer Hinweis auf die Millionen Mal, die ich meine Sauerei heute schon aufwischen musste.
»Soll ich übernehmen?«, ertönt Sylvies amüsierte Stimme hinter mir, und ich lasse die Schultern hängen. Es hat keinen Zweck. Egal, wie oft ich es versuche, ich gerate immer wieder in die gleiche Bredouille. Dieses Raumschiff und ich werden niemals Freunde.
Mit einem theatralischen Seufzer drehe ich mich um und gebe Sylvie das große, metallene Filterteil. »Tut mir leid. Anscheinend hasst mich dieser Apparat.«
Ihre leuchtend pinkfarbenen Lippen verziehen sich zu einem liebevollen Lächeln, und ihr schwarzer, schimmernder Bob fliegt hin und her, als sie den Kopf schüttelt. Ich kann ihre Geduld nur bewundern. »Das kommt schon noch. Warum räumst du nicht einfach Tisch sieben ab?«
Ich beeile mich, schnappe mir ein Tablett und eile auf den gerade frei gewordenen Tisch zu, in der Hoffnung, meinen Lapsus wiedergutzumachen. »Der schmeißt mich raus«, murmele ich vor mich hin, während ich das Tablett belade. Ich arbeite erst seit vier Tagen hier, und bei meiner Einstellung verkündete Del, dass ich am ersten Tag sicher ein paar Stunden brauchen würde, um den Dreh mit der Maschine rauszukriegen, die fast den gesamten Raum hinter der Bar einnimmt. Dieser Tag war grässlich, und ich glaube, Del fand das auch.
»Nein, macht er nicht.« Sylvie heizt die Maschine ein, und das Geräusch des Dampfes, der durch den Milchschäumer strömt, erfüllt das ganze Bistro. »Er mag dich«, sagt sie jetzt lauter, nimmt eine Tasse, dann ein Tablett, dann einen Löffel, eine Serviette und die Schokostreusel, während sie mit der anderen Hand entspannt den Metallbehälter mit Milch schwenkt.
Ich lächele auf den Tisch hinunter, den ich gerade abwische. Dann nehme ich das Tablett in die Hand und gehe zurück in die Küche. Obwohl Del mich erst seit einer Woche kennt, hat er letztens behauptet, dass er mich für einen durch und durch guten Menschen hält. Meine Großmutter sagt immer das Gleiche, fügt aber meist noch hinzu, dass ich mich besser schnell ändern sollte, denn die Welt und die Menschen seien nicht immer nett oder freundlich.
Ich stelle das Tablett beiseite und fange an, die Spülmaschine einzuräumen.
»Alles klar mit dir, Livy?«
Ich drehe mich um, als ich Pauls barsche Stimme höre. Er ist der Koch. »Doch, alles fit. Und bei dir?«
»Mir geht’s bestens.« Er spült die Töpfe und pfeift dabei vor sich hin.
Ich stapele weiter die Teller in die Spülmaschine und denke mir, dass eigentlich alles gut ist, so lange man mich nicht auf dieses Höllengerät loslässt. »Soll ich sonst noch was tun, bevor ich Feierabend mache?«, frage ich Sylvie, die sich durch die Schwingtüren in die Küche drängt. Ich beneide sie darum, dass sie sämtliche Aufgaben so souverän und schnell meistert, egal ob es um diesen verdammten Apparat geht oder darum, Tassen ohne hinzusehen übereinanderzustapeln.
»Nein.« Sie dreht sich um und wischt sich die Hände an der Schürze ab. »Mach dich vom Acker. Bis morgen.«
»Danke.« Ich ziehe die Schürze aus und hänge sie auf. »Tschüs, Paul.«
»Schönen Abend noch, Livy«, ruft er und winkt mir mit der Schöpfkelle zu.
Nachdem ich mich durch die Tische des Bistros hindurchgeschlängelt habe, stoße ich die Tür auf und gelange auf die enge Hintergasse, wo der Regen auf mich niederprasselt. »Na toll.« Ich lächele, halte mir die Jeansjacke über den Kopf und renne los.
Ich hüpfe zwischen den Pfützen herum, und meine Converses sind schon bald pitschnass und geben bei jedem eiligen Schritt zur Bushaltestelle ein schmatzendes Geräusch von sich.
***
Ich renne die Treppe zu unserem Stadthaus hinauf, dränge mich durch die Tür und lehne mich erst mal dagegen, um Atem zu schöpfen.
»Livy?« Die heisere Stimme meiner Oma hebt sofort meine verregnete Stimmung. »Livy, bist du das?«
»Ja!« Ich hänge meine durchweichte Jacke an den Kleiderhaken und schleudere meine triefenden Converses von mir. Dann gehe ich über den langen Flur weiter nach hinten in die Küche. Dort beugt sich Nan, wie ich meine Oma nenne, über den Herd und rührt in einem riesigen Topf – zweifellos mit Suppe.
»Da bist du ja!« Sie legt den Holzlöffel beiseite und watschelt auf mich zu. Mit ihren einundachtzig Jahren ist sie wirklich noch total gut drauf und fit. »Du bist ja völlig durchnässt!«
»So schlimm ist es auch nicht«, versichere ich ihr und zerzause mir das Haar, während sie mich von Kopf bis Fuß mustert und den Blick dann auf meinem flachen Bauch ruhen lässt, als mein T-Shirt hochrutscht.
»Wir müssen dich ein bisschen mästen.«
Ich verdrehe die Augen, will aber die Stimmung nicht verderben. »Ja, ich verhungere gleich.«
Das Lächeln, das ihr faltiges Gesicht verzaubert, bringt mich ebenfalls zum Lächeln. Sie nimmt mich in die Arme und streichelt über meinen Rücken.
»Was hast du heute so getrieben, Nan?«, frage ich.
Sie lässt mich los und deutet auf den Esstisch. »Setz dich.«
Ich gehorche aufs Wort und nehme den Löffel zur Hand, den sie da für mich bereitgelegt hat. »Also?«
Sie sieht mich stirnrunzelnd an. »Also was?«
»Heute. Was hast du so gemacht?«, souffliere ich.
»Oh!« Sie versetzt mir einen Klaps mit einem Geschirrtuch. »Nichts Besonderes. Ein paar Einkäufe, und ich habe deinen Lieblingsmöhrenkuchen gebacken.« Sie deutet auf die Arbeitsplatte, wo der Kuchen auf dem Rost abkühlt. Aber es ist kein Möhrenkuchen.
»Du hast mir Möhrenkuchen gebacken?«, frage ich und beobachte, wie sie mit zwei Tellern Suppe an den Tisch zurückkehrt.
»Ja. Wie ich schon sagte, Livy. Hab deinen Lieblingskuchen gebacken.«
»Aber ich mag am liebsten Zitronenkuchen, Nan. Das weißt du doch.«
Sie stutzt keinen Augenblick und stellt geschickt die beiden Teller auf den Tisch. »Ja, weiß ich. Deshalb hab ich dir einen Zitronenkuchen gebacken.«
Ich werfe wieder einen Blick auf die andere Seite der Küche, nur um mich noch mal zu vergewissern, dass ich mich nicht irre. »Nan, das sieht aber wie gestürzter Ananaskuchen aus.«
Ihr Hintern landet auf dem Stuhl, und sie sieht mich an, als sei ich diejenige, die hier den Verstand verliert. »Das kommt daher, dass es gestürzter Ananaskuchen ist.« Sie taucht den Löffel in die Koriandersuppe und schlürft genüsslich, bevor sie sich eine Scheibe frisch gebackenes Brot nimmt. »Ich hab deinen Lieblingskuchen gemacht.«
Sie ist verwirrt, und mir geht es nicht anders. Nach dieser kleinen Unterhaltung habe ich keine Ahnung, was für einen Kuchen sie gebacken hat, und es ist mir auch egal. Ich schaue meine liebe Großmutter an, mustere sie, während sie isst. Es scheint ihr prima zu gehen, und sie sieht auch nicht durcheinander aus. Oder ist das hier nur der Anfang? Ich beuge mich vor. »Nan, fühlst du dich wohl?«
Sie fängt an zu lachen. »Ich hab dich doch nur auf den Arm genommen, Livy!«
»Nan!«, rufe ich empört, fühle mich aber sofort besser. »Das darfst du nicht!«
»Ich hab immer noch alle Tassen im Schrank.« Sie deutet mit dem Löffel auf meinen Teller. »Und jetzt iss zu Abend und erzähl mir, wie es heute gelaufen ist.«
Mit einem dramatischen Seufzer lasse ich die Schultern hängen und lasse den Löffel in meiner Suppe kreisen. »Ich komme mit diesem Kaffeevollautomaten einfach nicht klar, und das ist ein Problem, weil neunzig Prozent der Kunden irgendeine Art von Kaffee haben wollen.«
»Das kriegst du schon noch hin«, sagt sie zuversichtlich, als sei sie ein Experte für dieses verdammte Ding.
»Da bin ich mir nicht so sicher. Del wird mich sicher nicht behalten, wenn ich nur Tische abräumen kann.«
»Na ja – mal abgesehen von der Kaffeemaschine – gefällt dir der Job?«
Ich lächele. »Ja, das tut er wirklich.«
»Gut. Du kannst dich schließlich nicht dein Lebtag um mich kümmern. Ein junges Ding wie du soll seinen Spaß haben und nicht seine Großmutter umsorgen.« Sie wirft mir einen vielsagenden Blick zu. »Und um mich muss man sich sowieso nicht kümmern.«
»Tu ich aber gern«, widerspreche ich leise und wappne mich für den üblichen Vortrag. Wir könnten darüber bis zum Sankt Nimmerleinstag streiten und würden nie übereinkommen. Sie ist zerbrechlich, nicht physisch, aber psychisch, egal, wie sehr sie behauptet, dass es ihr gut geht. Sie braucht nur Luft zu holen, und schon fürchte ich das Schlimmste. »Livy, ich werde Gottes grünen Erdboden nicht verlassen, bevor ich weiß, dass du dein Leben in den Griff gekriegt hast, und das kannst du nicht, solange du mich immer unterm Pantoffel hast. Mir läuft die Zeit davon, also musst du langsam mal deinen mageren, kleinen Arsch hochkriegen.«
Ich zucke zusammen. »Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich glücklich bin.«
»Glücklich, während du dich vor einer Welt verkriechst, die so viel zu bieten hat?«, fragt sie ernst. »Fang an zu leben, Olivia. Eins kannst du mir glauben, die Zeit geht viel zu schnell vorüber. Ehe du dich’s versiehst, kriegst du falsche Zähne und wagst es nicht mehr, zu husten oder zu niesen, weil du Angst hast, dich vollzupissen.«
»Nan!« Ich verschlucke mich an einem Stück Brot, aber sie scherzt nicht. Sie meint es todernst, wie immer, wenn wir über dieses Thema reden.
»Glaub mir, es stimmt«, sagt sie seufzend. »Geh aus. Nimm, was immer dir das Leben zu bieten hat. Du bist nicht deine Mutter, Oliv–«
»Nan«, sage ich warnend.
Sie sackt sichtlich auf ihrem Stuhl zusammen. Ich weiß, dass sie mein Verhalten frustrierend findet, aber ich bin glücklich mit meinem Leben. Ich bin vierundzwanzig, ich wohne seit meiner Geburt bei meiner Nan, und nach dem College blieb ich zu Hause, um ein Auge auf sie haben zu können. Aber im Gegensatz zu mir war sie alles andere als glücklich darüber. »Olivia, ich habe mich weiterentwickelt. Und du musst das auch tun. Ich hätte dich nie bremsen dürfen.«
Ich lächele, weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr ist einfach nicht klar, dass ich diese Art von Bremse brauchte. Immerhin bin ich die Tochter meiner Mutter.
»Livy, mach deine Nan glücklich. Zieh dir die Heels an, geh aus und amüsier dich.«
Jetzt bin ich diejenige, die die Schultern hängen lässt. Aber sie kommt jetzt erst so richtig in Fahrt. »Nan, du müsstest mich festbinden, um mich in Heels zu zwängen.« Meine Füße schmerzen schon allein bei dem Gedanken daran.
»Wie viele Paare von diesen Leinendingern besitzt du eigentlich?«, fragt sie, bestreicht mir noch ein Brot mit Butter und reicht es mir.
»Zwölf«, antworte ich ohne jegliche Scham. »In verschiedenen Farben.« Ich will mir am Samstag noch ein paar gelbe holen. Ich nehme das Brot und vergrabe die Zähne darin, lächele, als ich ihr missbilligendes Gesicht sehe.
»Na ja, dann geh wenigstens aus und amüsier dich. Gregory lädt dich doch dauernd ein. Warum nimmst du ihn nicht mal beim Wort?«
»Ich trinke nichts.« Ich wünschte, sie würde aufhören. »Und Gregory schleift mich dann nur durch die Schwulenbars«, füge ich hinzu und ziehe die Augenbrauen hoch. Mein bester Freund schläft mit genug Männern, dass es für uns beide reicht.
»Jede Bar ist besser als keine Bar. Vielleicht gefällt es dir ja.« Sie streckt die Hand aus und wischt mir ein paar Krümel von den Lippen, dann streichelt sie sanft meine Wange. Ich weiß genau, was jetzt kommt. »Es ist beängstigend, wie ähnlich ihr euch seid.«
»Ich weiß.« Ich lege meine Hand auf die ihre und halte sie fest, während sie gedankenverloren vor sich hin schweigt. Ich kann mich nicht allzu gut an meine Mutter erinnern, aber ich habe ein Bild gesehen; ich bin ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Sogar mein blondes Haar fließt mir seltsamerweise in den gleichen Wellen über die Schultern – viel zu viel Haar für solch einen zarten Körper. Es ist unglaublich schwer und lässt sich nur bändigen, wenn man es trocken föhnt und ansonsten gewähren lässt. Und meine großen, marineblauen Augen, die ich von meiner Großmutter und meiner Mutter geerbt habe, sind glasklar und spiegelblank. Wie Saphire, sagen die Leute schon mal. Das kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Manchmal schminke ich mich zum Vergnügen, aber eigentlich brauche ich kein Make-up, und ich trage es immer nur sehr sparsam auf meiner hellen Haut auf.
Nachdem ich ihr genug Zeit gegeben habe, in Erinnerungen zu schwelgen, greife ich nach ihrer Hand und lege sie neben ihren Teller. »Iss auf, Nan«, sage ich leise und widme mich wieder meiner eigenen Suppe.
Mühsam besinnt sie sich wieder auf das Hier und Jetzt und isst weiter, bleibt aber schweigsam. Sie ist nie über den leichtsinnigen Lebensstil meiner Mutter hinweggekommen – ein Lebensstil, der ihr die Tochter gestohlen hat. Es ist jetzt schon achtzehn Jahre her, aber sie vermisst sie immer noch schrecklich. Ich nicht. Wie kann ich jemanden vermissen, den ich kaum kennengelernt habe? Aber es schmerzt mich, mitansehen zu müssen, dass Nan sich immer wieder den traurigen Erinnerungen hingibt.
***
Ja, die perfekte Tasse Kaffee zuzubereiten hat definitiv was für sich. Ich mustere den Automaten erneut, aber heute mit einem Lächeln. Ich hab’s geschafft – die richtige Menge an Milchschaum, samtig weich mit ein wenig Kakao in Form eines Herzens oben drauf. Es ist nur eine Schande, dass ich selbst ihn trinken muss, und nicht irgendein Kunde, den ich damit vom Hocker reiße.
»Gut?«, fragt Sylvie und sieht mich erwartungsvoll an.
Ich summe vor mich hin und seufze genüsslich, als ich die Tasse abstelle. »Jetzt sind die Maschine und ich endlich Freunde.«
»Yeah!«, kreischt sie und wirft mir die Arme um den Hals. Ich lache und bin genauso begeistert wie sie. Über ihre Schulter hinweg sehe ich, wie die Tür zum Bistro sich öffnet.
»Ich glaube, gleich geht es mit dem Mittags-Run los«, sage ich und löse mich aus ihrem Griff. »Ich übernehme den da.«
»Guck dir an, wie selbstbewusst du sein kannst«, lacht Sylvie und macht mir Platz, damit ich an die Theke kann. Sie strahlt mich an, als ich auf den Mann zugehe, der gerade angekommen ist.
»Was kann ich für Sie tun?«, frage ich und will seine Bestellung notieren. Als er nicht antwortet, hebe ich den Blick und stelle fest, dass er mich eindringlich betrachtet. Unruhig trete ich von einem Fuß auf den anderen, denn ich werde nicht gern so gemustert. Schließlich finde ich meine Stimme wieder. »Sir?«
Seine Augen weiten sich etwas. »Äh, einen Cappuccino bitte. To go.«
»Klar.« Ich werde aktiv, damit Mr. Kullerauge sich wieder einkriegen kann, gehe zu meinem neuen besten Freund rüber, fülle das Filterdings mit Kaffee und schiebe es erfolgreich in den Halter – so weit, so gut.
»Deshalb schmeißt Del dich nicht raus«, flüstert mir Sylvie über die Schulter zu, sodass ich zusammenzucke.
»Hör auf«, sage ich, hole einen Wegwerfbecher aus dem Regal und stelle ihn unter den Filterhalter, bevor ich den richtigen Knopf drücke.
»Er beobachtet dich.«
»Sylvie, hör auf, hab ich gesagt!«
»Gib ihm deine Nummer.«
»Nein!«, platze ich etwas zu laut heraus und werfe einen schnellen Blick über die Schulter. Er starrt mich an. »Ich bin nicht interessiert.«
»Er ist süß«, meint Sylvie, und ich muss ihr recht geben. Er ist sehr süß, aber ich habe wirklich kein Interesse.
»Ich habe keine Zeit für eine Beziehung.« Das stimmt nicht ganz. Dies ist mein erster Job, denn bisher habe ich einen Großteil meines Erwachsenenlebens damit verbracht, mich um Nan zu kümmern. Obwohl ich mich frage, ob sie wirklich immer noch meine Fürsorge braucht, oder ob das nur eine Ausflucht von mir ist.
Sylvie zuckt die Achseln und überlässt mich meiner zweiten erfolgreichen Runde mit der Kaffeemaschine. Ich stelle den Kaffee fertig und lächele, als ich die Milch in den Becher fülle, sie ein wenig bestäube, und dann den Deckel darauf befestige. Ich bin viel zu stolz auf mich selbst, und das steht mir eindeutig ins Gesicht geschrieben, als ich den Cappuccino Mr. Kullerauge reiche. »Zwei Pfund achtzig, bitte.« Ich will ihn abstellen, aber er kommt mir zuvor und nimmt mir den Becher aus der Hand, wobei er dafür sorgt, dass unsere Finger sich berühren.
»Danke«, sagt er, und bei seinen sanften Worten wird mein Blick geradezu magisch von seinen Augen angezogen.
»Gern geschehen.« Langsam ziehe ich meine Hand zurück und nehme den Zehner, den er mir hinhält. »Wechselgeld kommt sofort.«
»Schon gut.« Er schüttelt leicht den Kopf und lässt den Blick langsam über mein Gesicht wandern. »Aber ich hätte nichts gegen ihre Handynummer.«
Ich höre Sylvie am Tisch, den sie gerade abräumt, vor sich hin kichern. »Tut mir leid. Ich bin gebunden.« Ich tippe seine Bestellung in die Kasse ein und hole schnell sein Wechselgeld raus. Als ich es ihm reiche, ignoriere ich Sylvies entrüstetes Schnauben.
»Natürlich.« Er lacht leise, wirkt verlegen. »Wie dumm von mir.«
Ich lächele, versuche, ihm die Verlegenheit zu nehmen. »Schon gut.«
»Ich frage sonst Frauen nicht einfach nach ihrer Nummer«, erklärt er. »So einer bin ich nicht.«
»Ehrlich, ist schon gut.« Jetzt ist mir die Sache ebenfalls peinlich, und ich wünsche mir im Stillen, dass er geht, bevor ich Sylvie einen Kaffeebecher an den Kopf schmeiße. Ich spüre ihren schockierten Blick. Also ordne ich die Servietten neu, alles, um mich dieser unerquicklichen Situation zu entziehen. Ich könnte den Mann küssen, der nun reinkommt und aussieht, als hätte er es eilig. »Ich kümmer mich jetzt besser um den da.« Ich deute über Mr. Kulleraugens Schulter hinweg auf den gehetzt wirkenden Geschäftsmann.
»Oh ja! Sorry!« Er zieht sich zurück, hält dankend den Becher hoch. »Bis dann.«
»Ciao.« Ich hebe grüßend die Hand, bevor ich meinen nächsten Kunden anschaue. »Was kann ich für sie tun, Sir?«
»Einen Latte, ohne Zucker, und schnell.« Er sieht mich kaum an, bevor er ans Handy geht, sich von der Theke entfernt und seine Aktentasche auf einen Stuhl fallen lässt.
Ich bemerke nur halb, dass Mr. Kullerauge das Bistro verlässt, aber sehr deutlich bewusst ist mir, dass Sylvies Wanderstiefel auf mich zumarschiert kommen, während ich wieder mit der Kaffeemaschine kämpfe. »Ich kann kaum glauben, dass du ihn abgewiesen hast!«, flüstert sie ungehalten. »Er war doch total nett.«
Schnell bereite ich meinen dritten perfekten Kaffee zu und schenke ihrem Schock nicht die verdiente Aufmerksamkeit. »Er war ganz okay«, antworte ich lässig.
»Okay?«
»Ja, er war okay.«
Ich sehe sie nicht an, aber ich weiß, dass sie gerade die Augen verdreht hat. »Kaum zu glauben«, murmelt sie und stapft davon, ihr üppiger Hintern im Gleichtakt mit ihrem schwingenden Bob.
Wieder lächele ich triumphierend, als ich meinen dritten perfekten Kaffee serviere, und mein Grinsen lässt noch nicht mal nach, als der gehetzte Geschäftsmann mir drei Pfund in die Hand drückt, bevor er sich seinen Becher schnappt und ohne jedes Dankeschön hinauseilt.
Den ganzen restlichen Tag kommen meine Füße nicht zur Ruhe. Ich fliege in die Küche hinein und wieder raus, räume jede Menge Tische ab und bereite dutzendweise perfekten Kaffee zu. In den Pausen rufe ich immer mal wieder Nan an, nur um mir jedes Mal einen Rüffel einzuhandeln oder als Arschkriecher beschimpft zu werden.
Kurz vor fünf lasse ich mich auf eines der braunen Ledersofas sinken und mache mir eine Dose Coke auf in der Hoffnung, dass Koffein und Zucker mich wieder zum Leben erwecken. Ich bin fix und fertig.
»Livy, ich bringe grad noch den Müll raus«, ruft Sylvie mir zu und hievt einen schwarzen Sack aus einer der Tonnen. »Alles klar mit dir?«
»Mir geht’s fantastisch.« Ich halte meine Dose hoch und lehne den Kopf gegen die Sofalehne, widerstehe dem Impuls, die Augen zu schließen und konzentriere mich stattdessen auf die Spots an der Decke. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu fallen. Mir tun die Füße weh, und ich brauche dringend eine Dusche.
»Ist noch jemand bei der Arbeit, oder kann ich mich selbst bedienen?«
Beim Klang der ungeduldigen, aber sanften Stimme springe ich von der Couch auf und wirbele herum, um mich um den Kunden zu kümmern. »Sorry!« Ich eile zur Theke, stoße mir die Hüfte an der Kante der Arbeitsplatte und unterdrücke einen Fluch. »Was kann ich für Sie tun?«, frage ich, reibe mir die Hüfte und blicke hoch.
Ich taumele nach hinten. Und keuche. Seine durchdringenden, blauen Augen brennen sich in mein Inneres. Tief, tief in mein Innerstes. Mein Blick wandert nach unten: Ich nehme die offene Anzugjacke wahr, dann eine Weste und ein hellblaues Hemd mit Krawatte, sein dunkles Drei-Tage-Bart-Kinn und die Art, wie er einfach so die Lippen öffnet. Dann finde ich wieder seine Augen. Das ist das leuchtendste Blau, das ich je gesehen habe, und sein forschender Blick scheint mich förmlich zu durchdringen. Er ist der Inbegriff der Perfektion, und ich starre ihn an wie eine Erscheinung.
»Mustern Sie Ihre Kunden immer so gründlich?« Er neigt den Kopf zur Seite und zieht erwartungsvoll die perfekt geschwungene Augenbraue in die Höhe.
»Was kann ich für Sie tun?«, hauche ich und wedele mit meinem Bestellblock.
»Einen Americano, vier Shots, zweimal Zucker, nur halb voll.« Die Worte gleiten aus seinem Mund, aber ich höre sie nicht. Ich sehe sie. Ich lese ihm jedes Wort von den Lippen ab, schreibe sie auf, während ich meine Augen auf seinen Mund richte. Bevor ich es richtig merke, ist mein Stift vom Block heruntergerutscht, und ich kritzele mir auf die Finger. Stirnrunzelnd schaue ich mir die Bescherung an.
»Hallo?« Er klingt jetzt wieder ungeduldig, zwingt mich, wieder hochzusehen. Ich erlaube mir, einen Schritt zurückzutreten und sein Gesicht ganz in mich aufzunehmen. Ich bin schockiert, nicht weil er so atemberaubend aussieht, sondern weil meine ganzen Körperfunktionen versagen. Nur meine Augen arbeiten noch. Sie arbeiten sogar ziemlich gut, und sie können sich von seinem makellosen Äußeren einfach nicht losreißen. Ich starre ihn sogar noch weiter an, als er die Handflächen auf die Theke stützt und sich vorbeugt, wodurch ihm eine zerzauste Haarsträhne in die Stirn fällt. »Fühlen Sie sich in meiner Gesellschaft unbehaglich?«, fragt er. Das verstehe ich auch nur durch Lippenlesen.
»Was kann ich für Sie tun?«, hauche ich erneut und winke wieder mit dem Block.
Er deutet mit einem Kopfnicken auf meinen Stift. »Das haben Sie mich schon gefragt. Meine Bestellung steht auf Ihrer Hand.«
Ich schaue herunter, sehe die Tinte auf meinen Fingern, aber das Gekritzel ist kaum erkennbar, noch nicht mal, wenn ich den Block danebenhalte, um den Rest zu lesen.
Ich hebe langsam den Kopf und sehe ihn an. Sein Blick ist wissend.
Er wirkt arrogant. Und bringt mich total aus dem Konzept.
Ich zermartere mir das Hirn, kann mich aber an keine Bestellung erinnern, nur an sein Gesicht.
»Americano«, entgegnet er lässig und fast flüsternd. »Vier Shots, zweimal Zucker und nur halbvoll.«
»Stimmt, ja!« Ich reiße mich von seinem Anblick los – erbärmlich, diese ehrfürchtige Staunerei! – und gehe zur Kaffeemaschine. Meine Hände zittern, mein Herz pocht wild. Ich schlage mit dem Filter auf die Holzschublade, um die benutzten Kaffeebohnen zu lösen und hoffe, dass der laute Knall mir wieder ein bisschen Verstand einbläut. Tut er aber nicht. Ich fühle mich immer noch … merkwürdig.
Ich betätige den Schalter des Mahlwerks und fülle den Filter erneut. Er starrt mich an. Ich kann spüren, wie diese durchdringenden, blauen Augen sich in meinen Rücken bohren, während ich mir umständlich an der Maschine zu schaffen mache, die ich zu lieben gelernt habe. Aber im Augenblick erwidert sie diese Liebe nicht. Sie tut einfach nicht das, was ich ihr sage. Ich kriege den Filter nicht in die Halterung; und meine zitternden Finger sind da auch nicht sonderlich hilfreich.
Ich hole tief Luft, um mich zu beruhigen und fange noch mal von vorn an, kriege den Filter rein und stelle den Becher darunter. Ich drücke auf den Knopf und warte darauf, dass der Apparat seinen Zauber wirkt, wobei ich dem Fremden hinter mir den Rücken zukehre. In der ganzen Woche, die ich nun in Dels Bistro arbeite, hat die Maschine meines Wissens noch nie dermaßen lange gebraucht, um Kaffee zu filtern. Ich bitte sie im Stillen, sich zu beeilen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit nehme ich den Becher, lasse zwei Zuckerwürfel hineingleiten und bin bereit, das Ganze mit Wasser aufzufüllen.
»Vier Shots«, durchbricht seine heisere, sanfte Stimme das ungemütliche Schweigen.
»Wie bitte?« Ich drehe mich nicht um.
»Ich habe vier Shots bestellt.«
Ich sehe auf den Becher, in dem nur ein Shot ist, und schließe die Augen, bete zu den Göttern des Kaffees, mir zu helfen. Ich habe keine Ahnung, wie lang es dauert, noch drei Shots hinzuzufügen, aber als ich mich schließlich umdrehe, um ihm den Kaffee zu servieren, sitzt er auf dem Sofa, entspannt, den schlanken Körper ausgestreckt, seine Finger klopfen auf die Armstütze. Sein Gesicht ist vollkommen emotionslos, aber ich sehe, dass er nicht glücklich ist, und aus irgendeinem seltsamen Grund macht mich das richtig unglücklich. Ich habe diese verdammte Maschine den ganzen Tag wunderbar gemeistert, und nun, da ich eigentlich den Eindruck erwecken will, dass ich weiß, was ich tue, komme ich rüber wie eine inkompetente Idiotin. Ich komme mir komplett dumm vor, als ich den Pappbecher hochhalte, bevor ich ihn ordentlich auf die Theke stelle.
Er sieht ihn an, dann wieder mich. »Ich will den Kaffee hier trinken.« Sein Gesicht ist ernst, sein Ton ausdruckslos, aber dennoch scharf, und ich sehe ihn an, versuche herauszufinden, ob er nur schwierig ist oder authentisch. Ich kann mich nicht erinnern, ob er einen Coffee-to-go bestellt hat; ich war wohl nur davon ausgegangen. Er sieht nicht aus wie ein Mann, der in Hinterhofbistros herumsitzt. Er gehört eher in eine Champagnerbar, unter Leute mit Geld.
Ich nehme eine Kaffeetasse und eine Untertasse und gieße den Kaffee um. Dann lege ich den Teelöffel daneben, um sicheren Schrittes zu ihm hinüberzugehen. Doch so sehr ich mich auch bemühe, die Tasse ruhig zu halten, sie klirrt gegen die Untertasse. Ich stelle sie auf dem Tischchen vor der Couch ab und beobachte, wie er die Untertasse herumdreht, bevor er die Tasse zur Hand nimmt. Aber ich warte nicht, bis er trinkt, sondern wirbele auf meinen Converses herum und ergreife die Flucht.
Ich stürze durch die Schwingtür, die zur Küche führt, wo Paul gerade seinen Mantel anzieht. »Alles klar, Livy?«, fragt er, und blickt mich aus seinem rundlichen Gesicht forschend an.
»Jep.« Ich flitze zu dem großen Metallwaschbecken, um meine verschwitzten Hände zu waschen, als an der Wand das Bistrotelefon anfängt zu klingeln. Paul geht dran, offenbar der Ansicht, dass ich wild entschlossen bin, meine Hände so lange zu schrubben, bis sie verschwunden sind.
»Für dich Livy. Ich geh jetzt.«
»Schönes Wochenende, Paul«, antworte ich und trockne mir die Hände ab, bevor ich den Hörer in die Hand nehme. »Hallo?«
»Livy, Schatz, hast du heute Abend schon was vor?«, fragt Del.
»Heute Abend?«
»Ja. Ich mache das Catering für eine Wohltätigkeitsgala, und man hat mich sitzen lassen. Sei ein Schatz und hilf mir aus der Patsche.«
»Oh, Del. Würd ich ja gern, aber …« Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, denn eigentlich habe ich keine Lust. Und prompt fällt mir auch kein geeignetes »aber« ein. Ich habe heute Abend nichts zu tun außer bei meiner Großmutter herumzulungern und mir deshalb erneut ihr Gemecker anzuhören.
»Ach Livy, ich bezahl auch gut. Ich stecke echt in der Klemme.«
»Wann und wie lange?«, seufze ich und lehne mich an die Wand.
»Du bist die Beste! Von sieben bis Mitternacht. Ist auch keine harte Arbeit, Schatz. Du musst nur mit ein paar Tabletts voller Kanapees und Champagner rumlaufen. Du bist meine Sahneschnitte.«
Eine Sahneschnitte? Na ja, trotzdem werde ich weiter auf den Beinen sein, dabei tun meine Füße jetzt schon höllisch weh. »Ich muss erst nach Hause, nach meiner Nan schauen und mich umziehen. Was soll ich anziehen?«
»Schwarz, und sei um sieben am Personaleingang des Hilton an der Park Lane, okay?«
»Klar.«
Er legt auf, und ich lasse den Kopf hängen, aber dann wird meine Aufmerksamkeit von den Schwingtüren abgelenkt, und Sylvie platzt rein, die braunen Augen geweitet. »Hast du schon gesehen?«
Ihre Frage erinnert mich sofort an dieses atemberaubende Wesen, das gerade im Bistro Kaffee trinkt. Ich muss fast lachen, als ich den Telefonhörer wieder auf die Gabel lege. »Ja, ich hab ihn gesehen.«
»Heiliger, verdammter Strohsack, Livy! Männer wie der sollten einen Warnhinweis auf der Stirn tragen müssen.« Sie wirft noch einen Blick zurück ins Bistro und fängt an, sich Luft zuzufächeln. »Oh Gott, jetzt pustet er in seinen Kaffee.«
Ich muss das nicht selbst sehen. Ich kann es mir vorstellen. »Musst du heute Abend arbeiten?«, frage ich, um zu verhindern, dass sie gleich auf den Küchenboden sabbert.
»Ja!« Sie wirbelt zu mir herum. »Hat Del dich gefragt?«
»Hat er.« Ich nehme meinen Schlüsselbund vom Haken und schließe die Hintertür ab.
»Er wollte eigentlich, dass ich dich frage, aber ich weiß ja, dass du dich nicht gerade darum reißt, abends zu arbeiten, weil deine Nan zu Hause sitzt. Machst du es trotzdem?«
»Na ja, ich hab zugesagt.« Ich schaue sie erschöpft an.
Plötzlich breitet sich ein Grinsen auf ihrem ernsten Gesicht aus. »Wir machen jetzt dicht. Willst du ihm vielleicht sagen, dass es Zeit zum Gehen ist?«
Blöderweise habe ich bei dem Gedanken, ihn wieder anzusehen, schon wieder mit diesem Zittern zu kämpfen, und ich schimpfe mich selbst deshalb aus. »Ja, ich sag es ihm«, erkläre ich selbstbewusster als ich bin. Ich lasse die Schultern kreisen, straffe sie und gehe mit sicherem Schritt an Sylvie vorbei ins Bistro. Abrupt bleibe ich stehen, als ich entdecke, dass er fort ist. Die seltsamsten Gefühle durchströmen mich, als ich mich umsehe: Ich komme mir auf bizarre Weise verlassen vor und bin enttäuscht.
»Oh, wo ist er denn hin?«, quengelt Sylvie und drängt sich an mir vorbei.
»Keine Ahnung«, flüstere ich, gehe langsam zu dem leeren Sofa hinüber und hole die halb leere Kaffeetasse und die drei Pfund-Münzen. Ich löse die Serviette, die an der Untertasse klebt und will sie gerade zerknüllen, als mir ein paar schwarze Zeilen ins Auge fallen. Schnell breite ich sie wieder aus und streiche sie auf dem Tisch glatt.
Ich japse nach Luft. Dann werde ich ein bisschen wütend.
Wahrscheinlich der schlimmste Americano, mit dem ich je meinen Mund beleidigt habe.
M.
Ich ziehe eine angewiderte Grimasse und zerknülle die Serviette zu einem Ball, den ich in die Tasse stopfe. Dieses arrogante Arschloch. Normalerweise bringt mich so leicht nichts aus der Fassung, und ich weiß, dass das Großmutter und Gregory auf die Palme bringt, aber jetzt steigt heißglühender Zorn in mir auf. Dabei ist das doch eigentlich eine alberne Kleinigkeit. Aber dann frage ich mich, ob ich so wütend bin, weil ich keinen guten Kaffee hingekriegt habe, obwohl es mir den ganzen Tag über doch gelungen ist, oder einfach nur deshalb, weil er dem perfekten Mann nicht geschmeckt hat. Und wofür steht überhaupt dieses M?
Nachdem ich die Tasse, die Untertasse und die beleidigende Serviette losgeworden bin und mit Sylvie alles abgeschlossen habe, komme ich schließlich zu dem Schluss, dass der Grund für meine Wut ersterer ist und dass das M für Mistkerl steht.
Kapitel 2
Del führt uns durch den Personaleingang des Hotels, gibt uns Instruktionen, deutet auf den Servierbereich und bereitet uns auf die Gäste vor, die uns hier erwarten.
Im Großen und Ganzen Schickeria.
Damit komm ich klar. Nachdem ich nach Nan gesehen hatte, schob sie mich buchstäblich zur Tür hinaus und schmiss mir meine schwarzen Converses hinterher, bevor sie sich fertig machte, um mit George im Altenclub um die Ecke Bingo zu spielen.
»Sorgt dafür, dass immer alle Gläser voll sind«, ruft Del uns jetzt über die Schulter hinweg zu. »Und dass die leeren Gläser gleich wieder in der Küche landen, damit sie gespült und neu gefüllt werden können.«
Ich folge Sylvie, die wiederum hinter Del hergeht, und höre aufmerksam zu, während ich mir mein schweres Haar mit einer Klammer hochstecke. Hört sich nach einem leichten Job an, bei dem ich sogar noch Leute beobachten kann, was ich immer gern mache. Wahrscheinlich wird dieser Abend sogar ganz lustig.
»Hier.« Del bleibt stehen und drückt jeder von uns ein rundes Silbertablett in die Hand.
Dann sieht er auf meine Füße. »Hast du keine schwarzen, flachen Schuhe?«
Ich folge seinem Blick und ziehe meine schwarze Hose hoch. »Die sind doch schwarz.« Ich wackele in meinen Leinenschuhen mit den Zehen und denke daran, wie weh mir die Füße täten, wenn ich etwas anderes trüge.
Er sagt nichts mehr, sondern verdreht nur die Augen und führt uns in eine chaotische Küche, wo Dutzende von Hotelangestellten umhereilen, schreien und sich gegenseitig Befehle zubellen. Ich rücke näher an Sylvie heran. »Sind wir heute Abend nur zu zweit?«, frage ich, plötzlich etwas beunruhigt. Diese wilde Hektik hier deutet auf eine Menge Gäste hin.
»Nein, die Leute von der Agentur kommen auch. Wir sind nur das Backup.«
»So was macht er also häufiger?«
»Das ist seine Haupteinnahmequelle. Ich weiß nicht, warum er das Bistro überhaupt noch weiter betreibt.«
Ich nicke nachdenklich vor mich hin. »Hat denn das Hotel keinen Catering-Service?«
»Oh doch, aber die Leute, die du gleich bedienst, geben hier den Ton an, und wenn sie Del haben wollen, dann kriegen sie ihn auch. Er hat sich in dieser Branche einen Namen gemacht. Seine Kanapees sind einfach göttlich.« Sie küsst ihre Fingerspitzen, und ich muss lachen.
Mein Boss führt uns durch den Saal, in dem der Empfang stattfinden soll, und stellt uns den zahlreichen anderen Kellnern und Kellnerinnen vor, die allesamt gelangweilt und genervt wirken. Für sie ist das Ganze anscheinend Routine. Für mich nicht – ich freue mich darauf.
»Fertig?« Sylvie stellt ein letztes Glas Champagner auf mein Tablett. »Also, der Trick besteht darin, das Tablett auf deiner Handfläche zu balancieren.« Sie nimmt ihr eigenes Tablett hoch, die Hand unter der Mitte. »Dann schwingst du es auf deine Schulter, etwa so.« Mit einer fließenden Bewegung schwebt das Tablett durch die Luft und landet auf ihrer Schulter, ohne dass die Gläser ein einziges Mal aneinanderklirren. Ich bin fasziniert. »Kapiert?« Das Tablett gleitet wieder von ihrer Schulter herunter, bis es in Taillenhöhe ist. »Wenn du den Gästen Getränke anbietest, hältst du es hier, und wenn du herumgehst, dann trägst du es oben.« Das Tablett wirbelt wieder durch die Luft, landet erneut genau auf ihrer Schulter. »Und bleib immer ganz entspannt. Du darfst dich keinesfalls verkrampfen. Versuch’s mal.«
Ich lasse mein Tablett von der Theke gleiten und lege meine Handfläche unter die Mitte. »Ist nicht schwer«, sage ich überrascht.
»Ja, aber denk dran: Wenn leere Gläser statt der vollen draufstehen, wird es noch leichter. Das darfst du nicht vergessen, wenn du es hoch- und runterhievst.«
»Okay.« Ich drehe das Handgelenk, hebe das Tablett mit Leichtigkeit auf die Schulter. Ich lächele strahlend und nehme es wieder runter.
»Du bist ein Naturtalent«, lacht Sylvie. »Na, dann los.«
Ich nehme das Tablett wieder auf die Schulter, wirbele auf den Converses herum und strebe der schwatzenden und lachenden Menge entgegen, die man im Saal hört.
Als ich eintrete, schaue ich mich staunend um. Lauter reiche Leute, die Kleider, die Smokings. Aber ich bin nicht nervös. Vielmehr aufgeregt. Hier kann ich nach Herzenslust die Crème de la Crème beobachten.
Ohne auf Sylvies Anweisung zu warten, verliere ich mich in der stetig anwachsenden Menge, biete den Gästen Champagner an und lächele unaufhörlich, ob sie mir nun danken oder nicht. Die meisten tun es nicht, aber das kann mir die Stimmung nicht verhageln. Ich bin in meinem Element, und das überrascht mich. Das Tablett gleitet mit Leichtigkeit auf und ab, mein Körper bewegt sich mühelos durch die Menge der Reichen und Schönen, und ich tanze leichtfüßig zwischen dem Saal und der Küche hin und her, um meine Vorräte wieder aufzufüllen und erneut zu servieren.
»Du machst das toll, Livy«, sagt Del zu mir, als ich die Küche mit einem Tablett voller Champagnerflöten wieder verlasse.
»Danke!«, singe ich, begierig darauf, mich wieder in die durstige Menge zu stürzen. Ich entdecke Sylvie am anderen Ende des Saals, und sie lächelt, sodass ich auch sie anstrahle. »Champagner?«, frage ich und halte mein Tablett ein paar Männern mittleren Alters entgegen, allesamt in Smoking und Fliege.
»Aah! Verdammt fantastisch!«, ruft ein korpulenter Herr, nimmt ein Glas und reicht es einem seiner Begleiter. Das macht er noch weitere vier Mal, bevor er sich selbst bedient. »Sie machen das hervorragend, junge Dame.« Er streckt die freie Hand aus, zwinkert mir zu und lässt etwas in meine Tasche gleiten. »Gönnen Sie sich mal was.«
»Oh nein!« Ich schüttele den Kopf. Ich werde doch kein Geld von einem Mann annehmen. »Sir, ich werde von meinem Boss bezahlt. Das dürfen Sie nicht.« Ich versuche, die Banknote aus meiner Tasche zu fischen, während ich das Tablett auf meiner Handfläche balanciere. »Wir erwarten keine Trinkgelder.«
»Nichts da«, beharrt er und zieht mir die Hand aus der Tasche. »Und es ist kein Trinkgeld. Ich habe es Ihnen nur gegeben, weil sie so wunderschöne Augen haben.«
Ich werde sofort puterrot und habe keine Ahnung, was ich darauf erwidern soll. Er muss mindestens sechzig sein! »Wirklich, Sir. Ich kann das nicht annehmen.«
»Unsinn!«, schnaubt er und entlässt mich mit einem Wedeln seiner knubbeligen Hand. Dann wendet er sich wieder der Unterhaltung seiner Gruppe zu, und ich stehe da und frage mich, wie zum Teufel ich mich verhalten soll.
Ich schaue mich in dem Saal um, aber Sylvie ist nirgends zu sehen, ebenso wenig wie Del. Sie kann ich also nicht fragen, deshalb entledige ich mich schnell der übrigen Gläser und kehre in die Küche zurück. Dort legt Del gerade letzte Hand an die Kanapees.
»Del, jemand hat mir das hier gegeben.« Ich klatsche die Banknote auf den Tisch, fühle mich jetzt schon besser, weil ich es zugegeben habe, aber dann fallen mir fast die Augen aus dem Kopf, denn ich sehe, dass es ein Fünfziger ist. Ein Fünfziger? Was denkt der sich eigentlich?
Ich bin sogar noch verblüffter, als Del zu lachen anfängt. »Livy, du Genie. Behalt es.«
»Ich kann nicht!«
»Doch, kannst du wohl. Diese Leute haben mehr Geld als Verstand. Betrachte es als Kompliment.« Er schiebt mir den Fünfziger wieder zu und widmet sich erneut den winzigen Brotscheiben.
Ich fühle mich keinen Deut besser. »Ich habe ihm doch nur ein Glas Champagner gebracht«, sage ich leise. »Das rechtfertigt wohl kaum ein Fünfzig-Pfund-Trinkgeld.«
»Zugegeben, aber wie ich schon sagte, betrachte es als Kompliment. Steck den Schein ein und mach weiter.« Er deutet mit einem Kopfnicken auf das leere Tablett und ruft mir damit ins Gedächtnis, dass ich noch zu tun habe.
»Oh! Ja, klar.« Hastig stopfe ich mir das obszöne Trinkgeld wieder in die Tasche. Das muss ich später loswerden. Dann belade ich mein Tablett erneut und kehre schnell zu der feiernden Menge zurück. Ich meide den Mann, der gerade fünfzig Pfund zum Fenster rausgeworfen hat und biege in die entgegengesetzte Richtung ab, bleibe hinter einem roten Satinkleid stehen. »Champagner, Madam?«, frage ich und werfe Sylvie einen kurzen Blick zu. Sie nickt mir noch mal beruhigend zu, lächelt, aber das brauche ich gar nicht. Ich krieg das wunderbar hin.
Ich richte die Aufmerksamkeit wieder auf die satingeschmückte Frau, deren glänzend schwarzes, glattes Haar ihr bis zu dem knackigen Po hinabfällt. Ich lächele, als sie sich umdreht, und mein Blick fällt auf ihre Begleitung.
Einen Mann.
Ihn.
M.
Keine Ahnung, wie ich es hinkriege, das Tablett mit den frisch gefüllten Champagnergläsern nicht auf den Boden fallen zu lassen, aber ich halte es tatsächlich fest. Seine Lippen öffnen sich, seine Augen durchbohren meine Haut, aber sein attraktives Gesicht zeigt keine Regung. Die dunklen Bartstoppeln sind verschwunden, sodass nur noch die perfekt gebräunte Haut zu sehen ist, und sein dunkles Haar ist nicht mehr ganz so zerzaust, sondern fällt ihm in perfekten Wellen auf die Ohrläppchen.
»Danke«, sagt die Frau bedächtig, nimmt sich ein Glas und lenkt meinen Blick von dem seltsamen Mann ab. Ein riesiges, funkelndes, mit Diamanten besetztes Kreuz hängt an ihrem zarten Hals, sodass die Edelsteine sich in ihr Dekolleté zu schmiegen scheinen. Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass sie echt sind. »Möchtest du?« Sie dreht sich zu ihm um und hält ein Glas in die Höhe.
Er sagt kein Wort. Er nimmt ihr nur das Glas aus der perfekt manikürten Hand und lässt mich keine Sekunde lang aus den schockierend blauen Augen.
Er wirkt verschlossen, alles andere als warmherzig, aber dennoch spüre ich ein seltsames Brennen in mir, als ich sein Gesicht betrachte. So etwas habe ich noch nie erlebt – mir ist unbehaglich zumute, und ich fühle mich verletzlich … habe aber keine Angst.
Die Frau nimmt sich noch ein Glas, und ich weiß, jetzt müsste ich gehen, aber ich kriege keinen Fuß vor den anderen. Ich sollte wahrscheinlich lächeln, irgendwas, um das Blickduell zu beenden, aber mit einem Mal fällt mir das Lächeln nicht mehr leicht. Nichts funktioniert, außer meinen Augen, und die weigern sich, sich von ihm abzuwenden.
»Das wäre dann alles«, sagt die Frau unfreundlich, und ich zucke zusammen. Ihre feinen Züge sind zu einer ärgerlichen Grimasse verzerrt, und ihre ohnehin schon dunklen Augen jetzt tiefschwarz. Sie hat ein atemberaubendes Gesicht, selbst wenn sie mich so grimmig ansieht wie jetzt. »Ich sagte, das wäre dann alles.« Sie tritt zwischen mich und M.
M? Ich beschließe in diesem Augenblick, dass M für Mysterium steht, denn das ist er in der Tat. Schweigend schwinge ich mein Tablett wieder auf die Schulter und drehe mich langsam um, gehe davon, habe den Drang, mich umzusehen, denn ich weiß, dass er mir hinterhersieht, und ich frage mich, ob das bei seiner Freundin so gut ankommt. Also wende ich tatsächlich den Kopf, und mein Verdacht betätigt sich – stahlblaue Augen brennen förmlich Löcher in meinen Rücken.
»Hey!«
Ich erschrecke mich zu Tode, das Tablett fällt mir aus der Hand, und ich kann es nicht aufhalten. Die Gläser segeln gen Boden, der Champagner fließt langsam aus den Sektflöten, das Tablett wirbelt mitten in der Luft herum, und alles landet mit lautem Klirren auf dem Marmor. Im Saal wird es ganz still. Wie erstarrt beobachte ich, wie die Glassplitter meine Füße umtanzen, eine gefühlte Ewigkeit brauchen, um endlich ruhig zu liegen, während das durchdringende Geräusch zersplitternden Glases in der Stille des Raumes widerhallt. Ich senke den Blick, bin total verkrampft und weiß, dass aller Augen auf mich gerichtet sind.
Nur auf mich.
Alle starren mich an.
Und ich weiß nicht, was ich tun soll.
»Livy!« Als ich Sylvies erschrockene Stimme höre, schnellt mein verzweifelter Kopf in die Höhe, und ich sehe, wie sie auf mich zugeeilt kommt, die braunen Augen besorgt. »Alles klar mit dir?«
Ich nicke und gehe in die Hocke, um die Glassplitter einzusammeln, zucke zusammen, als mir ein scharfer Schmerz durchs Knie fährt und den Stoff meiner Hose durchschneidet. »Scheiße!« Ich atme hörbar ein, und Tränen brennen in meinen Augen. Sie kommen vom Schmerz und der tödlichen Verlegenheit. Ich finde es grauenhaft, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, und normalerweise gelingt es mir ganz gut, das zu vermeiden, aber dieser Situation hier kann ich nicht entrinnen. Ich habe es geschafft, dass eine gespenstische Stille sich in einem Saal mit Hunderten von Menschen ausbreitet. Am liebsten würde ich weglaufen.
»Nicht anfassen, Livy!« Sylvie zieht mich hoch und mustert mich von Kopf bis Fuß. Anscheinend kommt sie zu dem Schluss, dass ich kurz vorm Zusammenbruch stehe, denn sie zerrt mich schnell in die Küche, entzieht mich meinem Publikum. »Hüpf drauf.« Sie klopft auf die Arbeitsplatte, und ich komme ihrer Aufforderung nach, kämpfe immer noch gegen die Tränen an. Sie krempelt mir die Hose hoch und hebt das Bein an, bis man die Wunde sehen kann. »Autsch!« Sie zuckt bei dem Anblick des sauberen Schnitts zusammen und sieht mir in die Augen. »Ich kann kein verdammtes Blut sehen, Livy. War das der Kerl aus dem Bistro?«
»Ja«, flüstere ich und schrumpfe förmlich zusammen, als ich Del auf mich zukommen sehe, aber er wirkt gar nicht verärgert.
»Livy, geht es dir gut?« Er geht in die Hocke und zieht ebenfalls eine Grimasse, als er mein blutendes Knie sieht.
»Tut mir leid«, flüstere ich. »Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.« Wahrscheinlich feuert er mich jetzt fristlos, weil ich so ein Spektakel verursacht habe.
»Hey, hey.« Er richtet sich wieder auf, und seine Miene wird sanft. »So was passiert halt, Schatz.«
»Ich hab so ein Drama verursacht.«
»Jetzt reicht’s aber«, sagt er streng, dreht sich um und nimmt den Erste-Hilfe-Kasten von der Wand. »Ist doch nicht das Ende der Welt.« Er öffnet den Kasten und kramt darin herum, bis er ein antibakterielles Reinigungstuch erwischt und die Packung aufreißt. Ich beiße die Zähne zusammen, als er sanft mein Knie abwischt. Es beißt, und ich atme scharf aus und verkrampfe mich wieder. »Sorry, aber die Wunde muss gesäubert werden.«
Ich halte den Atem an, als er mit der Reinigungsaktion fortfährt, mir schließlich einen viereckigen Verband aufs Knie klebt und mich von der Arbeitsplatte runterhebt. »Kannst du laufen?«
»Klar.« Ich beuge das Knie und lächele dankbar. Dann nehme ich mir wieder ein Tablett.
»Was hast du denn jetzt vor?«, fragt er stirnrunzelnd.
»Ich …«
»Oh nein«, lacht er. »Gott segne dich, Livy. Geh auf die Toilette und beruhige dich erst mal.« Er deutet auf den Ausgang am anderen Ende der Küche.
»Aber mir geht’s gut«, beharre ich, obwohl ich mich nicht gut fühle, nicht weil mein Knie schmerzt, sondern weil ich mich nicht gerade darauf freue, meinen Zuschauern oder M wieder gegenüberzutreten. Ich werde einfach den Kopf einziehen, einen gewissen Stahlblick meiden und meine Schicht ohne weitere Missgeschicke durchziehen.
»Toilette!«, befiehlt Del, nimmt mir das Tablett ab und stellt es auf die Theke. »Jetzt.« Er legt mir die Hände auf die Schultern und schiebt mich zur Tür, erstickt jeden weiteren Protest im Keim. »Raus mit dir.«
Ich ringe mir ein verlegenes Lächeln ab und lasse die chaotische Küche hinter mir, betrete den riesigen Saal und will möglichst unbemerkt hindurcheilen. Aber keine Chance – meine Haut prickelt, als ich die scharfen, blauen Augen auf mir spüre. Ich komme mir vor wie ein Loser. Unfähig, töricht und schwach. Aber vor allem fühle ich mich bloßgestellt.
Ich biege auf den mit üppigen Teppichen ausgelegten Flur ab, stoße zwei Türen auf und lande schließlich in einem lächerlich extravaganten Waschraum, der an jeder Ecke mit Marmor und schimmerndem Gold ausgekleidet ist. Hier hat man ja direkt Hemmungen, die Toilette zu benutzen. Als Erstes nehme ich die Fünfzig-Pfund-Note aus meiner Tasche und mustere sie ein paar Augenblicke lang. Dann knülle ich sie zusammen und werfe sie in den Müll. Von Männern nehme ich kein Geld. Ich wasche mir die Hände, bevor ich mich vor den gigantischen, goldgerahmten Spiegel stelle, um mein Haar zu richten. Ich seufze. Der Blick in meinen Saphir-Augen wirkt gehetzt. Neugierig.
Ich schaue nicht weiter hin, als die Tür sich öffnet und konzentriere mich weiter auf mein Haar. Aber dann steht plötzlich jemand hinter mir, wirft einen Schatten über mein Gesicht, als ich mich zum Spiegel vorbeuge. M. Ich schnappe nach Luft und weiche zurück, pralle genau gegen seinen Körper, der genauso hart und schlank ist wie in meiner Vorstellung.
»Sie sind in der Damentoilette gelandet«, keuche ich und wirbele herum, um ihn anzusehen. Ich versuche, vor ihm zurückzuweichen, aber ich komme nicht weit, denn das Waschbecken hinter mir hält mich auf.
Trotz des Schrecks mustere ich ihn jetzt ausgiebig aus der Nähe – den dreiteiligen Anzug, das sauber rasierte Gesicht. Er duftet überirdisch, sehr männlich mit einer sinnlichen Holznote. Ein berauschender Cocktail. Alles an ihm wirft mein empfindsames Ich vollkommen aus der Bahn.
Er macht noch einen Schritt auf mich zu, steht mir plötzlich noch näher und erschreckt mich, indem er sich hinkniet und sanft meine Hose hochschiebt, um mein Knie zu begutachten. Ich stütze mich am Waschbecken ab, halte den Atem an, beobachte, wie er den Daumen sanft über die Gaze gleiten lässt, die den Schnitt bedeckt. »Tut es weh?«, fragt er leise und sieht mich mit diesen unglaublich blauen Augen unverwandt an. Ich bringe keinen Ton heraus, also schüttele ich nur leicht den Kopf und beobachte, wie er sich wieder zu voller Größe aufrichtet. Er sieht mich einen Augenblick lang nachdenklich an, dann sagt er: »Ich muss mich zwingen, Ihnen fernzubleiben.«
Ich weise nicht darauf hin, dass er das nicht besonders gut hinkriegt. Ich kann den Blick nicht von diesen Lippen abwenden. »Warum müssen Sie sich zwingen?«
Er berührt mich am Unterarm, und ich muss meine ganze Kraft aufbieten, um nicht zusammenzuzucken vor der Hitze, die von seiner Berührung ausgeht. »Weil Sie ein süßes Mädchen sind, das mehr von einem Mann bekommen sollte als den besten Fick seines Lebens.«
Ich bin schockiert darüber, wie wenig Erstaunen seine Worte in mir hervorrufen. Vielmehr bin ich erleichtert, auch wenn er mir eben nur versprochen hat, mich zu ficken und sonst nichts. Er fühlt sich auch von mir angezogen, und diese Gewissheit lässt mich zu ihm aufblicken. »Vielleicht will ich das ja.« Ich reize ihn, ermutige ihn, obwohl ich doch lieber so schnell wie möglich abhauen sollte.
Gedankenverloren konzentriert er sich auf den sanften Pfad, den seine Fingerspitze auf meinem Arm beschreibt. »Sie wollen mehr als das.«
Das ist eine Feststellung, keine Frage. Ich weiß nicht, was ich will. Ich habe nie großartig über meine Zukunft nachgedacht, weder auf beruflicher noch auf persönlicher Ebene. Ich lasse mich treiben, mehr nicht, aber eines weiß ich genau. Ich befinde mich auf gefährlichem Terrain, nicht nur, weil dieser unbekannte Mann zudringlich, dunkel und viel zu atemberaubend ist, sondern weil er gerade gesagt hat, dass er nicht mehr tun wird, als mich zu vögeln. Ich kenne ihn gar nicht. Ich wäre unvorstellbar dumm, wenn ich geradewegs ins Bett mit ihm ginge, nur für Sex. Das widerspricht total meinen Wertvorstellungen. Aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, was mich aufhalten sollte. Das Bild, das er mit seinen Worten heraufbeschwört, sollte mir ein ungutes Gefühl geben, tut es aber nicht. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich lebendig. Ich vibriere, ganz neue Gefühle beleben meine Sinne, und ein sogar noch heftigeres Vibrato schwillt zwischen meinen Schenkeln an. Ich pulsiere förmlich.
»Wie heißen Sie?«, frage ich.
»Das will ich dir nicht sagen, Livy.«