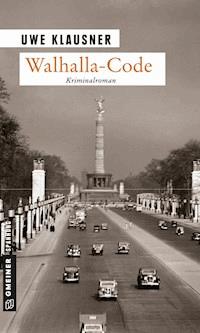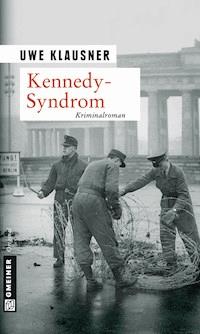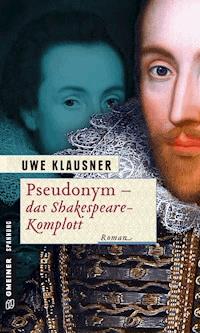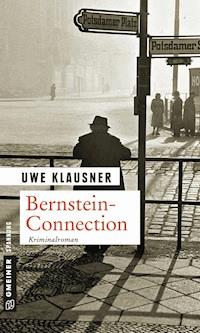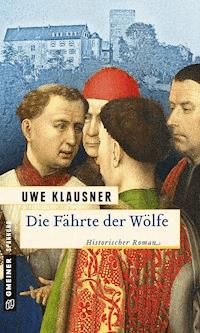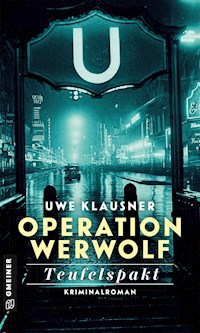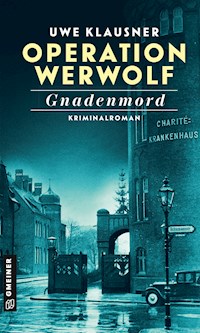Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Tom Sydow
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Berlin 1941. An der S-Bahn-Station Lehnitz wird ein SS-Scharführer tot aufgefunden. Kurz darauf wird am Bahnhof Bornholmer Straße die Leiche einer Frau entdeckt, die allem Anschein nach aus dem Zug geworfen wurde. Kommissar Sydow und sein Assistent stehen vor einem Rätsel. Zwei Tote, zwei Fälle? Die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass die Toten auf das Konto eines Unbekannten gehen, der die Order bekam, den Gerüchten über die sogenannte »Endlösung« auf den Grund zu gehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Klausner
Operation Werwolf – Todesprotokoll
Kriminalroman
Zum Buch
Mordmaschinerie Berlin im Juli 1941, kurz nach dem Angriff auf die Sowjetunion. An der S-Bahn-Station Lehnitz wird ein SS-Scharführer tot aufgefunden. Die Indizien deuten auf Selbstmord hin, wobei das Motiv für den Suizid im Unklaren bleibt. Kurz darauf wird am Bahnhof Bornholmer Straße die Leiche einer jungen Frau entdeckt, die allem Anschein nach mit einem Hammer getötet und im Anschluss aus dem fahrenden Zug geworfen wurde. Kommissar Sydow und sein Assistent Kalinke stehen vor einem Rätsel. Zwei Tote, zwei getrennte Fälle? Mitnichten. Nicht lange, und es stellt sich heraus, dass die Getötete beim sogenannten „Judenreferat“ des RSHA beschäftigt war und Zugang zu streng geheimen Akten besaß. Akten, die für die Kriegsgegner des Reiches von großem Interesse sind, allen voran der britische MI6, der einen Agenten einschleust, um den Gerüchten über die bevorstehende „Endlösung der Judenfrage“ auf den Grund zu gehen. Dass es sich dabei um einen alten Freund handelt, kann Sydow freilich nicht ahnen …
Uwe Klausner wurde in Heidelberg geboren und wuchs dort auf. Sein Studium der Geschichte und Anglistik absolvierte er in Mannheim und Heidelberg, die damit verbundenen Auslandsaufenthalte an der University of Kent in Canterbury und an der University of Minnesota in Minneapolis/USA. Heute lebt Uwe Klausner mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Neben seiner Tätigkeit als Autor hat er bereits mehrere Theaterstücke verfasst, darunter »Figaro – oder die Revolution frisst ihre Kinder«, »Prophet der letzten Tage«, »Mensch, Martin!« und erst jüngst »Anonymus«, ein Zweiakter über die Autorenschaft der Shakespeare-Dramen, der 2019 am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda uraufgeführt wurde.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg W 134_Nr. 000615 Bild 1 (5-94931-1), http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-94931-1
ISBN 978-3-8392-7394-4
DER NS-SICHERHEITSAPPARAT
SECHSTES BUCH Todesprotokoll
»Die Nazi-Partei duldete keine kriminellen Banden neben sich. Sie machte Berlin zur Kommandozentrale von Verbrechen einer ganz neuen Dimension: der staatlich gedeckten Entwürdigung, Freiheitsberaubung, Ausplünderung und Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen.«
(Michael Bienert / Elke Linda Buchholz, Die Zwanziger Jahre in Berlin. Ein Wegweiser durch die Stadt, Berlin 2018, S. 255)
FIKTIVE CHARAKTERE
(alphabetisch, Teil I–VI)
Paul Amman, Presseattaché an der Schweizer Botschaft
Hans Bechtold, Student
Karl Beckurtz, Werkmeister
Elsa Bruckmann, Schülerin
Paul Derpa, Revierleiter
Fred Drewitz, Bürogehilfe im Polizeipräsidium
Lea Enders, Psychotherapeutin
Lutz Faber, Ingenieur
Hiltrud Enke, Pflegerin
Jonathan Lewin Goldblum, Physiker
Paul Hanke, Polizeibeamter
Frank Heisig, Assistenzarzt an der Psychiatrischen und Nervenklinik der Charité
Lina Heisig, seine Schwester, Büroangestellte
Magda Helfrich, Ehefrau des Leiters der KTI
August Henschel, Justizoberrat
Sven Hinnerksen, Internist
Ulf Hinrichs, Heydrichs Adjutant
Erich Kalinke, Kriminalassistent und Sydows rechte Hand
Elise Kramm, Chefsekretärin
Hertha Krause alias Bijou, Animierdame im Tanz-Kabarett Kakadu
Max Jakubeit, Unterscharführer des SD der SS
Aaron Kahn, Agent des britischen MI6
Rudolf Lehmann, Kriminalhauptsekretär der Gestapo
Hermine Lewald, Rentnerin
Karl Lennert, Leiter des Sittendezernats
Emil Leschek, genannt Hantel-Emil, Türsteher im Tanz-Kabarett Kakadu
Ernst Liebig, Pathologe
Brad Macintosh alias Mark Cameron, Redaktionsleiter der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin
Jacques Mannsdörfer, Gerichtsmediziner
Jens Marquardt, Internist
Claus Martens, SS-Scharführer
Wilhelm Maschke, Streifenpolizist
Erna Mentzel, Hausverwalterin der Vehrenkamps
Hagen Mertz, Kriminalobersekretär der Gestapo
Eberhard Michalski, Kriminalassistent und stellvertretender Leiter der Spurensicherung
Hans-Werner Moebius, Facharzt für Psychiatrie und Institutsleiter
Constanze, seine Frau
Adele Mürwitz, Pensionärin
Rudolf Novotny, Zuhälter
Adolf Peschke, Frührentner
Fritz Petereit, Polizeizeichner
Erna Pommerenke alias Tante Lola, Grande Dame der Berliner Halbwelt
Karl Prittwitz, Oberbahninspektor
Ulf Schmidtke, Kommissaranwärter
Luise Stendhal, Vehrenkamps Schwester
Arndt Streckenbach, Verhörspezialist der Gestapo
Ernst Strehlitz, Revierleiter
Mira Schultz, Personalsachbearbeiterin beim RSHA
Friedbert Schultze-Maybach, Sydows Vorgesetzter und Leiter der Kriminalgruppe M der Kripo Berlin
Ava Schumann, Revue-Tänzerin
Tom von Sydow, Kommissar der Mordinspektion Berlin
Ida Varese, Ehefrau des italienischen Botschafters
Fritz-Dietlof Vehrenkamp, Korvettenkapitän
Vera Marie Vehrenkamp, seine zweite Frau
Immanuel von der Tann, Rechtsanwalt
Theodor Wattke, Leiter der Spurensicherung
Lutz Weigand, Revierleiter in Berlin-Steglitz
Bodo Wilmers, Chefarzt
Heinz Wischulke, Sanitätsgefreiter
Birgit Zsischke, Krankenschwester
REALE CHARAKTERE
(alphabetisch)
Hans Fröhlicher (1887–1961), Schweizer Botschafter in Berlin
Reinhard Heydrich (1905–1942), Chef des RSHA
Heinrich Himmler (1900–1945), Reichsführer-SS, Reichsinnenminister und Chef der Deutschen Polizei
DIE BERLINER S-BAHN 1941
ZITAT
Never in the field of human conflict
was so much owed
by so many
to so few.
(Winston Churchill, 21. August 1940)
PROLOG SONNTAG, 19. JANUAR 1941
1
Luftraum über dem Nordosten von Brandenburg, circa 20 Flugminuten von Berlin entfernt
02.12 Uhr
»Das ist noch gar nichts, Sir«, rief ihm der Bordmechaniker über die Schulter zu, auf dem Weg zum Heckteil des Bombers, um ihm beim Anlegen des Fallschirms behilflich zu sein. »Windstärke bei 50 Knoten, da kann unsereins nur drüber lachen!«
Ein Blick auf die im Rumpf eingelassene Luke, und sein Puls schnellte katapultartig in die Höhe. Absprünge aus geringer Höhe, das war etwas für Profis. Für Draufgänger, die es darauf anlegten, Vabanque zu spielen. Wäre er Offizier beim SAS gewesen, er hätte den Einsatz mit links absolviert. So aber, in der Kürze der Zeit nur notdürftig darauf vorbereitet, standen die Chancen, dass er überlebte, fifty-fifty.
Optimistisch betrachtet.
Trotz alledem, ein Zurück würde es nicht mehr geben. Die Entscheidung, aufs Ganze zu gehen, war gefallen. Und zwar ohne Wenn und Aber.
Augen zu und durch. So weit die Losung für den Tag.
»Letztes Jahr, so um Weihnachten herum, da hatten wir einen Einsatz über der Normandie, den werde ich so schnell nicht vergessen. Meine Fresse, das hat dir vielleicht geschaukelt, eine Fahrt mit der Achterbahn war nichts dagegen. Turbulenzen am laufenden Band, und was für welche. Da kam Freude auf, das können Sie mir glauben. Fragen Sie den MG-Schützen, der weiß Bescheid. Hat sich die Eingeweide aus dem Leib gekotzt, aber so was von!«
In Gedanken beim bevorstehenden Einsatz, deutete er ein mechanisches Nicken an. Kommissjargon hatte ihm noch nie gelegen. Und was die markigen Sprüche betraf, mit denen die Besatzung nur so um sich warf, auch auf sie konnte er getrost verzichten. Denn wenn man sich die Milchbubis genauer anschaute, dann wusste man Bescheid. Der siebenköpfigen Crew, im Durchschnitt gerade mal 19, saß die Angst im Nacken. Am heutigen Sonntag mehr denn je.
Ein Abschuss über feindlichem Territorium, und man war geliefert. Fürchteten die Jungs der Special Duties Squadron doch nichts mehr, als der Gestapo lebend in die Hände zu fallen. Den Folterknechten von Führers Gnaden, die wie die Heuschrecken über die besetzten Gebiete hergefallen waren, eilte nun mal ein spezieller Ruf voraus. Da machte er sich nichts vor. Würde passieren, was nicht passieren durfte – ihm bliebe nichts weiter übrig, als Zyankali zu nehmen. Von der Gestapo in die Mangel genommen zu werden, darauf konnte er verzichten. »Dann noch lieber hopsgehen«, so das lapidare Fazit, das bei der Royal Air Force, kurz RAF, kursierte.
Es ging um Sein oder Nichtsein, nicht zum ersten Mal in seinem Leben.
Was dieses Mistwetter betraf, war dem nichts hinzuzufügen.
»Alles so weit in Ordnung, Sir?«
Am Rand der Absprungluke angekommen, wo Fallschirm und Rucksack seiner harrten, nickte er bestätigend mit dem Kopf. »Dann mal los, verlieren wir keine Zeit.«
Der Mechaniker, Prototyp des trinkfesten Highland-Bewohners, sah ihm milde lächelnd ins Gesicht. Unter den »Senioren«, wie die Crewmitglieder mit mehr als einer Handvoll Feindflügen bezeichnet wurden, standen Leute wie er nicht unbedingt hoch im Kurs, ob Offizier oder nicht – oder gerade deswegen. Hinter vorgehaltener Hand, das wusste er aus berufenem Mund, wurden sie – halb spöttisch, halb naserümpfend – als »Joes«, »Mister X« oder »Jack Hazard« apostrophiert, nicht eben schmeichelhaft, wiewohl nur zu verständlich, weil sie die Aura des Geheimnisvollen umgab. Gespräche mit der Crew, so lautete die Vorschrift, seien auf das Nötigste zu beschränken. Und wer das nicht einsah, der handelte sich Scherereien ein. Ein falsches Wort zur falschen Zeit, und man lief Gefahr, vor dem Kriegsgericht zu landen – so es denn dabei blieb. Am besten, man sagte überhaupt nichts. Ob man sich damit beliebt machte oder nicht. Bedauerlich, aber nicht zu ändern. Denn Geheimhaltung ging nun mal vor.
Es sei denn, man hing nicht übermäßig am Leben.
Im Gegensatz zu ihm.
Davon abgesehen, stand unverrückbar fest: Alle an Bord, vom Piloten bis zum Bombenschützen, der Hüne von einem Mechaniker mit eingeschlossen, alle miteinander riskierten sie ihren Kopf – nicht zuletzt um seinetwillen.
Ohne Fragen zu stellen, ohne ein Wort der Klage, ohne Murren.
Ein Grund mehr, das Beste aus der Situation zu machen.
Und es den Nazis nach Kräften heimzuzahlen.
»Keine Bange, Sir. Das wird schon«, fühlte sich der Mechaniker bemüßigt, ihn mit wohlwollender Attitüde aufzumuntern, entriegelte die Luke und hielt sich fest. Kaum war dies geschehen, schien die Luft vor Kälte zu vibrieren, und als wolle er der Sogwirkung trotzen, stieß sein Rachen einen Schwall von Atemstößen hervor. Binnen Sekunden, nachdem der Luftstrom wie ein Geysir durch die Luke geschossen war, hatte der Eishauch den gesamten Rumpf erfasst, begleitet vom Heulen der Windböen, die an den Tragflächen der schlingernden Halifax rüttelten. Schneeflocken wirbelten umher, Derwischen gleich, eine größer als die andere, wie Spritzer einer ätzenden Flüssigkeit, die sein Gesicht mit einer Maske aus Eis überzogen. Und dann erst die Turbulenzen, in die der Bomber in immer kürzeren Abständen geriet, heftiger als ein Wirbelsturm, mit nie dagewesener Gewalt. Fast schien es, als sei die Halifax manövrierunfähig geworden, in die Luft gewirbelt wie ein Spielball, kurz davor, von den tosenden Elementen in Stücke gerissen zu werden. »Wie ich Sie kenne, machen Sie das mit links.«
Mit links.
Der Fleischberg hatte gut reden.
Einen Geschmack von aufsteigender Magensäure im Mund, griff er nach dem Haltegurt, der quer durch den abgedunkelten Rumpf verlief, schnappte nach Luft und bedeutete dem Monteur, ihm beim Anlegen seiner Montur zur Hand zu gehen. Als Letztes kam der Tornister mit dem Funkgerät an die Reihe, das mithin kostbarste Requisit, eine Landung ohne Blessuren vorausgesetzt. Dann trat er an den Rand der Luke – und warf einen Blick nach unten.
Schnee, Schnee und abermals Schnee. In sämtlichen Schattierungen, bald gleißend hell, bald mattgrau schimmernd, durchbrochen von vereisten Rinnsalen, vermutlich Flussläufen oder Teilen des Kanalsystems. Besprenkelt mit vereinzelten Baumgruppen, deren Geäst wie fleischlose Skelette anmuteten.
Eine Einöde wie am Polarkreis, so weit der Blick des Betrachters reichte.
Orientierung nahezu ausgeschlossen.
Ein Sprung ins Ungewisse, noch dazu bei Windstärke zehn. Der dritte Versuch überhaupt, wenn nicht gar der letzte.
Das konnte ja heiter werden.
»Fertigmachen zum Absprung, noch drei Minuten«, drang eine Stimme aus dem Bordlautsprecher an sein Ohr, untermalt vom Dröhnen der Motoren, die eine Leistung von knapp 1.400 PS erreichten. »Hals- und Beinbruch, Sir – und beehren Sie uns bald wieder!«
Hals- und Beinbruch.
Von wegen.
Darauf konnte er getrost verzichten.
Aber egal, was sein musste, das musste nun mal sein. Die Augen auf das brausende Inferno gerichtet, stülpte er sich seine Schutzbrille über, prüfte ihren Halt und ließ sich im Zeitlupentempo nieder.
Dann reckte er den Daumen.
Und nickte dem Bordmechaniker zu.
Es konnte losgehen.
»Sinkflug eingeleitet. Noch zwei Minuten.«
Die Prozedur war stets die gleiche: Bei einer Flughöhe von 2.000 Fuß, die auf dem Weg ins Operationsgebiet strikt eingehalten wurde, würde der Bomber circa dreieinhalb Stunden brauchen, eine Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern vorausgesetzt. Nicht eben gefahrlos, führte die Route doch quer über feindliches Gebiet, beginnend mit der französischen Kanalküste, an der sich ein Horchposten an den nächsten reihte. Von den Flakbatterien, mit denen sie nur so gespickt war, einmal abgesehen. An Suchscheinwerfern, die an die Radarstationen gekoppelt waren, um im Anflug befindliche Bomber zu orten, herrschte ebenfalls kein Mangel. Und dann gab es da auch noch die deutschen Jäger, allen voran die Messerschmitt Bf 109, kurz Me109 genannt, gefürchtet wegen ihrer Wendigkeit, mit der die Halifax nicht annähernd Schritt halten konnte. Eine oder gar mehrere Messerschmitts auf der Pelle, die wie ein Schwarm Hornissen über einen herfielen, und die Besatzung hatte ein Problem.
Und er, der ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war, natürlich auch.
Eine Halifax im Tiefflug nach Berlin zu dirigieren, da gehörte schon etwas dazu. Und wenn man dann wie jetzt in Unwetter geriet, na dann prost Mahlzeit. Striktes Funkverbot, so lautete die Order von oben. Selbst dann, wenn es sich um einen Notruf handelte.
Befehl war nun einmal Befehl.
Und damit Schluss.
Ob und in welchem Zustand er sein Ziel erreichen würde, nun ja, darüber nachzudenken lohnte den Aufwand nicht. Entweder die Halifax kam durch, setzte ihn ab und stahl sich unbemerkt von dannen, oder er und die Crew gingen bei dem Hasardunternehmen drauf.
So einfach konnte das Leben sein.
Wie es mit dem Sterben aussah, stand auf einem anderen Blatt.
»Noch eineinhalb Minuten, erreichen 1.000 Fuß.« Näherte man sich dem Ziel, ging der Pilot auf 500 runter – und drosselte die Motoren. Kaum Zeit also, um die Reißleine zu ziehen. Von der Aussicht, dass sich der Fallschirm nicht schnell genug öffnen würde, um einen ungebremsten Aufschlag zu verhindern, nicht zu reden.
Na dann mal viel Spaß, Special Agent.
Du hast es so gewollt.
»Erreichen 500 Fuß. Noch eine Minute.«
Ein weiterer Blick nach unten, fast beschwörend, wie um die Elemente zu besänftigen. Allein, die Szenerie, wenngleich mit schärferen Konturen, war nach wie vor die gleiche. Ein Archipel von verstreuten Baumgruppen, die unter der Last der Schneemassen ächzten, durchzogen von vereisten Rinnsalen, bei denen es sich vermutlich um Bäche handelte. Und Seen gab es auch, Dutzende davon, von bizarr anmutender Schönheit, mit einem Firnis aus Schnee und Eiskristallen bedeckt. Größere Ansiedlungen oder Städte gab es dagegen keine – zum Glück.
Bruchlandung unter der Dorflinde, umringt vom herbeieilenden Landvolk, das nichts lieber täte, als ihn zum nächstgelegenen Polizeirevier zu schleifen.
Oder ihn kurzerhand aufzuknüpfen, wie des Öfteren geschehen.
Zu seinem Glück hätte ihm das gerade noch gefehlt.
Proviant für drei Tage, eine prall gefüllte Feldflasche und – last, but not least – ein Peilsender zwecks Kontaktaufnahme mit einem Agenten, sprich: mit seinem Kontaktmann im Berliner Westen. Die brandneue Karte, basierend auf Luftaufnahmen der RAF, nicht zu vergessen.
Das musste reichen.
Obwohl, mit der Orientierung war es so eine Sache. Seit seiner Flucht waren mehr als fünf Jahre vergangen, und was den Landstrich rund um die Havelseen betraf, dort kannte er sich nicht wirklich aus. Als Kind war er zwar häufig am Groß Glienicker See gewesen, wo seine Eltern ein Wochenendhaus in Strandnähe besaßen. Allein, das Idyll aus den 20ern gehörte der Vergangenheit an, wie so vieles, an das er sich jetzt, im Alter von knapp 24 Jahren, allenfalls in Bruchstücken erinnern konnte. Beziehungsweise wollte. Die Zeit, so schien es, war über ihn hinweggegangen, der Fakt war nicht von der Hand zu weisen. Aber auch er selbst, der nicht zögerte, sich öffentlich als waschechten Berliner zu bezeichnen, hatte sich von Grund auf geändert.
Er war ein anderer geworden, und was blieb, war die Erinnerung an den Steppke, der in der Waldschule in Charlottenburg die Schulbank drückte. Die Erinnerung an ein Leben, das in weiter Ferne lag, mit dem ihn nichts, aber auch gar nichts mehr verband.
Er hatte einen Schlussstrich gezogen, ein für alle Mal.
Und das war auch gut so.
Denn wenn es einen Ort gab, an dem er nicht mehr leben wollte, dann war es Berlin, Dreh- und Angelpunkt einer Despotie, deren Untergang nicht nur er, dessen Familie seit Menschengedenken dort ansässig gewesen war, mit jeder Faser seines Ichs herbeisehnte.
»Noch 30 Sekunden, Countdown läuft.«
Na dann mal los, alter Junge – gleich ist es so weit.
»Da!« Bereit zum Sprung, schreckte er aus seinen Gedanken auf.
»Da drüben, Sir!«, stieß der Mechaniker mit hektischen Armbewegungen hervor, dicht neben einem kreisrunden Heckfenster postiert, von wo aus er die Gegend im Auge behielt. »Jäger im Anflug, volle Deckung!«
Doch, das gab es.
Und dann, nur Bruchteile von Sekunden später, nahm das Inferno seinen Lauf. Der Bordschütze, in einem drehbaren Geschützturm hinter den Tragflächen postiert, feuerte, was die Rohre hergaben, und die Me109, in Begleitung von zwei Maschinen gleichen Typs, zahlte mit gleicher Münze heim. Lichtblitze erhellten die Nacht, begleitet vom Stakkato der Geschütze, deren Sperrfeuer ihm wie Donnergrollen in die Ohrmuscheln fuhr.
»Operation abbrechen, Luke schließen!«, ließ sich die Stimme aus dem Bordlautsprecher vernehmen, so schrill, dass sie sich gleich mehrfach überschlug. »Ich wiederhole: Luke schließen – das ist ein Befehl!«
Ein Befehl indes, den er nicht befolgen würde.
»Weg da, Sir – oder haben Sie nicht gehört, was der Pilot ge…«
Weiter bis hierhin, als er ihn mit Gewalt am Absprung hindern wollte, kam der bullige Bordmechaniker nicht. Im Begriff, mit seiner Pranke nach dem Verschluss der Luke zu greifen, bäumte sich der Hüne auf, getroffen von einer Geschützgarbe, welche die Bordwand wie einen Pappkarton durchsiebte. Binnen Bruchteilen von Sekunden außer Gefecht gesetzt, taumelte der Zweimetermann, nur mehr ein blutüberströmter Torso, wie ein Betrunkener im Zickzack hin und her. Um kurz darauf, als sei das Leben durch ein Ventil aus ihm entwichen, wie ein gefällter Baum auf dem Boden aufzuschlagen.
Er aber, geschüttelt von einer heftigen Bö, die mit Macht durch die offene Luke strömte, nahm seinen ganzen Mut zusammen.
Und sprang.
Sekunden später, die ihm wie eine halbe Ewigkeit erschienen, öffnete sich der Fallschirm, gerade rechtzeitig, bevor die Tanks unter den Tragflächen explodierten.
Dem Inferno, das die Halifax in einen glühenden Feuerball verwandelte, um Haaresbreite entronnen, landete er auf einem schneebedeckten Feld, getaucht in glutrotes Licht, das ihm wie ein Menetekel erschien.
Die Crew, der er es zu verdanken hatte, dass seine Mission wie geplant begann, er würde sich ihrer würdig erweisen.
Und würde es den Nazis heimzahlen.
Auf Heller und Pfennig.
EINS MONTAG, 7. JULI 1941
2
S-Bahnhof Lehnitz, erste Station nach Oranienburg
23.55 Uhr
»Heil Hitler, Personenkontrolle!«
»Einen Moment bitte, das haben wir gleich«, gab er an die Adresse des SS-Scharführers zurück, die Gelassenheit in Person, trotz falscher Identität. Auf eine Kontrolle, und käme sie noch so ungelegen, war er natürlich vorbereitet gewesen. In Berlin wimmelte es nur so von Uniformierten, die Landser auf Urlaub nicht mitgezählt. Ein Blick auf die Passanten, die über den Ku’damm oder den Alex flanierten, und man wusste, wie der Hase lief. Ob SS, SA-Hilfspolizisten mit Armbinde oder Zivilfahnder der Gestapo, die Greiftrupps schienen immer zahlreicher zu werden. Und natürlich gab es auch noch die »Orpo«, frei nach Schnauze als Schupos oder grüne Jungs tituliert, das Gegenstück zur sogenannten »Sipo«, einem Zusammenschluss aus Gestapo und Kriminalpolizei.
An der Angst, die unter der Bevölkerung grassierte, hatte der Aufmarsch von Überwachern nichts geändert. Die Leute fühlten sich nicht mehr sicher, weniger aufgrund des Krieges, sondern außerhalb der eigenen vier Wände, wenn sie bei Einbruch der Nacht noch auf Achse waren. Da nützte es recht wenig, dass die Kontrollen um ein Vielfaches verschärft worden waren. So notwendig die Verdunkelung auch erschien, um anfliegenden Bombern die Orientierung zu erschweren, die Straßen waren dadurch nicht sicherer geworden, allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz.
Auch an Razzien herrschte aktuell kein Mangel, aufgrund der Rationierung nicht weiter verwunderlich. Dabei eingesetzt wurden nicht nur Polizisten, von denen ein Großteil erst unlängst eingezogen worden war, sondern auch Fußstreifen, die aus Mitgliedern der gefürchteten SS bestanden. An den Straftaten, die sich aufgrund der Verdunkelungsmaßnahmen häuften, hatte ihre Präsenz jedoch nur wenig geändert. Allerorten grassierte die Angst, neu entfacht durch die Jagd nach einem Serienmörder, der laut Presse fünf Frauen auf dem Gewissen hatte. Dass der »Werwolf«, wie von offizieller Seite verlautbart, der Polizei erst unlängst ins Netz gegangen war, daran glaubten indes nur die wenigsten. Was Wunder auch, wenn er es geschafft hatte, die Polizisten zu Trotteln vom Dienst zu degradieren. Dass es sich bei Heinrich Himmler, seines Zeichens Reichsführer-SS, um ihren Chef und obersten Dienstherrn handelte, hatte der Blamage schlussendlich die Krone aufgesetzt. Von wegen Ruhe und Ordnung an der Heimatfront, davon konnte man in Berlin nur träumen. »Da ist er ja endlich, der vermaledeite Ausweis – bitte schön!«
»Wurde aber auch Zeit«, hielt der Scharführer, dem Jünglingsalter kaum entwachsen, mit militärischer Attitüde dagegen, ein Vertreter der Spezies Herrenmensch, dem die Verachtung gegenüber Zivilisten ins Gesicht geschrieben war. Dann riss er ihm die gefälschten Papiere aus der Hand, hielt sie unter die mitgebrachte Taschenlampe und schnarrte: »Gebürtig in Berlin, sehe ich das richtig?«
Einer von den Hundertprozentigen.
Auch das noch.
»In der Tat.« Die Vergangenheit hatte ihn eingeholt. Wieder mal. Die Szene vor seiner Einreise in die Schweiz, als der Zug auf dem Badischen Bahnhof hielt, gerade sie würde er nie vergessen. Getrieben von jugendlichem Leichtsinn, hatte er sich nach der Ankunft eine Fluppe angesteckt, auf dem Weg zur nahen Zollstation, um die Kontrollen möglichst zügig zu passieren. Im festen Glauben, er befinde sich auf Schweizer Boden. Was den Badischen Bahnhof von Basel anging, hatte er mit der Annahme zwar richtig gelegen. Aber eben nur zum Teil, denn was die besagten Kontrollen betraf, wurden sie von Uniformierten der Reichsbahn durchgeführt, ergänzt durch Beamte in Zivil, bei denen es sich um Zielfahnder der Gestapo handelte. Gerade Letztere ließen sich reichlich Zeit, auf der Suche nach flüchtigen Regimegegnern, die versuchten, in die benachbarte Schweiz zu gelangen. Dementsprechend lang war die Schlange denn auch gewesen, in der er sich nach der Ankunft anstellte, im Besitz eines olivgrünen Passes, der ihn als Emigranten von Führers Gnaden auswies. Zehn Reichsmark, den Koffer mit den wichtigsten Habseligkeiten und eine Fahrkarte zweiter Klasse, mehr hatte er bei der Ausreise nicht mitnehmen dürfen. Für den Zivilfahnder, der ihn mit scheelem Blick beäugte, jedoch kein Grund, ihn einfach so in die ersehnte Freiheit zu entlassen. Schien er auf die Gelegenheit, ihn zu schikanieren, doch nur gewartet zu haben. Und das trotz britischem Visum, zunächst gültig für ein halbes Jahr, die Durchreisegenehmigung durch Frankreich inbegriffen. Eher widerstrebend hatte er schließlich klein beigegeben, so als sei ihm nichts anderes übrig geblieben.
Einer von den 100prozentigen, wie der Schnösel vom Schwarzen Korps.
»Und wann?«
»6. Mai 1917«, gab er wahrheitsgemäß von sich, wohl wissend, dass der Rest der Personalien erfunden war. »In Schöneberg.«
»Was Sie nicht sagen!«, bellte der Jungspund im Kasernenhofton zurück und ließ den Lichtkegel zwischen dem Passbild und seinem Gesicht hin und her wandern, und das gleich mehrfach hintereinander, als habe er es mit einem Kriminellen zu tun. »Brille runter, so kann man Sie ja kaum erkennen!«
»Und wozu?«
»Sie tun gefälligst, was ich sage«, kanzelte ihn der Uniformierte wütend ab, nur noch eine Armlänge von ihm entfernt, um der Aufforderung entsprechend Nachdruck zu verleihen. In etwa genauso groß, baute er sich zähnefletschend vor ihm auf, wie ein Bluthund, der danach gierte, auf Beutezug zu gehen. »Oder Sie erleben Ihr blaues Wunder!«
Wenn hier jemand sein blaues Wunder erlebt, dann du.
Ein süffisantes Lächeln im Gesicht, kam er der Aufforderung des SS-Mannes nach. Dass der damit sein Todesurteil unterschrieb, das konnte der Narr von einem Kommisskopf nicht ahnen. Ihn am Leben zu lassen, wäre ein großer Fehler gewesen, an dem Fazit führte kein Weg vorbei. Denn hatte er sich erst sein Gesicht eingeprägt, dann wäre es ein Leichtes, seine Fährte aufzunehmen. Der Gefahr war er sich von Beginn an bewusst gewesen. »Wie Sie wünschen«, ließ er mit eisiger Miene verlauten, fest entschlossen, auch jetzt nichts dem Zufall zu überlassen. Dann nahm er die Brille ab und fragte: »Kann ich jetzt gehen, oder möchten Sie mir noch etwas mitteilen?«
»Kommt drauf an.« Der Jungspund lächelte maliziös. »Und warum treiben Sie sich gerade jetzt hier rum, Herr …«
»Faber«, vollendete er mit süßlichem Ton und ließ den Blick wie zufällig durch den Wartesaal schweifen. Wie allerorten üblich, war der Raum in mattblaues Licht getaucht, und was die Verdunkelungsrahmen betraf, mit denen die Nischen abgedichtet worden waren, schien auch hier fast alles seine Richtigkeit zu haben. Einzig vom Ausgang, durch den man auf den angrenzenden Bahnsteig gelangte, sickerte das Mondlicht durch den schmalen Türspalt herein, begleitet vom Ticken der Wanduhr, deren Minutenzeiger auf 00.15 Uhr zeigte.
Viertel nach.
Höchste Zeit, die Komödie zum Abschluss zu bringen.
Mit Betonung auf Abschluss, solange es keine Zeugen gab.
»Vorname Lutz«, fügte er mit kaltem Lächeln hinzu, nahm den Ausweis in Empfang und ließ ihn in die Innentasche seines Zweireihers gleiten, wo die Handfläche eine geladene Parabellum streifte, die er für den Fall der Fälle bei sich trug. Dass er mit Letzterem bereits heute konfrontiert werden würde, damit hatte er nicht gerechnet. Allein, um seine Mission wie geplant fortzuführen, blieb ihm keine andere Wahl.
»Ich kann lesen, stellen Sie sich vor!«, blaffte der Scharführer von oben herab zurück, ein Grünschnabel ohne Instinkt, wie das aufgesetzte Imponiergehabe bewies. »Und wohin sind Sie so spät noch unterwegs?«
»Zu einem Rendezvous«, gab er in doppelbödigem Tonfall zurück und hatte Mühe, seinen aufkeimenden Unmut zu bezähmen. »In Zeiten wie diesen sollte man das Leben genießen, finden Sie nicht auch? Schließlich weiß man ja nie, was einem bevorsteht, schon gar nicht, wie lange es noch dauert!«
»Dann mal viel Vergnügen«, versetzte der Jüngling knapp, drehte sich um und machte Anstalten, den Warteraum zu verlassen. »Und was mein zukünftiges Leben betrifft, darüber mache ich mir keine Gedanken.«
»Sollten Sie aber, Herr Scharführer«, ergriff er die Gelegenheit, die sich ihm bot, beim Schopf, packte den SS-Mann an der Schulter und schob ihm den Arm unter das glattrasierte Kinn, die Parabellum in der linken Hand, um sie dem überrumpelten Schnüffler an die Schläfe zu drücken.
Dann drückte er ab, das Geräusch des Schalldämpfers in den Ohren. »Bei uns Engländern weiß man ja nie!«
DIENSTAG, 8. Juli 1941
3
S-Bahnhof Lehnitz, erste Station nach Oranienburg
00.25 Uhr
Eine Nacht, wie sie finsterer nicht hätte sein können, für seine Zwecke geradezu ideal. Und die S-Bahn nach Wannsee in Sichtweite, auf die Minute pünktlich, aller Voraussicht nach nur wenig frequentiert.
Ein Hoch auf die Berliner Verkehrsgesellschaft.
So hatte er es gern.
Nur mehr ein Schatten, dessen Konturen mit der Finsternis verschmolzen, nahm er einen letzten Zug. Dann schnippte seine Lucky Strike auf die Gleise, wo sie nach kurzem Aufglühen erlosch, und schlenderte auf den Rand des Bahnsteigs zu. Das Gelände lag in tiefem Dunkel, durchaus von Vorteil, was das Auftauchen von unerwünschten Zeugen betraf. Obwohl, bis jetzt war alles nach Wunsch verlaufen, und mit ein wenig Glück, von dem er höchst selten im Stich gelassen wurde, würde sein Vorhaben wie geplant vonstattengehen.
Es sei denn, jemand kam ihm unterwegs in die Quere. Ein Schnüffler pro Abend war genug, und er konnte von Glück sagen, wenn es dabei blieb. Wie dem auch sei, der Grünschnabel hatte seine Chance gehabt. Wäre er in Begleitung und nur halb so borniert gewesen, dann hätte es ein Desaster gegeben. So aber war es ihm geglückt, den Kopf gerade noch so aus der Schlinge zu ziehen. Ideen musste der Mensch haben – oder mehr Dusel als Verstand.
Wie dem auch sei, auf eine Zugabe war er nicht erpicht. Lautete doch die Order, kein Risiko einzugehen. Bei Einsätzen hinter der Front, wo der Agent damit klarkommen musste, auf sich allein gestellt zu sein, da durfte man nichts dem Zufall überlassen. Nur so – und mit einer gehörigen Portion Glück – besaß man die Chance, sich die Gestapo für eine Weile vom Hals zu halten.
Für eine Weile, wohlgemerkt.
Wie lange so etwas gutgehen würde, das stand auf einem anderen Blatt.
Grund genug, jetzt nur nicht leichtsinnig zu werden. Und vor dem Einsteigen kurz die Lage zu peilen. Schließlich konnte man nie wissen, die Göttin des Zufalls war allgegenwärtig.
Und launisch obendrein.
Sicher war nun einmal sicher.