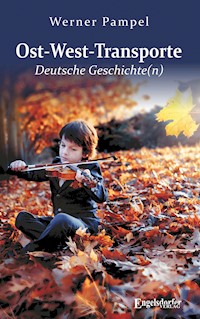
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Ereignisse der Wende 1989 vollzogen sich nicht nur im politischen Bereich, sondern wurden spürbar in allen, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Selbst in extremen Situationen, wie zum Beispiel bei Krankenhausaufenthalten, wurde das erkennbar. Der Autor zeigt dies unter anderem anhand eines authentischen Falls.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Pampel
OST-WEST-TRANSPORTE
Deutsche Geschichte(n)
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2023
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2023) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Igor Y. [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
INHALT
Langeweile ist die Not derer, die keine Not haben
Ein Ass auf der Geige
„Erbärmlich ist jener Schüler, der seinen Meister übertrifft.“
Er kam, sah und siegte
Ein vergeigter Ost-West-Transport
Haltet die Sachsen an!
Die kaum noch vermeidbaren Meister
War ich zu dünnhäutig?
Wildwest in der DDR
Kaffeeklatsch mit Kartoffelsuppe
Wo blieb eigentlich der Nebel?
„Die wahren Lebenskünstler sind bereits glücklich, wenn sie nicht unglücklich sind.“
Der Plumpsack
„Man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht ins Scheitern.“
Im „Heilig-Geist-Stift“
„Wer gegen Schmerzen unempfindlich ist, hat auch jedes andere Gefühl verloren.“
Das Montage-Kollektiv
Italienische Nächte
Ost – West – Medikamente
Das verkannte Genie
Käfighaltung
Zeigt her eure Füße!
„Sobald man etwas besitzt, ist es wertlos.“
Das knallrote Cabrio
„Mich würde interessieren, wie er über mich denkt.“
Heißer Draht ins Jenseits
„Ein Mensch, will er auf etwas pfeifen, darf sich im Tone nicht vergreifen.“
Gemma und der Aufbau Ost
Zwischen Tür und Angel
Der (alternativlos) letzte Ost-West-Transport
Auf der Ottomane
Der Elfte Elfte
Ja, ja im Westen
Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen
Ab in die Reha!
Die Sache mit Max
LANGEWEILE IST DIE NOT DERER, DIE KEINE NOT HABEN.
Wenn ich wieder einmal das zweifellose Vergnügen hatte, durch einen gras-grü-hü-ne-hen Wald zu gehen und dazu die Vögelein singen zu hören, kam mir auch die Natur gleich „ein Stück weit“ natürlicher vor. Für heute allerdings war mein Gesundheitslauf – bei welchem es sich lediglich um einen flotteren Spaziergang handelte – schon vorüber. Dreimal in der Woche raffte ich mich zu dieser Art von Fitness-Übung auf. Ich bildete mir ein, dass ich als Diabetiker, der ich war, einen besonderen Nutzen davon hätte. Regelmäßige Bewegung, so meine felsenfeste Überzeugung, sei für mich mindestens so wichtig wie eine wohlproportionierte Mahlzeit.
Was ist das für eine behämmerte Welt, überlegte ich, und wie „krass“ kam es mir vor, wenn mir so manche junge Frau als frisch gebackene „Mama“ begegnete. Es geschah meistens zu einer Zeit, in welcher sich gut gelaunte Vögelchen und frische Gräslein um die Wette präsentierten. Ängstlich fragte sich dann die Mama, ob sich ihr Kleines womöglich schon wieder abgewickelt hätte.
Zum Glück erblickte sie aber noch dasselbe Baby, das sie sich vor kurzem selbst erst auf den Bauch gebunden hatte.
Alles schien gut, und sie bekam sogar eine Hand frei für eine neue Kippe. Auch schaffte sie es, den hitzigen Terrier anzuleinen.
„Opa, stell dir vor, ab heute bin ich nicht mehr bei Facebook“, verkündete, wie aus heiterem Himmel, die Enkelin. Sie blinzelte, als erwarte sie von mir eine erstaunte Reaktion.
Ich indes hielt die Gelegenheit für gekommen, ihr eine ganz bestimmte Frage zu stellen, zugegeben: eine altmodische. Es handelte sich um eine Sache, die mich seit kurzem „echt umtrieb“, wie man heute zu sagen pflegte.
„Mal ganz ehrlich, Constanze, warum warst du wirklich Mitglied in diesem Verein? Ich gebe ja zu, dass die Frage ziemlich naiv klingt, zumal bekannt ist, wie viele Nutzer es inzwischen in besagtem Netzwerk gibt: über eine Milliarde.“
Da frage ich mich doch, ob der neue Zeitvertreib ein Beweis dafür ist, dass verlorene Zeit niemals wiedergefunden wird?
Nunmehr konnte sich die Enkelin nicht länger zurückhalten. „Es stimmt, Opa, dass die meisten, die bei Facebook sind, ihre kostbare Zeit verplempern und dies sogar zugeben. Ohne Facebook hätten sie „null Ahnung“, was sie ansonsten den lieben langen Tag anstellen sollten.
Und weißt du was, Opa, vor allem deshalb bin ich so gespannt auf Korea. Dort soll ja alles ganz anders sein.“
„Wieso Korea, wie kommst du plötzlich auf Korea?“ wollte ich unbedingt wissen.
„Also Opa!“, entgegnete die Enkelin, „du weißt schon noch, dass ich in Kürze für einige Monate nach Korea reisen werde.“
Ich war derart baff, dass ich die Enkelin mit leicht geöffnetem Mund anblickte. Nach kurzem Verharren fiel mir nichts Gescheiteres ein, als mich wortlos zurückzuziehen.
Phänomenal, dachte ich, dass im selben Maße, wie sich der Fortschritt ausbreitete, auch das Unvermögen wuchs, sinnvoll mit der freien Zeit umzugehen.
Derweil fingen diverse Gelüste, die ich bisher krampfhaft unterdrückt hatte, an sich zu regen.
Während man sich bisher die heiß ersehnten West-Ost-Transporte bestenfalls vorstellen konnte, standen sie nun, zum Greifen nahe, immer öfter „auf der Matte“.
War es da ein Wunder, dass man sich wie ein Heinzelmännchen vorkam, wenn man im neuen Job der täglichen (und nächtlichen) Befriedigung von Verreise-Gelüsten nachzugehen hatte?
Hätte jemand weissagen können, wohin uns solch unbändige Verreise-Lust eines Tages führen würde? Man denke nur an die Ungereimtheiten im Flugwesen, an mancherlei Unzufriedenheit auch beim Personal. Erinnert sei gleichfalls an Kettenreaktionen, welche die Verreise-Sucht bei der Deutschen Bahn auslöste. Dennoch gab es eine Unmenge von Mitbürgern, die über jegliche Verwicklungen glücklich zu sein schienen. Dienstleistungen fallen mir da ein oder auch die plötzlich überschaubaren Schlangen am Taxi-Stand.
Man erlebt gar nicht so selten, wie sehr unser Wohlbefinden von der gewählten Fluglinie abhängt. Schon bald würde man sich die Frage stellen, wann stark übergewichtige Gäste wegen Platzmangels im Stehen fliegen müssen. Verlautbarungen über geplante Veränderungen der Abstände von Sitzreihen wiesen übrigens darauf hin.
Trotzdem wird kaum jemand aufs Fliegen verzichten wollen – zumal immer noch keiner „oben geblieben“ war. Folgerichtig gab es jene Landungen, die planmäßig gar nicht vorgesehen waren, nur äußerst selten.
*
EIN ASS AUF DER GEIGE
Für all das, was mit Denken zu tun hat, haben wir sofort die passende Statistik zur Hand. Nun ja, gäbe es so etwas auch für die Qualität des Geigens, dann würden wir blitzschnell wissen, wie oft mancher den obigen Satz schon von sich gegeben hat – mehr oder weniger nur so dahingesagt. Handelte es sich dabei um eine von den Angewohnheiten, die sich noch verschlimmbessern könnten? Keine Angst, es vollzöge sich nur im Rahmen der heute allzu üblichen Sprachverstümmelungen.
Im Falle dieses Falles war alles anders. Hier war tatsächlich einer ein Ass auf der Geige. Wie hatte man sich das vorzustellen? Die ersten Verehrer huldigten ihm, als er noch nicht einmal die Schule besuchte. War also die Redewendung gerechtfertigt, nach der jeder als Wunderkind gelten („durchgehen“) durfte, jeder, der ein gewisses Talent besaß, sprich irgendeine Art von Talent.
Oder handelte es sich etwa um einen so genannten Brückenbauer?
Hing es „ein Stück weit“ damit zusammen, was man bei der Verleihung des „Klassik-Bambis“ über ihn sagte: dass er „bestimmt mühelos eine Brücke von Mozart zu Jackson schlüge“?
Ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf die Frage nach seinem Talent: Sein extraordinäres Spiel war mit dem eisernen Willen gepaart, nie wieder damit nachzulassen.
Und Paul Kuhn, hatte der mit seiner Weissagung daneben gelegen? Hätte sonst sein „Gib dem Bub die Geige nicht!“ irgendeine erkennbare Wirkung auf den Eiferer gehabt? War dies auch der Grund, weshalb Paul Kuhn viel eher dem Klavier zugetan war?
Eine so verzwickte Sache konnte nur jemand verstehen, der selbst (mit gemischten Gefühlen) versucht hatte, einer richtigen Geige die richtigen Töne zu entlocken.
Wer sich vorstellen kann, welche Instrumente beim Lernen immer wieder bevorzugt wurden, der wird auch erkennen, dass man die Violine darunter ziemlich selten fand. Die Blockflöte dagegen immer wieder. Genauso die Gitarre, und sehr häufig das Klavier. Mitunter auch das Akkordeon.
Da fragt man sich doch, was der Grund für solch „violinistitische“ Zurückhaltung sein mochte.
Werfen wir einen Blick auf einen der großen Niederländer unserer Tage. Weil die Musik in seiner Familie dem Broterwerb diente, hatte die Geige bei den Rieu’s keineswegs Seltenheitswert. Nach einer Aussage des Meisters antwortete seine (weniger erfolgreiche) Enkelin auf die Frage „Was macht eigentlich die Geige?“: „Na ja, ich war wohl damals noch zu jung fürs Geigen.“
Daran lässt sich erkennen: Wer gerade hier auf schnelle Erfolge aus ist, hat meist „schlechte Karten“. Was aber ist der eigentliche Grund dafür? Ich denke, dass es mehrere sind. In den ersten Wochen und Monaten muss sich der „blutige Anfänger“ immer und immer wieder auf dieselben Luftschwingungen einstellen. Das sind teils Schwingungen, die sogar für ihn selbst schwer erträglich sind. Obwohl recht gut hörbar, haben sie doch nur zufällig mit den landläufigen Vorstellungen von Tönen zu tun. Was hier überwiegt, ist ein (gut gemeintes) Geschabe und Gekratze, das nicht zuletzt von der Menge des verwendeten Kolophoniums abhängt.
Es zeugt von falsch verstandener Spielkultur, wenn man stets versucht, sich saft- und kraftlos am Instrument festzuhalten. Manch einer hatte es ja auch nach langer Zeit noch nicht geschafft, die Geige so zu platzieren, dass sie ohne Zuhilfenahme des linken Armes gehalten werden konnte. Nicht von ungefähr wird dieser Arm zum Greifen gebraucht – keinesfalls als eine Stütze für den Spieler!
Eine Schwierigkeit ganz besonderer Art stellt das Stimmen dar. Selbst dann, wenn im Laufe der Zeit so manches technische Detail immer besser beherrscht wird, erweist sich ein feines Gehör weiterhin als unabdingbare Voraussetzung. So wurde von Fall zu Fall offenbar, bei wem sich eine weitere Beschäftigung mit der Geige sozusagen von selbst erledigte.
Das Einstimmen ist erkennbar keineswegs nur ein Show-Teil, sondern quasi lebenswichtig für jeden Instrumentalisten.
Wer ab und zu genau hinschaute, konnte erkennen, welche Rolle speziell der linken Hand zugedacht war: Zum einen bewegte sie gefühlssicher die Wirbel – dabei wurde das Instrument konsequent zwischen Kinn und Schulter gehalten. Indem diese Hand über die Saiten glitt, kontrollierte sie abschließend noch, ob es wohl mit der Stimmung nun endlich stimmte.
Erstaunlich erschien mir die diesbezügliche zielgerichtete Befähigung junger Künstler.
Ganz anders zeigte sich die Situation zu einer Zeit, in welcher die Geige nicht ausschließlich im Konzertsaal eine respektable Rolle spielte – als „erste Geige“, wie oft gesagt wurde. Bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hinein gehörte die Fiedel zum Handwerkszeug des seminaristisch ausgebildeten Volksschullehrers.
Selbst in der Tanzmusik spielte sich nichts ohne Geige ab. Ich vermute, dass die damalige Qualität den heutigen Ansprüchen an eine „Mugge“ („musikalisches Gelegenheitsgeschäft“) nicht genügt hätte, nicht genügen konnte, vielleicht auch gar nicht genügen musste?
Viel wichtiger war die Entfaltung jener besonderen Freude, die nun mal beim Tanzen aufkam. Das Tanzen war zu allen Zeiten ein willkommener Kontrast zur Mühsal der Woche.
Es gab erstaunlich viele junge Leute, die mutig genug waren, mehr schlecht als recht zu fiedeln. Wobei sich auch der Wert der Tanzmarken als üblicher Obolus in vertretbaren Grenzen bewegte.
Welch Verwunderung meinerseits, als ich eines Tages feststellte, dass einer meiner Onkel mütterlicherseits bei mir als Geigenlehrer einsprang. Nämlich immer dann, wenn der „echte“ Geigenlehrer, (der ein studierter Orchestermusiker war), kurzfristig einen außerplanmäßigen Dienst zu versehen hatte.
Obwohl die überdurchschnittliche Grundmusikalität des besagten „Springers“ für mich außer Zweifel stand, wunderte ich mich doch, welch seltsame Blüten die Fiedelei zuweilen trieb.
Apropos Blüten: Meine Abstammung aus einer musikliebenden Familie legte zweifellos den Grundstein für die weitere intensive Beschäftigung mit Musik.
Schüler, die im Begriff waren, Geige zu lernen, waren, wie schon erwähnt, zahlenmäßig dünn gesät. So geschah es – meist bei speziellen Anlässen, die eine musikalische Umrahmung erforderlich machten – dass auch meine Mitwirkung ab und zu gefragt war. Es kam sogar vor, dass ich im Rahmen unseres regulären Musikunterrichts einen Geigenpart zu übernehmen hatte.
Ohne weitere Ausschweifungen zurück zum Ass, zum Wunderknaben, aus dem inzwischen ein „Star“ geworden war.
Ich ging davon aus, dass es sich beim Besuch einer Sektkellerei um keine sportliche Darbietung handeln würde, weshalb Fair Play keine besondere Rolle spielen müsse. Lag ich mit dieser Annahme etwa fehl?
*
„ERBÄRMLICH IST JENER SCHÜLER, DER SEINEN MEISTER ÜBERTRIFFT.“
Leonardo da Vinci
(1452 – 1519)
Maler, Bildhauer, Architekt, Mechaniker, Ingenieur Nat. phil.
Eine solch heitere Stimmung, wie sie schon im Eingangsbereich erkennbar war, hatte ich mir keineswegs vorgestellt. Was war der Grund für diese „supergute“ Laune? Es dauerte nicht lange und mir fiel ein, dass nur das süffige Produkt schuld daran sein konnte. Mittlerweile hatte wahrscheinlich schon jeder ein Gläschen davon probiert. Wollten die Macher auf diese Weise zeigen, wie „alternativlos“ die Verquickung von Kunst und Werbung sein kann?
Nunmehr stand für mich fest, dass ich mir wegen meiner „grenzwertigen“ Stimmung vom Anfang keine Sorgen mehr zu machen brauchte.
Wie jetzt? War es schon so weit? Würde sich von nun an alles um ihn drehen? Die Antwort war frenetischer Beifall.
Ich staunte die sprichwörtlichen Bauklötzer, als ich bemerkte, dass unter seiner fetzigen Jeans etwas Grasgrünes lugte, etwas, das einfach nach einer gewöhnlichen Unterhose aussah. War die vielleicht als Ausgleich dafür zu verstehen, dass jedwede Spur von Frack oder Smoking fehlte, dass seine Aufmachung stattdessen von einem offenherzigen seidenen Hemd komplettiert wurde?
Den meisten seiner Fans bereitete es keine Mühe zu zeigen, wie fasziniert sie von ihm waren. Allen Zweiflern jedoch, die sich klassische „Ohrwürmer“ niemals in poppigem Gewand hätten vorstellen können, ließ der Geiger keinen gedanklichen Raum.





























