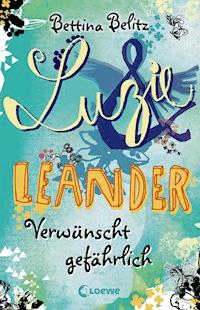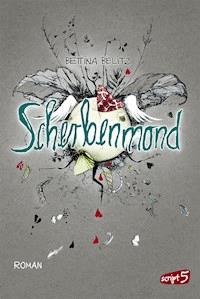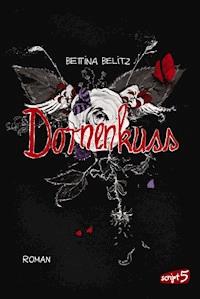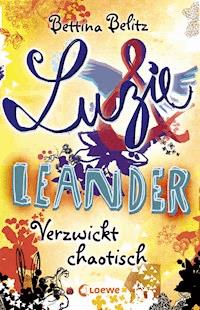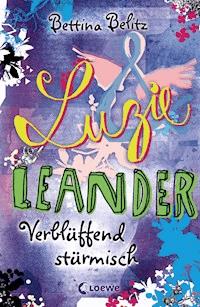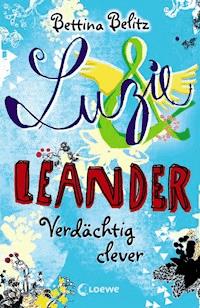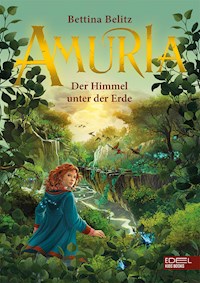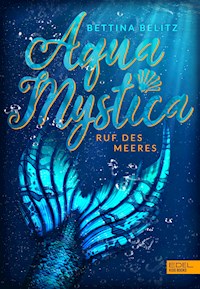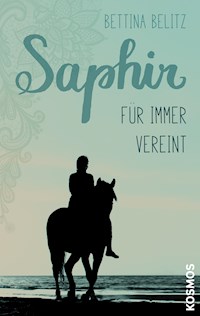Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Manchmal braucht man ein bisschen Magie, um zu sich selbst zu finden und zur ersten großen Liebe. Und niemand erzählt das auf so poetische und humorvolle Weise wie Splitterherz-Autorin Bettina Belitz. Mit Panthersommernächte legt die Bestsellerautorin einen fantastischen Jugendroman vor, der in Ton und Stimmung an ihre beliebte Luzie & Leander-Reihe anknüpft. Unter Ninas Bett liegt ein schwarzer Panther. Eine lebendige, wilde Raubkatze, die urplötzlich in der Kleinstadt aufgetaucht ist und die Bürger in Angst und Schrecken versetzt. Während draußen schon der Schützenverein zur Jagd auf "die Bestie" bläst, ist es Nina gelungen, Kontakt zu dem Tier aufzunehmen. Sie spürt den geheimnisvollen Zauber des Panthers, der sich sogar von ihr berühren lässt. Aber ein Panther ist kein Schmusekätzchen. Er braucht Freiheit und vor allem täglich jede Menge frisches Futter. Hilfe bekommt Nina von ihrem Klassenkameraden Lionel. Ausgerechnet, denn Lionels Vater ist der Anführer der Panther-Jagdgesellschaft. Mehr Infos zu den Büchern von Bettina Belitz unter: www.bettina-belitz.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
MUFFENSAUSEN UND MUFFINS
»Sind sie das?«
Cedric musste nicht antworten, ich konnte schon auf wenige Meter Entfernung riechen, dass sie es waren – fünfhundert frisch gedruckte, jungfräuliche Hallo, wach!-Ausgaben. Warum sollte Cedric auch sonst in aller Frühe einen schweren Karton durch das Schulhaus schleppen, selbst wenn ihn diese Anstrengung verstörend gut aussehen ließ? Seine Wangen waren leicht gerötet, nicht zu viel und nicht zu wenig, und in seine Augen trat jenes Glitzern, das sich auch dann zeigte, wenn er beim Basketball in letzter Sekunde einen Korb warf. Meiner Meinung nach bestand sein einziger (und zeitweise alles andere überschattender) Makel darin, dass er mit Sabrina ging, aber heute war ich gewillt, großzügig darüber hinwegzublicken. Der Geruch nach bedrucktem Hochglanzpapier half mir dabei.
»Ja, das sind sie«, keuchte Cedric überflüssigerweise und setzte den Karton direkt vor meinen Fußspitzen auf dem Boden ab. Sofort schlug mein Herz schneller, und ich konnte mich nur mühsam beherrschen, Cedric nicht dabei zu helfen, die Plastikverschnürung zu lösen, was er wie jedes Mal in fachmännischer Ruhe und mit einem eigens mitgebrachten knallgelben Cutter vollzog. Es war gut, Cedric solche Dinge tun zu lassen, denn er verfasste miserable Artikel, die man entweder komplett umschreiben oder aber in den Müll schmeißen musste. Er brauchte andere Aufgaben, in denen Muskelkraft, ein stabiles Fahrrad und Werkzeuge gefragt waren, sonst würde er unser Team wegen Frust und Überforderung verlassen. Niemand wollte das. Zumindest keines von den Mädchen, seine Beziehung mit Sabrina hin oder her. Cedric musste bleiben. Auch deshalb hatte ich ihm den ehrenvollen Auftrag erteilt, den winzigen Stick mit dem fertigen Layout zur Druckerei zu fahren (nicht ohne ihm zuzuraunen, welch kostbare Fracht ein solcher Stick ist und dass jetzt bloß nichts schiefgehen darf) und am nächsten Morgen in aller Frühe die fertigen Exemplare abzuholen, zur Schule zu bringen und erst wieder aus den Händen zu geben, wenn ich vor ihm stand.
Endlich hatte sein Cutter alle vier Plastikriemen durchtrennt. Der Geruch nach Farbe und Hochglanzpapier verstärkte sich. Erneut musste ich mir auf die Zunge beißen, um nicht »Mach schon!« zu brüllen, als Cedric die Riemen erst zusammenknüllte und in seine Tasche stopfte, bevor er in nervenaufreibender Behutsamkeit den Karton öffnete, die obersten zwanzig Exemplare herausnahm, tief atmend aufstand und mir den Stapel übergab. Rasch drehte ich sie auf den Bauch, sodass mir nur die übliche Schröter-Anzeige entgegenstrahlte – knallrote Schrift und rosa Würstchen –, die wie immer die letzte Seite verunstaltete. Immer noch besser als seine Werbung für »Schröters schlanke Schlachtplatte« im Innenteil, die Mama stets zu provokativen Würgegeräuschen animierte, da mindestens die Hälfte der Schlachtplatte aussah, als würde das Fleisch noch leben (oder gleich zu leben anfangen). Schlank waren an dieser Schlachtplatte allenfalls die drei frisierten Radieschen, die sich zwischen den Unmengen an Blutwürsten, Mett und Schwartenmagen äußerst unbehaglich fühlen mussten.
Doch ohne Schröters Anzeigen hatten wir kein Geld für den Hochglanzdruck und die farbigen Fotos. Die wiederum brauchten wir, um eine minimale Chance im Wettbewerb zu bekommen, ja, um überhaupt von der Jury gelesen zu werden. Deshalb führte kein Weg an Schröters Würstchenimperium vorbei und auch nicht an Lionels Mitarbeit, die größtenteils darin bestand, an den Cartoons herumzunörgeln und Hallo, wach! mit todlangweiligen Sudoku-Rätseln zu bestücken. Aber Lionel war Schröters einziger Sohn. Eine Zeitung herauszubringen, bedeutete nun mal, Kompromisse einzugehen. Ab und zu musste man in den sauren Apfel beißen, das hatte ich mittlerweile gelernt. Da Lionel nicht störte und es ohnehin schwer hatte, weil jeder ihn »Lyoner« oder »Würstchen auf zwei Beinen« nannte, war es nur fair, ihn im Team zu lassen, auch wenn er bis heute keinen einzigen Artikel verfasst, keine brauchbaren Ideen beigesteuert und keine einzige Recherche zu Ende geführt hatte.
Ich drückte die Zeitungen fest an meine Brust, damit ich nicht in Versuchung geriet, einen Blick auf die Titelseite zu werfen. Das hatte ich mir nach dem Schock vor einem Jahr abgewöhnt, als ich bei genau jenem ersten freudigen Blick einen dicken Fehler in der Überschrift entdeckte. Dieses Mal musste ich blind darauf vertrauen, dass die Schlussredaktion sorgfältig gearbeitet hatte, denn ich hatte wegen meines Trainings nicht dabei sein können.
»Keine Sorge, Nina«, erriet Cedric meine Gedanken. »Wir haben alles noch mal durchgelesen, mindestens doppelt. Vielleicht sogar dreifach.«
Vielleicht … Ein vielleicht war zu wenig. Sowieso waren Beteuerungen von einem ausgewiesenen Legastheniker nur bedingt tröstlich. »Ich hab die Bilder geprüft, nicht den Text«, schob Cedric rasch hinterher, als er meine betrübte Miene sah. »Sitzen perfekt. Die anderen haben sich um die Texte gekümmert. Es kam wieder in letzter Sekunde ein Gedicht rein, gestern früh, wir haben es anstelle des zweiten Cartoons von Anni reingesetzt. Es ist echt ganz gut.«
»Stand dieses Mal wenigstens ein Name darunter?« Die glatten Seiten begannen, an meinen Fingern zu kleben, so fest umklammerte ich die Zeitungen. Es wurde Zeit, dass ich nach oben zum Lehrerzimmer lief – außerdem klingelte es bereits zum zweiten Mal. Nur noch fünf Minuten bis zum Unterrichtsbeginn.
»Nein, wieder anynom. Was glaubst du, wer es ist?«
Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, gegen den Kloß in meinem Hals anzuschlucken. Ich war nervöser, als ich mich je vor einem meiner Eislauf-Wettbewerbe gefühlt hatte. Das hier war nicht nur eine Schülerzeitung, die ich in meinen Händen hielt, als sei sie mein eigenes Baby. Es war unsere letzte Chance, endlich den ersten Platz beim bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb in der Kategorie Gymnasium/Mittelstufe zu erreichen und damit eine Reise nach Berlin zu gewinnen, für ein ganzes Wochenende und mit Übernachtung in einem Hotel. Alle brannten darauf, und das auch deshalb, weil es eine der seltenen Möglichkeiten war, Cedric ohne Sabrina zu erleben, und zwar über mehrere Tage hinweg. So eine Gelegenheit war überaus kostbar.
»Ist nicht wichtig, wenn es gut ist.« Ich hatte längst einen konkreten Verdacht. Die Verse mussten von Magdalena stammen, die schon seit der Grundschule davon träumte, eine berühmte Autorin zu werden, irgendwann in einem Haus über den schottischen Klippen zu wohnen und dort mit Blick auf den schäumenden Atlantik ihre Romane in die Tasten fließen zu lassen. Ich verstand zwar nicht, warum sie bei derartigen Zukunftsplänen nicht ihren Namen unter die Gedichte schrieb und sich für unser Team bewarb, aber vermutlich lag das unter der Würde einer zukünftigen Rowling.
»Ich bringe sie nach oben, okay?« Das war mein Job. Ich war die Chefredakteurin. Also war ich auch diejenige, die die Leser der ersten Stunde versorgte – unsere eigenen Lehrer. Dieses Vorgehen war pure Taktik und einer der vielen Kompromisse. Wir bildeten uns ein, dass sie milder gestimmt waren, wenn sie die frisch gedruckte Schülerzeitung vor allen anderen lesen durften – ganz egal, was sie dabei über sich selbst erfahren würden. Bei dieser Vorstellung zuckte mein Magen unruhig, und ich konnte mich nicht überwinden, mich in Bewegung zu setzen.
»Ich schaffe die anderen schon mal in den Redaktionsraum. Hilfst du in der Pause beim Verkauf? Nina? Hey, alles okay?«
»Ich – ja, klar. Ich war nur in Gedanken.«
Verwirrt schüttelte ich den Kopf. In dem Augenblick, in dem mein Magen gezuckt hatte, hatte ich ein sonores, tiefes Knurren in mir vernommen. Kein Bauchgrummeln, auch kein Hungergrollen. Sondern etwas, das ich noch nie zuvor gehört hatte und das eher aus meiner Brust drang anstatt aus meinem Bauch. Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Laut faszinierend oder beängstigend fand. Vielleicht ja beides zugleich.
»Wir haben an alles gedacht. Es kann nichts schiefgehen«, murmelte ich mehr zu mir selbst als zu Cedric, doch er nickte eifrig.
»Ja, wir haben alles. Reportage, Feature, klassischer Bericht, Glosse, Cartoon, Lyrik, Fotostrecken und die Satire. Und die ist echt witzig. Niemand kann uns mehr vorwerfen, dass wir nicht witzig sind!«, wiederholte Cedric im Wortlaut, was ich bei der letzten Redaktionssitzung zum Besten gegeben hatte. Ob er es heimlich mitgeschrieben hatte?
Denn genau das war der Knackpunkt gewesen, der uns vergangenes Jahr scheitern ließ. Dritter Platz nicht wegen des Fehlers in der Überschrift, sondern weil wir nicht witzig genug gewesen waren. Es fehle das Element der Satire, merkte die Jury an. Sie vermisse intelligenten Humor. Das hatte meinen Ehrgeiz angestachelt. Intelligenter Humor – das musste ja wohl zu schaffen sein. Also hatte ich mich persönlich darum gekümmert. Mit Erfolg, wie ich fand. Alle hatten geschmunzelt und kichernd genickt, als ich meinen Graufink-Artikel vorgelesen hatte. Sogar Lionel hatte seinen Mund leicht verzogen; die Miesepeterandeutung eines Lächelns. Jetzt bekam die Jury, was sie wollte – und ein anonymes Gedicht gab es gratis dazu. Hallo, wach! hatte Glamour und Charme, das würde niemand bezweifeln können.
»Ich muss hoch!«, beendete ich Cedrics und meine Unterhaltung, bevor mein Lampenfieber mir noch die Kehle zuschnürte. »Wir sehen uns in der Pause. Und natürlich nach der Schule! Anni bringt Schokomuffins mit.«
»Ja, bis dann!«
Beschwingt nahm ich die Treppenstufen nach oben. »Ja, bis dann« – das bedeutete, Cedric würde dabei sein. Oh, wie ich diese Nachbesprechungen liebte, wenn wir bei Kaffee und Muffins (die ich eigentlich nicht essen sollte) im gemütlichen Redaktionsraum saßen und zusammen in der frisch gedruckten Zeitung blätterten. Wenn all der Zeitdruck und Stress vorüber waren und wir hoffentlich nicht ganz so viele Fehler entdeckten wie in den Ausgaben zuvor und uns gegenseitig zu unseren Artikeln beglückwünschten. Diese Momente waren jede Nervosität und jede Anstrengung wert.
Mit den Ellenbogen klopfte ich an die Lehrerzimmertür, wartete das streng-nasale »Herein« von Frau Schramm ab, die seit einigen Jahren die Wächterfunktion für diese heilige Halle übernommen hatte, und schob mich samt meiner kostbaren Fracht an der Brust in den Raum.
»Ach, die Nina«, begrüßte mich Herr Rudolf aufgeräumt und griff nach den Zeitungen. Für eine Sekunde überkam mich der Impuls, sie festzuhalten, doch dann ließ ich los. Ich sollte mich dringend entspannen. »Wir freuen uns schon! Ihr schafft es dieses Mal bestimmt. Wir drücken euch die Daumen, wir sind schließlich alle stolz auf euch!«
Frau Schramm warf mir einen säuerlichen Blick zu, der mit Inbrunst das Gegenteil ausdrückte. Sie hatte es uns immer noch nicht verziehen, dass wir in der Frühjahrsausgabe Noten an die Lehrer verteilt hatten und sie nur eine Drei minus bekommen hatte. Seitdem war es tabu, die Lehrer zu zensieren. Denn sie saßen nun mal am längeren Hebel, wenn es um Noten und Prüfungen ging, was Frau Schramm uns in den folgenden Wochen eindrücklich bewiesen hatte. Kein Montag ohne unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen, kein Freitag ohne mündliche Abfragen in der letzten Stunde.
Gelernt hatten wir daraus die goldene Regel Nummer 1: Nicht künstlich Prüfungen und Tests provozieren. Eine Satire jedoch, hatte ich gelesen, sei eine Kunstform, in der alles erlaubt sei, solange es intelligent und humoristisch geschrieben sei. In einer Satire dürfe man sogar Staatsmänner und den Papst persönlich auf die Schippe nehmen. Da Herr Graufink zu beidem nicht taugte, sondern ein zu Trübsinn und strähnigem Haar neigender Religionslehrer war, der mit Katzen sprach und in seiner Freizeit Bäume umarmte oder nackt im Waldtümpel baden ging, waren wir auf der sicheren Seite. Außerdem tendierte Herr Graufink dazu, die Tests, die wir bei ihm schrieben, auf Nimmerwiedersehen zu verschlampen und mündliche Abfragen in einen Monolog zu verwandeln, aus dem er bis zum Klingeln nicht wieder herausfand. Es war generell schwierig, eine Note von ihm zu bekommen, auch wenn man sich noch so sehr anstrengte. Woher er sie am Schuljahresende nahm, wusste keiner, doch wir alle bekamen Zweien und Einser, ob wir sie verdient hatten oder nicht. Irgendeine Note musste er geben.
»Jetzt aber Marsch nach unten mit dir. Wir sind gespannt!«
Nicht nur ihr, dachte ich mit flauem Gefühl im Bauch, als ich Herrn Rudolfs Aufforderung folgte und zum Klassenraum trabte. Meine Nervosität hatte sich nicht im Geringsten gelegt, sondern steuerte neue Ausmaße an. Mir war, als hätte ich etwas Wichtiges vergessen oder übersehen, aber wann immer ich das Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe im Kopf durchging, fiel mir nichts Fehlerhaftes auf.
Es war alles in bester Ordnung.
SIGNALTÖNE
Es war nichts in Ordnung. Ich spürte es, bevor ich wusste, warum. Als es dann so weit war, verstand ich auf einmal, was es bedeutete, wenn Menschen sich wünschten, in einem Erdloch zu verschwinden und fortan nie wieder gesehen zu werden. Es fühlte sich scheußlich an.
Dass etwas nicht seinen gewohnten Lauf nahm, wurde mir schon klar, als von Ferne das Martinshorn ertönte und sich so zielstrebig und klar der Schule näherte, dass niemand mehr auf die Worte von Herrn Schrumpf hörte. Es war leicht, nicht auf ihn zu hören, denn er wiederholte die frühneuzeitliche Ständeordnung wie ein einschläferndes Mantra, dessen Sinn und Zweck sich einem niemals auch nur annähernd erschließen würde. Doch immerhin sorgte sein monotones Gebrabbel dafür, dass wir still wurden und unbeteiligt vor uns hin dösten, bis der nächste Geschichte-Test zeigte, dass niemand wach genug gewesen war, um zu verstehen, worum es Herrn Schrumpf eigentlich ging.
Jetzt aber machte sich Unruhe breit. Ein Martinshorn auf dem Weg zu unserem Gymnasium – zu welchem Einsatz gehörte es, Feuerwehr, Polizei oder Krankenwagen? Und wenn der Alarm uns galt, warum? Brannte die Schule? Hatte jemand um sich geschossen (unwahrscheinlich, denn es war so ruhig gewesen, dass man durch das Schrumpf-Mantra hindurch die Wasserleitung des angrenzenden Waschraums hatte gurgeln hören können)? Mit Drogen gedealt? Oder gab es etwa eine Entführung? War jetzt genau das geschehen, worauf wir seit Jahren warteten – dass sich in unserer kleinen Stadt endlich etwas ereignete, das uns zu einer anständigen Schlagzeile verhalf?
Gleichzeitig fühlte ich mich seltsam beklommen – fast als hätte ich selbst etwas mit diesem Blaulicht zu tun und es persönlich angelockt. Piet verrenkte sich bereits den Hals, um von seinem Pult aus durch die verschmierten Fensterscheiben auf die Straße schauen zu können, und sogar Lionel hörte auf, in sein Heft zu kritzeln, als Herr Schrumpf seinen Monolog unterbrach und ans Fenster trat. Im selben Augenblick klingelte sein Handy.
Wir wussten bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Herr Schrumpf ein Handy besaß, geschweige denn dass er damit umgehen konnte. Herr Schrumpf brauchte eine halbe Stunde, um einen uralten Overhead-Projektor anzuschließen, und weitere zehn Minuten, um die Lampe so einzustellen, dass man etwas erkennen konnte. Fünf Minuten später klingelte es zur nächsten Stunde. Vielleicht war das der Grund, weshalb wir seit einem halben Jahr im Mittelalter feststeckten, obwohl die Parallelklasse schon bei der Französischen Revolution angelangt war. Außerdem gelang es Herrn Schrumpf auch nach dreißig Jahren Schullaufbahn nicht, den Kaffeeautomaten so zu bedienen, dass sich kein Milchsee zwischen seinen abgewetzten Wildlederboots bildete, und seine Versuche, uns DVDs zu zeigen, scheiterten bereits beim Heraussuchen des richtigen Kanals. Auch nach mehrmaligen Erklärungen kapierte er nicht, dass man DVDs nicht über den TV-Kanal schauen konnte. Denn seiner Meinung nach handelte es sich ja um ein und denselben Bildschirm. In diesem Punkt war er stur wie ein Ochse.
Jedenfalls lenkte uns sein Handyklingeln jäh von dem sich nähernden Martinshorn ab, und wir schauten Herrn Schrumpf gebannt dabei zu, wie er ein glitzerndes iPhone aus der Jacketttasche zog und auf das Display starrte. Die Szene hatte eine ähnliche Faszination, wie wenn ein Schimpanse plötzlich damit anfängt, aus einer Tasse zu trinken.
»Ich glaub’s nicht …«, flüsterte jemand hinter mir, und wie die anderen konnte auch ich meine Augen nicht von dem Schauspiel lösen, das sich uns bot – Herr Schrumpf wischte routiniert über das Display und hob das iPhone ans Ohr, als habe er einen Zeitsprung vollbracht und sei nahtlos von der Technik der 70er-Jahre in die des neuen Jahrtausends geswitcht.
Doch das Martinshorn schallte bereits so laut durch die Straße, dass wir nicht hören konnten, mit wem Herr Schrumpf telefonierte und warum. Aber es musste eine ernste Angelegenheit sein, denn das Grau seines Teints verwandelte sich binnen Sekunden in ein Aschfahl, und zu meinem Schrecken winkte er mich zu sich, als habe ich etwas mit seinem Anruf zu tun. Zögernd folgte ich seiner Aufforderung und trat an sein Pult.
»Herr Graufink ist umgekippt, irgendwas mit dem Herzen …«, versuchte Herr Schrumpf das Schrillen des Martinshorns zu übertönen. »Der arme Kerl. Es war doch alles auf einem guten Weg gewesen … Ich muss sofort nach oben ins Lehrerzimmer.«
»Was habe ich denn damit zu tun?« Meine Stimme hörte sich so an, wie ich mich fühlte. Schwach und erschrocken. Was war mit Herrn Graufink?
Doch Herr Schrumpf zuckte nur mit den Schultern, als wisse er es ebenfalls nicht, und reichte mir nur stumm das Handy weiter. Widerstrebend führte ich es an mein Ohr.
»Ja, hallo?«
»Nina!?« Noch nie hatte jemand meinen Namen so erbost ausgesprochen. Selbst Ludmilla klang freundlicher, wenn sie auf dem Eis einen ihrer Schreianfälle bekam, weil sie glaubte, das würde mich zu besseren Leistungen anstacheln. Wer da sprach, hatte ich ebenfalls sofort erkannt. Wir nannten ihn nur MrRight, wegen seines ausgeprägten Gerechtigkeitssinns. Böse Zungen behaupteten, er wiege die Hälften auf der Küchenwaage ab, wenn er mit seiner Frau ein Croissant teile. Auffällig war auch, dass das Kollegium aus exakt so vielen Frauen wie Männern bestand. Am Telefon war der Direktor persönlich, Herr Richt.
»Ja, ich bin es.«
»Sobald Herr Graufink abgeholt wurde, kommst du postwendend in mein Büro, verstanden? Wir müssen miteinander sprechen.«
»Verstanden.« Meine Hände wurden eiskalt, als Herr Schrumpf mir das Handy aus den Fingern zog und es aufs Pult legte. Inzwischen hatten die anderen ihre Plätze verlassen und schauten aus dem Fenster, denn der Krankenwagen hatte vor der Schule gehalten.
Das Martinshorn. Herr Graufinks Zusammenbruch. Unsere Zeitung. MrRights strenger Ton. Kombinieren konnte ich, und mir schwante Fürchterliches.
»Ruhe! Ruhe, hab ich gesagt!«, brüllte Herr Schrumpf in das Schnattern der Menge und den Lärm von draußen hinein, doch nur die Hälfte der Klasse hörte auf ihn. Die andere Hälfte klebte an den Fenstern fest. »Lest den Text auf Seite 167 und macht euch Notizen dazu, bis ich wieder da bin! Verstanden?«
Nein, niemand hatte verstanden, und in seiner Not wandte sich Herr Schrumpf wieder mir zu. »Versuche für Ruhe zu sorgen, während ich oben bin. Du kannst das, ich weiß es. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Ich verlasse mich auf dich!«
»Das sollten Sie besser nicht«, wisperte ich, doch Herr Schrumpf war bereits auf den Flur gestürmt, so schnell wie ich es ihm niemals zugetraut hätte. Ich jedoch hatte nur eines im Sinn – ich musste die Meute von den Fenstern wegholen. Wenn sie sahen, wer rausgetragen wurde, hatten sie schon den ersten Verdacht – zumindest die, die zum Schülerzeitungsteam gehörten. Noch konnte diese Vielleicht-Katastrophe begrenzt werden.
»Hey, weg von den Fenstern, ihr Gaffer!«, verschaffte ich mir Gehör. »Macht man so was? Gaffen? Nein, oder?«
Unwillig drehten die Mädchen sich zu mir herum, während die Jungs weiter ihre Nase am Fenster platt drückten.
»Och komm, Nina, sei kein Spaßverderber. Willst du nicht wissen, was passiert ist?«, fragte Lena und wandte sich sofort wieder nach draußen um.
»Nein, will ich nicht«, log ich wenig überzeugend. »Schluss jetzt damit. Zurück auf eure Plätze.«
Lionels schmale Augen bohrten sich missgünstig in meine, als er sich als Erster zu seinem Pult bewegte, doch ich lächelte ihm nur dankend zu. Bloß nichts anmerken lassen. Bisher hatte ich lediglich einen Verdacht, einen schrecklichen Verdacht zwar, das ganz gewiss – doch die Wahrheitsprüfung stand noch aus. Bis dahin musste ich so tun, als sei alles in Ordnung. Vielleicht war es das ja. MrRight konnte sich so erbost angehört haben, da er aufgeregt war, und er konnte mich auch sprechen wollen, weil er mich loben wollte – oder aber wegen etwas ganz anderem. Es musste nicht zwingend mit der Zeitung und Herrn Graufink zu tun haben. Ich war schließlich auch noch Klassensprecherin und Vertrauensschülerin. MrRight wollte fast jeden Monat mit mir sprechen, es war bestimmt nichts Schlimmes.
»Bis Herr Schrumpf zurück ist, lesen wir den Text auf Seite … 176. Ja, 176, und wir machen uns Notizen dazu. Jeder für sich. In Stille. – Ja, ist halt so, ich kann es auch nicht ändern«, fügte ich etwas zu forsch hinzu, als sich allgemeines Murren breitmachte. »Von mir aus könnt ihr auch etwas anderes lesen. Aber bitte verhaltet euch ruhig, okay? Danke.«
Das Murren wurde leiser. Endlich löste sich auch Jasper vom Fenster und trollte sich auf seinen Stuhl, um wie die anderen sein Handy aus der Tasche zu holen, online zu gehen und Nachrichten zu checken oder zu daddeln. Das Martinshorn war längst verstummt, und die Stille wurde nur von den verschiedenen Signaltönen der Handys durchbrochen. Piepsen, Melodiefetzen, hämisches Gelächter, Wellenrauschen, Möwenkreischen, Wolfsheulen. Einzig Lionel beugte sich wieder über sein Heft und kritzelte mit vorgeschobenem Arm vor sich hin, damit auch ja niemand von ihm abschreiben konnte (was ohnehin nicht funktionieren würde, denn Lionel saß seit Jahren alleine an seinem Zweierpult).
Ich selbst versuchte, nach draußen zu lauschen, um herauszufinden, was dort geschah, doch meine Gedanken polterten zu laut durch meinen Kopf, um etwas Konkretes wahrzunehmen. Was sollte das auch sein? Jemand, der zusammenbrach, machte keine Geräusche mehr. Er war still und blass und leblos.
Herr Graufink kam mir bereits blass und leblos vor, wenn er gesund war. Wie blass und leblos musste er sein, wenn er kollabiert war? Und wie leblos war er jetzt, in diesen Minuten, tatsächlich? Wie gefährlich war sein Zustand? Wie weit war er vom Leben entfernt, wie nah befand er sich dem Tod?
Es schien Stunden zu dauern, gespenstisch lange Stunden, in denen die Handys der anderen sich munter miteinander unterhielten und niemand ein Wort sprach, bis die Tür sich wieder öffnete und ein gealterter, erschöpft wirkender Herr Schrumpf mich finster ins Visier nahm.
»Nina, du sollst …«
»Ich weiß schon«, unterbrach ich ihn. »Recherche«, erklärte ich bedeutungsvoll in Richtung meiner Mitschüler. »Könnte sein, dass wir darüber berichten müssen, was … was da gerade passiert ist.«
Cedric nickte anerkennend, doch ich wich seinem Blick aus und ebenso den stechenden Augen von Herrn Schrumpf, der zu fassungslos war, um mir zu widersprechen. Wenn nur ein Hauch von dem stimmte, was ich ahnte, würde der Rest des Tages alles andere als gemütlich und gesellig werden. Ob mit oder ohne Muffins.
Meine Stunden waren gezählt.
AUF SIE MIT GEBRÜLL
»Hallo, wach!? Ja, sicher, Nina‚ Hallo, wach!? Wollt ihr eure Zeitung nicht lieber in Hallo, tot! umbenennen? Das wäre passender!«
»Aber Herr Graufink ist doch nicht …«
»Nein. Gott bewahre, nein.« Stöhnend ließ MrRight sich in seinen schwarzledernen Chefsessel plumpsen, was die Polsterung mit einem pupsartigen Geräusch quittierte, dem aber weder er noch ich Bedeutung schenkten. Hätte ich mir nicht schon Sorgen um Herrn Graufink und mich gemacht, würden sie MrRight gelten. In einer solchen Verfassung hatte ich ihn noch nicht erlebt. Sein sonst so exakt gezogener Seitenscheitel hatte sich in eine Art Vogelnest verwandelt, in dem ein cholerischer Bergadler gehaust haben musste. In Kombination mit den roten Flecken auf seinem Hals und den Spuckebläschen in seinem linken Mundwinkel ergab das ein Bild, das mich überlegen ließ, ob es sinnvoll wäre, vorsichtshalber einen zweiten Krankenwagen zu bestellen.
Mit beiden Händen fuhr er sich über seinen Hinterkopf und dann über sein Gesicht, bis er versteckt hinter seinen akkurat manikürten Fingern sitzen blieb und einige Minuten lang nichts anderes tat, als vernehmlich zu atmen. Da es für mich das allererste Mal war, einen Lehrer außer Fassung gebracht zu haben, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Mich verteidigen? Ihm einen Tee kochen? Still und heimlich den Raum verlassen? Seine Sekretärin um Rat fragen, die mich vorhin noch mütterlich angelächelt und mir zugeraunt hatte: »So schlimm wird es schon nicht werden.«?
Doch es war schlimm. Ich wusste nicht, wohin mit mir vor lauter Unbehagen. Andere Schüler waren es gewohnt, Bockmist zu bauen; es passierte ihnen ständig, selbst wenn sie versuchten, sich gut zu benehmen. Ihnen mussten Standpauken und Zurechtweisungen nichts mehr ausmachen; es war reine Gewöhnungssache. Ich hingegen fühlte mich wie auf einem Scheiterhaufen – ich wartete lediglich darauf, dass der Scharfrichter die lodernde Fackel in das Holz stieß, sodass die Hexe endlich brennen konnte. Dieser Dienstag war der schwärzeste Tag meines Lebens, obwohl ich noch gar nicht wusste, was mir als Strafe blühen würde. Alleine die Tatsache, sich so grauenvoll fehlerhaft und schuldig zu fühlen, war Strafe genug. Dennoch sagte ich mir, dass ich ein Recht hatte, meinen Artikel zu verteidigen. MrRight musste das verstehen – wenn einer, dann er.
»Es war eine Satire, Herr Richt, und eine Satire …«
»Ach!«, knurrte es hinter seinen Händen hervor, und er löste eine davon, um über die Sprechanlage Verbindung mit seiner Sekretärin aufzunehmen, tobte aber weiter. »Tucholsky, was? Die Satire darf alles, ja, ja. Nein, das darf sie nicht, Nina! Nicht bei einer Schülerzeitung! – Frau Schmitz? Sagen Sie Herrn Patter, er soll alle Zeitungen aus dem Pausenraum holen und in mein Büro bringen. Sofort! Es darf keine einzige davon in Umlauf kommen, keine einzige, hören Sie?«
»Wir haben es nicht böse gemeint«, startete ich einen weiteren Verteidigungsversuch. »Wir wollten die Leser zum Lachen bringen. Die Jury hatte bemängelt, dass …«
Ich wagte nicht weiterzusprechen, denn MrRight hatte seine Hallo, wach!-Ausgabe mit einer hektischen Bewegung aufgeschlagen und mir vor die Nase geschubst, wobei sie beinahe auf meinen Knien landete. Vorsichtig schob ich sie mit den Fingerspitzen zurück auf seinen Schreibtisch. Ich wollte sie weder auf meinen Knien liegen haben noch länger als notwendig berühren. Sie schien mir plötzlich hochgiftig zu sein.
»Schau ruhig hin, Nina. Ist das lustig? Nur lustig? Ja?«
Mit einem Auge schielte ich auf meinen zweiseitigen Artikel. »Wenn Graufink mit Graureiher flirtet«, nun, das war sprachlich sicherlich keine satirische Sternstunde, aber an dieser Überschrift konnte ich nichts Schlechtes oder Gemeines entdecken. Auch der Text war nicht gemein. Ich hatte ein paar humorige Theorien über das Verschwinden der Froschpopulation im Waldweiher aufgestellt und den Verdacht geäußert, dass dies mit Graufinks abendlichen Nacktbade-Aktionen zu tun haben könnte, ebenso wie die Tatsache, dass der Teich im vergangenen Sommer umgekippt war, nachdem es drei Wochen lang nicht geregnet und Graufinks übliche Blässe sich in ein leuchtendes Indianerbraun verwandelt hatte. Unter diesem Absatz hatten wir das Foto eingefügt, das vorigen Sommer entstanden war; Cedric hatte es geschossen. Es zeigte Graufink, der offenbar versuchte, wie Jesus auf dem Wasser zu gehen – was ihm natürlich nicht gelang, weshalb er einen wilden Sprung machte und …
»Oh nein. – Wo ist der Balken? Wir hatten einen schwarzen Balken auf das Bild montiert, ich schwöre es ihnen! Da war ein Balken!«
»Ich sehe keinen.« Jetzt verstand ich, warum MrRight die Hände vor sein Gesicht legte. Ich wollte es auch tun. An dieser Stelle des Weihers war bis zu diesem Frühling Nacktbaden erlaubt gewesen, in einer kleinen geschützten Zone – bis Schröter sich darüber beschwerte, dass er bei seinen Jagdausflügen in der Abenddämmerung unsittliches Treiben am Weiher beobachte und die Kinder von Bornhausen gefährdet sah. Moralisch sei diese Nacktbadezone nicht vertretbar, nicht in einer sauberen, idyllischen, touristisch aufstrebenden Kleinstadt wie Bornhausen. Sie locke Drogenkonsumenten, Hippies und Prostituierte an. Als Schröter mit diesen Worten in der Bornhausener Rundschau zitiert worden war, meinte Mama spöttisch, dass jeder vernünftige Hippie einen weiten Bogen um Bornhausen machen würde, woraufhin Papa bemerkte, vernünftig und Hippie sei ein Widerspruch in sich, zumal Hippies bereits seit dem vergangenen Jahrhundert ausgestorben seien. Das wiederum brachte mich zu der These, dass die Hippies womöglich nicht ausgestorben wären, wenn sie sich etwas vernünftiger benommen hätten.
Jedenfalls hatte ich auch Schröters altbackene Verdächtigungen in meinen Artikel eingeflochten, ebenfalls humoristisch, und anschließend überlegt, ob die Jäger nicht eher Bedenken hatten, Graufink könne beim Bad im Weiher beobachten, wie sie sich auf ihren Hochsitzen mit verbotenem »Zielwasser« zuprosteten, und seinen Verdacht bestätigt sehen, dass Jäger verantwortungslos durch die Gegend schossen und seine geliebte Fauna und Flora zerstörten, in der er sich so gerne im Adamskostüm aufhielt und Avatar nachspielte, indem er mit Pflanzen sprach, Vögel nachahmte und Bäume umarmte.
Diese Passage war jene Stelle gewesen, bei der ich das Gefühl hatte, etwas vollkommen Wahres zu schreiben, ja, sogar etwas Ernsthaftes und Wichtiges, doch meinen Mitschülern war sie nicht großartig aufgefallen. Nur Lionel hatte kurz seine Hand gehoben, sie dann aber schlaff fallen lassen, als ich ihm auffordernd zunickte, und sich wieder in sein Sudoku vertieft.
Stattdessen hatten sich alle neugierig über das unscharfe, verwackelte Foto gebeugt, und ich musste mir den schwarzen Balken über Graufinks Hinterteil mit vielen klugen Argumenten erkämpfen, da es die anderen am liebsten ohne Balken abgedruckt hätten. Man sah nicht mehr als Graufinks blassen Po, und auch den musste man sich mit viel Vorstellungkraft zurechtfantasieren. Dennoch zeigten wir unseren unbekleideten Religionslehrer, von hinten zwar und aus ungefähr fünfzig Meter Entfernung, lediglich ein blasser Streifen Mensch in dichtgrüner Natur, aber eindeutig nackt, und jetzt, wo ich das Bild ohne Balken betrachtete, wusste ich, dass auch der Balken nicht mehr viel gerettet hätte. Wir hatten eine Grenze überschritten.
»Punkt A. Man schießt nicht heimlich Fotos von Nacktbadenden.«
»Ich habe das Foto nicht gemacht, ich …«
»Du bist die Chefredakteurin. Oder?«
»Ja«, erwiderte ich kleinlaut und sackte noch etwas tiefer in meinen Stuhl. »Stimmt.«
»Damit hast du die Verantwortung für den Inhalt der Zeitung, und bisher hast du uns nie enttäuscht. Punkt B. Fotos von Privatpersonen nur mit Genehmigung. Recht am eigenen Bild. Auch bei einer Satire!«, rief MrRight streng, als ich mich genau damit freisprechen wollte. »C. Warum ausgerechnet Herr Graufink? Warum?«
»Na ja, er … er ist ziemlich schräg und macht seltsame Sachen, das müssen Sie zugeben. Wir haben ihn beobachtet, er umarmt wirklich Bäume und redet ständig über seine Katzen, anstatt zu unterrichten, oder singt beim Schwimmen laut vor sich hin. Ich könnte Ihnen noch mehr solcher Sachen aufzählen, es gibt genug, und außerdem – es ist eine Satire! Es ist nicht böse gemeint!«
»Das weiß ich doch, Nina.« MrRight stieß einen abgrundtiefen Seufzer aus und ließ die Schultern ein Stückchen nach unten sacken. »Aber Herr Graufink ist nicht nur ein Gymnasiallehrer – was übrigens Grund genug wäre, kein solches Foto von ihm abzudrucken –, sondern auch Pfarrer. Er soll demnächst in Bornhausen seine erste Predigt halten, womöglich winkt ihm hier eine Festanstellung, und …«
»… und jetzt wissen alle, wie der nackte Hintern unseres neuen Pastors aussieht«, führte ich seinen Satz mit belegter Stimme zu Ende. Von sehr weit weg betrachtet, war das die eigentliche Satire – und ziemlich witzig. Aber eben nur von sehr, sehr weit weg betrachtet. Mindestens fünfhundert Lichtjahre.
»Die Zeitung darf nicht verkauft werden. Das ist euch hoffentlich klar?«
»Sonnenklar«, erwiderte ich apathisch. Um Himmels willen, was hatten wir uns nur dabei gedacht? Wieso überhaupt hatte ich mich dazu überreden lassen, dieses Foto abzudrucken, und unseren Plan irgendwann genauso witzig gefunden wie die anderen? Das war doch eigentlich gar nicht meine Art. »Und Herr Graufink hat sich so darüber erschrocken, dass … dass er ohnmächtig wurde?«, fragte ich verschüchtert nach, während meine Wangen heiß anliefen.
»Ihm genügte die Überschrift. Er schlug die Zeitung auf, erwischte den Artikel über sich selbst, las die Überschrift und das von dir zitierte Zitat von Schröter, griff sich ans Herz und klappte zusammen. Er ist eine sensible Seele, Nina. Und eines ist sicher: Wenn jemand von der Kirche diese Zeitung liest und nur einen Bruchteil von dem glaubt, was ihr … was du …« MrRight räusperte sich erneut. Es klang, als stünde er kurz vorm Ersticken. »Recherchiert hast. Nennen wir es recherchiert.«
»Ich musste das gar nicht recherchieren! Er redet selbst davon. Im Unterricht. Dass es guttut, wenn man ab und zu einen Baum umarmt, und wir das ausprobieren sollen, wenn wir Kopfschmerzen haben oder uns einsam fühlen.«
MrRights schmaler Mund zuckte, doch er hatte sich sofort wieder unter Kontrolle, während seine Haare nach wie vor Adlernest spielten. Er war ein Gerechtigkeitsfreak. Selbst wenn wir hier bis morgen früh sitzen und reden würden: Er würde niemals zugeben, dass Herr Graufink nicht alle Tassen im Schrank hatte.
»Er sagt, wir würden Gottes Atem in den Bäumen fühlen, wenn wir das tun. Das ist … finden Sie nicht, dass das … na ja …« Auf einmal wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Wenn ich mit Herrn Richt über diese Dinge sprach, fühlten sie sich nicht mehr ganz so abgedreht an. Herrn Graufinks Worte auf diese Weise und vor den Augen eines Erwachsenen zu wiederholen, ließ mich still und verlegen werden.
»Nina, ich umarme auch keine Bäume, aber wenn Herr Graufink das in seiner Freizeit tun möchte, ist daran nichts Verbotenes. Doch es gehört nicht in eine Schülerzeitung. Nicht wenn er gerade die Chance seines Lebens bekommen hat, von der er seit Jahren träumt. Warum habt ihr das eigentlich nicht recherchiert? Ihr glaubt, alles zu wissen, aber diese Information entgeht euch, ja?« Nächster abgrundtiefer Seufzer. »Nina, Nina, Nina …« Jedes Nina hatte eine andere Betonung, und keine davon gefiel mir. Dennoch schien MrRight sich langsam zu beruhigen. »Nina.« Mit einem schiefen Lächeln blickte er mich an. »Manchmal schießt man übers Ziel hinaus, wenn man etwas erreichen will. Deinen Ehrgeiz weiß ich zu schätzen, aber du bist zu weit gegangen. Meilenweit. Also, die Zeitung wird weder verkauft noch bei der Jury eingereicht. Wie wäre es, wenn du für die nächste Ausgabe eine Pause einlegst und dich ganz auf deine Eislaufkarriere konzentrierst? Ja? Wir setzen große Hoffnungen in dich!«
»Ich – ich soll meinen Posten abgeben?«
»Nun ja …« MrRight strich mit gespreizten Fingern über seine Krawatte und schloss dann den Knopf seines Jacketts. »Ich könnte dich auch von ihm entheben. Es würde dir Raum und Ruhe geben, die Dinge sacken zu lassen.«
»Nein, bitte nicht. Ich mach das wieder gut, versprochen. Ich kann Ihnen die nächste Ausgabe vor dem Druck zeigen, Sie können alles vorher prüfen, so was wird nicht mehr passieren!« Beinahe wäre ich aufgesprungen. Keine Schülerzeitungssitzungen mehr mit Cedric und den anderen, wenn sonst niemand mehr im Schulhaus unterwegs war und wir bis in den Abend hinein zusammensaßen? Keine Redaktionswochenenden bei Anni mit selbst gemachter Pizza und Journalisten-Filmen? Wir wollten doch gemeinsam Erin Brockovich schauen, übernächste Woche! Keine Vorfreude auf die nächste Ausgabe, kein angeregtes Pläneschmieden und Diskutieren und Kaffeetrinken? Keine Gelegenheit mehr, Cedric ohne Sabrina zu erleben? Nein, das durfte nicht passieren.
Sonst gab es nur noch Schule und Eislauf, und das war zu wenig für eine Vierzehnjährige, die seit ihrer Geburt in Bornhausen gefangen war. In der Eishalle lernte ich weder Jungs kennen, noch konnte man dort Muffins essen und zusammen über die Lehrer lästern. Ich liebte die Eishalle, und noch mehr liebte ich es, mich zu Musik über das Eis zu bewegen, selbst wenn Ludmilla dabei einen Schreianfall bekam und meine Muskeln brannten vor Anstrengung, aber die Schülerzeitung war meine Insel, meine Auszeit, mein … ja, meine einzige Chance, nach der Schule meine Freunde zu treffen und mit ihnen zusammen nach Berlin zu reisen. Eine Chance, die ich vollkommen vermasselt hatte.
»Nun schau nicht so betrübt, Nina. Wir konnten den Schaden ja noch abwenden, und Herr Graufink scheint einen Schwächeanfall erlitten zu haben, keinen Herzinfarkt. Wir sind froh, dass wir dich an dieser Schule haben, glaub mir. Du bist eine verlässliche Vertrauensschülerin und Klassensprecherin, alle mögen und schätzen dich.« Dessen war ich mir nicht mehr so sicher, doch ich ließ MrRight weiterreden. Offenbar tat es ihm leid, mich zu Beginn des Gesprächs in einem solch rauen Ton angepflaumt zu haben. »Vertrauensschülerin und Klassensprecherin, das ist schon viel Verantwortung. Dazu die Chance, an den deutschen Meisterschaften teilnehmen zu können. Bornhausen steht hinter dir! Ich denke nur, dass es gut wäre, sich ein wenig Zeit zu gönnen, um darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist. Und du solltest Herrn Graufink eine Karte ins Krankenhaus schicken und ihm gute Besserung wünschen, ja?«
»Klar, natürlich mache ich das. Was – was passiert jetzt mit den Zeitungen?«
»Die sperre ich in den Giftschrank. Auf den Müll schmeißen wäre zu riskant in diesem K… in dieser kleinen Gemeinde«, verbesserte sich MrRight rasch und schickte ein Räuspern hinterher. »Es wäre gut, wenn die anderen aus eurem Team Stillschweigen bewahren. Der Verdienstausfall – tja, jetzt wisst ihr eben, wie es ist, eine leere Kasse zu haben. So lernt man aus Fehlern.«
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Kein Verkauf bedeutete keinen Erlös. Wir waren pleite. Wir konnten nicht einmal mehr Kaffee kaufen. Eigentlich mochte ich keinen Kaffee, ich ertrug ihn nur mit viel Zucker und Milch, aber er hatte dazu gehört wie die miefige Luft, die Ausdünstungen der Drucker und das Flüstern der Heizungen. So war das eben in Redaktionsräumen. Niemand hatte behauptet, dass Journalisten ein gesundes Leben führten. Das tat ich schon den Rest meines Tages, dem Eislauf zuliebe, und meistens machte es keinen Spaß.
»Also hat niemand eine Zeitung gesehen außer den Lehrern und uns Schülern?«
»Das hoffe ich«, antwortete MrRight, schlug die Ausgabe wieder zu und erlöste mich endlich von dem Anblick eines nackten Männerhinterns.
Nur die Lehrer und die Schüler des Hallo, wach!-Teams wussten, was in der Zeitung stand. Zwanzig Schüler und ein komplettes Kollegium, das sich zudem erschreckend gut verstand. Der Hausmeister wusste ebenfalls Bescheid, dazu die Leute vom Rettungswagen (noch verdrängte ich, dass möglicherweise mein Vater höchstpersönlich Herrn Graufink abgeholt hatte), die behandelnden Ärzte, die Familie von Herrn Graufink.
Ich hatte meinen Scheiterhaufen noch lange nicht verlassen.
Noch konnte alles gut gehen. Aber es konnte auch eine Katastrophe werden.
SCHERBEN BRINGEN GLÜCK
»Wir sind hier heute leider nicht zusammengekommen, um unsere neue Zeitung zu feiern und sie bei dem Wettbewerb einzureichen«, begann ich mit lauter Stimme zu sprechen, doch die Unruhe im Raum wollte sich nicht legen. Aus unserer Feierstunde war eine Krisensitzung geworden, wie ich sie sonst nur von den Filmen kannte, die wir zusammen schauten, um uns inspirieren zu lassen. Die Stimmung war frostig, und wenn mich nicht alles täuschte, galt der Eisnebel in der Luft mir. Waren denn schon Informationen durchgedrungen über den Zusammenhang zwischen meinem Graufink-Artikel und dem Krankenwagen? Oder würde ich ungeschoren davonkommen?
Noch hatte ich mit niemandem offen reden können. In den Hofpausen hatte ich mich in der Bibliothek versteckt und dort per WhatsApp eine Nachricht in unsere Gruppe gestellt, dass wir uns wie gewohnt um 14Uhr im Redaktionsraum treffen würden. Doch natürlich mussten die anderen gemerkt haben, dass keine Zeitungen mehr da waren, die verkauft werden konnten, und alleine das warf unzählige Fragen auf.
»Wie ihr mitbekommen habt, fand heute kein Verkauf statt.«
Schweigen. Keine Fragen, nur Schweigen? Ich blickte auf, doch niemand sah mich an. Jeder schaute irgendwo anders hin. Sonst hingen sie an meinen Lippen, wenn ich sprach. »Uns ist ein … ein Fehler unterlaufen. Ein Druckfehler.« Zwei Seiten voller Druckfehler, um korrekt zu sein. Plus Fotofehler. »Herr Richt hat ihn zum Glück rechtzeitig entdeckt und entschieden, dass Hallo, wach! nicht verkauft wird, um Schaden von uns und der Schule abzuwenden. Wir können die Zeitung daher nicht beim Wettbewerb einreichen. Lasst uns einfach so tun, als habe es sie nie gegeben.«
»Nina …« Annis »Nina« klang so falsch und gönnerhaft, dass ich zusammenzuckte. »Wir wissen es. Das mit Graufink. Und dass er im Krankenhaus liegt.«
»Wer ist ›wir‹?«, hakte ich sachlich nach, obwohl mir die Hitze den Nacken hinaufstieg. Meine Frage war lachhaft, denn spätestens jetzt wussten es alle, die in diesem Raum waren.
»Na, wir. Wir hier«, antwortete Anni belustigt.
»Woher?« Von Herrn Richt stammte diese Info bestimmt nicht.
»Hey, Nina, wir sind Journalisten, wir können eins und eins zusammenzählen«, mischte Nikki sich ein. »Außerdem hat die Frau vom Patter gesehen, dass Graufink rausgetragen wurde, und hat es gleich überall herumerzählt. Weißt doch, wie sie ist.«
Oh ja, Frau Patter war eine fleischgewordene Buschtrommel.
»Gut, dann wissen es die Patters und wir und das Kollegium und ja, ich geb zu, dass Herr Graufink einen Schwächeanfall erlitt, als er in die Zeitung schaute, und mir tut das leid, ehrlich. Aber wir können es für uns behalten. Die Zeitung ist im Giftschrank, keiner kann reinschauen. Wenn wir schweigen und die Lehrer auch, bleibt unsere Weste rein. Das wollt ihr doch auch, oder?«
»Na jaaaaa …« Das war Lionel, und dass er sich ohne Aufforderung zu Wort meldete, war eine solche Sensation, dass sämtliches Raunen und Murmeln schlagartig verstummte und wir ihn anstarrten, als hätten wir ihn noch nie zuvor gesehen. Irgendwie sah er auch anders aus. Nicht mehr ganz so unscheinbar, und auch seine Stimme kam mir tiefer vor als sonst. Weniger brüchig. Lag es daran, dass er endlich mal etwas Wichtiges zu sagen hatte? »Dazu ist es wohl zu spät.«
»Wie – zu spät? Habt ihr etwa heimlich welche verkauft?«
»Nein«, antwortete Lionel ruhig. »Ich hab heute früh die Web-Version freigeschaltet. Damit hast du mich beauftragt, vorgestern noch. Die Zeitung steht im Netz.«
»Und das sagst du mir jetzt?«, herrschte ich ihn an, zog einhändig mein Laptop aus meiner Schultasche und schob es ihm vor die Nase. »Nimm sie wieder raus, bitte, Lionel! Lösche sie von mir aus, ist mir egal, Hauptsache, sie ist weg!«
Schweigend und mit einer Trägheit, die mich bis aufs Blut reizte und daran zweifeln ließ, dass Lionel den Ernst der Lage begriffen hatte, machte er sich an die Arbeit. Auch die anderen verhielten sich verdächtig still und viel zu gleichgültig. Warum nur? Wussten sie mehr als ich? War es kein Zufall gewesen, dass alle schon hier gewesen waren, als ich pünktlich um 14Uhr eintrudelte? Normalerweise wurde es mindestens halb drei, bis wir vollzählig waren und endlich anfangen konnten. Außerdem waren die anderen schlagartig verstummt, als ich den Raum betreten hatte. Auch das war mir komisch erschienen. Ich war es zwar gewohnt, dass niemand dazwischenredete, wenn ich sprach, doch dieses Verstummen hatte eine andere Qualität gehabt. Sie waren nicht verstummt, damit ich das Wort ergreifen konnte. Sie waren verstummt, weil ich nicht hören sollte, worüber sie gesprochen hatten.
»So, fertig«, meldete Lionel nach einigen quälenden Minuten, in denen ich vergeblich versucht hatte, in die Köpfe meiner Teammitglieder zu lauschen. Doch leider besaß ich keine übersinnlichen Fähigkeiten, und in der angespannten Stille, die mich umgab, hatte ich lediglich wahrgenommen, was mich vorhin schon irritiert hatte – ein Geräusch in mir selbst, nicht in den Hirnen der anderen. Es ähnelte dem Knurren, das ich mir heute früh bereits eingebildet hatte, doch diesmal schien es noch prägnanter gewesen zu sein, tiefer und kehliger. Animalischer. Andererseits hatte ich seit gestern Abend vor lauter Vorfreude und Aufregung keinen Bissen mehr herunterbekommen. In meinem Bauch musste tiefste Ebbe herrschen, und wenn sich meine Anspannung gelegt hatte, würde ich wahrscheinlich fünf Nutellastullen auf einmal verdrücken. Lionel schloss den Laptop und schob ihn zu mir zurück.
»Danke. Wenn ihr alle Bescheid wisst, warum hast du das nicht schon in der Pause getan?«, fragte ich, ohne ernsthaft eine Antwort zu erwarten. In der Regel ignorierte Lionel meine Fragen. Er tat so, als habe er sie nicht gehört, oder zuckte nur mit den Schultern.
»Hatte meinen Vater am Handy. Er … er droht damit, die Anzeigen zurückzuziehen. Also, was heißt drohen.« Lionel guckte auf den Tisch, was sehr klug war, denn ich spürte, dass meine Augen bereit waren, mit einem einzigen Blick zu töten. »Ähm. Er zieht sie zurück. Sagt er. Wenn ich ihn richtig verstanden habe. Er war ziemlich laut. Und wütend.«
»Warum will er sie zurückziehen?« Ich wusste nicht, wieso ich überhaupt noch weiterfragte. Aber mir schien alles besser zu sein, als weiter in das vernichtende Schweigen der anderen zu lauschen. Dann lieber ein sinnloses Gespräch mit Lionel.
»Na ja, wegen der Passage über die Hippies und so.«
»Welche Hippies?«, fragte Nikki verdutzt.
»Keine Sorge, die sind ausgestorben«, erwiderte ich barsch und verbarg mein Gesicht in meinen Händen, wie MrRight es heute Morgen getan hatte. Hatte ich es doch gewusst – keiner von den anderen hatte mir richtig zugehört, als ich meinen Artikel vorgelesen hatte. Sie hatten mir blind vertraut. Doch jetzt hatte sich der Wind gedreht. Ich wurde dafür abgestraft, dass die anderen sich auf mich verlassen hatten. Konnte ich das Blatt noch wenden? Gab es irgendwelche Argumente, mit denen ich sie zurück an meine Seite locken konnte? Oder war das nur eine jener Krisen, die jede Redaktion von Zeit zu Zeit durchmachte? Eines war jedenfalls klar – wenn Schröter die Zeitung bereits gelesen hatte, würden in Kürze alle Bornhausener Bescheid wissen. Schröter war Vorsitzender des Schützenvereins, Präsident des Gewerbevereins und sponserte die Eishockeymannschaft (und mich übrigens auch). Er belieferte zwei Metzgereien und einen Supermarkt, seine Frau saß im Vorstand des Verschönerungsvereins und engagierte sich in der Kirche, und beide zusammen aßen Dienstag und Freitag im Brauhaus am Marktplatz zu Abend, wo jeder sein Bier trank, der mit Bornhausen verheiratet war. Also Pi mal Daumen siebzig Prozent der Altstadtbewohner. Der Worst Case war eingetroffen. »Gut, jetzt ist es passiert. Alle wissen es«, sprach ich tapfer aus, was nicht mehr zu verhindern war. »Und wir sind pleite. Das muss aber nicht heißen, dass wir aufgeben. Wir können immer noch mit der nächsten Zeitung …«
»Also, zum Thema ›wir‹«, unterbrach mich Anni erneut, und ich ahnte mit erdrückender Gewissheit, dass ich in diesem »wir« nicht mehr viel zu melden hatte. »Wir haben vorhin schon zusammen über diese ganze Sache gesprochen und haben einstimmig beschlossen, dass …«
In diesem Augenblick ertönten die Schreie – und retteten mich. Es war keine endgültige Rettung, das nicht. Es war eher so, als sei dem Scharfrichter die Fackel ausgegangen, mit der er meinen Scheiterhaufen hatte anzünden wollen, weil ein Wolkenbruch heruntergeprasselt war. Ich bekam Zeit geschenkt. Denn diese Schreie ließen keinen Zweifel daran, dass es hier um die Wurst ging (und dies war, wie sich später herausstellte, nicht nur eine Redewendung). Die Schreie bohrten sich ins Rückgrat, schossen durch sämtliche Nervenbahnen, schoben sich unter die Haut, ließen die Haare im Nacken erzittern und die Ohren schrillen – und zeitgleich schwirrte das Klirren von zerbrechendem Glas durch die Luft. Dort unten auf der Straße brüllte jemand aus Leibeskräften um sein Leben. Seine Schreie unterbrachen jeden Satz, jeden Gedanken, jedes Bewusstsein für die Vergangenheit und Zukunft, und binnen Sekunden hatten meine Teammitglieder vergessen, was sie mir sagen wollten – nämlich dass ich gefeuert war. Stattdessen stürzten sie wie die Lemminge an das einzige Fenster des Redaktionsraums und rangelten um die besten Plätze, damit sie sehen konnten, wer da unten schrie und warum.
Was seid ihr nur für miese Journalisten, dachte ich grimmig, schnappte mir meine Tasche und ergriff die Flucht. Ein guter Reporter war vor Ort, wenn etwas geschah. Er schaute nicht aus dem Fenster, nein, er näherte sich dem Geschehen so weit wie möglich! Genau das würde ich tun. Ich würde den Bericht liefern, auf den die Lindgren-Schule seit Jahren wartete, weil dieses ach so idyllische Kaff in Langeweile erstickte, und dann würden alle begreifen, dass man mich nicht zu feuern brauchte, weil ich den Mut hatte, mir aus nächster Nähe anzuschauen, wer … wer da gerade starb? Waren das Schreie eines Sterbenden? Hatte ein Sterbender so viel Kraft in den Lungen?
Und war es nicht vollkommen leichtsinnig, sich in eine Situation zu begeben, von der ich nicht viel mehr wusste, als dass jemand vollkommen hysterisch vor sich hin schrie? Es konnte schließlich sein, dass er bedroht wurde, vielleicht hatten wir jetzt doch den Bornhausener Amokläufer und die nächste Kugel würde mich treffen. Andererseits wäre das ein auf poetische Weise tragischer Tod, wie er einer kühnen, jungen Reporterin bestens stehen würde – und jeder, wirklich jeder würde zu meiner Beerdigung kommen und bereuen, wie ungerecht er gewesen war.
»Was für ein Quatsch«, murmelte ich. »Ich will doch gar nicht sterben. Nicht wegen so einem Käse.«
Unschlüssig blieb ich stehen. Und nun? Nummer sicher oder das Motto »ohne Risiko kein guter Bericht«? Konnte ich mir das überhaupt leisten – mich wie ein Angsthase hinter der schweren Eingangstür verschanzen und abwarten, während meine Teammitglieder von oben längst alles beobachtet und mit ihren Handys Fotos und Filme gemacht hatten? Nein. Außerdem hatten die Schreie sich verändert. Sie gingen in dramatisches Schluchzen über, und von Ferne näherte sich erneut ein Martinshorn. Jemand musste Hilfe gerufen haben, also waren andere Menschen dazugestoßen, und ich hatte die ganze Zeit über weder einen Schuss noch Explosionen gehört. Nur das Zersplittern von Glas.
Todesmutig stieß ich die Tür auf und marschierte die Eingangsstufen hinunter. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, was ich sah, und noch einige mehr, um zu entscheiden, ob es komisch war oder auf verstörende Weise anrührend.
Auf dem Bürgersteig gegenüber stand (falls man diese Haltung als »stehen« bezeichnen konnte) Metzgergeselle Todd, besudelt mit Mett und Zwiebelringen, und schrie weinend nach seiner Mutter, während aus dem Hinterraum der Metzgerei Atemlos durch die Nacht schallte (ein Song, der Mama zu ihren berühmten Würgegeräuschen veranlasste und somit thematisch zur Schlachtplatte passte).
Das alles stand im schrillen Kontrast zu Todds Ausmaßen. Er war ungefähr zwei Meter groß und mindestens einen Meter breit und konnte mit seinem Hackebeil vermutlich auch im Schlaf mühelos eine Kalbsschulter durchtrennen. Er selbst schien unverletzt zu sein, sofern ich das zwischen all dem Mett und den Zwiebeln auf seinem Kopf und Bauch erkennen konnte. Auch erschloss sich mir nicht, warum die Schaufensterscheibe zu Bruch gekommen war und die Auslage sich über den gesamten Metzgereiboden und den Bürgersteig verteilte (und über Todd selbst).
Es kam mir unpassend vor, ein Foto von ihm zu machen, wie er mit eingeknickten Knien bebte, zitterte und schluchzte, denn ich war möglicherweise Zeuge einer urplötzlich ausbrechenden Geisteskrankheit geworden. Anders konnte ich mir seinen Zustand nicht erklären. Sollte ich nicht lieber zu ihm gehen und ihn trösten, anstatt ihn anzustarren? Ihm wenigstens ein Taschentuch geben, damit er sich das Gesicht sauber machen konnte? Die Minileberwurst-Kette von seinem Ohr lösen?
Aber wenn ich das tat, war ich nicht mehr in der Lage, neutral über dieses Ereignis zu berichten. Reporter mischten sich niemals verändernd in das Geschehen ein, das hatte ich gelernt. Ich konnte jedoch auch beides tun. Erst ein Foto machen, mir merken, was ich gesehen hatte, bevor ich mich einmischte, und dann zu ihm gehen und ihn zu beruhigen versuchen, denn die anderen Leute, die nach und nach aus ihren Löchern krochen und gafften, sahen sich dazu nicht in der Lage. Aus gebührendem Sicherheitsabstand beobachteten sie die Szenerie und raunten sich hin und wieder bedeutungsvoll etwas zu, doch niemand hatte den Mut, Todd entgegenzutreten – was sicher auch daran lag, dass ein blutiges Hackebeil an seinem Hosenbund baumelte und niemand recht wusste, ob das Blut an der Schneide von einer Schweinshaxe oder einem Menschen stammte. Aber hätte man dann nicht zwischen all dem Fleisch und der Wurst eine Leiche sehen müssen?
Zögerlich erhob ich mein Handy, aktivierte die Kamera und …
»Um Himmels willen, Nina, nicht! Bitte, bitte nicht schon wieder!« Sanft, aber bestimmt drückte MrRight meine Hand herunter und trat neben mich, um sich mit gehetzten Blicken einen ersten Eindruck zu verschaffen. »Bitte kein neuer Bericht über verzweifelte Menschen, tu uns das nicht an.«
»Aber ich wollte doch nur … Okay, dann eben nicht«, willigte ich ein, als ich sah, wie MrRights Verzweiflung in Wut umzuschlagen drohte. »Ich gucke nur. Kein Bericht. Ja, und auch kein Foto.« Demonstrativ ließ ich das Handy in meinen Rucksack plumpsen. »Aber trösten darf ich ihn? Man kann ihn doch so nicht stehen lassen.«
»Hm, hm«, machte MrRight, unschlüssig wie ich, und wir schauten dabei zu, wie wieder Bewegung in Todds bulligen Mett-Körper kam und er den rechten Arm hob, um erst in die Metzgerei und dann auf die Straße zu deuten.
»Monster! Riesig … riesige Zähne … Krallen … der Sprung …«
Immerhin, er fand seine Sprache wieder. Sinn ergab sein Gestammel jedoch nicht. Es sprach viel eher für meinen Anfangsverdacht: Todd verlor seinen Verstand, und das vor den Augen seiner Mitbürger. Ob das die Aufmerksamkeit von meinem Graufink-Fiasko ablenken konnte?
»Schwarz«, heulte Todd, während Schnodder aus seiner Nase lief und auf die Fleischwürste zwischen seinen blutbesudelten Schlachterpantoffeln tropfte. »Schwarz und riesige Zähne. Ein Panther! Ein Panther war in meiner Metzgerei!«
Oh, ein ganzer Satz. Er machte Fortschritte. Doch er weinte und zitterte noch immer wie ein kleines Baby. Trotzdem hallten seine Worte als ein tiefes, flüsterndes Echo in meinem Bauch nach. »Ein Panther war in meiner Metzgerei!« Wie musste das sein, wenn man so etwas sah, von Jetzt auf Nachher – etwas, das es nicht gab, von dem man aber fest überzeugt war, dass es da war? Registrierte man, was mit einem geschah? Oder hielt man alle anderen Menschen für durchgedreht, weil sie nicht sahen und glaubten, was man selbst sah?
Doch die Scheibe war kaputt, und wenn Todd nicht verletzt war, konnte er nichts damit zu tun haben. Oder hatte er sie in seiner Angst eingeworfen, als er plötzlich etwas sah, was nicht da war – nämlich einen schwarzen Panther mit riesigen Zähnen? Aber womit hatte er sie eingeworfen? Wie passte das alles zusammen?
Endlich hatte Helene Fischer zu Ende gesungen, und der nächste Schlachter-Hit, Finger im Po, Mexiko, wurde glücklicherweise von der Sirene des Rettungswagens übertönt. Kein geringerer als mein Vater saß auf dem Beifahrersitz und sprang heraus, kaum dass der Wagen gehalten hatte. Seine Gesichtsfarbe wechselte in rekordverdächtiger Zeit von kalkweiß zu leuchtend orange, was bei ihm ein Zeichen von Entspannung war. Armer Papa. Seitdem er als Rettungssanitäter arbeitete, bekam er jedes Mal Panik, wenn ein Einsatz ihn in die Nähe meiner Schule oder der Eishalle rief, weil er die fixe Angstvorstellung pflegte, dass er mich eines Tages von der Straße oder vom Eis kratzen müsse und niemals mehr darüber hinwegkäme. Deshalb winkte ich ihm betont lebendig zu und beobachtete lächelnd, wie er sich in kleinen Schritten dem Panthergeschichten erzählenden Todd näherte.
»Na, Todd? Bisschen zu tief ins Glas geschaut gestern?«, fragte Papa ihn brüderlich, während er beiläufig ein wenig Mett von Todds Schultern wischte, die Leberwurstkette vom Ohr löste und mit der anderen Hand den Puls prüfte. »Unverletzt! Zumindest äußerlich«, rief er seinem Kollegen zu, nachdem er Todds massigen Körper von oben bis unten nach blutenden Wunden untersucht hatte. »Aber der Puls rast, und seine Haut ist kalt. Schock vermutlich. – Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun, als zu glotzen? Hier ist nichts passiert, geht wieder nach Hause!«
Papa war ein Gaffer-Hasser, doch heute lag er daneben. Es war etwas passiert. Wir alle waren Zeugen eines Rätsels geworden. Eine Schaufensterscheibe zerbrach nicht ohne äußere Einwirkung, und noch immer wussten wir nicht, wie das hatte passieren können. Auch ich verspürte keine Lust zu gehen.
»Biste in die Auslage gekracht, hm?«, beantwortete Papa eine meiner ungelösten Fragen.
»Nein. Nein!« Nun schluchzte Todd nur noch trocken; Tränen kamen keine mehr. »Ich war hinten und hab eine Schlachtplatte für die Theißens gerichtet und Musik gehört, und auf einmal war da dieser Geruch … und das Knurren … oh, dieses Knurren!« Todd schloss die Augen, während seine Unterlippe einen wahren Tanz aufführte. Sein Gesicht sah aus, als würde es jeden Moment in mehrere Puddings zerfallen. »Ich drehte mich um, ging nach vorne, und … da war er … ein Panther … wirklich, ein Panther! Oder Leopard! Oder Bär, Wolf, ein Raubtier jedenfalls, und es hat die Hirschkeule mitgenommen, ich schwöre es, die ganze Hirschkeule, und als ich angefangen hab zu schreien, sprang es durch die Scheibe …«
»Natürlich«, sagte Papa beruhigend. »Natürlich, Junge. Du schläfst dich jetzt erst einmal gründlich aus, ja? Alles kommt wieder in Ordnung.«
Das wagte ich zu bezweifeln, doch nun wurden Stimmen bei den Gaffern laut, etwas weiter die Straße hinunter.
»Blut!«, rief einer. »Hier sind Blutstropfen auf dem Bürgersteig, ganz frisch!«
Aus einer anderen Ecke ertönte eine Frauenstimme, nicht minder wichtig und geschwollen: »Es stimmt, das Brauhaus hatte eine Hirschkeule bestellt, und heute Morgen hab ich sie noch in der Theke liegen sehen. Ich wollte sie nämlich kaufen, aber Todd meinte, sie sei schon vergeben und ich müsste auf morgen warten. Ist sie noch da?«
Da MrRight wie angewachsen neben mir stand, wagte ich es nicht, Block und Stift herauszuholen, um mir Notizen zu machen. Stattdessen versuchte ich mir die Worte der Zeugen einzuprägen, so gut es ging. Bluttropfen auf dem Bürgersteig, Hirschkeule im Fenster. Hirschkeule noch da? Beim Brauhaus nachfragen. Unauffällig ließ ich meine Blicke über das Gewusel aus Mett, Würstchen, Steaks, Geschnetzeltem und Rouladen wandern, das die Szenerie mit einem würzigen Aroma nach Curry, Zwiebelpulver und Paprika garnierte. Nein, ich konnte keine Hirschkeule entdecken, weder auf dem Boden noch in der verwüsteten Auslage. Doch auch das war kein Beweis. Todd konnte die Keule dem Brauhaus längst geliefert haben.
Nun näherte sich ein Streifenwagen dem Geschehen, und das Stimmengewirr der Gaffenden wurde lauter. Ich kannte dieses Phänomen schon – in Bornhausen wollte immer irgendjemand irgendetwas Wichtiges gesehen haben, wenn sich ein Unfall ereignet hatte. Bevor ich Genaueres wusste, war es ein Unfall – eine wunderbar neutrale Bezeichnung. Auch das mit Herrn Graufink konnte man als Unfall bezeichnen, obwohl ich an den jetzt nicht denken wollte – ich war dankbar genug, dass Todds aufbrechende Geisteskrankheit meinen Scharfrichter unterbrochen hatte.
Wenn sich ein Unfall ereignete, kam die Polizei – so war es auch heute. Während mein Vater Todd wie ein verwirrtes Kind zum Krankenwagen führte und mir mit einem strengen Blick zu verstehen gab, dass ich gefälligst verschwinden sollte, begannen Herr Brunswick und sein Kollege, ein schmächtiger Typ mit steil gegeltem Haar, den Tatort abzusperren. Wie Störche staksten sie durch die Würstchen und Steaks, in den Händen Flatterband und Metallstangen, und einigen Frauen gelang es, hinter ihrem Rücken ein paar der unversehrteren Fleischwaren vom Boden zu picken, in Taschentücher zu wickeln und in ihre Handtaschen zu stopfen. Die Männer hingegen gaben sich einem unverständlichen Raunen hin, die Köpfe zusammengesteckt und ihre Blicke wichtig und wissend. Die Worte »armer Kerl« und »zu viel gesoffen« und »schlechte Gene« streiften meine Ohren, als ich mich durch die zusammenstehenden Trüppchen schlich und schließlich fand, was ich suchte: Blut. Es war keine Übertreibung gewesen – dunkelrote, kreisrunde Blutstropfen zogen sich über den Asphalt, und an ihrem Glitzern konnte ich erkennen, dass sie frisch waren. Doch die Straße war ebenfalls feucht. Es hatte den ganzen Vormittag geregnet. Sosehr ich mich auch bemühte – ich konnte keine Pfotenabdrücke oder Ähnliches erkennen. Nur diese kleine Blutspur, frisch und warm. Ja, warm fühlte sie sich an, wenn ich sie betrachtete … und lebendig.
Ich durchwühlte meine Hosentaschen nach einem Tempo, fand aber keines, und mein Halstuch war mir zu schade, um es derart zu besudeln. Dennoch kniete ich mich nieder und berührte mit der Kuppe meines Zeigefingers den kleinsten der Blutstropfen. Ein feines Kribbeln wanderte durch meine Hand, und meine Kehle wurde eng, fast so, als müsse ich gleich wegen eines traurigen Films zu weinen beginnen. Doch am meisten irritierte mich der Duft, der von meinem Finger aufstieg. Das Blut roch nach Wald – einem Wald, den ich nie zuvor betreten hatte. Er war wilder als unser Wald, blumiger, verwunschener, so, wie es ihn nur in Büchern von fremden Ländern gab.