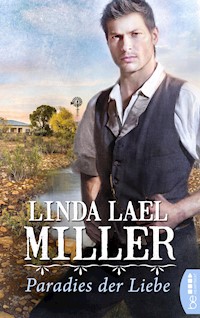
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Corbin-Saga – Historical Western Romance
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Auftakt der historischen Western-Romance-Serie um die Corbin-Geschwister
Port Hastings, Washington, 1886: Der Arzt Adam Corbin braucht einen Assistenten - da kommt ihm Banner O’Brien gerade recht. Bis sich herausstellt: Der Aushilfsarzt ist eine Frau! Nach dem ersten Schock nimmt Adam sie zu seinen Patientenbesuchen mit und findet allmählich Gefallen an ihr. Und das, obwohl die temperamentvolle Schönheit ihren ganz eigenen Kopf hat. Doch Adam verschweigt ihr ein Geheimnis, das seit dem tragischen Unfalltod seines Vaters auf ihm lastet ...
Dieser historische Liebesroman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Wer das Paradies nur finden will" erschienen.
Die Corbin-Saga geht weiter - im nächsten Band entdeckt Jeff den "Zauber der Herzen".
Über die Reihe: Das Leben hat die Corbins eigentlich immer verwöhnt - die Brüder Adam, Jeff, Keith und ihre Schwester Melissa. Bis zu dem Tag, als ihr Vater unter mysteriösen Umständen verunglückte. Nun müssen die vier Geschwister allein versuchen, ihren Weg zu finden - und die Liebe ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:
Die Corbin-Saga
Band 2: Zauber der Herzen
Band 3: Lächeln des Glücks
Springwater – Im Westen wartet die Liebe
Band 1: Wo das Glück dich erwählt
Band 2: Wo Träume dich verführen
Band 3: Wo Küsse dich bedecken
Band 4: Wo Hoffnung dich wärmt
Die McKettrick-Saga
Band 1: Frei wie der Wind
Band 2: Weit wie der Himmel
Band 3: Wild wie ein Mustang
Über dieses Buch
Der Auftakt der historischen Western-Romance-Serie um die Corbin-Brüder
Port Hastings, Washington, 1886: Der Arzt Adam Corbin braucht einen Assistenten – da kommt ihm Banner O’Brien gerade recht. Bis sich herausstellt: Der Aushilfsarzt ist eine Frau! Nach dem ersten Schock nimmt Adam sie zu seinen Patientenbesuchen mit und findet allmählich Gefallen an ihr. Und das, obwohl die temperamentvolle Schönheit ihren ganz eigenen Kopf hat. Doch Adam verschweigt ihr ein Geheimnis, das seit dem tragischen Unfalltod seines Vaters auf ihm lastet …
Über die Autorin
Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/.
Linda Lael Miller
Paradies der Liebe
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Braun
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1984 by Linda Lael Miller
Titel der amerikanischen Originalausgabe: „Banner O‘Brien“
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1991/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: „Wer das Paradies nur finden will“
Lektorat: Ute Biermann
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Francois Loubser; © ALETA RAFTON
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6864-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Staat Washington – 15. Dezember 1886
Die Lichter von Port Hastings leuchteten und funkelten im dahintreibenden Schnee, als das Dampfschiff anlegte. Vom dunklen Pier drang Leierkastenmusik herüber, und Banner O’Brien beugte sich über die vereiste Reling, um zu sehen, woher die Melodie kam.
Mr. Temple Royce, der neben ihr stand, zeigte auf das Ufer und murmelte: »Das ist es – Klein Sodom und Gomorrha.«
Banner wandte sich verblüfft zu ihm um. Sodom und Gomorrha? Warum sagte er das erst jetzt, wo es zu spät zur Umkehr war? Bisher hatte er die Stadt nur in den herrlichsten Farben geschildert.
Bevor Banner etwas darauf erwidern konnte, nahm Royce ihren Arm und führte sie auf die Rampe zu. »Wir brauchen Sie hier«, sagte er schlicht, als sei damit alles erklärt.
Die Musik wurde lauter, und Temple Royce drängte Banner hastig über den Kai zu einer wartenden Kutsche.
Während das Gefährt eine steile Anhöhe hinaufzog und in eine Straße einbog, die von verwitterten Tavernen und Freudenhäusern gesäumt war, schaute Banner neugierig aus dem unverhangenen Fenster. Angetrunkene Seeleute schwankten von einem Etablissement zum anderen, verfolgt von den heiseren Rufen der Prostituierten, die über die Straße schlenderten.
»Water Street«, erklärte Royce in gelangweiltem Ton. »Aber beurteilen Sie bitte nicht die ganze Stadt nach diesem Ort.«
Banner ließ sich in den gepolsterten Ledersitz zurücksinken und schob die Hände unter ihren warmen blauen Wollumhang. Fast wünschte sie nun, in Portland geblieben zu sein, wo sie ein sauberes, gemütliches Zimmer besaß und eine Praxis, die genug einbrachte, um ihre bescheidenen Ansprüche zu befriedigen.
Dann richtete sie sich auf und straffte die Schultern. In Portland war Sean – sie hatte ihn mit eigenen Augen dort gesehen – und damit war alles entschieden.
»Sie sind bezaubernd«, sagte Mr. Royce spontan. Er war selbst ein gutaussehender Mann von mittlerer Größe und durchschnittlichem Gewicht. Haar- und Augenfarbe hatten denselben schimmernden Braunton. Banner schätzte ihn um die dreißig. Seine elegante Kleidung bewies, dass er wohlhabend sein musste, wenn nicht sogar reich. »Was hat Sie dazu veranlasst, Ärztin zu werden?«
Banner war zu müde und entnervt, um auf Einzelheiten einzugehen. Sie war hier, um die Praxis eines anderen Arztes zu übernehmen, der sich von einer Verletzung erholte, und nicht, um vor einem Mann, den sie kaum kannte, ihre Seele bloßzulegen.
»Sie haben meine Qualifikationen gesehen, Mr. Royce«, entgegnete sie kühl. »Ich habe Ihnen Empfehlungsschreiben und mein Diplom gezeigt. Wie ich daran gekommen bin, dürfte meiner Ansicht nach keine Bedeutung für Sie haben.«
Royce lächelte, und seine Stimme klang rau und doch weich, als er weitersprach.
»Dieses zimtfarbene Haar und diese schönen grünen Augen – wieso hat Sie bisher noch niemand geheiratet, Miss O’Brien?«
»Doktor O’Brien«, berichtigte Banner. Ein leiser, aber beständiger Schmerz pochte hinter ihren Schläfen. Ein Mann hatte sie geheiratet und es bitter bereut. Aber das ging Temple Royce nichts an.
Er nickte zustimmend. »Doktor O’Brien, meinetwegen. Wie alt sind Sie?«
Banner seufzte. »Sechsundzwanzig. Und Sie?«
Royce lachte, obwohl eine Spur von Ärger in seinem Blick erschien. »Sie sind recht dreist, Dr. O’Brien«, bemerkte er. »Und um Ihre Frage zu beantworten – ich bin zweiunddreißig.«
»Wie ist es zu Dr. Hendersons Verletzung gekommen?«, fragte Banner. Dr. Henderson war der Arzt, dessen Praxis sie für eine Zeitlang übernehmen sollte.
»Es geschah während einer Konsultation mit Ihrem Konkurrenten, Dr. O’Brien. Der arme Stewart Henderson hat es gewagt, eine gegenteilige Ansicht zu äußern, worauf Dr. Corbin recht aggressiv reagierte.«
»Sie wollen doch nicht etwa sagen ...«
»Oh doch! Adam Corbin ist ein gewalttätiger, verbohrter Mensch, und jene, die anderer Meinung sind als er, gehen ein beachtliches Risiko ein.«
Es schauderte Banner. Sie war entsetzt, dass ein Arzt sich so verhalten sollte, doch sie sagte nichts.
»Ich bin überzeugt, dass Adam Corbin Sie aufsuchen wird, sobald er erfährt, dass Sie Stewarts Praxis übernommen haben. Falls Sie lieber nicht allein sein möchten ...«
Banner spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Sie fürchtete sich vor keinem Mann, Sean Malloy ausgenommen, und sie hatte nicht die Absicht, sich wie ein verschrecktes Küken unter Mr. Royce’ Fittiche zu begeben. »Ich bleibe in Dr. Hendersons Haus«, erwiderte sie kühl. »Wie wir es vereinbart haben.«
»Wie Sie wünschen.« Royce zuckte die Schultern.
Sie hatten Water Street mittlerweile hinter sich gelassen, sah Banner. Im dichten Schneegestöber erkannte sie jetzt einen Kolonialwarenladen, eine Bank und ein imposantes Backsteingebäude.
Um einer weiteren Unterhaltung aus dem Weg zu gehen, hüllte sie sich in ihr Cape und schloss die Augen.
Es war eine übereilte, tollkühne Entscheidung gewesen, auf Royce’ Behauptung hin, seine Stadt brauche einen Arzt, eine derart weite Reise anzutreten. Aber Banners Verzweiflung hatte ihr keine andere Wahl gelassen, denn knapp zwei Stunden bevor Royce ihre kleine Praxis betreten hatte, war ihr bei einem Patientenbesuch am Hafen Sean begegnet.
Das Angebot, eine Praxis in Port Hastings zu übernehmen, war Banner in jenem Augenblick wie eine Gottesgabe erschienen.
Dr. Hendersons Haus, das im Moment leer stand, weil er bis zu seiner Genesung bei seiner Schwester lebte, war ein robustes Backsteingebäude. Es lag in einem blühenden kleinen Garten und war von einem schmiedeeisernen Zaun umgeben.
In einem der Fenster brannte Licht, und Rauch kräuselte sich aus dem Schornstein. Der Geruch erweckte ein behagliches Gefühl in Banner, genau wie das freundliche Lächeln der jungen Indianerin, die sie an der Tür empfing.
»Wo ist der Mann?«, wollte sie wissen und schaute an Banner und Mr. Royce vorbei auf den Kutscher, der das Gepäck ausräumte.
An solche Fragen gewöhnt, lächelte Banner nur und trat an der Frau vorbei ins Haus. Es war zwar nur karg möbliert, doch das Wenige blitzte vor Sauberkeit. Neben dem Kamin im Wohnzimmer stand ein Tablett mit Tee.
»Ich habe keinen Mann«, antwortete Banner, während sie Umhang und Hut ablegte und die Handschuhe auszog. »Ich bin Dr. Banner O’Brien. Wie heißen Sie?«
Die Indianerin starrte Banner mit großen Augen an, bevor sie antwortete, sie werde Jenny Lind genannt.
Nun war es Banner, die ein verblüfftes Gesicht machte. »Jenny Lind?«, wiederholte sie ungläubig.
Royce lachte. »Jennys richtiger Name ist unaussprechbar, deshalb haben wir ihr einen gegeben, den jeder versteht.«
Banner nickte stumm und schenkte sich von dem Tee ein, den die Namensschwester der weltbekannten Sängerin zubereitet hatte. Es ist traurig, dachte Banner, dass der weiße Mann den Indianern nicht nur ihr Land, sondern auch ihre Namen genommen hat.
Royce warf Jenny einen argwöhnischen Blick zu. »Was machst du überhaupt hier? Das ist kein ...«
Jenny trat näher zu Banner, als spürte sie deren mitleidigen Gedanken. »Haus war sehr schmutzig«, sagte sie leise.
Royce verzichtete auf eine Entgegnung, was ihm sichtbar schwerfiel, und verabschiedete sich kurz darauf.
Jenny schien erleichtert, und Banner gähnte und streckte sich in einem bequemen Sessel aus, um ihren Tee zu trinken und das Kaminfeuer zu genießen. Sie war völlig übermüdet, und der Schock über Seans Erscheinen steckte ihr noch immer in den Knochen.
Jenny trat hinter sie und strich über Banners Haar. »Dr. Feuerhaar«, murmelte sie bewundernd.
Banner lebte schon fast ein Jahr im Westen und glaubte, die Indianer inzwischen recht gut zu verstehen. Sie hatten keinerlei Hemmungen, andere Menschen zu berühren, und es war ganz normal für sie, ein Haus zu betreten, ohne vorher anzuklopfen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten störte es Banner nicht.
»Arbeitest du für Dr. Henderson?«
Das Mädchen schrak zurück, als habe es sich an Banners kupferrotem Haar verbrannt. Pures Entsetzen flackerte in ihren braunen Augen auf, und sie schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr schwarzes, hüftlanges Haar in Bewegung geriet. »Nein!«, antwortete sie heftig.
Banner schwieg und schaute das Mädchen nur fragend an.
»Dr. Adam mir gesagt, saubermachen. Sauberes Haus gut.«
Banner erschrak. »Dr. Adam?«
Jennys schönes Haar glänzte im Schein des Feuers, als sie nickte.
»Ist das der Mann, der Dr. Henderson verwundet hat?«
Jenny senkte den Kopf und presste die Lippen zusammen. »Ja«, gab sie dann zu. »Aber ...«
Im gleichen Augenblick drang ein kalter Luftzug in den Raum und ließ das kleine Feuer im Kamin aufflackern. Die Anwesenheit einer dritten Person war spürbar, und als Banner sich umschaute, entdeckte sie einen großen, dunkelhaarigen Mann um die dreißig, dessen blaue Augen Jenny lächelnd betrachteten.
»Du hast es versprochen«, sagte er gedehnt und verschränkte die Arme vor der Brust.
Jennys braune Wangen glühten vor Verlegenheit. »Es tut mir leid, Adam«, erwiderte sie in perfektem, akzentfreiem Englisch.
Der Mann richtete seinen Blick auf Banner, musterte sie prüfend und schaute ihr dann in die Augen. »Sie hat Ihnen die Rolle der unwissenden Wilden vorgespielt, was?«
Banner war so entrüstet über sein Eindringen, dass sie kein Wort hervorbrachte.
Das schien den großen Mann nicht zu stören. Er lächelte und machte eine knappe Verbeugung. »Dr. Adam Corbin.«
Banner stand auf. Sie wusste, dass ihre Antwort diesen Mann schockieren würde. »Dr. Banner O’Brien«, sagte sie mit einem kurzen Nicken und wartete gespannt auf seine Reaktion.
Sie wurde nicht enttäuscht. Der gutaussehende Fremde erblasste sichtlich. »Was?«
»Sie kamen her, um den neuen Arzt einzuschüchtern, nicht wahr?«, entgegnete Banner kühl. »Nur zu, Dr. Corbin – ich stehe Ihnen zur Verfügung.«
Er fuhr sich mit der Hand durch sein widerspenstiges dunkles Haar und schaute Banner an, als traute er seinen Augen nicht. »Mein Gott – eine Frau! Soll das ein Witz sein?«
Banner straffte die Schultern. »Keineswegs. Ich bin hier, um den Arzt zu vertreten, den Sie so roh behandelt haben – Doktor!«
»Roh behandelt?« Es war nicht mehr als ein Flüstern, aber seine nächsten Worte schienen das ganze Haus zu erschüttern. »Wer hat das gesagt? Temple?«, fragte er drohend.
Jenny trat zwischen Banner und den Mann. »Verdammt, Adam, beruhige dich doch! Natürlich war es Temple!«
»Was hat er gesagt?« Adam sah Banner prüfend in die Augen. »Ich will alles ganz genau wissen. Jedes Wort! Haben Sie mich verstanden?«
Banner sank in ihren Sessel zurück. Ihr Mut hatte sie verlassen, und ihre Hände zitterten, als sie die Teetasse aufnahm. »Mr. Royce sagte, Sie wären gewalttätig und verbohrt. Und es sei sehr riskant, eine andere Ansicht als Ihre zu vertreten.«
»Aha.«
»Im Übrigen ist das mein Haus, im Augenblick jedenfalls«, fuhr Banner entrüstet fort, »und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es nicht mehr unangemeldet betreten würden. Ist das klar, Doktor?«
Seine Antwort war ein belustigtes, raues Lachen. »Wie Sie wünschen«, erklärte er mit einer weiteren Verbeugung – die irgendwie noch unverschämter wirkte als die erste.
Aber Banner war viel zu müde, um sich auf Streitgespräche mit Leuten wie Dr. Corbin einzulassen. Er sollte verschwinden – und seine beeindruckende Persönlichkeit, seine breiten Schultern und seine intelligenten blauen Augen mitnehmen! »Gute Nacht«, sagte Banner betont.
Doch Adam rührte sich nicht vom Fleck, und erst jetzt fiel Banner auf, dass er keinen Mantel trug, obwohl es draußen schneite. Seine Hosen, das Hemd aus feinem Linnen und die halbzugeknöpfte Weste schmiegten sich in unnachahmlicher Eleganz an seinen kräftigen Körper. Sämtliche Kleidungsstücke waren von bester Qualität, wenn auch leicht zerknittert.
Jenny brach das entstandene Schweigen mit einem nervösen Kichern. »Soll ich Ihnen etwas zu essen machen?«, fragte sie.
Banner hatte seit Portland nichts mehr zu sich genommen und daher großen Hunger, aber die Aussicht, mit diesem seltsamen Mann allein zu bleiben, war ihr äußerst unangenehm.
»N-nein«, antwortete sie rasch. »Danke. Ich mache mir später selbst etwas zurecht.«
Adams Blicke richteten sich auf die Indianerin und schienen ihr eine stumme Botschaft zu übermitteln. Jenny drehte sich abrupt um und verschwand ohne ein weiteres Wort im rückwärtigen Teil des Hauses.
»Woher soll ich wissen, dass Sie wirklich Ärztin sind?«, fragte Adam kühl.
»Sie werden mir wohl vertrauen müssen«, erwiderte Banner.
Dr. Corbin neigte seinen beeindruckend schönen Kopf. »Oh nein«, entgegnete er ernst. »Henderson hat schon genug Schaden angerichtet. Ich denke nicht daran, einen weiteren Quacksalber auf die Leute dieser Stadt loszulassen.«
Banner war beleidigt, und das Pochen in ihren Schläfen war fast so heftig wie das aufgeregte Klopfen ihres Herzens. »Sie sprechen mit einer Arroganz, Doktor, als benötigte ich Ihre Erlaubnis, um zu praktizieren«, sagte sie kalt.
Ein humorloses Lächeln erschien auf seinem Gesicht. »Vielleicht brauchen Sie die ja auch.«
Banner sprang empört auf und taumelte sekundenlang, weil ihr hungriger, erschöpfter Körper gegen die abrupte Bewegung protestierte.
Adam Corbin umfasste stützend ihre Schultern, und Banner verspürte ein erschreckendes, unerklärliches Prickeln auf ihrer Haut. »Setzen Sie sich!«, sagte er und drückte sie in den Sessel zurück.
Banner war den Tränen nahe und glaubte, den Druck von Adams Händen noch zu spüren, obwohl er sie längst fortgenommen hatte. »Ich bin kein Quacksalber«, sagte sie. »Ich habe bei Dr. Emily Blackwell am New York Infirmary studiert.«
Adam war vor ihr in die Hocke gegangen. Seine Hände ruhten auf den Sessellehnen, und Banner wagte nicht, sich zu rühren. »Dr. Blackwell«, wiederholte er nachdenklich. »Das ist eine gute Empfehlung. Sehr gut sogar.«
»Ja.« Mehr brachte Banner nicht über die Lippen. Wie hypnotisiert starrte sie auf das weiche, schwarze Haar, das sich unter Adams offenem Hemdkragen kräuselte.
»Ich würde trotzdem gern Ihr Diplom sehen.«
Banner setzte zu einer beleidigenden Antwort an, aber dann sagte sie nur: »Sie sind unerträglich.«
»Ja«, gab er lächelnd zu. »Das Diplom, bitte.«
Fast hätte sie ihn zu ihrem Arztkoffer geschickt, der auf dem restlichen Gepäck stand, aber sie hielt sich gerade noch rechtzeitig zurück. Es befanden sich noch andere Papiere darin, die weder dieser Mann noch sonst jemand sehen sollte. »Sie werden schon aufstehen müssen, Sir, wenn Sie erwarten, dass ich Ihren Wunsch erfülle.«
Adam richtete sich auf und bedeutete Banner mit einer Handbewegung, es ihm nachzutun.
Mit so viel Würde, wie sie noch aufbringen konnte, holte Banner ihre Papiere und reichte sie Dr. Corbin.
Er las sie mit ausdrucksloser Miene, musterte Banner prüfend und las die Papiere noch einmal. »Banner könnte ein Männername sein«, meinte er dann sinnend. »Sie könnten die Papiere gestohlen haben – Ihrem Vater, Ihrem Bruder ... oder Ihrem Mann.«
Banner errötete. »Das ist eine unverschämte Unterstellung! Ich habe sie mir verdient, und das war nicht leicht, wenn man bedenkt, mit wie vielen arroganten Narren ich mich auseinandersetzen musste!«
Obwohl Adams Lippen fest zusammengepresst waren, erschien ein belustigtes Funkeln in seinen Augen. »Bezeichnen Sie mich als arroganten Narren, Miss ... Dr. O’Brien?«
»Ja.«
Diesmal lachte er ganz offen, um dann fortzufahren, als hätte Banner nichts gesagt: »Morgen nehme ich Sie zu meinen Visiten mit, dann werden wir schon sehen, ob Sie Ärztin sind oder nicht.«
Heiße Röte stieg Banner ins Gesicht, aber sie wusste, dass sie sich nicht weigern konnte, ihn zu begleiten, weil er sonst nie aufhören würde, sie zu belästigen. Das Beste war, ihn von Anfang an von ihren Kenntnissen zu überzeugen. »Ich werde bereit sein«, erklärte sie.
»Gut. Ich hole Sie um Punkt sieben Uhr ab.«
»Um sieben«, bestätigte Banner.
Sichtbar zufrieden – für den Moment jedenfalls – verließ Adam Corbin das Haus. Und obwohl Banner froh war, allein zu sein, kam es ihr ohne ihn ganz merkwürdig leer vor.
Sie zerbrach sich noch immer den Kopf über dieses seltsame Gefühl, als Jenny zurückkam, um das Teegeschirr abzuräumen.
»Es gibt nur einen Adam«, bemerkte sie mit aufreizend verständnisvollem Lächeln.
»Gott sei Dank!«, versetzte Banner.
Jenny wirkte gekränkt. »Sie irren sich, Dr. O’Brien«, sagte sie kühl. »Ihr Essen steht in der Küche.« Damit ging sie hinaus, und Banner blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen.
In der Küche begann sie, heißhungrig die Graupensuppe zu essen. Sie schmeckte köstlich, genau wie das Brot und alles andere, was Jenny zubereitet hatte.
»Sie mögen Dr. Corbin sehr, nicht wahr?«, fragte Banner, als ihr schlimmster Hunger gestillt war.
Jenny drehte sich um. »Er ist ein guter Mensch«, entgegnete sie ernst. »Zu gut vielleicht.«
»Gut? Wie können Sie sagen, er sei gut, Jenny, wenn er ...«
»Wenn er Mr. Henderson das Kinn zerschmettert hat?«, schloss Jenny, und eine leise Röte stieg in ihre Wangen.
Banner wurde blass. »Du lieber Himmel! Er hat dem armen Mann das Kinn zerschlagen?«
Jenny nahm ein rotkariertes Küchentuch in die Hand und warf es dann wieder auf den Tisch. »Ja!«
»Warum?«, erkundigte sich Banner betroffen.
Jenny schob trotzig die Unterlippe vor. »Adam hat Dr. Henderson bei einer Operation in Water Street erwischt«, antwortete sie ruhig. »Stewart gab der Patientin Opium statt Äther, und die Frau wachte auf, bevor die Operation vorbei war.«
Banner wurde von einer solchen Übelkeit erfasst, dass sie die Augen schloss. »Um Gottes willen ...«
»Die Frau schrie vor Schmerzen, bis sie starb«, schloss Jenny.
Banner schauerte vor Entsetzen und umklammerte die Tischplatte, bis sie sich ein bisschen erholt hatte. Sie konnte gut verstehen, welchen Zorn eine solche Situation in einem verantwortungsbewussten Arzt auslösen musste.
Jenny ging auf die Küchentür zu. »Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer«, sagte sie. »Kommen Sie!«
»Es tut mir leid, dass ich Sie gestern Nacht geweckt habe, Jenny«, sagte Banner beim Frühstück. Ein schrecklicher Alptraum hatte sie gequält, in dem eine Frau verblutete und vor Schmerzen schrie, und aus der Frau war schließlich Banner selbst geworden, und Adam, der in ihrem Traum mit wutverzerrtem Gesicht vor dem Bett stand, hatte sich in Sean verwandelt. Banners entsetzter Aufschrei hatte Jenny herbeigerufen.
Jenny musterte Banner sinnend. »Haben Sie oft Alpträume?«
Nur einen, dachte Banner. »Ich war sehr müde«, sagte sie.
»Wer ist Sean?«, beharrte Jenny.
Ein lautes Klopfen an der Haustür ersparte Banner eine Antwort. Dr. Adam Corbin war nicht nur pünktlich, sondern anscheinend auch recht ungeduldig.
»O’Brien!«, schrie er von draußen, als Banner durch die Halle ging, um ihn einzulassen.
Er stand auf der Veranda, und seine blauen Augen blitzten vor unterdrücktem Zorn. Heute sah er eher wie ein Mitglied des englischen Adels aus als wie ein Landarzt auf dem Weg zu seinen Visiten: Seine Hosen waren aus einem weichen, rehfarbenen Material gearbeitet, das sich eng an seine muskulösen Oberschenkel schmiegte und dann im Schaft von hohen schwarzen Reitstiefeln verschwand. Über dem taillierten weißen Hemd trug er einen Mantel aus feinstem Tweed.
Im hellen Tageslicht sah Banner, dass sein Haar gar nicht richtig schwarz war, sondern von einem sehr dunklen Braun, das mit helleren, kastanienfarbenen Strähnen durchsetzt war.
»Was ist, O’Brien?«, fragte er ungehalten.
Banner errötete, als ihr bewusst wurde, wie sie ihn anstarrte, und zwang sich zu einem Lächeln. »Nichts, Dr. Corbin. Was soll schon sein?«
»Worauf warten wir dann noch?«
Banner hatte ihren wärmsten Umhang und ihren Arztkoffer bereitgelegt, und drehte sich nun so hastig um, um beides zu holen, dass sich ihr rechter Schuh im Rocksaum verfing und sie fast gefallen wäre.
Adams Züge schienen weicher, als sie sich danach zu ihm umdrehte, und ein schwaches Lächeln spielte um seinen Mund.
»Ich bin fertig«, sagte sie, um das Schweigen zu brechen. »Ihre Augen haben die Farbe von Klee«, erwiderte er gedankenverloren.
Banner beschloss, die Bemerkung zu ignorieren. »Gehen wir?«
Adam lachte und deutete auf die zweisitzige Kutsche, die vor dem Haus stand. »Nach Ihnen«, sagte er.
Es war Banners erste Gelegenheit, sich Port Hastings anzuschauen, und sie war froh, dass ihre Neugierde die merkwürdigen Gefühle verdrängte, die die Gegenwart dieses Mannes in ihr auslöste.
Sie stieg munter in den kleinen Wagen und spähte durch das Schneegestöber, während Adam einstieg und die Zügel nahm.
»Wird diese Stadt wirklich Klein Sodom und Gomorrha genannt?«, erkundigte sie sich neugierig.
Adam lachte. »Das und vieles andere mehr. Sodom und Gomorrha bezieht sich eigentlich nur auf Water Street.«
Banner dachte an die Frau, die dort durch Stewart Henderson gestorben war, und ihre heitere Stimmung ließ erheblich nach.
Um sich abzulenken, zeichnete sie in Gedanken eine Landkarte und trug Port Hastings an der Meerenge von Juan de Fuca ein, des Kanals, der Puget Sound vom Pazifik trennte. Es war anzunehmen, dass hier Schiffe aller Nationalitäten anlegten, um die Steuern für ihre Fracht zu entrichten.
Die Straßen im Stadtzentrum waren mit hölzernen Bürgersteigen versehen. Auf den Laternen türmte sich hoch der Schnee. Hausfrauen, Arbeiter, Seeleute, Indianer und Chinesen bevölkerten die schmalen Straßen.
Die Geschäftsauslagen waren schon für das bevorstehende Weihnachtsfest geschmückt, und vor fast jeder Tür hing ein Kranz aus Stechpalmenblättern mit bunten Schleifen.
Banner war entzückt von der fieberhaften Geschäftigkeit der Stadt. Es war ganz offensichtlich, dass Port Hastings danach strebte, sich zu vergrößern.
Sie bogen um eine Ecke. Kurz darauf zog Adam die Zügel und befestigte die Bremse. »Ich komme gleich zurück«, sagte er.
Banner betrachtete misstrauisch die beschlagenen Scheiben von Wung Los Wäscherei und Teeküche. Adam hatte versprochen, sie auf seine Visiten mitzunehmen. Hatte er jetzt etwa vor, sie draußen im Wagen sitzen zu lassen, während er seine Patienten besuchte?
Er schien ihre Gedanken zu erraten und schüttelte lachend den Kopf, als er aus dem Wagen stieg.
»Ich hole, nur meine Hemden ab, Kleeblatt«, versicherte er.
Banner kam sich ziemlich dumm vor und blieb steif sitzen, bis Adam mit einem Paket zurückkam, das er hinter dem Sitz verstaute. Der Wagen neigte sich zur Seite, als er einstieg. Er rückte ein wenig näher an sie heran als vorher, und Banner erschauerte unwillkürlich, als sie seinen kräftigen Schenkel an ihrem Bein spürte.
Adam schaute sie mit hochgezogenen Brauen an, aber der schwache Duft seiner Kleider nach Schnee und Seife löste noch mehr Unbehagen in Banner aus als sein fragender Blick.
»Kalt?«, fragte er.
»Nein.«
Adam schien ihr nicht zu glauben. Sein amüsiertes Lächeln weckte den Wunsch in ihr, die Fäuste zu ballen und gegen seine Brust zu schlagen. »Ich hätte eine Decke mitbringen sollen«, meinte er.
Die Vorstellung, unter einer Decke mit diesem Mann zu sitzen, machte sie noch nervöser. »Ihre Patienten warten«, sagte Banner steif.
Wieder lachte er aufreizend und trieb das Pferd zum Weitergehen an. Der Wind pfiff durch Banners Umhang und Kleid, aber um nichts auf der Welt wäre sie bereit gewesen, es zuzugeben.
Ihr erster Besuch war Routinesache. Es handelte sich um einen Mann, der von einem Gerüst gefallen war und sich einen Knöchel gebrochen hatte. Der Patient begrüßte Adam freundlich und musterte Banner mit unverhohlener Neugier.
Die zweite Visite war schon ernüchternder. Über eine steile, glitschige Außentreppe erreichten sie eine bescheidene Wohnung, in der auf einem schmalen Bett zwischen Herd und Wand eine stöhnende Frau lag. Zwei kleine Jungen in schäbigen Kniebundhosen und losen Hemden kauerten mit großen, ängstlichen Augen am Fußende des Lagers.
Adam strich beiden über das Haar und zog zwei Pfefferminzstangen aus der Manteltasche. »Ich hatte noch keine Zeit, sie zu essen«, sagte er mit derart ernster Miene, dass Banners Herz zu flattern begann wie ein aufgeregter Vogel. »Wollt ihr mir nicht dabei helfen?«
Die Kinder waren sofort bereit dazu und zogen sich in eine Ecke des Zimmers zurück, wo sie flüsternd die Länge ihrer Pfefferminzstangen verglichen.
Banner richtete den Blick auf die Frau im Bett. Sie war so dünn, dass ihre Hüftknochen deutlich unter der Decke hervortraten. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen und waren von dunklen Rändern umgeben. Das braune Haar war glanzlos und verfilzt.
»Hildie, das ist Dr. O’Brien«, stellte Adam sie sanft vor. »Wärst du bereit, dich von ihr untersuchen zu lassen?«
Hildies schmerzgepeinigter Blick ruhte auf der gesunden, hübschen Frau, die neben Adam stand. »Wenn Sie hinausgehen, Dr. Corbin«, sagte sie leise. »Mein Fitz will nicht ...«
Adam hob ergeben die Hand. »Ich weiß«, unterbrach er sie. »Er will nicht, dass ein anderer Mann dich ohne Kleider sieht.«
»Es ist unanständig«, murmelte Hildie.
Adam seufzte leise, aber so ungeduldig, dass Banner überrascht aufschaute. Sie hatte die ganze Zeit versucht, den Geruch zu analysieren, der in diesem Zimmer hing und die Kochdünste, den Tabakgeruch und den Gestank eines unausgeleerten Nachttopfes noch übertraf.
»Ich gehe mit den Jungen nach unten«, sagte Adam.
Hildie richtete sich halb auf. »Kaufen Sie ihnen nichts, Doktor. Machen Sie es nicht wie das letzte Mal.«
Adams Kinn verhärtete sich, aber er erwiderte nichts und winkte den Jungen nur auffordernd zu, mit ihm hinauszugehen.
Dann war Hildie mit der jungen Ärztin allein, und Banner erkannte nun endlich, was der strenge Geruch in diesem Raum zu bedeuten hatte.
»Machen Sie bitte Ihre Brust frei«, forderte sie und verbarg ihre Verzweiflung hinter einem aufmunternden Lächeln.
Hildie gehorchte zögernd. »Wie sind Sie Arzt geworden?«, erkundigte sie sich verwundert.
»Es war nicht leicht«, antwortete Banner beherrscht, obwohl ihr die Galle in die Kehle stieg. Hildies rechte Brust war von einer unheilbaren Krankheit zerfressen.
»Meine Ma hatte es im Bein«, gestand Hildie mit zitternder Stimme, die ihre Angst verriet. »Sie wurde blind, meine Ma. Und dann ist sie gestorben.«
Banner schloss einen Moment die Augen und sehnte sich nach der kalten, frischen Luft draußen. Aber sie nahm sich zusammen und reinigte die infizierte Brust mit einer Alkohollösung. Dann gab sie Hildie eine ansehnliche Dosis Laudanum.
Als das erledigt war, goss Banner aus einem Kessel, der auf dem Herd stand, Wasser über ihre Hände und schrubbte sie mit der Kernseife, die sie immer bei sich trug.
Danach ging sie zur Tür, öffnete sie und atmete gierig die frische Luft ein.
Adam wartete unten an der Treppe. In seinem Blick las Banner den gleichen hilflosen Schmerz, den sie fühlte.
Sie trafen sich auf der Treppenmitte, aber Banner konnte nichts sagen. Sie hielt sich die Hand vor den Mund, würgte und rannte die restlichen Stufen hinunter, um sich zu übergeben.
Adam hielt ein weißes Taschentuch bereit, als ihre Übelkeit nachließ. »Krebs?«, fragte er in schulmeisterhaftem Ton.
Banner schüttelte den Kopf und reinigte ihren Mund mit einer Handvoll frischem Schnee. Erst dann antwortete sie. »Diabetes«, und es klang fast wie ein Schluchzen. »Ihre Brust – der Wundbrand hat sie völlig zerstört ...«
Respekt vermischte sich mit dem Mitleid in Adams blauen Augen. »Ich weiß.«
»Woher?«, krächzte Banner. »Woher können Sie das wissen, wenn sie sich nicht von Ihnen untersuchen lässt?«
»Der Geruch.«
Banner nickte abwesend. »Sie muss ins Krankenhaus.«
»Ja.« Adam schaute zum schneeverhangenen Himmel auf. »Aber ...«
»Aber ihr Fitz erlaubt es nicht. Ist es das?«
»Genau. Er ist überzeugt, dass ich Hildie nur in die Klinik bringen will, um meine Gelüste an ihr zu befriedigen.«
Banners Empörung war so groß, dass sie glaubte, daran ersticken zu müssen. In Portland hatte sie einiges an Ignoranz erlebt, aber das hier war kaum noch zu überbieten. »Sie wird sterben.«
»Ich weiß.«
»Und sie muss wahnsinnige Schmerzen haben.«
Adam nickte nur, doch die starre Haltung seiner Schultern und seine fest zusammengepressten Lippen verrieten, wie hilflos er sich fühlte.
Und da liefen Hildies Jungen lachend um die Ecke, bewarfen sich mit Schneebällen und schienen für einen Moment die triste Atmosphäre in ihrem Heim vergessen zu haben.
»Was wird aus den beiden werden?«, flüsterte Banner.
Adam seufzte. »Das weiß der liebe Gott. Im Moment ist Hildie meine größte Sorge. Ich werde heute Abend noch einmal mit Fitz sprechen und versuchen, ihn zu überreden, sie in meine Klinik zu bringen.«
Banner hatte nicht einmal zu träumen gewagt, dass es ein Krankenhaus in Port Hastings gab.
Adam lächelte. Wieder schien er ihre Gedanken erraten zu haben. »Möchten Sie meine Klinik sehen, O’Brien?«
»Ihre Klinik?«
Er nickte. »Da ich sie selber führe, neige ich dazu, sie als meine Klinik zu betrachten.«
»Ganz allein?«, fragte Banner fassungslos.
Adams sah sie lange an. »Eine andere Wahl hatte ich leider nicht«, entgegnete er. »Henderson ist der einzige andere Arzt im Umkreis von fünfundzwanzig Meilen, und diesen Schlächter würde ich nicht einmal an meine Pferde heranlassen, geschweige denn an meine Patienten. So, und jetzt gehe ich Ihren Arztkoffer und Ihren Umhang holen.«
Damit ließ er Banner stehen und ging in Hildies Wohnung zurück. Einer der kleinen Jungen näherte sich Banner und knabberte hingebungsvoll an dem Streifen Trockenfleisch, das Adam für die Kinder gekauft hatte. »Sie haben ja richtig rotes Haar, Miss!«, staunte er.
Bevor Banner etwas erwidern konnte, erschien Adam mit ihren Sachen.
2
Es war ein steiler Weg von Port Hastings zu Adams Klinik – so steil, dass Banner mehrmals vor Angst den Atem anhielt. Um sich davon abzulenken, betrachtete sie die Häuser, an denen sie vorbeifuhren.
Es waren imposante Villen mit gepflegten Gärten und hohen Zäunen. Auf der Hügelkuppe erhob sich ein elegantes, zweistöckiges Haus mit mehreren Schornsteinen und Dutzenden von Fenstern. Eine Seite des Hauses war ganz mit Efeu bewachsen, an der anderen zog sich ein langgestreckter einstöckiger Anbau hin.
»Das ist Ihre Klinik?«, fragte Banner verblüfft, als Adam das Pferd auf das Kopfsteinpflaster der Einfahrt lenkte.
»Es ist mein Haus«, erwiderte er. »Oder besser gesagt, das Haus meiner Mutter. Im rechten Flügel sind die Klinik, meine Praxis und all das.«
Banner war beeindruckt. »Es ist riesengroß«, sagte sie bewundernd. Ob eine Frau hinter diesen Mauern lebte – eine Frau, die Adams Ring am Finger trug? Darüber hatte sie vorher nicht nachgedacht, und jetzt empfand sie den Gedanken als ausgesprochen störend. »Sie haben sicher viele Kinder«, vermutete sie.
Adam lachte kurz, zog die Zügel und ließ das Pferd vor einer Steinveranda halten, die zu mehreren massiven Türen mit Bronzegriffen führte. »Nichts wäre mir lieber«, antwortete er. »Aber der Anstand verlangt, dass ich mir vorher eine Frau suche.«
Die Erleichterung, die Banner überfiel, war so groß, dass ihr der Atem stockte und sie errötete. »Ist Ihnen der Anstand so wichtig, Doktor?«
»Im Allgemeinen nicht«, entgegnete Adam schmunzelnd. »In mancher Hinsicht bin ich sogar ein ziemlicher Draufgänger, könnte man sagen. Aber sobald es sich um Kinder handelt, neige ich eher zu konventionelleren Ideen.«
Banner verspürte ein leises Flattern in ihrem Bauch, als bereitete er sich darauf vor, Adams Kinder zu tragen und zu nähren. Aus Ärger über diese Gedankengänge biss sie sich auf die Lippen und straffte die schmalen Schultern. »Es ist kalt«, sagte sie steif.
Es war eine so offensichtliche Lüge, dass Banner mit Adams Protest rechnete. Denn trotz des kalten Wetters war es angenehm warm unter dem Lederdach des Zweisitzers. Und Adams Gesicht war dem ihren plötzlich so nahe, dass sie einen wilden Augenblick lang sicher war, er würde sie küssen ...
Bevor es jedoch dazu kommen konnte, sprang eine der Türen auf, und ein hübsches junges Mädchen erschien auf der Schwelle. Es hatte große blaue Augen und ebenso dunkles Haar wie Adam. Im rechten Arm hielt es den größten Weihnachtskranz, den Banner je gesehen hatte.
»Adam!«, rief das schöne Wesen begeistert, hüpfte graziös über die schneebedeckten Stufen und eilte auf den Wagen zu.
Adam wandte sich von Banner ab und stieg aus, um das Mädchen zu umarmen. Er zog es stürmisch an sich, schwenkte es herum und küsste es auf beide Wangen.
Banner war zum ersten Mal in ihrem Leben eifersüchtig, doch sie bemühte sich, ein geduldiges Lächeln aufzusetzen. Schließlich war es ja nicht so, als hätte sie einen Anspruch auf die Aufmerksamkeit dieses Mannes, und obwohl er behauptet hatte, nicht verheiratet zu sein, hatte er nicht gesagt, dass es keine Frau in seinem Leben gab ...
Als Adam das entzückende junge Mädchen endlich aus seinen Armen entließ, betrachtete es Banner neugierig, doch ohne Ablehnung. »Wer ist das?«, fragte es neugierig.
Adam machte eine angedeutete Verbeugung. »Melissa, ich möchte dir Dr. Banner O’Brien vorstellen. O’Brien – das ist meine Schwester Melissa.«
Banner war so froh, dass sie das Mädchen am liebsten umarmt hätte. »Hallo«, grüßte sie freundlich, als Adam ihr aus dem Wagen half.
Melissas vielsagender Blick wanderte von Banner zu ihrem Bruder, und ein unausgesprochenes »Aha!« hing in der Luft.
Adam schaute sie strafend an, bevor er Banners Arm nahm und sie ins Haus führte.
»Wann bist du zurückgekommen?«, fragte er Melissa, die den Weihnachtskranz an einen Haken an der Tür hängte.
»Nett, dass du fragst, Adam!«, entgegnete Melissa in vorwurfsvollem Ton.
»Du hättest mich am Hafen abholen sollen oder hast du das schon wieder vergessen?«
Adam machte ein übertrieben zerknirschtes Gesicht. »Jetzt bist du ja da«, meinte er. »Ich sehe also nicht, wo das Problem liegt.«
»Natürlich nicht«, entgegnete das Mädchen, das Banner auf etwa siebzehn Jahre schätzte, und rieb seine Hände, als habe der Weihnachtskranz Staub darauf hinterlassen. »Wäre Jeff nicht gekommen, hätte ich zu Fuß gehen müssen.«
»Wie schrecklich!«, neckte Adam seine Schwester und berührte flüchtig Banners Hand, die auf seinem Arm ruhte.
Die Geste war Melissa nicht entgangen, und nun musterte sie Banner prüfend. »Sind Sie wirklich Ärztin?«, wollte sie wissen.
Adam zwinkerte Banner zu, als er sie durch die Eingangshalle führte. »Ja«, antwortete er in einem Ton, bei dem seiner Kollegin fast der Atem stockte. »Kleeblatt ist wirklich Ärztin.«
Er schien sie akzeptiert zu haben. Banner jubelte innerlich vor Freude. »Können wir uns jetzt die Klinik ansehen?«
Adam geleitete sie durch einen imposanten Speisesaal mit mahagoniverkleideten Wänden, Kristalllüstern und einem Kamin, in dem ein Feuer angenehme Wärme verbreitete. Die schlichten Möbel aus massivem Holz zeugten von Geschmack und gediegenem Wohlstand.
»Bevor Papa das Haus bauen ließ, lebten er und Mama in einer Hütte – genau hier.« Melissa pochte auf den langen, auf Hochglanz polierten Tisch. »Papa sagte oft, meine Brüder seien an der gleichen Stelle zur Welt gekommen, an der Maggie heute das Essen serviert.«





























