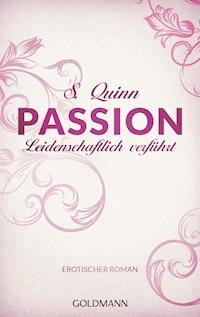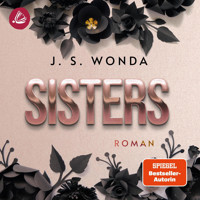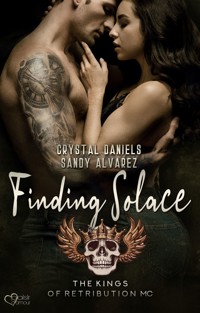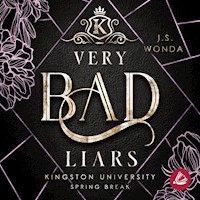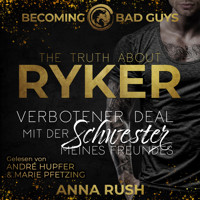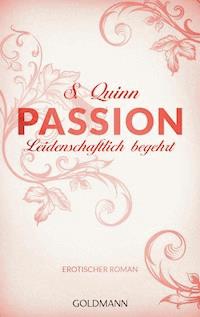
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
Als Seraphina Harper eine Stelle als Kindermädchen in Mansfield Castle annimmt, wird sie gewarnt: Bisher hat es keine Nanny länger als eine Woche in dem geheimnisvollen Herrenhaus ausgehalten. Der Hausherr, der früh verwitwete Lord Patrick Mansfield, ein verboten gutaussehender ehemaliger Offizier, besteht darauf, dass seine Regeln bedingungslos befolgt werden. Doch Seraphina widersetzt sich den Anweisungen des arrogant wirkenden Lords. Schon bald ist Patrick von Seraphina fasziniert. Und je mehr er ihren Widerstand zu brechen versucht, desto tiefer geraten die beiden in eine verbotene, leidenschaftliche Beziehung gegen alle Konventionen ... (Band 1)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Ähnliche
Buch
Als Seraphina Harper eine Stelle als Kindermädchen in Mansfield Castle annimmt, wird sie gewarnt: Bisher hat es keine Nanny länger als eine Woche in dem geheimnisvollen Herrenhaus ausgehalten. Der Hausherr, der früh verwitwete Lord Patrick Mansfield, ein verboten gut aussehender ehemaliger Offizier, besteht darauf, dass seine Regeln bedingungslos befolgt werden. Doch Seraphina widersetzt sich den Anweisungen des arrogant wirkenden Lords. Schon bald ist Patrick von Seraphina fasziniert. Und je mehr er ihren Widerstand zu brechen versucht, desto tiefer geraten die beiden in eine verbotene, leidenschaftliche Beziehung gegen alle Konventionen …
Informationen zu S. Quinn
sowie zu weiteren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
S. Quinn
PASSION
Leidenschaftlich
begehrt
Band 1
Roman
Aus dem Englischen
von Andrea Brandl
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.Die Originalausgabe erschien 2014
unter dem Titel »The Ice Seduction«.
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2015
Copyright © der Originalausgabe 2014 by S. Quinn
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: © FinePic®, München
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
BH · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-15402-8V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
1
Omein Gott. Was war das denn gerade?
Das Herz schlägt mir bis zum Hals, als ich, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunterstürze, die letzten vier überspringe und mit einem dumpfen Knall auf dem glänzenden Parkett aufkomme.
Igitt. Nicht zu fassen, was Mr Carmichael gerade getan hat. Wenn ich bloß daran denke, wie sich sein Arm um meine Taille schlingt, wird mir speiübel.
Kotz.
Seine arme Frau. Okay, mag ja sein, dass Helen Carmichael zu den Ehefrauen gehört, denen ein perfektes Make-up wichtiger ist als die eigenen Kinder, aber einen Mann, der sich an die Nanny heranmacht, verdient nun wirklich keiner.
Ich muss es ihr sagen. Das bin ich ihr schuldig.
Ich drehe mich um und sehe Mr Carmichael die Treppe zur Dachkammer herunterkommen. Sein Designeranzug spannt sich um seinen feisten Körper, sein kurz geschnittenes graues Haar glänzt vor Pomade.
Er sieht mich wie ein geprügelter Welpe an, völlig verzweifelt, als wolle er mich anflehen, bloß nichts zu verraten.
»Ich werde alles Ihrer Frau sagen.« Ich schlage den Weg zum Elternschlafzimmer ein.
»Moment mal, junge Dame«, ruft Mr Carmichael.
Ich beachte ihn nicht.
Helen steht vor dem Spiegel und besprüht sich mit Parfum aus einem dieser altmodischen Flakons. Sie ist bildschön. Und blutjung. Kaum vorstellbar, dass sie und Mr Carmichael das Bett teilen. Die meisten Leute halten sie für Vater und Tochter.
»Mrs Carmichael … Helen.« Ich hole tief Luft.
Bevor ich fortfahren kann, stürmt Mr Carmichael herein und zeigt mit dem Finger auf mich. Mir fällt auf, dass seine Hand zittert.
»Diebin!«, schreit er.
»Wie bitte?«
»Ich habe Sera gerade beim Klauen erwischt.« Sein Gesicht ist dunkelrot angelaufen. »In Rebeccas Zimmer.«
»Soll das ein Witz sein?« Ich kann nur den Kopf schütteln. »Netter Versuch, Mr Carmichael. Echt netter Versuch.«
»Ich habe gesehen, wie sie Geld aus Rebeccas Sparschwein nehmen wollte«, stammelt Mr Carmichael.
»Das gibt’s doch nicht!«, rufe ich. »Ich habe noch nie etwas gestohlen. Der Einzige, der seine Finger nicht unter Kontrolle hat, sind Sie.«
Helen mustert uns abwechselnd.
Unsere Blicke begegnen sich, und mir ist klar, dass sie ganz genau weiß, was Sache ist. Aber ich ahne bereits, dass sie wohl kaum Partei für mich ergreifen wird, sonst könnte sie ihr angenehmes, sicheres Leben mit all dem Schmuck, den vielen Klamotten und den Opernbesuchen sofort in den Wind schreiben.
»Vielleicht liegt ja ein Missverständnis vor«, sagt sie lahm und stellt vorsichtig den Flakon auf der Frisierkommode ab. Auch ihre Hand zittert leicht.
»Sie muss gehen«, erklärt Mr Carmichael und stemmt die Hände in die wabbeligen Hüften. »Auf der Stelle.« Schweißperlen glitzern auf seiner Stirn.
»Das ist doch Irrsinn!« Ich stemme ebenfalls die Hände in die Hüften. »Sie betatschen mich, während Ihre Töchter in den Betten liegen und schlafen, und jetzt wollen Sie mich feuern?«
Ich wende mich Helen zu. »Ich würde niemals stehlen. Niemals. Schon gar nicht Geld aus dem Sparschwein eines kleinen Mädchens. Ich liebe Ihre Töchter heiß und innig, das wissen Sie ganz genau.«
Helen kann mir nicht in die Augen sehen. Stattdessen wirft sie ihrem Mann einen Blick zu, sieht aber ganz schnell wieder weg. Mir fällt auf, dass ihre Hände immer noch zittern.
»Wir regeln die Bezahlung Ihres restlichen Lohns mit der Agentur.« Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern, und auch jetzt meidet sie den Blickkontakt.
»Sie brauchen keine Angst vor ihm zu haben«, fahre ich eine Spur sanfter fort. »Sie wissen genau, dass ich die Wahrheit sage.«
Aber natürlich hat sie Angst vor ihm, und wir wissen beide, dass sie ohne ihn ein Niemand ist.
»Bitte«, flehe ich. »Lassen Sie das nicht zu. Ich liebe die Mädchen, und sie lieben mich.«
»Wir finden ein anderes Kindermädchen«, wirft Mr Carmichael mit seiner Fistelstimme ein. »Eines mit einer richtigen Qualifikation.«
Ich werfe ihm einen finsteren Blick zu. »Was zum Teufel hat ein Abschluss damit zu tun, wie wichtig mir Ihre Kinder sind? Außerdem sind sie Ihnen doch sowieso völlig egal.«
Als ich Mrs Carmichael erneut ansehe, fällt mir auf, dass sich ihre Augen mit Tränen füllen.
»Wenn Sie jetzt gleich packen und verschwinden, lege ich Ihnen keine weiteren Steine in den Weg. Sie bekommen kein schlechtes Zeugnis oder sonst etwas«, sagt er.
»Ich bin seit über einem Jahr bei Ihnen. Und jetzt soll ich einfach bei Nacht und Nebel verschwinden? Ohne Abschied, ohne alles?« Meine Stimme ist zittrig, und mir ist klar, dass ich drauf und dran bin, die Fassung zu verlieren.
»Wenn Sie jetzt sofort gehen, sorge ich dafür, dass Sie keinen Ärger bekommen«, sagt Mr Carmichael.
Helen nimmt den Flakon von der Kommode und sprüht noch etwas Parfum auf ihren Hals.
»Sollten Sie allerdings einen Aufstand machen, muss ich Sie anzeigen«, fährt Mr Carmichael fort. »Überlegen Sie sich das gut. Wie wollen Sie je wieder eine Stelle finden, da Sie noch nicht einmal eine abgeschlossene Ausbildung haben?«
»Ich …« Er hat recht.
Ich habe tatsächlich keine Ausbildung als Kindermädchen, zumindest keine offiziell anerkannte. Ich bin mit sechzehn von der Schule abgegangen und war nie auf dem College. Meine Jobs bekomme ich über Mundpropaganda. Weil ich einen guten Ruf habe. Zumindest bis heute.
»Haben Sie nicht eine jüngere Schwester, die Sie finanziell unterstützen? Es wäre doch schade, wenn die Kleine ihre Tanzausbildung abbrechen müsste, oder?«
Um mich herum beginnt sich alles zu drehen.
Verdammt!
Er hat recht. Ich kann mir nicht erlauben, dass mein Ruf beschädigt wird. Ich brauche eine anständig bezahlte Stelle, so einfach ist das.
»Erlauben Sie mir wenigstens, dass ich mich von den Mädchen verabschiede. Das sind Sie den beiden schuldig. Notfalls auch morgen. Ich rufe sie an und sage Auf Wiedersehen.«
»Vielleicht …«, beginnt Mr Carmichael, doch Helen fällt ihm ins Wort.
»Natürlich dürfen Sie sich verabschieden«, sagt sie. »Sie können jederzeit anrufen.«
»Danke.« Eine Träne kullert mir über die Wange.
Helen berührt meinen Arm. Kurz schweift ihr Blick zu ihrem Mann, dann sieht sie mich wieder an. »Es tut mir leid, Sera. Aufrichtig leid.«
2
Beim Nachhausekommen bin ich immer noch wie gelähmt. Ich lebe mit meiner Schwester auf einem Hausboot in der Nähe von Camden Lock. Es ist zwar beengt und ständig feucht, aber es ist unser Zuhause.
Die Vorstellung, nicht da zu sein, wenn Rebecca und Rachel morgen früh aufwachen, macht mich ganz krank. Ich liebe die beiden heiß und innig. Dass ihnen nun so wehgetan wird …
Und wo soll ich auf die Schnelle einen neuen Job herbekommen? Dass ich dringend Geld brauche, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Trotz meines Vollzeitjobs haben wir gewaltig Mühe, über die Runden zu kommen.
Meinem hervorragend vernetzten Bruder und seinen zahllosen Freunden haben wir es zu verdanken, dass wir quasi mietfrei hier wohnen, aber die Gebühren für Wilas Tanzausbildung bringen mich jeden Monat aufs Neue in finanzielle Bedrängnis.
Meine kleine Schwester Wila ist ein Naturtalent – sie ist eine begnadete Tänzerin und hat vor ein paar Jahren einen der begehrten Plätze an der Prince Regent Ballet School in West London ergattert.
Das ist eine echte Sensation.
Das Problem sind die astronomischen Schulgebühren, die uns zwingen, uns hauptsächlich von Dosensuppe und Knäckebrot zu ernähren. Aber dieses Opfer bringe ich gern.
Tausende Mädchen würden alles für einen Platz an der Schule geben, und wenn Wila ihren Abschluss schafft, eröffnen sich ihr Möglichkeiten, die keiner aus unserer Familie je hatte.
Und ich werde unter keinen Umständen zulassen, dass ihr diese Gelegenheit durch die Lappen geht.
Das Boot schwankt, als ich meine Tasche auf das alte, durchgesessene Sofa fallen lasse.
Ich setze mich hin und stütze den Kopf in beide Hände.
Verdammt, verdammt, verdammt. Was mache ich jetzt bloß?
»Pheeny? Bist du’s?« Wilas hohe, klare Stimme dringt aus der Schlafkabine, die wir uns teilen.
»Ja, Lala.« Ich presse mir die Handballen auf die Augen, hole tief Luft und versuche zu lächeln. »Ich komme gerade von der Arbeit. Wie war’s heute in der Schule?«
»Du bist früh dran.« Wila kommt in den winzigen Wohnbereich getänzelt und dreht eine Pirouette vor mir. »Mein Tag war prima.«
Wila fühlt sich manchmal etwas isoliert, weil alle anderen Schülerinnen das angeschlossene Internat besuchen, aber an eine Unterbringung dort ist nicht einmal im Traum zu denken.
Ich lege die Arme um sie und drücke sie an mich. »Wie schön.«
Manchmal mache ich mir Sorgen um Wila. Sie ist noch ein halbes Kind, sowohl optisch als auch was die Reife betrifft. Es braucht nicht viel, um sie in Tränen ausbrechen zu lassen.
»Irgendwas stimmt nicht, Pheeny, hab ich recht?« Sie sieht mich aus ihren großen blauen Augen an. Mit ihrem zarten Gesichtchen und dem aschblonden, zu einem hoch sitzenden Knoten frisierten Haar sieht sie wie der Inbegriff der Ballerina aus. Im Grunde kann sie nur Tänzerin werden.
Manchmal kann ich kaum glauben, dass wir Schwestern sind. Zwar haben wir dieselben elfenhaften Züge – eine winzige Stupsnase, zarte Ohren und ein spitzes Kinn –, aber mit meinem leuchtend roten Haar und den braunen Augen mit Goldsprenkeln bin ich das glatte Gegenteil von ihr.
Und auch charakterlich sind wir völlig verschieden. Wila ist hinreißend und süß, ich dagegen kann ziemlich die Stacheln ausfahren, wenn jemand den Menschen zu nahe kommt, die mir am Herzen liegen. Andererseits sind wir nur Halbschwestern, mit verschiedenen Vätern, was es wahrscheinlich erklärt.
»Es ist alles in Ordnung. War nur ein anstrengender Tag. Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest.«
Wila tritt einen Schritt zurück und legt den Kopf schief.
Oje, jetzt kommt wieder die Psychonummer – als könnte sie geradewegs in mich hineinsehen.
»Hier stimmt etwas nicht.«
»Nein. Ehrlich. Es ist nur … Es war ein langer Tag, mehr nicht.«
»Du kannst es mir sagen, Pheeny. Ich bin sechzehn, also praktisch erwachsen.«
Ich lache. »Wenn du mich fragst, hast du noch ein paar Jahre vor dir, bis es so weit ist, kleine Tanzfee.«
»Los, raus damit. Sonst löchere ich dich so lange, bis ich es herausgefunden habe.«
Ich seufze. »Es gab nur ein bisschen Ärger bei der Arbeit. Aber das kriege ich schon hin. Wir schaffen das. Ich suche mir etwas anderes. Etwas Besseres.«
Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das anstellen soll.
3
Aber irgendetwas muss es doch geben.« Ich sitze vor Sharons vollgepacktem Schreibtisch.
Sharon ist meine Agentin. Die meisten Nannys haben Agenten. Sharon steht mit all den reichen Familien in engem Kontakt, bringt uns zusammen und kassiert dafür einen Teil meines Lohns als Provision. Aber Sharon ist auch meine Freundin; sogar eine meiner besten.
Sie schüttelt den Kopf. »Tut mir echt leid.« Eine Mischung aus Zuneigung und Sorge spiegelt sich in ihren hellbraunen Augen wider.
Sie hat ihre Garage zum Büro umfunktioniert. Die Betonwände sind kahl, und das ganze Jahr über hängt ein leicht modriger Geruch in der Luft. Und während der Wintermonate ist es trotz des kleinen Elektroheizstrahlers eiskalt hier.
»Bitte. Irgendeine freie Stelle muss es doch geben. Ich würde alles tun, völlig egal, was. Auch wenn die Leute noch so schlimm sind.«
Sharon schürzt ihre knallrot geschminkten Lippen und blickt an die Decke. Sie ist überzeugter Achtziger-Fan und erinnert mich immer an eine der Hauptdarstellerinnen aus Dallas. Ihre Haare sind raspelkurz und auffallend stark gesträhnt, ihre Augen sind dick mit Kajalstift umrandet, und sie trägt fast ausschließlich Oberteile mit dicken Schulterpolstern.
»Hm.« Sie sieht über meine Schulter hinweg zur geschlossenen Garagentür. »Na ja. Eine Möglichkeit hätte ich natürlich …«
»Sharon.«
»Moment.« Sie tippt etwas in ihren Computer. »Sie haben zwar keinen Ersatz angefragt, aber bisher haben wir immer wieder neue Mädchen hingeschickt.« Sie runzelt die Stirn. »Und jemand hat gerade gekündigt. Also …«
»Also?«
»Also sollten wir unser Glück versuchen. Mansfield Castle, so heißt der Kasten.«
4
Mansfield Castle?«
»Ja«, bestätigt Sharon vorsichtig.
»Klingt spannend. Ich habe noch nie in einem Schloss gearbeitet.«
Sharon tippt sich mit ihrem lackierten Nagel gegen die Lippen. »Ich schicke praktisch im Wochentakt neue Mädchen hin. Und nach ein paar Tagen rufen sie mich alle heulend an und wollen, dass ich sie wieder nach Hause hole.«
»Wieso das?«
»Wegen des kleinen Jungen dort. Er ist … ein bisschen schwierig.«
»Es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur Erwachsene, die nicht genug Verständnis für sie aufbringen.«
Sharon nickt. »Das zweite Problem ist der Boss.«
»Was ist mit ihm?«
»Er ist … na ja.«
»Sharon, du wirst ja ganz rot.«
»Echt?« Sharon fächelt sich mit der Hand Luft zu.
»Also, was ist mit dem Typen?«
»Er ist sehr streng. Er duldet keine Dummköpfe um sich und wird ziemlich ungehalten, wenn die Mädchen mit Bertie nicht umgehen können.«
»Und wieso wirst du so rot?«
Sie seufzt. »Okay. Und er sieht verdammt gut aus.« Die Röte breitet sich über ihr Gesicht und ihren Hals aus. Sie räuspert sich. »Er ist ein sehr attraktiver Mann. Patrick Mansfield heißt er. Lord Patrick Mansfield, um genau zu sein. Klingelt da etwas bei dir?«
Ich schüttle den Kopf. »In diesen Kreisen bewege ich mich normalerweise nicht.«
Sharon beugt sich vor. »Anscheinend haben sich manche Mädchen in ihn verknallt. Genützt hat es ihnen allerdings herzlich wenig, weil Lord Mansfield sich nicht viel Zeit für Frauen nimmt.«
»Du willst damit sagen, er ist schwul?«
Sharon lacht. »Wohl kaum. Laut Catwalk gehört er zu den begehrtesten Männern des Landes, und die Frauen liegen ihm massenweise zu Füßen, aber er ist eben ein richtiger Kerl.«
»Ach so?«
»Er hat einen eigenen Survival-Blog, der manchmal im Radio zitiert wird. Er schreibt darüber, wie man unter widrigsten klimatischen Bedingungen im Freien überlebt. Er schläft offenbar regelmäßig im Wald und ernährt sich von Tieren, die er eigenhändig erlegt hat. Solches Zeug eben. Außerdem hat ihn sein Olympiasieg zur Berühmtheit gemacht.«
»Er hat olympisches Gold geholt? In welcher Disziplin denn?«
»Im Schießen.«
»Und bisher ist kein Kindermädchen länger als eine Woche geblieben?«, frage ich nachdenklich.
Sharon schüttelt den Kopf. »Nein. Und das gilt nicht nur für die Jüngeren. Ich habe auch erfahrenere Damen hingeschickt, die ebenfalls innerhalb weniger Tage ihre Sachen gepackt haben. Eine hat sogar bloß ein paar Stunden durchgehalten.«
»Wie schlimm kann ein Job sein, dass man nach ein paar Stunden das Handtuch wirft?«
»Wie gesagt, der Junge ist schwierig.«
»Und wie ich bereits gesagt habe – es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Eltern. Also muss Patrick derjenige mit den Problemen sein.«
»Patrick Mansfield ist nicht Berties Vater.«
»Nicht?«
»Nein, er ist sein Onkel. Patricks jüngere Schwester Anise hat Bertie bekommen, als sie noch blutjung war. Seitdem wurde der Kleine wie ein Wanderpokal herumgereicht, bis er diesen Winter bei seinem Onkel Patrick gelandet ist.«
»Klingt, als bräuchte der Kleine dringend sehr viel Liebe. Und was diesen Patrick Mansfield angeht, bin ich sicher, dass ich das schon hinkriege. Du kennst mich ja. Ich gehöre nicht zu den Mädchen, die sich Hals über Kopf in einen Mann verlieben, nur weil er gut aussieht und ein bisschen Kohle hat.«
»Aber er sieht verdammt gut aus.« Sharon blickt wieder auf ihren Bildschirm.
»Ich bin sicher, auch damit kann ich umgehen.«
»Die Bezahlung ist hervorragend. Doppelt so viel Gehalt wie sonst. Und auch wenn die Mädchen gehen, bekommen sie ihr volles Monatsgehalt ausbezahlt. Aber es gibt noch ein anderes Problem.«
»Und zwar?«
»Mansfield Castle liegt nicht gerade um die Ecke. Und deine kleine Schwester wohnt doch bei dir.«
Eisige Finger legen sich um mein Herz. »Wie weit ist es weg? Im Norden von London? Oder noch weiter?«
»Viel weiter. Mansfield Castle ist in Schottland.«
5
Gedankenverloren schlängle ich mich auf meinem Motorrad durch den Vormittagsverkehr nach Camden zurück.
Am Camden Market stelle ich die Maschine ab.
»Hey, Sera«, ruft mir einer der Standbesitzer zu.
»Hey, Tony.« Ich winke ihm zu. »Hast du Danny zufällig gesehen?«
Tony tritt aus seinem Stand. »Ja. Er ist dahinten. Alles in Ordnung? Du siehst ganz schön fertig aus.«
»Ach, das Übliche eben.« Ich streiche mir das Haar glatt und ziehe meine Schaffelljacke enger um mich. Es ist ein windiger Januartag, und die Eisschicht auf dem Asphalt knackt unter meinen Cowboystiefeln.
»Ich hätte ein Kräutchen zum Entspannen für dich«, meint Tony.
»Du solltest doch allmählich wissen, dass ich dieses Zeug nicht nehmen will, Tony«, erwidere ich lächelnd. »Und du solltest es dir auch nicht schon um diese Uhrzeit reinziehen, sonst wird es noch zur Gewohnheit.«
Tony lacht – ein rasselndes Raucherlachen. »Ist es längst.«
»Alles in Ordnung mit Danny?«
»Die Polizei war vorhin da.«
»Oje.«
»Eines Tages schnappen sie ihn noch. Aber nicht heute.«
Ich verdrehe die Augen. »Klingt ganz nach Danny. Der Kerl hat neun Leben. Mindestens.« Ich schiebe mich durch die mit Zigarettenstummeln und zerdrückten Bierdosen übersäten Gänge zwischen den Buden, sorgsam darauf bedacht, ganz flach zu atmen, um nicht zu viel von dem umherschwebenden Hasch abzubekommen.
Mein Bruder Danny steht in seinem gewohnten Outfit – weite, zerrissene Jeans, Wollpulli und eine alte Armeejacke – und mit einer selbst gedrehten Zigarette in der Hand schlotternd hinter seinem Stand.
»Schwesterherz!« Er grinst und entblößt dabei sein weißes Gebiss. Eigentlich ist mein Bruder ziemlich attraktiv, aber seine Frontzähne sind teilweise abgebrochen und schiefer als so mancher Gartenzaun. »Solltest du nicht bei der Arbeit sein?«
»Die haben mir gekündigt. Kennst du zufällig jemanden, der Leute braucht?«
»Wie bitte?« Danny stößt den Rauch aus. »Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber hier werden die Leute maximal vor die Tür gesetzt.«
Wir beobachten die Schnäppchenwütigen, die sich durch die Gänge schieben. Man erkennt auf den ersten Blick, wer Tourist ist und wer hier lebt: die traurigen Augen, das nervöse Zucken und der grünliche Teint von Langzeitjunkies sprechen Bände.
»Wie kommt es, dass man dich gefeuert hat?«, will Danny wissen.
»Mr Carmichael hat mich begrapscht.«
»Den prügle ich windelweich.«
»Ach, es bringt doch nichts, sich deswegen Ärger einzuhandeln. Außerdem ist er steinreich und hat überall Freunde. Ich wusste von Anfang an, dass er ein Drecksack ist, aber das hätte ich ihm nicht zugetraut.«
»Und wie geht’s jetzt weiter? Bei deinen Referenzen sollte es doch kein Problem sein, etwas Neues zu finden, oder?«
»Es gibt im Moment aber nichts. Zumindest nicht hier. Eine Stelle könnte ich sofort antreten, doch die ist in Schottland. Das ist zu weit weg.«
»So weit ist es nun auch wieder nicht.« Danny bläst eine weitere Qualmwolke in die Luft. »Und wenn es bedeutet, dass du hier rauskommst, kann es nur ein gutes Angebot sein.«
»Aber Wila …«
»Sie ist sechzehn. So alt wie du, als du von zu Hause ausgezogen bist. Sie kommt allein klar.«
Ich schüttle den Kopf. »Wila ist nicht wie wir, Danny. Sie braucht mehr Fürsorge.«
»Vielleicht hatte sie sogar zu viel davon, und es wäre besser für sie, wenn man sie ihr Ding allein machen ließe.«
»Ich glaube nicht, dass sie schon so weit ist.« Ich seufze. »Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Monat das Schulgeld zusammenbekommen soll. Ich habe schon dort angerufen und um Aufschub gebeten. Aber sie haben Nein gesagt.«
»Verdammt! Ich wünschte, ich könnte dir etwas leihen.«
»Selbst wenn du könntest, würde ich es nicht annehmen. Du brauchst dein Geld für dich. Du bist alleinerziehender Vater.«
»Wie du, wenn man es genau nimmt. Du tust doch alles für sie.« Danny wirft seinen Zigarettenstummel auf den Boden und tritt ihn mit der Sohle seines löchrigen Converse-Turnschuhs aus. »Wenn du ein Jobangebot und dadurch die Möglichkeit hast, von hier abzuhauen, dann nimm es an. Was für eine Zukunft erwartet dich hier schon? Wenn du hierbleibst, endest du noch wie wir alle – zu viele Joints, zu viel Alkohol und immer mit einem Fuß über dem Abgrund. Was hält dich hier noch?«
»Wila. Und die Band.«
»Ich bitte dich. Sollten wir als Band jemals etwas auf die Reihe kriegen, wäre es pures Glück. Du bist die Einzige von uns, die Talent hat. Du könntest es ohne Weiteres auch solo schaffen. Deine Stimme ist der reine Wahnsinn.«
»Es gibt massenhaft gute Sängerinnen.« Verlegen fingere ich an den flauschigen Ärmeln meiner Jacke herum.
»Aber keine so guten wie dich.«
»Außerdem ist es sowieso egal. Ich kann Wila nicht allein lassen, das weißt du genauso gut wie ich.«
Danny runzelt die Stirn. »Wieso redest du nicht mal mit ihr? Frag sie, ob sie etwas dagegen hat, dass du für eine Weile nach Schottland gehst. Außerdem hat sich das mit der Ballettakademie wahrscheinlich sowieso erledigt, wenn du den Job nicht annimmst. Und das will keiner von uns. Sie ist genauso talentiert wie du. Ihr beide habt die Chance, von hier wegzukommen, und diese Schule ist Wilas Fahrkarte in ein anderes Leben.«
Ich beiße mir auf die Lippe. »Ich kann mir nicht vorstellen, sie allein zu lassen. Sie ist doch noch ein Kind.«
»Vielleicht weniger, als du glaubst.«
6
Als Wila von der Schule nach Hause kommt, mache ich ihr ein Sandwich und verfrachte sie mit ihrem Teller auf die Couch – da wir keinen Esstisch haben, nehmen wir all unsere Mahlzeiten dort ein, was zur Folge hat, dass der hellrote Sofaüberwurf unablässig mit Krümeln übersät ist.
»Ich habe heute einen Job angeboten bekommen«, erkläre ich ihr. »Aber die Leute wohnen zu weit weg. Du würdest doch nicht wollen, dass ich einen Auftrag annehme, für den ich ewig weit weg müsste, oder?«
Wila zuckt die Achseln. »Damit käme ich schon klar. Solange es nicht für immer ist.«
Das schockiert mich ein bisschen. »Ernsthaft?«
»Klar.«
»Aber wer soll dann kochen, putzen, den Kamin reinigen und all das? Das schaffst du doch nie im Leben. Nicht bei deinen vielen Proben und den Hausaufgaben.«
»Vielleicht bräuchtest du dir darum ja keine Gedanken zu machen.«
»Wieso nicht?«
Ein geheimnisvolles Lächeln spielt um ihre Lippen. »Ich habe mich für das Internatsstipendium beworben.«
»Ein Internatsstipendium?«
Sie nickt. »Die Schule vergibt jedes Jahr eins. Für Externe, die sich die Unterbringung nicht leisten können. Und soll ich dir was verraten? Ich hab’s bekommen.«
Mir fällt die Kinnlade herunter. »Du … Wow! Lala, das ist ja Wahnsinn! Wieso erzählst du mir das erst jetzt?«
»Ich wusste nicht recht, wie ich es dir sagen soll. Ich wohne so gern mit dir zusammen. Aber jetzt, da du für eine Weile weggehst und ich hier allein wäre …«
»Es würde dir also nichts ausmachen? Im Internat zu wohnen, meine ich.«
Wila blickt auf ihr Sandwich. »Ich finde es viel schlimmer, nicht dazuzugehören, weil ich eine Externe bin. Das ist das Einzige, was mir echt zu schaffen macht.«
Ich betrachte ihr süßes, unschuldiges Gesicht. »Ich weiß nicht recht, Lala. Wir reden hier von einer wichtigen Entscheidung. Wir waren noch nie voneinander getrennt.«
»Das weiß ich. Aber vielleicht ist es allmählich Zeit, dass ich erwachsen werde.«
Ich muss lachen. »Danny hat genau dasselbe gesagt. Findest du, ich behandle dich wie ein kleines Kind?«
»Manchmal«, antwortet Wila, ohne den Blick von ihrem Teller zu lösen. »Ich weiß ja, dass du mich lieb hast und so, aber du machst dir zu viele Sorgen. Ich bin reifer, als du glaubst.«
»Meine kleine Schwester … eine erwachsene Frau.«
»Na ja, vielleicht noch nicht ganz, aber auf dem besten Weg, eine zu werden.«
»Ich wollte unbedingt, dass du auf der Schule bleiben kannst, egal, was passiert. Danny hat recht, wenn er sagt, dass der Abschluss deine Fahrkarte in ein anderes Leben ist. Wenn du im Internat unterkommst, wäre es vielleicht tatsächlich nicht so schlimm, wenn wir getrennt wären. Es ist ja nur für eine Weile«, sage ich mehr zu meiner eigenen Beruhigung als zu Wilas.
»Klar, Pheeny.« Wila strahlt mich an.
»Okay. Tja, in diesem Fall sollte ich Sharon anrufen.«
»Wie lange wirst du weg sein?«, fragt Wila.
»Wenn ich Sharon glauben kann, nicht allzu lange«, antworte ich lachend. »All die anderen Nannys waren nach nicht mal einer Woche wieder zu Hause.«
»Muss ein übler Job sein, wenn so viele das Handtuch werfen.«
»Kann sein, aber ich bin hartnäckig. Ich schaffe das schon. Wir schaffen das schon.«
»Ich weiß, Pheeny. Das haben wir doch immer getan.«
7
Scheiße! Wieso habe ich nur so einen miserablen Orientierungssinn?
Die Straße schlängelt sich durch die Landschaft – meilenweit nichts als Tannen und graue, verschneite Berge. Und nirgendwo ein Straßenschild.
Tatsache ist, dass mir der Hintern von der langen Fahrt auf dem Motorrad wehtut, dass ich dringend auf die Toilette muss und meine Schenkel vom überhitzten Metalltank meiner Suzuki brennen.
Die Gitarre, die ich mir auf den Rücken geschnallt habe, knallt pausenlos gegen meine Schaffelljacke und fühlt sich im Fahrtwind wie ein riesiger Bremsschirm an.
Weit kann es nicht mehr sein. Ringsum gibt es bloß Berge und Bäume, und wie nennen die hier oben die Seen noch mal? Ach ja – Lochs.
Aber ich kann nirgendwo einen Hinweis auf Mansfield Castle erkennen. Außerdem bin ich spät dran. Ich hasse Zuspätkommen. Wieso gibt es hier keine Wegweiser, verdammt noch mal?
Ich fahre an den Straßenrand, steige ab und hüpfe auf der Stelle, um die Blutzirkulation in meinen Beinen wieder in Gang zu bringen.
Dann nehme ich den Helm ab und lege ihn auf die Sitzbank. Ich muss Sharon anrufen und sagen, dass ich zu spät komme, aber … Herrgott noch mal!
Kein Netz.
Wie kann ein Mensch in einer Gegend ohne anständiges Telefonsignal leben?
Orte wie dieser machen mir Angst – mitten in der Pampa, keine Menschenseele, sondern nichts als Einöde und Kälte.
Ich sehe mich um. Irgendwo muss es doch ein Haus oder eine Telefonzelle oder sonst etwas geben. Aber ich stehe mitten in der Wildnis.
Die Luft ist so frisch und sauber und die Landschaft wunderschön, aber was nützt einem das, wenn man keinen Handyempfang hat? Die Stadt fehlt mir schon jetzt, dabei bin ich gerade einmal ein paar Stunden weg.
In dem Moment, als ich mich wieder in den Sattel schwingen will, höre ich ein Geräusch.
Ein Quietschen. Instinktiv umfasse ich den Lenker fester, doch dann mache ich einen alten Mann aus, der schnaufend und ächzend auf einem uralten Fahrrad auf mich zugestrampelt kommt.
Dem Himmel sei Dank. Ein menschliches Wesen.
»Hallo«, rufe ich und rücke meine Gitarre zurecht. »Entschuldigung! Hallo, können Sie mir helfen?«
Der alte Mann schiebt sein Fahrrad über die Straße und bleibt keuchend vor mir stehen.
Neben dem quietschenden Drahtesel wirkt mein Motorrad wie der reinste Feuerdrache.
»Na, sieh mal einer an«, sagt er, als sein Blick auf die Gitarre auf meinem Rücken fällt. »Eine reisende Musikantin. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein?« Er trägt ein dünnes Hemd und eine Cordhose.
»Ist Ihnen nicht kalt?«, frage ich schlotternd.
»Kalt?« Der alte Mann sieht mich verdattert an. »Hier unten im Tal? Ich? Großer Gott, nein.« Er dreht sich um und zeigt auf die schneebedeckten Hügel. »Da oben, da ist es kalt.«
Ich folge seinem Blick. Die Berge sind wunderschön.
»Ich suche Mansfield Castle. Kennen Sie es zufällig?«
Der Mann lacht. »Kennen? Ha! Allerdings. Ich arbeite dort.«
»Wirklich?«
Er nickt. »Ich bin der Gärtner. Gregory Croft. Und wer sind Sie?«
»Das neue Kindermädchen.«
»Oh.« Gregory nickt. »Schon wieder eine Neue. In Mansfield werden die Nannys nicht sonderlich alt.«
»Das habe ich auch schon gehört. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?«
»Der kleine Mann kann eine ziemliche Plage sein. Und Mr Mansfield hat die Geduld nicht gerade gepachtet. Er hat keinen Nerv für Nannys, die mit seinem Neffen nicht fertigwerden.«
»Wie lange arbeiten Sie schon dort?«
»Seit Jugendtagen. Ich habe Patrick und seinen Bruder aufwachsen sehen. Aber seit ein paar Jahren hält Patrick das Zepter in der Hand. Nach dem Tod seiner Großmutter ist er zurückgekommen. Bis dahin war er in der Armee.«
»Wie ist er so?«, frage ich.
»Solange Sie ihm nicht in die Quere kommen und den Mund nur aufmachen, wenn Sie aufgefordert werden, sollte es schon hinhauen.«
Ich muss lachen. »Ich habe noch nie zu den Mädchen gehört, die nur reden, wenn sie dazu aufgefordert werden.«
»Tja, Mr Mansfield hat durchaus etwas übrig für Herausforderungen.« Er streckt mir seine schwielige Hand hin. »Freut mich. Wie war Ihr Name noch?«
»Seraphina Harper.«
»Hübscher Name für ein hübsches Mädchen. Sie klingen nicht, als würden Sie aus der Gegend stammen, Miss Seraphina. Aber mit Ihren roten Haaren passen Sie perfekt hierher.« Er erklärt mir den Weg zum Schloss, ehe er wieder auf sein Fahrrad steigt. »Dann bis bald.«
Damit radelt er quietschend davon.
8
Als ich um die nächste Kurve fahre, sehe ich Mansfield Castle hinter einem Streifen dichten Waldes hervorblitzen.
Wahnsinn!
Ich bleibe stehen und lasse den Anblick auf mich wirken.
Selbst ich muss zugeben, dass es ein Traum von einem Schloss ist, vielleicht noch schöner als der Sonnenuntergang über Big Ben oder die verschneite London Bridge.
Ein Teil des Schlosses ist von Wald verdeckt, trotzdem kann ich Türme, die schottische Flagge und grünbraune Steinmauern ausmachen.
Als kleines Mädchen war ich glühender Fan von Die Schöne und das Biest, und dieses Schloss sieht genau so aus wie das im Film.
Verbirgt sich in Mansfield Castle wohl auch ein Biest? Vielleicht in Gestalt von Patrick Mansfield, der all die Kindermädchen in Angst und Schrecken versetzt?
Die Türme haben etwas Düsteres, Geheimnisvolles. Das ganze Schloss wirkt so kalt und abweisend. Und verschlossen.
Links von mir verläuft ein Weg, der sich durch die silbrig grünen Wälder in Richtung Schloss schlängelt.
»Mansfield Castle« steht auf einem moosüberwucherten Schild.
Es widerstrebt mir, den Pfad mit dem Motorrad entlangzubrettern und diese herrliche Idylle zu stören. Der Lärm könnte die Vögel verjagen. Also steige ich ab und fange an zu schieben. Mein Rücken dankt mir die Bewegung nach dem langen Sitzen.
Ich sauge die kalte, frische Luft tief ein und lasse den Blick über das moosige Ufer, die immergrünen Bäume und zerklüfteten weißen Felsbrocken schweifen. Schon komisch, wohin das Leben einen so führt, denke ich.
Gestern noch habe ich mich von den Massen die Camden High Street entlangschieben lassen, und heute bin ich im schottischen Hochland, ohne eine Menschenseele weit und breit.
Schließlich stehe ich vor dem Schloss und hole ein weiteres Mal tief Luft.
Wow!
Das Anwesen in seiner vollen Pracht raubt einem den Atem – runde Ecktürme aus grauem Stein, schlanke Türme in der Mitte, wuchtige Mauern mit Zinnen. Und ringsum ist ein herrlicher Garten angelegt.
Ich dachte immer, so etwas gibt es nur im Märchen.
Über mir spannt sich ein kalter weißer Himmel, der irgendwie zu dem Schloss zu passen scheint. Alles fühlt sich nach Winter an, die braungrauen Mauern, die dunklen Fenster, einfach alles.
Ein leiser Schauder überläuft mich, als ich zu den Fenstern emporblicke. Ich habe das seltsame Gefühl, dass mich jemand beobachtet.
Ich schiebe das Motorrad an die Hauswand, befestige den Helm am Rahmen, hebe meine Tasche vom Gepäckträger und trete vor die schwere, rot gestrichene Eingangstür.
Sie ist dreimal so groß wie ich, und als ich gegen das dicke Holz klopfe, kann ich mich nur fragen, wer um alles in der Welt mich hören soll.
Ich warte. Wieder schweift mein Blick zu den Fenstern.
Da – auch jetzt beschleicht mich das Gefühl, beobachtet zu werden.
Ich recke den Hals und glaube eine Bewegung in einem der Türme zu erhaschen, aber dann ist der Moment vorüber, und das Fenster wirkt wieder kalt und unbelebt.
Ein Knarren lässt mich zusammenzucken. Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie sich die Tür langsam öffnet.
9
Ich setze mein überzeugendstes Supernanny-Lächeln auf. »Hallo!«
»Wer sind Sie?« Eine argwöhnische Frauenstimme dringt aus dem Innern des Schlosses.
Die Tür schwingt noch weiter auf.
»Äh«, stammle ich und bemühe mich um einen fröhlichen Tonfall, obwohl mich der frostige Empfang ziemlich irritiert. »Ich bin Seraphina Harper, das neue Kindermädchen. Bitte entschuldigen Sie, ich bin ein wenig …«
»Das neue Kindermädchen?« Die Tür öffnet sich noch ein Stück. Vor mir steht eine ältere, kreidebleiche Frau mit verkniffenem Gesicht und tiefschwarzem, zu einem strengen Knoten frisiertem Haar.
Ihre Lippen sind beinahe blau, und sie trägt ein schwarzes Kleid aus dickem Wollstoff mit einem kleinen weißen Kragen und weißen Rüschen an den Ärmeln, das ihren Körper vom Hals bis zu den Knöcheln umhüllt.
Sie sieht aus, als käme sie von einer Beerdigung; nein, eher als wäre sie diejenige, die im Sarg liegen müsste.
»Ja. Sharon von der Agentur schickt mich.«
Die Frau runzelt die Stirn. Ein dichtes Netz aus Falten überzieht ihr bleiches Gesicht. »Aber wir haben kein neues Mädchen von dieser Agentur angefordert. Die taugen alle nichts.«
Mist.
Ich schwinge meine Gitarre über die Schulter. »Aber Sharon sagte, Sie hätten eine Art Dauerabo. Sobald ein Mädchen weg ist, schickt sie jemand anders.«
»Vielleicht hat Mr Mansfield … Ich muss ihn fragen, aber er ist gerade nicht da. Er hat einen Geschäftstermin und kommt erst am späten Abend zurück.«
Sie mustert mich von oben bis unten. Dabei bleibt ihr Blick an meiner Gitarre hängen. »Wozu soll die denn gut sein?«
Ich lege die Hand auf die Hülle. »Meine Gitarre begleitet mich überallhin. Die meisten Kinder lieben Musik.«
»Von Kindern sollte man am besten weder etwas hören noch sehen.«
Ich stemme die Hände in die Hüften. »Die Welt wäre ziemlich trostlos, wenn das so wäre.«
Die Frau zieht eine dünn gezupfte Braue hoch. »Mr Mansfield hat wenig übrig für Personal, das Widerworte gibt. Sollte er Sie engagieren, kann ich nur für Sie hoffen, dass Sie lernen, Ihre Zunge im Zaum zu halten.«
Widerstrebend tritt sie einen Schritt zurück. »Ich sollte Sie wohl besser hereinlassen. Wie gesagt, es dauert noch eine Weile, bis Mr Mansfield zurückkommt. Er soll entscheiden, ob Sie passend sind oder nicht. In der Zwischenzeit bringe ich Sie ins Quartier für die Kindermädchen.«
Sie macht auf dem Absatz kehrt, sodass ich die Tür auffangen muss, die mir vor der Nase zuzufallen droht.
Ich habe Mühe, ihr zu folgen.
»Ich bin Agnes Calder«, sagt sie, ohne sich umzudrehen, und geht einen langen Korridor entlang. »Mrs Calder für Sie. Ich bin die leitende Haushälterin hier. – Das Personal ist zum einen Mr Mansfield und zum Zweiten mir unterstellt. Sollte er Sie morgen also nicht schon vor die Tür gesetzt haben, bin ich Ihre direkte Vorgesetzte.«
»Wunderbar«, murmle ich. Ich kann mir niemanden vorstellen, von dem ich mich lieber herumkommandieren lasse.
10
Mir fällt auf, wie kalt es hier ist. Fast noch kälter als draußen. Gütiger Himmel.
Die Wände sind aus Stein, und bis auf ein paar hohe schmiedeeiserne Kerzenständer und zerschlissene Wandteppiche ist alles kahl und leer.
Mrs Calder erklimmt eine steinerne Wendeltreppe. Meine Cowboystiefel hallen auf den Stufen wider, als ich ihr folge, so weit hinauf, dass mir beinahe schwindlig wird.
»Ihr Zimmer befindet sich im Ostturm«, erklärt sie und biegt in einen langen Korridor, dann nach links und schließlich nach rechts ein.
»Ich fürchte, ich werde eine Karte brauchen, um noch einmal herzufinden«, sage ich halb lachend.
»Verwechseln Sie niemals den Ost- mit dem Westturm«, bellt Mrs Calder. »Das Betreten des Westturms ist streng verboten.«
»Wieso?«
Mrs Calder gibt keine Antwort.
»Hier ist es.« Sie bleibt vor einer in die Turmwand eingelassenen Tür stehen. »Im Moment habe ich keinen Schlüssel dafür. Aber sollte Mr Mansfield Ihnen erlauben hierzubleiben, werde ich ihn suchen müssen.«
»Äh. Es ist sehr … äh.«
Beim Anblick des schmalen Betts mit der braunen Decke und dem wackligen Nachttisch, auf dem ein Krug mit gräulichem Wasser steht, fallen mir spontan die Adjektive kalt, ungemütlich und einsam ein.
»Ich bin sicher, ich kann es mir hier oben gemütlich machen«, sage ich stattdessen.
»Wir erwarten von unserem Personal, dass es um sechs Uhr aufsteht«, erklärt Mrs Calder, während ich meine Reisetasche und die Gitarre aufs Bett lege. »Das Frühstück wird bis Punkt sieben Uhr im großen Saal serviert. Die Treppe hinunter, links, dann rechts, den langen Gang entlang, dann wieder links. Die dritte Tür ist es dann.«
»Moment, das sollte ich mir lieber aufschreiben.«
Aber Mrs Calder hat bereits das Zimmer verlassen und die Tür zugeschlagen. Ich höre ihre Schritte im Korridor verklingen.
11
Gähnend sehe ich mich in dem trostlosen Raum um. Es dämmert bereits, und der Himmel hat jene typische grauweiße Färbung angenommen, die verrät, dass es bald schneien wird.
Ich ziehe mein Handy heraus. Ich muss dringend Wila anrufen und sie fragen, wie ihr erster Tag im Internat war.
Immer noch kein Handysignal. War ja klar!
Das Großstadtgirl in der Einöde.
In welchen Schlamassel hast du dich da bloß hineingeritten, Seraphina Harper?
Ich mache die Tür auf und spähe auf den Korridor. Hier muss es doch irgendwo einen brauchbaren Empfang geben.
Hallo? Ich bin hier in Schottland und nicht in der Antarktis, außerdem sind Schloss und Grundstück größer als manches Dorf.
Keine Ahnung, wieso, aber ich habe das unbestimmte Gefühl, mich ganz leise bewegen zu müssen. Alles ist so still hier; ganz anders als der Trubel der Camden High Street und das unablässige Knarren und Quietschen meines Hausboots unter der Brücke, über die zu jeder Tages- und Nachtzeit die Züge hinwegdonnern.
Ich gehe die Treppe hinunter, bis ich wieder in der Eingangshalle stehe.
Immer noch kein Signal.
Ich setze meinen Weg fort. Die Gänge sind von flackerndem orangefarbenem Licht erhellt. Ringsum hängen schwere Wandteppiche, auf denen sich Soldaten mit Bajonetten gegenseitig abschlachten.
Kein Signal.
Eine halbe Stunde irre ich durch verwinkelte Gänge, vorbei an geschlossenen Türen, bis ich – endlich! – einen einzelnen Balken auf dem Display meines Handys sehe.
Gott sei Dank.
Ich wähle Wilas Nummer.
»Pheeny?«
»Lala!«
Wie schön, ihre Stimme zu hören.
»Wie lief dein erster Tag?«
»Gut«, antwortet sie. »Eines der Mädchen hat ein iPad, und wir haben uns irgendwelche Sachen auf YouTube angesehen. Musikvideos und so.«
Ich lächle. Sie scheint bester Dinge zu sein.
»Und wir sind noch auf etwas anderes gestoßen.« Sie kichert. Ich höre noch mehr Gekicher im Hintergrund. »Der Mann, für den du arbeitest … Patrick Mansfield.«
Für den ich vielleicht arbeiten werde.
»Genau. So heißt er.«
»Eines der Mädchen kennt ihn. Besser gesagt, ihr Dad.«
»Ach ja? Und?«
»Er sieht hammermäßig aus.«
»Das habe ich auch schon gehört.«
»Manda hat ihn schon mal gesehen«, fährt Wila fort. »Sie hat ein Foto von ihm, wie er neben ihrem Dad im olympischen Dorf steht.«
Wieder höre ich Kichern im Hintergrund.
»Er ist echt groß«, sagt sie. »Und total durchtrainiert.«
»Der Typ ist der reinste Gott, Wila«, höre ich eine kieksige Mädchenstimme rufen. »Ein Gott!«
Haltloses Kichern dringt durch die Leitung.
»Ein Gott also, ja?« Ich muss grinsen. »Tja, da habe ich ja ein Riesenglück, hier vielleicht arbeiten zu dürfen.«
»Mandas Dad sagt, er sei in der Armee gewesen«, fährt Wila fort. »Deshalb weiß er auch genau, was Sache ist.«
»Morgen werde ich ja mehr über ihn erfahren«, sage ich.
Wir plaudern noch eine Weile über den Unterricht, trotzdem merke ich, wie meine Gedanken immer wieder zu Patrick Mansfield schweifen.
Ein Gott also, ja? Aber einer, dem gerne einmal der Geduldsfaden reißt, wenn es mit dem Kindermädchen nicht so läuft, wie er es sich vorstellt.
Ich hoffe bloß, es gelingt mir, die Klappe zu halten, wenn ich ihm begegne. Mich herumkommandieren zu lassen gehört nicht gerade zu meinen Stärken, und mein Mund entwickelt gern einmal ein Eigenleben.
Ich bin so froh, dass es Wila gut geht. Sie scheint sich prächtig zu amüsieren. Danny hatte völlig recht: Meine kleine Schwester braucht mich weniger, als ich dachte.
Schließlich lege ich auf und sehe mich um.
O Scheiße.
Auf der Suche nach einem Netz bin ich blindlings durch die Gänge getappt, ohne mir den Weg zu merken. Und habe mich hoffnungslos verirrt.
12
Zwanzig Minuten und ungefähr fünfhundert Abzweigungen später ist es noch schlimmer. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo ich bin.
In meiner Verzweiflung fange ich an, gegen Türen zu klopfen. »Hallo? Hallo?«
Keine Reaktion.
Das Schloss ist völlig verwaist.
Verdammt.
Draußen ist es mittlerweile stockdunkel. Es wird spät.
Vor den dunklen Fenstern sehe ich Flocken wirbeln. Offenbar tobt draußen ein Schneesturm.
Blöderweise sind die Gänge und Flure das reinste Labyrinth. Wie um alles in der Welt soll sich hier einer zurechtfinden?
Ich gehe weiter, treppauf, treppab, auf der Suche nach etwas, das mir bekannt vorkommt.
Mrs Calders Warnung, mich vom Westturm fernzuhalten, kommt mir wieder in den Sinn. Aber woher um alles in der Welt soll ich wissen, wo er sich überhaupt befindet?
Als ich eine weitere Wendeltreppe hinaufgehe, geben meine Beine plötzlich nach. Ich rutsche ab und falle polternd die Treppe hinunter, bis zur untersten Stufe, wo ich liegen bleibe.
Aua!
Mein Knöchel brennt wie Feuer.
Ich versuche aufzustehen, doch sobald ich den Fuß belaste, ist es, als würde ich ihn in kochendes Wasser tauchen.
Aua!
Ich lasse mich auf den Boden sinken und lehne mich gegen die kalte Steinmauer. Vorsichtig ziehe ich meinen Cowboystiefel aus und massiere die schmerzende Schwellung an meinem Knöchel.
»Hilfe!«, rufe ich.
Aber natürlich antwortet niemand. Einen Moment lang erfasst mich Panik, als ich mir ausmale, wie ich tagelang hier liege. Niemand weiß, wo ich bin, und dieses Schloss ist so verwinkelt.
Mach dich nicht lächerlich. Irgendjemand wird schon vorbeikommen.
»Hilfe!«, rufe ich noch einmal. »Hilfe, bitte!«
Aber es kommt niemand.
Ich bin so blöd.
13
Nach einer Weile fange ich an, ganz leise zu singen. Damit treibe ich Wila jedes Mal um den Verstand. Man könnte dich glatt für eine Geisteskranke halten, sagt sie dann immer. Aber mir hilft es. Es macht mich ruhiger.
Unvermittelt höre ich ein Geräusch.
Schritte. Ganz in der Nähe.
Ich setze mich auf.
Gott sei Dank. Es kommt jemand.
»Hallo?«
Keine Antwort.
Anscheinend habe ich es mir nur eingebildet.
Ich schlinge die Arme um meine Beine und lege den Kopf auf die Knie in der Hoffnung, dass das Zittern aufhört.
Vielleicht sollte ich mich einfach hinlegen und versuchen, ein bisschen zu schlafen.
In diesem Moment fällt mein Blick auf etwas: zwei schwarze Kampfhosenbeine, die in einem Paar schwarzer Springerstiefel stecken.
Als Nächstes sehe ich den Schnee, der an dem Hosenstoff klebt, und das Schmelzwasserrinnsal auf dem Fußboden.
Eine Männerstimme, tief, durchdringend und mit einem leichten schottischen Akzent, ertönt: »Was treiben Sie da unten?«
Ich lasse den Blick nach oben wandern. Noch etwas höher. Du lieber Gott!
Der Mann ist ein Riese – mit breiten Schultern, muskelbepackten Armen und einem markanten Kiefer.
Und er trägt kein Hemd.
Seine Brust ist ebenfalls auffallend muskulös und gebräunt. Schmutzspuren zieren seine deutlich hervortretenden Bauchmuskeln und das Adlertattoo auf seinem linken Schlüsselbein.
Verdammt! Wieso zum Teufel läuft der Typ halb nackt durch die Gegend wie ein Neandertaler?
»Was ist mit Ihrem Hemd?«, stammle ich und krümme mich innerlich vor Scham über diese schwachsinnige Frage. Außerdem habe ich ihm damit verraten, dass mir seine nackte Brust nicht entgangen ist.
Er runzelt die Stirn. »Ich habe Sie zuerst etwas gefragt. Was treiben Sie da unten?«
Erst jetzt bemerke ich den Pulli in seiner Hand, an dem ebenfalls noch Schnee klebt. Vermutlich hat er ihn ausgezogen, damit er nicht noch nasser wird.
Sein feuchtes Haar ist sandfarben, und die glatte Haut auf seiner Brust schimmert leicht im fahlen Schein der Beleuchtung.
»Also?« Er wischt sich mit dem Pulli den geschmolzenen Schnee vom Gesicht. »Was haben Sie hier zu suchen? Es ist eiskalt hier unten.«
Ich setze mich aufrechter hin. »Ich bin gestürzt. Ich bin Seraphina Harper«, sage ich und bemühe mich, nicht zusammenzuzucken, als ein stechender Schmerz durch meinen Knöchel schießt. »Die neue Nanny. Ich … ich wollte …«, stottere ich, aber mein Gehirn versagt kläglich seinen Dienst.
Er ist beinahe unerträglich attraktiv – ein ausdrucksvolles Gesicht mit durchdringenden Augen, ein herrlich voller Mund mit strahlend weißen Zähnen, ein muskelbepackter Körper – dieser Mann ist unbeschreiblich.
Er hat mehrere Narben im Gesicht. Eine verläuft quer durch seine Augenbraue, eine zweite zieht sich über seine Wange. Aber es sind keine gewöhnlichen Narben, vielmehr sehen sie wie Verbrennungen aus. Verletzungen durch Granatsplitter. Sie verleihen ihm etwas Verwegenes, Gefährliches.
Er mustert mich.
Selbst hier unten auf dem Boden kann ich die Hitze seines Körpers spüren, und ein frischer, maskuliner Duft, der mir den Atem zu rauben droht, steigt mir in die Nase.
Unsere Blicke begegnen sich, und einen Moment lang scheinen die Mauern zu erbeben.
Wir starren einander an. Ich sehe die Wut in seinem Blick.
Trotzdem bin ich nicht fähig wegzusehen. Schließlich finde ich meine Stimme wieder. »Ich … äh … Und wer sind Sie?«, krächze ich.
»Wissen Sie das etwa nicht?«
Ein winziges Lächeln spielt um seine zusammengepressten Lippen.
Ein warmer, wohliger Schauder überläuft meinen ganzen Körper, als er die Stimme erhebt.
»Ich bin Patrick Mansfield. Der Hausherr.«
14
Seine Stimme ist sehr autoritär. Offenbar ist der Mann daran gewöhnt, Befehle zu geben.