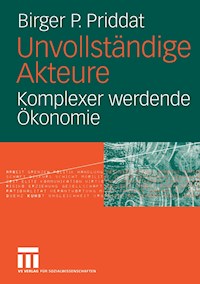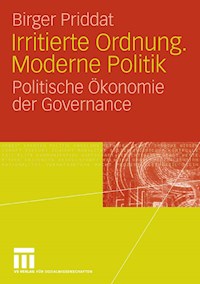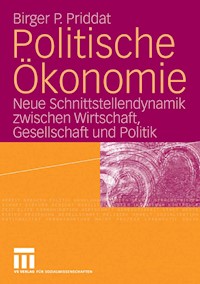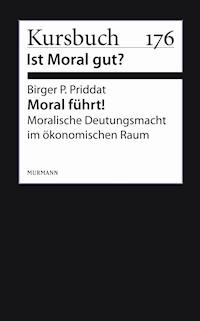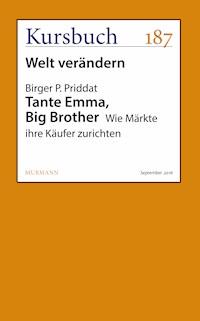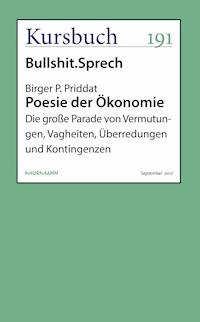
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sven Murmann Verlagsgesellschaft mbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kursbuch
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Märkte sind voller Kommunikation, denn ohne diese wüsste niemand, was er kaufen können sollte. Die Sprache der Unternehmen dabei ist die der Werbung. In der Ökonomik selbst aber werden diese sprachlichen Dimensionen noch erstaunlich wenig beachtet. Zeit, dies zu ändern, meint Birger P. Priddat. Denn Kommunikation wird für die wirtschaftlichen Transaktionen immer bedeutsamer. In seinem Beitrag betrachtet Priddat die Auswirkungen der sprachlichen Dimensionen auf ökonomische Prozesse und argumentiert für eine Öffnung der Wissenschaft gegenüber anderen Disziplinen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 28
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bullshit.Sprech
Inhalt
Birger P. Priddat | Poesie der Ökonomie. Die große Parade von Vermutungen, Vagheiten, Überredungen und Kontingenzen
Anhang
Der Autor
Impressum
Birger P. PriddatPoesie der ÖkonomieDie große Parade von Vermutungen, Vagheiten, Überredungen und Kontingenzen
Die Ökonomie ist eine glänzende Wissenschaft; aber ihre Attitüde, als exakte Wissenschaft aufzutreten, wird in der Gesellschaft zunehmend als weniger glaubwürdig angesehen. Man nimmt ihr nicht mehr wie früher ab, dass sie die Ungewissheiten, Unwägbarkeiten, Komplexitäten der globalen Wirtschaftsprozesse angemessen verarbeiten kann. Immer mehr Menschen halten die Ökonomik für Bullshit.1 In vielem ist sie eine Wissenschaft der Vermutungen, eine economy of guess, und in den Märkten eine economics of persuasion: der machtvollen beziehungsweise subtilen Überredung, das zu kaufen, wozu man selber gar keine Neigung hatte. Die Märkte regeln sich nicht von selber.2 Richard Bookstaber spricht in diesem Zusammenhang vom »Ende der Theorie«.3 Das wäre vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen.
Die Ökonomen betrachten ihre Wissenschaft häufig wie eine soziale Physik, weil sie so genau, präzise, logisch sei. Einzig unter Ökonomen hält sich dieser Glaube.4 Nichtökonomen können das nicht prüfen, da sie die Sprache der Ökonomie, insbesondere ihre Algebra, weder kennen noch verstehen. Sie aber stellen die Mehrzahl der Akteure der Wirtschaft. Sie sprechen die Sprache A, nicht die Sprache Ö der Ökonomen.5 In Sprache A interpretieren sie die wirtschaftlichen Vorgänge aus ihren Erfahrungen. Für die Sprache Ö zeigen sie Respekt, ohne zu wissen, was sie daran verstehen sollten. Ihr Verhalten ist irrationaler, emotionaler, moralischer, mehr kulturell bestimmt, stimmungsabhängiger, sozialer, konventionaler, als es der Normenkatalog der Rationalitäten der Ökonomik zulässt. Die Wirtschaft funktioniert wunderbar, ohne dass die Akteure etwas von Ökonomie verstehen (jedenfalls nicht so, wie Ökonomen Ökonomie verstehen). Die Ökonomen reden deshalb auch nicht von Ökonomie, sondern von Ökonomik. Die »ik«-Endung macht die Wissenschaftlichkeit aus, die methodisch/methodologisch gestützten, mathematisch modellierten Aussagensysteme über Wirtschaft. Wenn aber die Wirtschaft funktioniert, obwohl beziehungsweise weil sie von Leuten betrieben wird, die keine Ahnung von Wirtschaft haben (jedenfalls keine Ahnung von ökonomischer Ökonomik), was leistet dann die Ökonomik überhaupt für die Analyse der Wirtschaft? Denn wenn viele nicht verstehen, was Ökonomen sagen: Mit wem reden Ökonomen dann – außer mit sich selber? Wem erklären sie was? Und – wie funktioniert Wirtschaft dann tatsächlich?
Über lange Zeit hat die Ökonomik nicht gewusst, wie sich die in ihren Modellen beschriebenen Akteure tatsächlich verhalten. Man hatte sich stattdessen ersatz- beziehungsweise hilfsweise darauf geeinigt, alle ökonomischen Akteure für rational (rational actor) zu erklären: Ganz so, als ob der »methodologische Individualismus als die berechnende Ratio das Wesen des Menschen« ausmache.6 Und viele Ökonomen sind schlicht bei dieser Gewohnheit geblieben.
Erst seit einiger Zeit gibt es eine Verhaltensökonomie, die in Experimenten dem tatsächlichen Verhalten auf die Spur kommen will.7 Dabei hat sich herausgestellt, dass es viele Situationen gibt, in denen sich Akteure nicht rational oder nicht effizienzorientiert, sondern zum Beispiel altruistisch, auf Fairness anderen gegenüber bedacht, kooperativ statt kompetitiv, reziprozitär verhalten.8 Der Spieltheoretiker Armin Falk hat deshalb den Homo oeconomicus bereits durch den Homo reciprocans ersetzt.9 Reziprozität ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen (wie zum Beispiel im aktuellen »Diesel-Kartell« der Autofirmen), nicht ab ovo auf Durchsetzung der jeweiligen Vorteile ausgerichtet. In vielen Sphären der Gesellschaft haben wir es mit eher reziprozitären Interaktionen und nicht mit Vorteilsdurchsetzung oder individuellen Maximierungen zu tun – in den Familien, unter Freunden, in längerfristigen Kundenbeziehungen, im öffentlichen Sektor, in Kartellen, im Stiftungsbereich etc.10