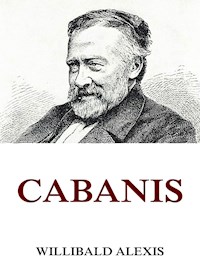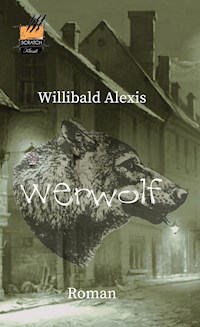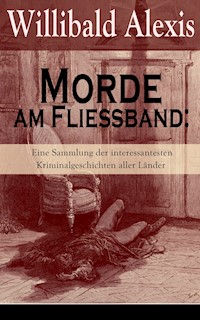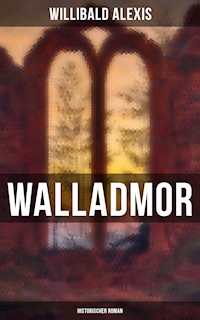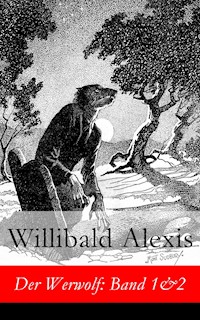4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Pommersche Gespenster sind eine Erzählung, von einem Mann, der nicht an Gespenster glaubt, aus dessen Erzählung aber hervorgeht, dass er dennoch mit ihnen zu tun hat. Einiges wird in der Sprache auf den pommerschen Dialekt hinweisen, obwohl dieser nicht benutz wird. Die wenigsten leser würden ihn verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 59
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Willibald Alexis
Pommersche Gespenster
Verlag Saphir im Stahl
e-book 175
Willibald Alexis - Pommersche Gespenster
Erstveröffentlichung: 01.07.2023
Erste Auflage 01.09.2023
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Vertrieb: neobooks
Willibald Alexis
Pommersche Gespenster
Mein Oheim war ein wunderlicher Kauz, aber an Geister glaubte er nicht. Sie waren ihm so verhasst, dass er selbst das Wort geistreich nicht leiden mochte. Er war es selbst nicht, aber pfiffig, und die ihn näher kannten, versicherten, in der Art und Weise, wie er den Zopf trug, stecke etwas Apartes, und wie er den Rauch ausblies, da sei Methode darin; und ich muss bekennen, dass, wenn er blinzelte unter den schneeweißen Brauen, und ein Blitz seines hellen Auges mich traf, ich mir immer etwas Besonderes dabei dachte. Doch kann ich mich getäuscht haben, da ich den Seligen nur selten besuchte. Von seiner Pfiffigkeit und dem zuweilen schrecklichen Blitzen seines Auges wussten alle die viel zu sagen, welche mit Rechnungen zu ihm kamen. Er pflegte ihnen anzudeuten, dass sie sich zu einem Wesen scheren möchten, welches er zweifelsohne auch zu den Geistern zählte, und fand es unbillig, dass ein alter Major, der es als Leutnant mit den Juden, als Rittmeister mit den Österreichern und Reichstruppen aufgenommen, im Alter mit den ...nötern, wie er sie titulierte, nicht fertig werden sollte. Er behauptete, ein Krieg, wie der Siebenjährige, komme nicht wieder; es wäre ein schöner Krieg gewesen: die selige Tante aber meinte dann immer, seine Nase wäre damals noch nicht so rot gewesen. Das ästimierte er nicht.
Mit der neuen Zeit war er dagegen unzufrieden; er meinte, ein Soldat brauche nicht gelehrt zu sein, man erzöge die Jungen zu naseweis, und die Poesie, die er in seinen jungen Jahren geliebt – er kannte Kleists Gedichte auswendig –, sei jetzt verrückt geworden, seit man kurze Verse mache, katholisch sein müsse und an Ahnungen glaube. Ein Schüler Galls behauptete einmal, er sei ein Geisterseher. Mein Oheim nahm das ruhig hin, wie vieles; er steckte aber nie etwas ein. Er sah den jungen Doktor scharf an, schlug den Pfeifendeckel zu, wünschte den übrigen Ressourcemitgliedern eine wohlschlafende Nacht und sagte dem Mediziner: Sie zögen ja eines Weges. Es war Mitternacht geworden, eine helle Mondnacht. Mein Oheim führte den Begleiter gerade über den Kirchhof. Er wollte ablenken, aber mein Oheim sagte nein, und wenn mein Oheim nein sagte – nämlich in seiner Garnison –, so pflegten die andern nicht ja zu sagen. Er führte ihn mitten auf den Kirchhof, und dort lud mein Oheim den Mediziner ein, sich auf ein Grab zu setzen, und er nahm neben ihm Platz. Es ist aber wohl zu beachten, dass mein Oheim noch ein sehr starker Mann, dass es eine warme Sommernacht war, und dass er den Mediziner am Arm festhielt, wenn er etwa Miene gemacht hätte, davonzulaufen. „Nun wollen wir doch einmal sehen, wer von uns ein besserer Geisterseher ist“, sagte er und zündete sich die Pfeife an. Beide waren mutterseelenallein; es ging kein Lüftchen, keine Tür knarrte, es raschelte keine Maus, kein Heimchen zirpte, und beide sprachen in einer ganzen Stunde kein Wort – so nämlich wollte es mein Oheim. – Als es eins schlug, stand er auf und sah den Doktor gerade an: „Was haben wir denn nun gesehen?“ Der Mediziner kramte allerlei aus, was seine inneren Augen gewahrt; mein Oheim aber sagte, indem er wieder den Pfeifendeckel zuschlug: „Ich habe nichts gesehen als einen Schafskopf.“
Die Geschichte wurde im Städtchen ruchbar – ich weiß nicht, wer sie ausgeplaudert, meines Oheims Art war es nicht – und der Doktor war seitdem die Freundlichkeit selbst gegen meinen Oheim. Denn ihm verdankte er in seinem Museum den kostbar präparierten Schädel eines Hammelkopfes, und er sagte zu jedermann, es wäre derselbe Kopf, den mein Oheim in der Geisterstunde gesehen. Er versicherte gegen jeden – und darin musste man ihm glauben, denn er war dazumal der einzige Doktor –, es wäre ein äußerst seltener Kopf, und ein Schöps, wie der, dem er einst gehört – jetzt gehörte er ihm –, werde nicht zweimal geboren. Sonderbarer- oder gerechterweise hieß seitdem mein Oheim „der Geisterseher“ im Städtchen, und er schien es nicht übelzunehmen. Im Gegenteil zog er viel bedächtiger den Rauch ein und schmunzelte auf eine eigene Weise, wenn man ihn so titulierte. Man bekam es heraus, dass er oft viel klüger als andere sei, dass er vieles vorausgesagt, was nachher eingetroffen, zum Beispiel dass nach des Bürgermeisters Tode ein anderer das Amt bekommen, dass die französische Revolution eine arge Geschichte werden würde. Auf sein „Ja! Ja!“ und sein Kopfschütteln bei bedenklichen Dingen gab man jetzt mehr als je acht, und bat ihn gern zu Gevatter, denn er fand immer die Namen für die Kinder heraus, welche den Nagel auf den Kopf trafen.
Mein Oheim hielt den Wein für ein gesundes und gutes Getränk, womit ich nicht sagen will, dass er den Punsch, Grog und andere Getränke, nicht für gut gehalten hätte, und meine selige Tante meinte, sein Pontac müsse wohl stark sein, da er sein pommersches Gut hineindestilliert habe. Sie waren aber beide herzlich frohe Leute und immer guter Dinge, und wie er den Pontac, liebte sie den Kaffee, und wenn er beim Pontac wenig sprach, so sprach sie beim Kaffee desto mehr, und was das Merkwürdigste war, sie bestritt niemals ihren Freundinnen, dass ihr Mann ein Geisterseher wäre; im Gegenteil ließ sie es ganz deutlich merken, dass sie es auch glaube.
Es war einmal etwas Besonderes, ich weiß nicht was, gefeiert worden, und die Stammgäste der Ressource sahen in ihrem Rauch-, Wein- und Eckzimmerchen dem Staub im großen Tanzsaale zu. Einer verglich ihn dem Pulverdampf in einer erstürmten Redoute. Der andere meinte, es schwirre ihm wie ein Hexentanz vor den Augen, wenn die Blitzmädchen so vorüberführen. Ein dritter meinte, wenn nur solche Hexen auf Walpurgis tanzten, wäre er selbst bei der Partie. Ein vierter – es war der Doktor, und er hatte eben Schillers Geisterseher gelesen – seufzte, dass in der Mark und Pommern von eigentlichen interessanten Geistergeschichten gar nichts vorkäme. Mein Oheim blies eine ungeheure Wolle schussgerade aus dem Munde, dass ihre Vorposten bis ins Tanzzimmer sich verloren, und sah den Mediziner ungemein pfiffig an; dabei kraute er sich hinter dem Ohr, und es kam wie ein Seufzer heraus, als er sagte: „Meint Ihr?“
„Obristwachtmeister, Sie glauben also doch?“
„Ich glaube gar nichts, was ich nicht fassen kann.“
„Geister lassen sich aber doch nicht fassen.“
„Es kommt drauf an.“
Alles war Aug' und Ohr.
„Herr Bruder“, sagte der alte Major von den Musketieren, „hast du schon einen Geist gefasst?“
„Ja!“ war die ebenso kurze als unerwartete Antwort.
Ich saß dabei im Winkel, man hatte mir ein Glas Wein eingeschenkt und ein Stück Kuchen gegeben, aber ich habe den Oheim in meinem Leben nicht mit so feierlicher Miene gesehen, als wie er die eine Silbe und das eine Wörtchen Ja vorbrachte. Es gab bleiche Gesichter; der Doktor fasste sich selbst an, einige rückten näher, einige ab und alle erwarteten eine Aufklärung, die auch wirklich auf den Lippen des Oheims schwebte.