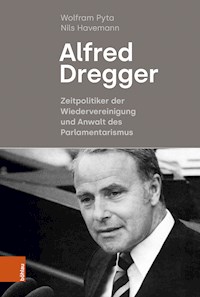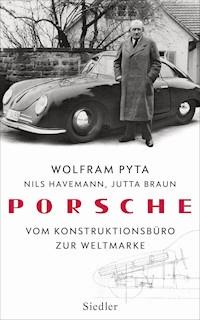
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Porsche und der Aufstieg zum Weltunternehmen
1931 gründete Ferdinand Porsche sein „Konstruktionsbüro“. Der geniale Techniker – zuvor Konstrukteur von Elektrokutschen und Rennwagen sowie Chefentwickler von Daimler-Benz – sollte bis zu seinem Tod 1951 die Grundlagen für das spätere Weltunternehmen schaffen. Wolfram Pyta erzählt die Geschichte des Unternehmens in diesen turbulenten Anfangsjahren: von der Entstehung des Volkswagens über das Arrangement mit den Nazis und die Kriegsproduktion bis zur Entwicklung zur exklusiven Sportwagenschmiede ‒ eine faszinierende Darstellung, die Unternehmens-, Automobil- und Zeitgeschichte miteinander verknüpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 913
Ähnliche
Zum Buch
1931 gründete Ferdinand Porsche sein »Konstruktionsbüro«. Der innovationsfreudige Techniker – zuvor Konstrukteur von Elektromobilen und Rennwagen sowie Chefentwickler von Daimler-Benz – sollte bis zu seinem Tod 1951 die Grundlagen für das spätere Weltunternehmen schaffen. Wolfram Pyta erzählt die Geschichte des Unternehmens in diesen turbulenten Anfangsjahren: von der Entstehung des Volkswagens über die Umstellung auf Kriegswirtschaft unter den Nationalsozialisten und die Entwicklung von Kampfpanzern bis hin zur Etablierung der Automobilmarke, die Porsches Namen trägt – eine faszinierende Darstellung, die Unternehmens-, Automobil- und Zeitgeschichte miteinander verknüpft.
Zu den Autoren
Wolfram Pyta, geboren 1960 in Dortmund, leitet als Universitätsprofessor die Abteilung für Neuere Geschichte am Historischen Institut der Universität Stuttgart sowie die Forschungsstelle Ludwigsburg zur NS-Verbrechensgeschichte. 2007 erschien bei Siedler seine vielgelobte Biographie »Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler«, 2015 folgte »Hitler. Der Künstler als Politiker und Feldherr«.
Nils Havemann, geboren 1966, studierte Geschichte, Romanistik und Politische Wissenschaften in Bonn, Paris und Salamanca. Er wurde 1996 an der Universität Bonn promoviert. Heute ist er am Historischen Institut der Universität Stuttgart tätig. Veröffentlichungen u. a. »Fußball unterm Hakenkreuz. Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz« und zuletzt bei Siedler »Samstags um halb vier. Die Geschichte der Fußball-Bundesliga« (2013).
Jutta Braun, geboren 1967, studierte Zeitgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und wurde 1999 mit einer Arbeit zur politischen Justiz in der DDR promoviert. Sie forscht am Zentrum für Zeithistorische Forschung zur friedlichen Revolution in Potsdam und Brandenburg und ist seit 2004 Vorstand des Zentrums deutsche Sportgeschichte. 2009 erschien »Berlin 1936. Die Geschichte von Gretel Bergmann und Dora Ratjen«.
WOLFRAM PYTA
NILS HAVEMANN, JUTTA BRAUN
PORSCHE
VOM KONSTRUKTIONSBÜRO ZUR WELTMARKE
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Alle Abbildungen in diesem Buch stammen aus dem Historischen Archiv der Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG.
Erste AuflageAugust 2017
Copyright © 2017 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg, unter Verwendung
einer Abbildung von © Ullstein Bild und einer Konstruktionszeichnung
aus dem Historischen Archiv der © Porsche AG
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-21436-4V001
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Einleitung
KAPITEL 1Wagemutiger Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit
KAPITEL 2Ende der Durststrecke und Durchbruch
KAPITEL 3Mit Auto Union auf der Erfolgsspur
KAPITEL 4Geschäftliche Entwicklung und Aufgabenprofil des Konstruktionsbüros von 1933 bis 1939
KAPITEL 5Familienunternehmen pur – das Hinausdrängen familienexterner Gesellschafter
KAPITEL 6Vereint zur Rekordjagd: Porsche und Daimler-Benz
KAPITEL 7Porsche und der Volkswagen
KAPITEL 8Strategische Erweiterung des Unternehmens zu einem Entwicklungsbetrieb
KAPITEL 9Ultramobilität im Gelände:Kübel- und Schwimmwagen als Erfolgsmodell
KAPITEL 10»Untauglich« – Porsche und die Panzerkampfwagenkonstruktion
KAPITEL 11Komplettierung des Portfolios – Porsche und die Entwicklung von Landmaschinen
KAPITEL 12Die Politik holt das Unternehmen ein –Porsche im Zweiten Weltkrieg
KAPITEL 13Ein französischer Volkswagen?Chancen und Risiken des Neuanfangs nach 1945
KAPITEL 14Emanzipation vom Übervater
Resümee und Ausblick
ANHANG
Dank
Anmerkungen
Abkürzungen
Einleitung
Der Name Porsche ist als Hersteller exklusiver Sportwagen weltweit ein Begriff. Seit das erste Automobil mit dem Namen Porsche auf den Markt kam – der Typ 356 aus dem Jahr 1948 –, hat sich das Unternehmen mit einer stringenten Modellpolitik sowie einer bereits frühzeitig ausgeprägten Exportorientierung als global erfolgreiche Weltmarke etabliert.1 Die historischen Wurzeln aber reichen weiter zurück. Die Expertise von Ferdinand Porsche und seinen Mitarbeitern bildete das Fundament, auf dem sich das Unternehmen Porsche in der Nachkriegszeit entwickeln konnte. Als Ferdinand Porsches Sohn Ferry den Typ 356 baute, konnten er und seine Ingenieure auf ein umfassendes technisches Erfahrungswissen zurückgreifen. Denn bereits 17 Jahre zuvor, am 25. April 1931, hatte Ferdinand Porsche in Stuttgart das Konstruktionsbüro »Dr. Ing. h.c. F. Porsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Konstruktionen und Beratungen für Motoren- und Fahrzeugbau« gegründet und ins Handelsregister eintragen und dann im Jahr 1937 in eine Kommanditgesellschaft umwandeln lassen. Dieses Unternehmen kann als Keimzelle der heutigen »Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG« gelten. Seine wechselvolle Geschichte von der Gründung im Jahr 1931 bis zum Tod des Unternehmers Ferdinand Porsche zwanzig Jahre später ist Gegenstand dieser Studie.
Was macht dieses Stuttgarter Unternehmen zu einem heuristisch ergiebigen Untersuchungsgegenstand? Das Spannende und zugleich Herausfordernde ist vor allem die Reichhaltigkeit der Aspekte, die sich hier darbietet. Die vier zentralen Themenfelder sollen im Folgenden kurz umrissen werden.
Als erstes sticht die technische Vielfalt der Produktpalette der Porsche GmbH/KG ins Auge. Das Unternehmen hat sich an motorgetriebenen Fahrzeugen nahezu aller Art versucht, nicht nur an Personenkraftwagen und Rennwagen, sondern auch an Traktoren und Panzerkampfwagen. Dabei hat es im Laufe der Zeit die gesamte Verwertungskette abgedeckt: Startete es noch als Anbieter von Konstruktionsleistungen, die im Kern aus Entwurfszeichnungen bestanden, schaffte es bald den Sprung zu einem kompletten Entwicklungsbetrieb, der serienreife Versuchsfahrzeuge herstellte. Der Einstieg in die Produktion von Serienfahrzeugen glückte allerdings erst 1948 – und insofern ist das Geschäftsmodell der heutigen »Porsche AG« nicht deckungsgleich mit dem Profil des Vorgängerunternehmens. Die Vielseitigkeit der Porsche GmbH/KG hat dazu geführt, dass sich bislang vor allem Automobilenthusiasten der Geschichte des Unternehmens zugewandt haben. Es entstanden detailreiche Untersuchungen, die ihre emotionale Nähe zum Gegenstand auf den ersten Blick erkennen lassen.2 Auch jene Arbeiten, die archivalisches Material verwerten, blieben letztlich der Faszination der präsentierten technischen Artefakte verhaftet.3 Der Geschichtswissenschaftler wird von diesen Studien wegen ihres Materialreichtums4 profitieren, doch sowohl vom Zugriff her als auch von der Quellenbasis hält sich der Ertrag in engen Grenzen.
Von der technischen Seite des Generalthemas führt ein direkter Weg zur Sportgeschichte. Dass sich Porsche von 1932 an mit zunehmendem Erfolg als Rennwagenkonstrukteur betätigte, ist keineswegs ein Nebenaspekt beim Aufstieg des Unternehmens Porsche zur Weltmarke. Der wirtschaftliche Durchbruch gelang schließlich mit der Konstruktion und Entwicklung eines Rennwagens, der für den sächsischen Hersteller Auto Union an den Start ging und von Rennfahrerassen wie Hans Stuck und Bernd Rosemeyer gesteuert wurde. Die Unternehmensgeschichte ist damit aufs engste verflochten mit dem Anstieg des Interesses am Motorsport, der Hunderttausende in seinen Bann schlug und damit in den Fokus medialer Aufmerksamkeit geriet. Als ein Kulturphänomen erster Güte bildete der Motorsport einen wichtigen Nährboden, auf dem Zuschreibungen gediehen und in Umlauf gebracht wurden, die auch auf das Image Porsches positiv ausstrahlten. Porsches Abstecher in den Rennsport wirkte noch nach in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als der erste internationale Auftrag darin bestand, für einen italienischen Rennstall einen konkurrenzfähigen Rennwagen zu entwickeln. Der durch die frühen rennsportlichen Aktivitäten erzielte Imagegewinn hat nicht wenig zur Ausbildung des sportlichen Markenkerns beigetragen, der den Absatz des von 1948 an produzierten Sportwagens beförderte. Insofern möchte die vorliegende Untersuchung auch einen Beitrag zu einer kulturhistorisch sensiblen Sportgeschichte5 dort leisten, wo es sich anbietet.
Eine integrativ angelegte Unternehmensgeschichte kann die politischen Umstände nicht ausblenden, die unternehmerisches Handeln beeinflussen. Für die Porsche GmbH/KG gilt das erst recht, da sie in besonderer Weise mit der Politik verwoben war. Ohne die von staatlicher Seite angeschobenen Projekte hätte das Unternehmen keine derartige Dynamik freisetzen und innerhalb weniger Jahre Entwicklungssprünge vollziehen können. Ferdinand Porsche war eben nicht nur der konstruktive Kopf des Unternehmens, sondern auch der Akquisiteur politikaffiner Aufträge und gelangte erst dadurch in die Lage, in seinem Portfolio eine so reichhaltige Produktpalette zu offerieren. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Auftraggeber nicht wählerisch war. Die allererste Anfrage erreichte Porsche im Jahr 1931 aus der kommunistischen Sowjetunion; und im Herbst 1945 war das unter kommunistischer Leitung stehende »Ministère de la production industrielle« der Französischen Republik entschlossen, mit der Porsche KG ins Geschäft zu kommen. Im Nachkriegsösterreich arbeitete der österreichische Zweig des Unternehmens eng mit Repräsentanten unterschiedlicher politischer Lager zusammen, am Hauptsitz in Kärnten vor allem mit Regierungsmitgliedern, die der Sozialistischen Partei Österreichs angehörten.
Unter dem NS-Regime hat das Unternehmen den Grundstein für sein dynamisches Wachstum gelegt und seinen erfolgreichen Aufstieg vollzogen. Das imageprägende Projekt des »Volkswagens« hätte die Porsche GmbH nicht ohne Unterstützung Hitlers zum Abschluss bringen können; darüber hinaus sicherte Porsches privilegierte Beziehung zur »Deutschen Arbeitsfront«6 dem Unternehmen Anschlussaufträge im Bereich der Traktorentwicklung. Die Nähe zur Politik immunisierte es zwar nicht gegen Fehlschläge – bei der Konstruktion und Entwicklung von Panzerkampfwagen scheiterte Porsche auf ganzer Linie –, aber insgesamt lässt sich nicht bestreiten, dass es enormen Nutzen aus dem Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zog. Nicht viele Unternehmer dürften mit Hitler derartig häufig zusammengetroffen sein wie Ferdinand Porsche. Daher drängt sich die Frage auf, wie stark sich die Unternehmensleitung auf die NS-Politik einließ, eine Frage, die im Zentrum der in letzter Zeit geradezu boomenden Unternehmensgeschichten steht, wenn es um die Zeit zwischen 1933 und 1945 geht.7 Einschlägige Spezialstudien8 haben inzwischen deutlich gemacht, wie sich nüchternes wirtschaftliches Kalkül mit politisch-moralisch fragwürdigem Gebaren verschränken konnte. Dabei ist der Historiker gut beraten, seine berufsbedingte Nüchternheit im Urteil gerade in den Fällen zur Geltung zu bringen, die eine überaus komplexe Gemengelage aus wirtschaftlichen und politischen Erwägungen aufweisen. So muss man zur Kenntnis nehmen, dass auch die Bosch-Gruppe an der Kriegswirtschaft des »Dritten Reiches« Anteil hatte und auf die Arbeitskraft von Zwangsarbeitern zurückgriff9 – also ein Unternehmen, das in geradezu exzeptioneller Weise den Widerstand gegen das verbrecherische NS-Regime mit allen Mitteln förderte und dabei die philanthropische Gesinnung des Gründers Robert Bosch zur Geltung brachte.10
Das bloße Faktum, dass ein Unternehmen Zwangsarbeiter beschäftigte, erlaubt mithin kein eindeutiges Urteil über seine Nähe zum NS-Regime. Eine Engführung auf einen einzigen Aspekt wie Beschäftigung von Zwangsarbeitern wird der komplexen Verflechtung von Wirtschaft und Politik nicht einmal ansatzweise gerecht. Es kommt also darauf an, inhaltliche Asymmetrien zu vermeiden und dieses anspruchsvolle Vorhaben so zu bewältigen, wie es Thomas Nipperdey in unnachahmlicher Weise formulierte: die Schattierungen der Geschichte freilegen – und das heißt nicht strahlendes Weiß oder tiefes Schwarz, sondern Grautöne in unendlicher Vielfalt.11 Dass dazu eine Prosa, die um faire Urteile ringt und ihren Gegenstand mit gebotener Distanz in den Blick nimmt, hilfreich ist, wird niemand bestreiten.
Der in der vorliegenden Studie gewählte Untersuchungszeitraum beschränkt sich nicht auf die NS-Zeit, sondern erstreckt sich über die Jahre 1931 bis 1951 und damit über drei politische Systeme auf deutschem Boden, in denen die Porsche GmbH/KG unternehmerisch tätig war. Rechnet man das Besatzungsregime der Nachkriegszeit hinzu sowie das besondere politische Biotop der frühen Zweiten Republik in Österreich, dann erhält man eine enorme Variationsbreite von politischen Konstellationen, in denen sich das Unternehmen einrichtete. Durch diesen Umstand lassen sich Techniken geschmeidiger Anpassung an sich rasant wandelnde politische Umstände am vorliegenden Beispiel besonders gut studieren. Wie andere auch waren die leitenden Akteure der Porsche GmbH/KG nach 1945 um Schadensbegrenzung bemüht und suchten politische Altlasten aus der NS-Zeit möglichst rasch zu entsorgen. Was den Fall Porsche besonders interessant macht, ist der Umstand, dass das Unternehmen nach 1945 seinen Hauptsitz vorübergehend in Österreich nahm und in der alten Heimat der Großfamilie Porsche von den vergleichsweise milden Entnazifizierungsbemühungen profitierte. Dabei kommt ans Licht, wie trickreich unterschiedliche Standards der NS-Aufarbeitung für den wirtschaftlichen Neuanfang nach 1945 genutzt wurden. Die österreichische Staatsbürgerschaft wurde hierbei zu einer ökonomischen Trumpfkarte; zugleich hatte eine fehlgeschlagene Naturalisierung gravierende Standortverlagerungen zur Folge. Dass die beiden heutigen Familienstämme (Porsche und Piëch) zwei unterschiedliche Staatsbürgerschaften (deutsch und österreichisch) besitzen, ist das Resultat des nur teilweise geglückten Versuchs, den größten Teil des Betriebsvermögens der Porsche KG mit tatkräftiger Unterstützung österreichischer Landes- wie Bundesbehörden zu austrifizieren.12
Der vierte leitende Aspekt der vorliegenden Studie führt ins Zentrum der Untersuchung. Die Porsche GmbH/KG verkörpert – so die Grundannahme – einen besonders reinen Typus des Familienunternehmens.13 Die Familie Porsche verfügte ja nicht nur über den weit überwiegenden Anteil am Geschäftsvermögen der Gesellschaft, sondern übte zugleich auch alle wesentlichen Führungsfunktionen in diesem Unternehmen aus. Daraus ergibt sich eine auf die Unternehmerpersönlichkeiten zugeschnittene Anlage dieser Untersuchung. Gemäß der vor allem von Werner Plumpe14 vertretenen Auffassung, eine kulturgeschichtlich sensible Unternehmensgeschichte müsse unternehmerische Entscheidungsträger ins Zentrum rücken und habe damit immer auch die Biographie dieser Akteure in den Blick zu nehmen, fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf das unternehmerische Handeln der Führungsfiguren, vor allem auf Ferdinand Porsche senior und junior. Die Geschichte eines Familienunternehmens würde leblos und blutleer bleiben, wenn die Weichensteller und Entscheider nicht den ihnen gebührenden Platz einnähmen. Das gewissermaßen dynastische Strukturprinzip von Familienunternehmen verlangt eine solche Schwerpunktsetzung. Insofern versteht sich die vorliegende Studie nicht zuletzt als unternehmenshistorischer Beitrag zu einem besonders markanten, aufschlussreichen und bis heute nachwirkenden Exempel eines Familienunternehmens.
Das Interaktionsgeflecht zwischen der Familie und dem Unternehmen bildet den Rahmen, in dem sich die vorliegende Darstellung bewegt und der die Einzelaspekte miteinander verbindet.15 Auf diese Weise soll ein Gesamtbild unternehmerischen Handelns entworfen werden, das auf der einen Seite aus einzigartigen historischen Konstellationen erwuchs, auf der anderen Seite aber einer zumindest mittelfristig angelegten Handlungsdisposition der Akteure entsprang. Dass sich insbesondere Ferdinand Porsche situationsabhängige unternehmerische Chancen boten und er beherzt zugriff, gehört zu den historisch kontingenten Faktoren der Unternehmensgeschichte, die sich nicht strategisch planen ließen. Wie er damit umging und wie er diese vor allem politisch bedingten Konjunkturen für die strategische Gesamtanlage seines Unternehmens zu nutzen verstand, fällt unter die strukturellen Handlungsbedingungen. Auch wenn die vorliegende Studie in vielen Detailfragen neue Erkenntnisse beizusteuern verspricht, die über die Geschichte des Unternehmens hinaus von Belang sind, sollte man sich vor Augen halten, dass eine Isolierung solcher Spezialaspekte dem integrativen Anspruch dieses Werkes nicht gerecht wird. Diese Darstellung nimmt darüber hinaus für sich in Anspruch, durch intensive Auswertung archivalischer Quellen Erträge zu generieren, die geeignet sein könnten, bislang wenig beachtete Forschungsfelder einer stärkeren systematischen Erkundung zu unterziehen. Gerade weil sich die Porsche GmbH/KG auf so unterschiedlichen Gebieten betätigte und aufgrund der Herkunft ihres Führungspersonals und der Verquickung mit vitalen Interessen der französischen Besatzungsmacht über Deutschland hinaus Spuren hinterließ, bietet ihre Geschichte einen Seiteneinstieg in wenig beachtete Aspekte der österreichischen und französischen Geschichte.
Es war den Verfassern ein Anliegen, in der Ausbreitung möglichst vieler Aspekte den heuristischen Ertragreichtum des Gegenstandes zum Ausdruck zu bringen. Die jeweiligen Proportionen ergeben sich erst in der Gesamtschau. Man würde den Anspruch der Studie verfehlen, wenn man die Abstecher in thematische Randzonen zum archimedischen Punkt der Gesamtdarstellung erhöbe. Das dynamische Beziehungsgeflecht zwischen der Familie und ihrem Unternehmen bildet ihren Dreh- und Angelpunkt. Es seien daher im Folgenden einige Themenkomplexe angerissen, die sich aus dieser Schwerpunktsetzung ergeben.
Vor allem ist von Belang, ob und wie man im Unternehmen mit der heiklen Frage der Nachfolgeregelung umging. Gerade bei einer so dominierenden Persönlichkeit wie Ferdinand Porsche kann sich der Übergang auf die nächste Generation zu einem veritablen Problem auswachsen, wenn der Patriarch nicht weichen will. Dass Ferdinand Porsche durch äußere Umstände gezwungen wurde, den Platz an der Spitze seines Unternehmens zu räumen und seinem Sohn Ferry Porsche den Weg frei zu machen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die innerfamiliären Strukturen. Wie sehr der Gründungsvater seinem Unternehmen den Stempel aufdrückte, lässt sich auch an der von ihm geprägten Unternehmenskultur16 ablesen. Hier berührt sich die vorliegende Studie mit Ansätzen einer kulturhistorisch aufgeschlossenen Unternehmensgeschichte, die den Faktor Unternehmenskultur zunehmend als ausschlaggebend für den Unternehmenserfolg einschätzt. Denn ein gemeinsamer Vorrat an Sinnmustern stellt eine kaum zu überschätzende Ressource für die innere Kohäsion eines Unternehmens dar. In dem hier vorliegenden Fall hat der Gründervater allerdings kein normativ aufgeladenes Regelwerk im Sinne einer Unternehmensphilosophie als Richtschnur für unternehmerisches Handeln hinterlassen, wie es beispielsweise Robert Bosch tat.17 Die Porsche GmbH/KG wurde – zumindest auf der Ebene der leitenden Ingenieure, die ein ausgeprägtes Treueverhältnis mit Ferdinand Porsche verband – zu einem überaus homogenen Sozialverband. Die wichtigste Triebkraft für die unternehmensinterne Gemeinschaftsstiftung bildete diese von Porsche selbst gestiftete, affektiv aufgeladene, asymmetrische Beziehung zum bewunderten und kritiklos angebeteten Patriarchen. Solche personenbezogene Treue lässt sich nicht auf den Unternehmensnachfolger übertragen.18 Gab es also weitere identitätsfördernde Faktoren, die das Unternehmen im Innersten zusammenhielten? In diesem Kontext wird man vor allem einer landsmannschaftlich erstaunlich homogenen Personalrekrutierung Aufmerksamkeit schenken. Die Mitglieder der Kernmannschaft des Stuttgarter Konstruktionsbüros waren fast alle in Altösterreich aufgewachsen und hatten mit Ferdinand Porsche bereits während seiner langjährigen Tätigkeit für österreichische Fahrzeughersteller zusammengearbeitet.
Dass der Historiker Selbstbeschreibungsdiskurse nicht einfach übernehmen darf, liegt auf der Hand. Zeitgenossen wie engagierte Beobachter haben nicht mit dem Begriff »Genie«19 gegeizt, wenn sie Ferdinand Porsche angemessen zu beschreiben suchten. Eine solche Bezeichnung trifft aber auf Porsche ebensowenig zu wie der normativ aufgeladene Begriff »Erfinder«. Eine adäquate Annäherung an die Stellung, die der Unternehmensgründer, Mehrheitsgesellschafter und tatkräftige Entscheider einnahm, hat immer auch die Verfahrensabläufe im Konstruktionsbüro abzubilden, bis ein Entwurf fertig gestellt war. Dabei hat man von der durch einen genialischen Erfinderkult genährten Vorstellung Abstand zu nehmen, hier habe sich ein einzigartiger Künstler in einem präzedenzlosen Werk verewigt. Denn das Konstruieren eines Fahrzeugs war ein arbeitsteiliger Prozess eines ganzen Teams, das sich gezielt aus Vorarbeiten Dritter bediente. Ferdinand Porsche hat dies in einer der ganz wenigen schriftlichen Aussagen über seine Profession treffend skizziert: »Das Werk eines Konstrukteurs gleicht einem Mosaik und ist gleich ihm zusammengesetzt aus vielen kleinen und großen, auch hellen und dunklen, Steinen. Ein solcher Stein ist das Wissen und Wirken anderer Konstrukteure, das meist über Veröffentlichungen kund wird.«20 Die Kreativität eines Konstrukteurs bestand demnach nicht in einer Schöpfung aus dem Nichts, sondern in dem fantasievollen Zusammenfügen unterschiedlicher Elemente zu einem Ganzen, das mehr als die Summe seiner Teile war.
Unter den an diesem Schöpfungsprozess beteiligten Akteuren nimmt Ferdinand Porsche unbestritten den ersten Platz ein. Daher lohnt es, an dieser Stelle einen Blick auf die wichtigsten beruflichen Stationen Ferdinand Porsches zu werfen, bevor er sich mit seinem Unternehmen in Stuttgart selbstständig machte.
Der 1875 in Nordböhmen geborene Porsche entschloss sich zum eigenen Unternehmertum erst, nachdem er drei Jahrzehnte lang als Chefkonstrukteur bei verschiedenen bedeutenden Automobilunternehmen in Österreich und Deutschland gewirkt hatte. Seine Interessen reichten weit über die Passion für die Mechanik hinaus, die bei einem Fahrzeugkonstrukteur zu erwarten ist. Schon in jungen Jahren beschäftigte ihn die Frage, wie man die Elektrizität, die um 1900 ihren Siegeszug antrat, für den Antrieb von Fahrzeugen nutzen könne. Kaum hatte er seine erste Leitungsposition inne, setzte er diese Lieblingsidee, die ihn zeit seines Lebens beschäftigen sollte, in die Tat um. Porsche wurde mit dem lenkbaren Radnabenmotor zu einem Pionier der Elektromobilität, da er damit eine innovative Lösung des Antriebsproblems bei Elektrofahrzeugen entwickelte. Vorgestellt wurde das erste Radnabenelektromobil »System Lohner-Porsche« im April 1900 auf der Weltausstellung in Paris, wo es für erhebliches Aufsehen sorgte.21 Porsche beschritt diesen Weg konsequent weiter, indem er seine batteriegespeisten Radnabenantriebe mit einem Benzinmotor kombinierte. Damit war das Prinzip des seriellen Hybridantriebs geboren. Mit dem ersten funktionsfähigen Vollhybridautomobil der Welt, dem »Semper Vivus«, betrat er 1900 technisches Neuland und brachte danach das Konzept des Hybridantriebs bis zur Serienreife. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Ferdinand Porsche an diese innovativen Anfänge immer wieder anknüpfte und er dem Hybridantrieb selbst bei einem Panzerkampfwagen zum Durchbruch verhelfen wollte.
Von 1906 an trug Porsche fast ein Vierteljahrhundert lang als Technischer Direktor Verantwortung für Serienprodukte führender europäischer Automobilhersteller: zunächst von 1906 bis 1923 bei Austro-Daimler, einem österreichischen Produzenten in Wiener Neustadt, danach bei der Daimler-Motoren-Gesellschaft in Stuttgart-Untertürkheim, wo er als Technischer Direktor wie auch als Vorstandsmitglied wirkte. Doch ausgerechnet hier, an der Wiege des Automobils, geriet seine Karriere ins Stocken. Porsche verließ das Unternehmen, das sich inzwischen mit Benz & Cie. zur Daimler-Benz AG fusioniert hatte, im Januar 1929 im Streit. Es folgte ein Intermezzo bei den oberösterreichischen Steyr-Werken, das aufgrund der schweren Wirtschaftskrise schon nach wenigen Monaten beendet wurde. Ferdinand Porsche war zu dieser Zeit bereits Mitte fünfzig und wurde – da die Automobilbranche schwer unter der Wirtschaftskrise litt und nicht nach Konstrukteuren Aussschau hielt – von Existenznöten geplagt. In dieser Notlage wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete in Stuttgart ein Unternehmen, das auf dem Automobilsektor Dienstleistungen anbot. Seine Stammbelegschaft bestand aus einer Gruppe von Ingenieuren und Technikern, mit denen er bereits bei Austro-Daimler und Steyr zusammengearbeitet hatte. Mit von der Partie war von Beginn an auch sein 1909 geborener Sohn Ferdinand Anton Ernst, genannt »Ferry«. Im Umfeld dieser erfahrenen Ingenieure erwarb Ferry Porsche eine solide Wissensbasis und entwickelte sich innerhalb weniger Jahre vom Praktikanten zum Juniorchef des Unternehmens. Der Unternehmensgründer war also von Anfang an bestrebt, seinen Sohn als Nachfolger aufzubauen.22
Ferdinand Porsche war kein Mann der Feder und der Bücher, sondern ein Techniker, von Unrast getrieben auf der ständigen Suche nach der optimalen technischen Lösung. Daher sind von seiner Hand stammende oder von ihm autorisierte schriftliche Zeugnisse überaus rar. Reflexionen über sein Leben und Werk hat er erst in den letzten Lebensjahren in einer kommunikativen Sondersituation vorgenommen. Daher kann die Studie nicht auf einen breiten Fundus an Egodokumenten zurückgreifen, zumal auch Familienkorrespondenz nur sehr begrenzt vorhanden ist. Allerdings steht mit dem Tagebuch des Porsche-Chefkonstrukteurs Karl Rabe eine bedeutsame Ersatzüberlieferung zur Verfügung. Das Defizit an Selbstzeugnissen kann überdies kompensiert werden mit Hilfe weiterer Archivalien unterschiedlicher Provenienzen, so dass sich Porsches beruflicher Lebensweg von 1931 bis 1951 sowie die Entwicklung seines Unternehmens minutiös nachverfolgen lassen. Als besonders ergiebig haben sich dabei die Archive der beiden Firmen erwiesen, mit denen Porsche und seine Gesellschaft in intensiven Geschäftsbeziehungen standen: die Daimler-Benz AG sowie das Volkswagenwerk. Die staatsnahen Aufträge (Volkswagen, Panzerkampfwagen) haben darüber hinaus in staatlichen Archiven vielfältige Spuren hinterlassen, wobei insbesondere das Bundesarchiv Berlin und das Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg zu nennen sind. Über die komplexen eigentumsrechtlichen Fragen von 1945 an sowie über die politischen Einstellungen der Führungsmannschaft geben Akten im ehemaligen Berlin Document Center sowie in den mit der Entnazifizierung befassten Staatsarchiven Auskunft. Dokumente aus staatlichen und privaten französischen Archiven liefern Aufschlüsse zum Geschehen um die bislang nur in Umrissen bekannte Inhaftierung Ferdinand Porsches und seines Schwiegersohns durch die französische Militärjustiz in den Jahren 1945 bis 1947. In österreichischen Archiven wurde Einsicht genommen in Archivalien zu dem bislang wenig beachteten Strang der Unternehmensgeschichte, der im Nachkriegsösterreich spielt. Die wichtigste archivalische Basis der vorliegenden Untersuchung stellt das Archiv der »Porsche AG« dar, dessen reichhaltige Bestände sich zu nahezu allen behandelten Fragen als ergiebig erwiesen.
Die »Porsche AG« hat das hier vorgelegte Werk insofern unterstützt, als sie über die enge Kooperation mit ihrem Historischen Archiv hinaus Mittel zur Verfügung stellte, die es dem an erster Stelle genannten Verfasser erlaubten, neben seinen ungeminderten akademischen Verpflichtungen an seiner Heimatuniversität die Arbeit an dieser Studie zu übernehmen. Der hier vorgelegte Text ist die Frucht intensiven wissenschaftlichen Austausches des Hauptverfassers mit den aus Projektmitteln finanzierten Koautoren, wobei festzuhalten ist, dass etwa neun Zehntel des Textes von ihm verfasst wurden. Eine Projektförderung durch ein Unternehmen wirft zwangsläufig die Frage auf, unter welchen Bedingungen dieses Projekt durchgeführt wurde. Es sei daher an dieser Stelle in aller Deutlichkeit angemerkt, dass die Verfasser uneingeschränkte inhaltliche Gestaltungsfreiheit sowie ungehinderten Zugang zu allen im Porsche-Archiv verwahrten Unterlagen besaßen.
Ferdinand Porsche 1937 in seinem Konstruktionsbüro in der Stuttgarter Kronenstraße 24.
KAPITEL 1Wagemutiger Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit
Ferdinand Porsche war kein unbeschriebenes Blatt, als er im Dezember 1930 die »Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH« gründete. Aber es war auch nicht so, dass die deutsche Fahrzeugindustrie sehnsüchtig darauf gewartet hätte und bei ihm die Auftraggeber Schlange standen. Eher das Gegenteil war der Fall: Für das neue Unternehmen war es schwer, sich auf dem hart umkämpften Feld der Konstruktionsleistungen zu behaupten. Es ist daher begründungsbedürftig, warum sich dieses Unternehmen nach Anfangsschwierigkeiten prächtig entwickelte und schon nach einigen Jahren zu einem Komplettanbieter von Entwicklungsaufträgen avancierte. Seit 1937 bestand es nicht mehr allein aus dem Konstruktionsbüro, sondern war auch räumlich zu einem Versuchsbetrieb gewachsen, der Fahrzeuge bis hin zur Serienreife in Eigenregie entwickelte. Der Name Ferdinand Porsche war in diesem Zeitraum zu einem Markenzeichen für besonders attraktive Fahrzeuge geworden und hatte eine symbolische Aufwertung erfahren.
Dieser rasante Aufstieg bedarf der Erklärung – und dabei muss man sich davor hüten, den beruflichen Lebensweg Porsches einer mehr oder weniger verkappten Teleologie zu unterwerfen. Die bisher vorliegenden, stark biographisch ausgerichteten Studien zu Porsche folgen im Grunde alle einem Musternarrativ, das in Kurzform folgenden Inhalt hat:1 Der begnadete Autodidakt Ferdinand Porsche entflieht der Enge seiner nordböhmischen Heimat und macht sich in Wien schon in jungen Jahren mit aufsehenerregenden technischen Innovationen einen Namen. Es folgt ein unaufhaltsamer beruflicher Aufstieg: Ferdinand Porsche wird zum Technischen Direktor bei Austro-Daimler, einer in Wiener Neustadt angesiedelten Schmiede technisch innovativer Automobile. Nach dem Ersten Weltkrieg verlässt er das viel zu kleine Österreich und wendet sich nach Stuttgart, wo in der Tradition eines Gottlieb Daimler und Carl Benz, den Pionieren des Automobils schlechthin, die europäische Marktführerschaft angestrebt wird. Porsche bereichert die Angebotspalette des Stuttgarter Automobilherstellers Mercedes mit richtungweisenden Innovationen und krönt nach einem kurzen Zwischenspiel in seiner österreichischen Heimat (bei der Steyr-Werke AG) seine Stuttgarter Karriere mit der Gründung eines selbstständigen Konstruktionsbüros in der Automobilmetropole. Die Gründung eines eigenen Unternehmens erscheint mithin als logischer Karriereschritt, denn ein technisches Genie wie Porsche kann auf Dauer nicht fremden Herren dienen, sondern benötigt ein eigenes Unternehmen, um seine vielfältigen Ideen ohne großbetriebliche Reibungsverluste der Welt präsentieren zu können. Es ist nicht verwunderlich, dass Porsche sein berufliches Leben rückblickend nach diesem Erzählmuster präsentiert hat. Im Frühjahr 1943 stellte er seinen Weg in die Selbstständigkeit als zwangsläufige Konsequenz von Entwicklungen in seinem beruflichen Leben dar, die er stets selbst gelenkt habe: »In diesem Augenblick hielt ich den Zeitpunkt für gekommen, das zu verwirklichen oder, besser und richtiger, zu wagen, was mir schon lange als Wunschbild vorschwebte: ein eigenes selbständiges Konstruktionsbüro zu besitzen, das allen Automobilfabriken zur Verfügung stehen sollte. Es wurde Wirklichkeit unter dem heute wohl nicht mehr unbekannten Firmenschild: ›Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH.‹ mit dem Sitz in Stuttgart.«2
Der Historiker wird solchen retrospektiven Entwürfen des eigenen Lebens immer mit besonderer Skepsis gegenüberstehen, wenn er dem tatsächlichen Geschehen auf die Spur kommen möchte. Denn autobiographische Konstruktionen des eigenen Lebens sagen oft mehr über das retrospektive Feilen am eigenen Ich aus als über faktisch verbürgte Geschichte. Rückblicke auf die eigene Vita im Abstand von vielen Jahren zum tatsächlichen Geschehen enthüllen die Selbstwahrnehmung des Verfassers und die Art und Weise, wie er retrospektiv Vergangenheit nach gegenwartsabhängigen Kriterien strukturiert und damit zwangsläufig verformt. Nur eine naive, die Erkenntnisse der historischen Memorik3 ignorierende Herangehensweise wird solche Erinnerungen für bare Münze nehmen. Gewiss besitzen Erinnerungen einen Wert als historische Quelle, aber weniger als valide Dokumentation der Vergangenheit, sondern vielmehr als nachträgliche Organisation des eigenen Lebens. Dies gilt auch für die von Ferdinand Porsche und seinen engen Mitarbeitern verfassten autobiographischen Zeugnisse.
Wenn wir die historischen Dokumente von den Staubschichten solcher nachträglichen Erzählungen reinigen, dann gelangt man zu dem Ergebnis, dass für Ferdinand Porsche die Gründung eines Unternehmens keineswegs die Krönung seines beruflichen Lebenswegs bedeutete, denn er fühlte in sich keine wirkliche Berufung zum klassischen Unternehmer. Dazu fehlte ihm der kommerzielle Sinn, technische Erzeugnisse unter dem Aspekt ihrer Gewinnaussichten herzustellen. Zeit seines Lebens blieb er im Kern ein Ingenieur, der nach der technischen Vollkommenheit des Produktes strebte und nicht nach dessen Absatzchancen fragte. Seine Wunschposition war die eines leitenden Angestellten, genauer eines Technischen Direktors bei einem renommierten Automobilproduzenten. Als solcher konnte man seine technischen Ideen umsetzen, wenn die Eigentümerseite einen gewähren ließ. Aus dieser Konstellation ergab sich für Porsche aber unvermeidlich eine Kollision, wenn die Geschäftsführung seine ambitionierten Pläne auf den betriebswirtschaftlichen Prüfstand stellte und ihnen bei zu großen finanziellen Risiken eine Absage erteilte. Aus genau diesem Grund kehrte er Austro-Daimler im Jahr 1923 den Rücken, nachdem dort mit Camillo Castiglioni ein auf kurzfristige Gewinne zielender Geschäftsmann4 die Ausrichtung des Unternehmens immer mehr bestimmte. Castiglioni verkörperte für Porsche den Inbegriff des an schnellen Profiten interessierten Spekulanten, einen Typ von Unternehmer, der ihm besonders unsympathisch war. Zu dieser Spezies ging Porsche fortan auf Distanz; und auch nach seinem erzwungenen Einstieg in die unternehmerische Selbstständigkeit hielt er sich konsequent fern von allen sozialen Verkehrskreisen des Wirtschaftsbürgertums.
Porsche ist in seiner Zeit bei Austro-Daimler allerdings auch dem Pendant von Castiglioni begegnet: dem Motorsportenthusiasten Alexander Graf Kolowrat-Krakowsky, der sein Engagement als Verwaltungsratsmitglied von Austro-Daimler unter Rückgriff auf eine gut gefüllte Privatschatulle betrieb. Kolowrat ermöglichte Porsche die Konstruktion, Entwicklung und Produktion der Prototypen eines Kleinwagens, der unter dem Namen »Sascha« Motorsportgeschichte schrieb.5 Doch auch ein so edler Sponsor wie Kolowrat taugte kaum als unternehmerisches Vorbild für Porsche, da der Graf sich vor lauter Begeisterung für die nach ihm benannten »Sascha«-Kleinwagen finanziell übernahm und seine Familie nach seinem frühen Tod nur noch einen Bruchteil des einstigen Vermögens vorfand. Dazu hatte allerdings erheblich beigetragen, dass der Verstorbene auch in das von ihm geradezu obsessiv betriebene Filmgeschäft beträchtliche private Mittel investiert hatte.6
In technischer Hinsicht drang Porsche mit dem »Sascha« in neue Dimensionen beim Kleinwagenbau vor; und auch die eigens für das anspruchsvolle Rundrennen »Targa Florio« im Jahr 1922 gebaute Rennausführung fiel mehr als ansprechend aus. Allerdings vermochte selbst die Anschubfinanzierung durch den uneigennnützigen Sponsor das strukturelle Kernproblem des Konstrukteurs Ferdinand Porsche nicht zu lösen: Der Aufbruch zu neuen technischen Ufern stand immer unter dem Vorbehalt, dass sich solche ambitionierten Projekte aus Sicht der Geschäftsführung rechneten. Da Austro-Daimler keine ausreichenden Absatzchancen für den 1,1-Liter-»Sascha«-Kleinwagen sah, kam es nicht zur Serienproduktion. Damit blieb Porsches Arbeit unvollendet: Er hatte zwar auf dem zukunftsträchtigen Gebiet der Kleinwagenherstellung dank des edlen Mäzens Kolowrat außergewöhnlich günstige Arbeitsbedingungen vorgefunden und verheißungsvolle Prototypen konstruieren und entwickeln können, aber in Serie gingen sie allesamt nicht. Es war kaum vorstellbar, dass er ein zweites Mal einen privaten Geldgeber fand, der einem börsennotierten Automobilhersteller das finanzielle Risiko der Konstruktion und Entwicklung eines neuartigen Fahrzeugtyps abnehmen würde.
Die Geschichte des »Sascha«-Kleinwagens zeigt, wie eingeschränkt die Gestaltungsspielräume selbst des für die technische Entwicklung Zuständigen bei einem anerkannten Automobilhersteller waren. Porsches Herz aber schlug für ungewöhnliche, ja aufregende technische Lösungen; eine routinemäßige Verbesserung der laufenden Produktion war nicht seine Welt. Bot daher nicht der Sprung in die Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit, den ständigen Kompromissen zu entfliehen, die der Alltag bei einem Automobilhersteller mit sich brachte? Porsche hätte diese Frage zweifellos bejaht, wenn er sicher gewesen wäre, es als selbstständiger Konstrukteur nur mit Auftraggebern vom Schlage eines Grafen Kolowrat zu tun zu haben: Enthusiasten, die er mit seiner Begeisterung für neuartige technische Lösungen anstecken konnte und die in nie endendem Langmut den Glauben an die innovative Kraft der Porsche-Projekte auch dann nicht verloren, wenn sich bei der Realisierung Rückschläge einstellten.
Die Zukunft sollte zeigen, dass Porsche von 1933 an für mehr als ein Jahrzehnt tatsächlich unter derartig privilegierten Bedingungen an der optimalen technischen Lösung feilen konnte, wobei die Politik die Rolle des Grafen Kolowrat in nuce übernehmen sollte. Doch das war nicht vorauszusehen. Nüchtern betrachtet war der Schritt in die Selbststständigkeit ein Abenteuer, das zu wagen man schon triftige Gründe haben musste. Porsche wusste, dass er als Inhaber eines unabhängigen Konstruktionsbüros bei der Annahme von Aufträgen nicht wählerisch sein durfte. Die technische Selbstverwirklichung würde dabei vermutlich nicht an oberster Stelle stehen.
Es muss schon einiges vorgefallen sein, dass Ferdinand Porsche sich schließlich zu diesem Schritt entschloss. Dies ist der Aspekt, unter dem hier Porsches Tätigkeit für den schon damals renommierten Stuttgarter Automobilhersteller Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), den Nukleus der 1926 gegründeten Daimler-Benz AG, betrachtet werden soll. Ferdinand Porsche trat im April 1923 als Technischer Direktor bei der DMG ein;7 darüber hinaus wurde er in den Vorstand berufen, was einen beruflichen Aufstieg bedeutete, da er in dem Gremium vertreten war, welches über das operative Geschäft befand. Porsche erhielt einen bis 1928 befristeten Arbeitsvertrag und ein ansehnliches Jahresgehalt,8 welches die Wertschätzung zum Ausdruck brachte, die ihm von Seiten des Stuttgarter Autobauers gezollt wurde. Dass Porsche seinen Arbeitgeber nach fünf Jahren im Streit verließ, braucht an dieser Stelle nicht in allen Einzelheiten aufgerollt zu werden. Der Konflikt als solcher ist für die weitere Karriere Porsches aber von Belang, weil er ein Schlaglicht auf sein berufliches Selbstverständnis wirft: Porsche bestand in den Verhandlungen nach Ablauf seiner Vertragszeit auf dem Primat der Konstruktion vor der Produktion und leitete daraus den Anspruch ab, dass die immer wieder aufkommenden »Reibungen zwischen Fabrikation und Konstruktion« nur ausgeräumt werden könnten, wenn »die gesamte technische Leitung in einer Hand« lag, und zwar in der des Technischen Direktors, also in seiner eigenen.9 Darin zeigte sich eine Grundeinstellung, die er während seines gesamten Berufslebens nicht ablegte: Die Produktion habe sich den Erfordernissen der Konstruktion unterzuordnen; gegenüber dem kreativ veranlagten Konstrukteur sei der Herstellungsexperte nur ein dienstbarer Geist. Diesen Standpunkt vertrat Porsche gegenüber keinem Geringeren als dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Daimler-Benz, Emil Georg von Stauß, der zugleich Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank war. Aus dem Primat der Konstruktion leitete Porsche ein erhebliches Mitspracherecht in »allen wichtigen kommerziellen Fragen« ab – und überspannte damit den Bogen. Die Daimler-Benz AG wollte sich nicht der Dominanz ihres Chefkonstrukteurs beugen, zumal dieser in seinem Entwurf zur Verlängerung des Arbeitsverhältnisses seinen Führungsanspruch über die Zentrale in Stuttgart-Untertürkheim hinaus auf sämtliche Betriebe des Unternehmens ausdehnen wollte.10
Dass man sich im Arbeitsleben trennt, weil divergierende Vorstellungen über das operative Geschäft herrschen, ist keine Seltenheit. Wenn es allein um unterschiedliche Auffassungen über den innerbetrieblichen Stellenwert des Chefkonstrukteurs gegangen wäre, hätte ein auslaufender Vertrag ein unspektakuläres Ende gefunden. Doch Porsches Abschied war mit einem hässlichen Streit verbunden, in dem beide Parteien die andere Seite in ein möglichst unvorteilhaftes Licht zu rücken versuchten. Fest steht, dass Porsche in seiner Stuttgarter Zeit Privatschulden angehäuft hatte, und zwar in erster Linie bei seinem Arbeitgeber. Im August 1928 stand er bei diesem mit etwa 110000 Reichsmark in der Schuld.11 Dass der leitende Angestellte einer Firma »mit erheblichen Beiträgen als Schuldner in deren Büchern«12 auftaucht, ist in der Tat ungewöhnlich und erschwert eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen erheblich, weil die Schuldenfrage naturgemäß Konfliktpotenzial birgt. Porsche fuhr daher scharfe juristische Geschütze auf, vorgetragen von seinem Schwiegersohn Anton Piëch, der die Interessen seines Schwiegervaters mit der ihm eigenen Unerbittlichkeit wahrnahm. Die Schulden seines Mandanten seien mit dessen finanziellen Ansprüchen gegen seinen Arbeitgeber zu verrechnen, argumentierte Piëch. Bei dieser Rechnung ergebe sich ein Saldo von nicht weniger als 100000 Reichsmark zugunsten Porsches.13 Bei derartig exorbitanten Forderungen auf beiden Seiten war der Gang vor Gericht unvermeidbar. Der Rechtsstreit zog sich über mehrere Etappen14 bis in das Jahr 1930 hin und endete schließlich damit, dass Porsches Gesamtschuld gegenüber seinem Arbeitgeber gegen eine Einmalzahlung von 30000 Reichsmark als abgegolten angesehen wurde.15
Porsche hätte einen so langwierigen Rechtsstreit vermeiden können, wenn er auf den Vorschlag16 seines Noch-Arbeitgebers eingegangen wäre, der anbot, seinen Immobilienbesitz zu übernehmen und entsprechend mit seinen Schulden zu verrechnen, wobei er die Immobilie zur Miete weiter bewohnen konnte. Dass sich Porsche diesem Ausweg kategorisch verweigerte und es ihm gelang, sein Eigentum an der in Frage stehenden Immobilie – einer Privatvilla, die sich in bevorzugter Höhenlage im Stuttgarter Norden befand – zu behaupten, lädt zu Nachfragen ein. In dieser Angelegenheit kommt eine Seite Porsches zum Vorschein, die für den unternehmensgeschichtlichen Zugang einigen Ertrag abwirft.
Sowohl die biographisch akzentuierte Unternehmensgeschichte als auch die kulturgeschichtlich ausgerichtete Bürgertumsforschung haben die Bedeutung des Privathauses für den Wirtschaftsbürger unterstrichen: Bürgerliche Vergesellschaftung findet auch und gerade im eigenen Domizil statt – und zwar dann, wenn es als Treffpunkt für bürgerliche Geselligkeit dient.17 Bekannte sich Porsche mithin zu einer genuin bürgerlichen Lebensform, als er in Stuttgart die renommierten Architekten Paul Bonatz und Fritz Scholer mit dem Entwurf einer Villa im Landhausstil auf dem Killesberg beauftragte? Führte er dort ein gastfreundliches Haus, in das er Kultur- wie Technikinteressierte einlud, um gepflegte Konversation zu betreiben? Zeugt sein hartnäckiges Festhalten an dem Besitz davon, dass er diese Pflanzstätte bürgerlicher Reproduktionsformen bewahren wollte?
Ein näherer Blick auf die architektonische Gestaltung und vor allem die soziale Nutzung der Immobilie am Feuerbacher Weg 48 offenbart, dass in diesem Haus kein genuin bürgerlicher Lebensstil gepflegt wurde. Dabei soll »Bürgerlichkeit« verstanden werden als ein nicht abgeschlossener Prozess individueller Persönlichkeitsreifung, bei dem ästhetische Bildung einen unentbehrlichen Beitrag zur Genese eines handlungsleitenden Sets an Orientierung leistet.18 Zur bürgerlichen Lebensgestaltung zählt im Kern auch, dass sich solche Suchbewegungen einfügen in kommunikative Austauschbeziehungen, die der regelmäßigen Pflege und Einübung solcher Bildungspraxen dienen. Von solchen genuin bürgerlichen Geselligkeitsformen hielt Ferdinand Porsche sich allerdings völlig fern. Er mied die Treffpunkte bürgerlicher Kultur und begab sich höchstens einmal zu einem Kinobesuch oder dem Besuch eines Marionettentheaters außer Haus.19 Die Welt der Bücher und der Musen war ihm fremd. Die architektonische Anlage seines Anwesens bestätigt das: Es gab in dieser Immobilie keine große Bibliothek des Hauseigentümers, in welcher die literarischen Zeugnisse bürgerlichen Bildungseifers gesammelt wurden. Stattdessen hatte Porsche direkt neben dem Wohnhaus eine geräumige Garage mit angegliederter Werkstatt20 bauen lassen, um dort nach Ende der Bürotätigkeit nach Herzenslust seinen mechanischen Neigungen nachgehen zu können. Statt nach Feierabend ein Buch in die Hand zu nehmen und den Tag mit dem bürgerlichsten aller deutschen zeitgenössischen Schriftsteller – Thomas Mann – ausklingen zu lassen, leistete Porsche in seinem speziellen »home office«, der Garage, eine spezifische Form der Heimarbeit. Dies kam seinem Unternehmen in späteren Zeiten sehr zugute; schließlich wurden dort in Handarbeit die ersten Versuchswagen des legendären Volkswagen angefertigt. Aber in Bezug auf den wirtschaftsbürgerlichen Habitus von Ferdinand Porsche ist zu konstatieren, dass dieser kein klassischer Bürger im Sinne eines bürgerlichen Lebensentwurfes war und sich damit nicht unerheblich selbst vom Gros der technischen Intelligenz unterschied.
Wie passt dazu, dass Porsche überaus großen Wert auf seine Ehrendoktortitel legte? Die akademische Würde des »doctor honoris causa« hatten ihm zwei technische Hochschulen verliehen: 1917 die Technische Hochschule Wien und 1924 die Technische Hochschule seines neuen Wirkungskreises Stuttgart.21 In beiden Fällen war es eine Anerkennung für vielfältige technische Leistungen, für welche einflussreiche universitäre Kreise die Verleihung des Ehrendoktortitels für angebracht angesehen hatten. Porsche heftete sich diese Auszeichnungen, die in akademischen Kreisen nicht als Ausweis genuin wissenschaftlicher Befähigung galten, stolzgeschwellt ans Revers; und auch in dem später von ihm mitbegründeten Unternehmen durfte das »Dr. h.c.« im offiziellen Firmennamen nicht fehlen. Von seinen Mitarbeitern ließ er sich ehrfürchtig mit »Herr Doktor« anreden oder schriftlich betiteln.22 Nachweislich genoss er es, wenn im offiziellen Schriftverkehr und in der Öffentlichkeit von »Doktor Porsche« die Rede war und damit Gleichheit mit dem durch eine Dissertation erworbenen Doktorgrad zu herrschen schien. Dahinter verbarg sich mehr als die in seiner altösterreichischen Heimat nicht unübliche Titelsucht. Denn im technikbegeisterten Deutschen Reich hatte es ein Konstrukteur wie Ferdinand Porsche gar nicht nötig, sich durch einen Ehrendoktortitel gesellschaftliche oder geschäftliche Anerkennung zu erwerben. Für Porsche aber war der Ehrendoktortitel letztlich ein Symbol für die gesellschaftliche Respektabilität eines beruflichen Aufsteigers, dem die Weihen höherer Bildung fehlten und der dieses Manko durch das Führen eines wohlklingenden Titels zu kompensieren suchte. Die Aufdringlichkeit, mit der sich Porsche mit solchen Meriten schmückte, stand in deutlichem Kontrast zur bürgerlichen Tugend stilvoller Zurückhaltung und unterstreicht, dass er in habitueller Hinsicht eben kein Bürger war.
Warum hielt Porsche dann trotz der ihn drückenden Schuldenlast so hartnäckig an seinem Haus fest, dessen Besitz ihn bis zum Eintritt in die Selbstständigkeit in finanzieller Hinsicht einengte? Man kann wohl annehmen, dass das Anwesen am Feuerbacher Weg 48 für ihn weit mehr war als ein privater Rückzugsraum. Und in der Tat stellte die Porsche-Villa vor allem den Kristallisationskern innerfamiliärer Gemeinschaftsbildung dar: Das Mehrfamilienhaus sollte drei Generationen beherbergen, da für Ferdinand Porsche außer Frage stand, dass sein gleichnamiger Sohn – zur besseren Unterscheidung vom Vater »Ferry« gerufen – nach der Eheschließung mit seiner Familie auf dem väterlichen Anwesen bleiben und damit die Enkelgeneration in unmittelbarem Kontakt zum Großvater aufwachsen würde. Schon früh stand fest, dass Ferry beruflich in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Dem Sohn waren rebellische Neigungen gegen den autoritären Vater fremd, der schon früh die Weichen für dessen Zukunft gestellt hatte. Die Imitation des Vaters wurde Ferry gewiss auch dadurch erleichtert, dass kein jüngerer Bruder mit ihm in Konkurrenz treten konnte,23 da er als Einziger den Namen Porsche an die nachfolgende Generation weitergeben konnte. Das ließ bei ihm einen ausgeprägten Sinn für die Verantwortung entstehen, die er in Bezug auf die Zukunft der Familie trug, aber durchaus nicht das Gefühl der Überforderung aufkommen. Wie der Vater war auch der Junior ein technikbesessener Automobilist, der schon mit 16 Jahren den Führerschein für Kraftfahrzeuge erwarb und nach der Mittleren Reife eine technische Ausbildung absolvierte.24 Bereits mit 18 Jahren hatte der 1909 geborene Ferry die Frau fürs Leben – eine Stuttgarterin – gefunden, die er schließlich am 10. Januar 1935 ehelichte. Mit der Tatsache, dass Ferry Porsche katholisch getauft und Dorothea Reitz evangelischen Glaubens war, ging die Familie auf für sie typische Weise um: Die Trauung wurde von einem protestantischen Pfarrer vollzogen,25 und die vier der Ehe entstammenden Kinder – allesamt Söhne – wurden protestantisch getauft. Ferdinand Porsche pflegte ein sehr pragmatisches Verhältnis zu seiner katholischen Herkunftswelt, der er äußerlich verbunden blieb, ohne sich im Berufs-, Privat- oder Familienleben von den strengen Normen der katholischen Kirche in seinem Handeln einschränken zu lassen.
Vergleicht man die Familie Porsche mit einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmerfamilien, der Familie Thyssen, die ebenfalls katholischen Glaubens war, so fallen gewichtige Unterschiede auf: Zwar lässt sich in beiden Familien nicht normgerechtes Eheleben registrieren; doch kam der Katholizismus der Porsches ohne politische Auslegung, demonstrative Sichtbarkeit und auch ohne familiale Frömmigkeitsformen aus, wie sie bei den Thyssens über drei Generationen hinweg anzutreffen waren.26
Dem Familienpatriarchen Ferdinand Porsche lag vor allem daran, dass die Ehepartner seiner beiden Kinder ihn als Familienoberhaupt anerkannten und die Kernfamilie vergrößerten. Da Porsche neben dem Sohn Ferry nur noch ein Kind hatte, die Tochter Louise, kam der Auswahl des Schwiegersohns besondere Bedeutung zu, da die Familie um einen Stamm erweitert wurde, der nicht den Namen Porsche trug. Der Wiener Rechtsanwalt Anton Piëch, den Louise Porsche 1928 heiratete, erwies sich hier als ideale Wahl,27 denn er ergänzte das Portfolio des Porsche-Clans um die dort bislang nicht vorhandene juristische Kompetenz. Piëch vertrat als Rechtsanwalt die Interessen seines Schwiegervaters auf geradezu unerbittliche Weise. Dass die Ehe zwischen den beiden katholisch getauften Brautleuten am 28. Juni 1928 in der wichtigsten katholischen Stadtkirche – St. Eberhard im Stuttgarter Zentrum – geschlossen wurde, war für Ferdinand Porsche kaum von Bedeutung. Viel wichtiger war für ihn der Umstand, dass die Verbindung seiner Tochter mit dem vielfältig einsetzbaren Schwiegersohn, der weiterhin in Wien praktizierte, mit einer stattlichen Kinderschar – drei Jungen und ein Mädchen – gesegnet wurde, die sich häufig beim Großvater in Stuttgart aufhielten und dann selbstverständlich im Haus am Feuerbacher Weg wohnten.
Für die Typologie des knapp sieben Jahre nach Einzug in die Villa gegründeten Unternehmens »Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH« ist entscheidend, dass Porsche es von Anfang an als Familienunternehmen konzipiert hatte. Er musste manche Umwege gehen, bis am 14. Dezember 1937 mit der Kommanditgesellschaft die für ein Familienunternehmen maßgeschneiderte Unternehmensform gefunden war. Doch das strategische Ziel, das für ihn in dem Moment feststand, in dem er durch äußere Umstände den Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit gewagt hatte, verlor er nie aus dem Blick. Das Unternehmen, das seinen Namen trug, sollte den einzigen Personen, denen er vertraute, Eigentums- und Mitbestimmungsrechte einräumen: den Angehörigen seiner Kernfamilie. Auf Porsches Unternehmen trifft die Kategorie »Familienunternehmen« vollkommen zu, weil die Familie Porsche in dem Unternehmen ihren Einfluss in den beiden zentralen Bereichen zur Geltung brachte, die Familien offenstehen: in der Ausübung von Kontrollfunktionen vermittels der Eigentumsrechte und in der Mitwirkung an der Unternehmensleitung.28 Die Porsches verfügten von Anfang an über das Gros der Gesellschafteranteile, wobei Ferdinand Porsche stets weit mehr als die Hälfte der Anteile hielt. Diese Eigentumsrechte nutzten sie nicht nur dazu, die Gesamtausrichtung der Gesellschaft zu kontrollieren, sondern sie gaben auch den operativen Kurs des Unternehmens vor, wobei Ferdinand Porsche als Zentralfigur den unternehmerischen Alltag auf der Leitungsebene dominierte. Wenn man als zentrale unternehmerische Funktion den unbändigen Willen zur Konzipierung und Implementierung von Entscheidungen definiert, dann war Ferdinand Porsche ein überaus willens- und durchsetzungsstarker Unternehmer.29 Das von ihm ins Leben gerufene Unternehmen erfüllt in idealtypischer Weise das Anforderungsprofil eines Familienunternehmens – auch über das hier gewählte Ende des Untersuchungszeitraums im Jahr 1951 hinaus.
Das Porsche-Unternehmen war mithin seit seiner Entstehung als familiales Projekt konzipiert, wobei Familie und Vermögen aufs Engste miteinander verflochten waren.30 Darüber hinaus bildete die Kernfamilie für den Patriarchen Ferdinand Porsche die einzige Rekrutierungsbasis für vertrauenswürdiges Führungspersonal. Seine Zeit als Technischer Direktor bei Austro-Daimler wie bei Daimler-Benz hatte ihm lehrreiche Erfahrungen mit Entscheidungsstrukturen von Aktiengesellschaften beschert und in ihm die Überzeugung reifen lassen, dass sich ein auf den Namen Porsche lautendes Unternehmen gegenüber externen Kapitalgebern so reserviert wie möglich verhalten sollte. Dies ging nur, wenn die Familie als Rückzugsraum und Vertrauensspeicher wie als Rekrutierungsbasis für Führungsaufgaben innerhalb des Unternehmens zur Verfügung stand. Dieser gegen Außenstehende abgeschottete familiäre Mikrokosmos konnte entstehen, weil sich das gesamte soziale Leben im geschützten innerfamiliären Binnenraum abspielte und innerhalb der Familie andere Verhaltensformen galten als im gewöhnlichen sozialen Leben. Diese für Familienunternehmen typische Kommunikationspraxis31 nutzte Porsche, um eine innerfamiliäre Kommunikationskultur zu etablieren, bei der es eine klare Hierarchie gab: Als Pater familias gab Ferdinand Porsche in jeder Hinsicht den Ton an; dieses autoritäre Kommunikationsmodell sah keine freimütige innerfamiliäre Aussprache vor und schon gar keine eingeübten Formen, in denen ein gleichberechtigter Austausch stattfinden konnte. Dass Porsche sich aller typisch bürgerlichen Geselligkeitsformen enthielt, war mithin auch eine Schutzmaßnahme, um das innerfamiliale Biotop nach außen abzuschotten und seine kommunikative Hegemonie zu perpetuieren. Porsche gewährte Fremden keine Einblicke in das Familienleben, wie er überhaupt sein Herz verschlossen hielt. Dass es einen Menschen gab, mit dem ihn eine Freundschaft verband, bei der man sein Innerstes nach außen kehrte, ist nicht bekannt. Das Naturell dieses eigenbrötlerischen Technikers, dem die Familie vollauf genügte, war der Ausbildung von Freundschaften kaum zuträglich. Die Porsche-Villa am Feuerbacher Weg erfüllte also zwei eng miteinander verflochtene Funktionen: Sie war innerfamiliales Refugium ebenso wie Stammsitz eines Familienunternehmens. Daher musste die Immobilie der Familie unbedingt erhalten bleiben. Das erklärt, warum Ferdinand Porsche im Rechtsstreit mit seinem Noch-Arbeitgeber Daimler-Benz im Jahr 1928 den Einsatz der Villa zur Begleichung der aufgehäuften Privatschulden kategorisch ausschloss. Diese Immobilie war – wie Piëch im Namen seines Schwiegervaters ausführte – »für seine Familie«32 bestimmt.
Porsches Agieren unter dem Primat familiärer Vergemeinschaftung hatte zur Folge, dass eine Pflanzstätte in Gestalt der Familienvilla geschaffen, erhalten und ausgebaut wurde. Für bis heute verbreitete Erzählmuster über Porsche und sein Unternehmen spielt der gemeinsame familiäre Ankerplatz eine gewichtige Rolle. Die immer weiter anwachsende Großfamilie Porsche-Piëch bildete eine Erzählgemeinschaft, die um den Ahnherrn zentriert war.33 Auf Ferdinand Porsche liefen alle – oft anekdotenhaft verpackten – Geschichten zu; er war und blieb in diesen überlieferten Narrationen der Spiritus rector, der Schöpfer aller technischen und ökonomischen Leistungen, die das nach ihm benannte Unternehmen vorzuweisen hatte. Der lange diskursive Schatten des Urvaters legte sich über alle Familienmitglieder, die sich mit ihrer dienenden Rolle gehorsam abfanden und bis in die dritte Generation die Familiensaga immer wieder erneuerten – vor allem wenn sie den Großvater noch persönlich erlebt hatten.34 Insofern handelt es sich um eine überaus langlebige »Generationenerzählung«,35 deren Kern getreulich an die jeweils nächste Generation weitergegeben wurde, wobei der Unternehmensbegründer als unbewegter Beweger im Porsche-Universum erschien.
Es ist kein Zufall, dass zu Porsches Lebzeiten keine autorisierte, auf breiter Materialbasis verfasste Biographie erschien,36 da Porsche die Deutungshoheit über sein Leben und Schaffen nicht an Familienfremde abtreten wollte. Als nach dem Ableben des Patriarchen im Jahr 1951 die erste gründliche Darstellung zu Ferdinand Porsche veröffentlicht wurde,37 fanden sich darin die traditionellen narrativen Muster – in gekonntem erzählerischen Arrangement verpackt – wieder. Diese erste solide Studie über Ferdinand Porsche stammte aus der Feder des Multitalents Richard von Frankenberg, der für dieses Buch wie für seine beachtlichen historischen Darstellungen das Pseudonym Herbert A. Quint gewählt hatte.38 Von den direkten Nachfahren Porsches fühlte sich besonders der treue Sohn Ferry bemüßigt, dieses Image seines Vaters zu perpetuieren.39 Die Pflege des Geschichtsbildes blieb gewissermaßen in der Familie – was durch den Umstand erleichtert wurde, dass die zumeist publizistisch arbeitenden Autoren, auch wenn sie von einem investigativen Impetus getragen wurden, sich letztlich auf autobiographische Aussagen von Familienmitgliedern stützten und auf diese Weise dazu beitrugen, dass der Kern der Familiengeschichte bis in unsere Tage nicht angetastet wurde.40 Darüber hinaus übertrug sich die Anhänglichkeit an den Unternehmensgründer auf die Söhne bewährter Mitarbeiter, die aus zweiter Hand nur Gutes über den von ihren Vätern verehrten Chef zu berichten wussten, journalistischen Federn dementsprechend bereitwillig Auskunft erteilten und sogar Manuskripte redigierten.41
In Wahrheit war Porsches beruflicher Weg keine Schnellstraße, auf der der Protagonist mit hohem Tempo und großer Präzision geradlinig auf sein Ziel zusteuerte. Nach dem unter Verwerfungen erfolgten Ausscheiden bei Daimler-Benz fand Porsche zunächst eine neue berufliche Herausforderung, die nicht unbedingt einen beruflichen Aufstieg bedeutete. Er tauschte seinen Stuttgarter Direktorenposten gegen eine vergleichbare Position beim oberösterreichischen Unternehmen Steyr-Werke AG ein. Die Ursprünge dieses Unternehmens lagen in der Waffenherstellung, die sich nach dem Ende des für Österreich besonders desaströs verlaufenen Ersten Weltkriegs als nicht mehr zukunftsfähig erwies, so dass eine Umstellung auf die Kraftfahrzeugfertigung mit großem Elan vorangetrieben wurde. Bei diesem Prozess sollte Porsche an entscheidender Stelle mitwirken. Doch sein Wirken in der oberösterreichischen Provinz währte nicht lange, da die Wirtschafts- und vor allem die Finanzkrise dem kleinen Österreich und insbesondere Steyr so sehr zusetzten, dass die Automobilproduktion wegen gewaltiger Überkapazitäten im Jahr 1930 für ein Jahr stillgelegt werden musste. Ferdinand Porsche brachte während seines Intermezzos in Steyr zwar ansehnliche Sechs-Zylinder-Serienwagen auf den Markt, dennoch wurde sein Kontrakt Anfang 1930 aufgelöst, so dass er sich erstmals in seiner beruflichen Laufbahn mit Existenznöten herumzuplagen hatte.42
Es ist nicht übertrieben, den Ferdinand Porsche des Frühjahrs 1930 als einen auf dem Arbeitsmarkt schwer Vermittelbaren einzustufen. Dies lag zum einen daran, dass sich die Weltwirtschaftskrise just zu diesem Zeitpunkt auch in Deutschland mit voller Wucht bemerkbar machte und inbesondere die Absatzzahlen der Automobilindustrie drastisch absacken ließ.43 Damit sank der Bedarf an Konstrukteuren vom Schlage eines Porsche, die zu den besonders gut verdienenden Spezialisten einer schrumpfenden Branche zählten. Innerhalb der Automobilindustrie hatte sich aber auch Porsches Zerwürfnis mit seinem Ex-Arbeitgeber Daimler-Benz schnell herumgesprochen. So zeigte sich in diesen Krisenzeiten kein Automobilunternehmen in Deutschland bereit, einen Konstrukteur zu beschäftigen, der sich wenig um die Belange der Produktion scherte, in seiner kreativen Eigenwilligkeit ein nur gering ausgeprägtes Kostenbewusstsein besaß und dessen Teamfähigkeit zu wünschen ließ.
Der Prophet gilt bekanntlich nichts im eigenen Land, aber sollte es nicht wenigstens außerhalb des deutschsprachigen Raums eine Zukunft für einen so kreativen Kopf wie Porsche geben? Gewiss war es eine Übertreibung, wenn österreichische Automobilsportenthusiasten aus verständlichem Lokalpatriotismus die Rückkehr des verlorenen Sohnes – wie sich zeigen sollte nur für kurze Zeit – in die Heimat als Beleg des internationalen Renommees von Porsche deuteten.44 Porsche standen im Jahr 1930 eben nicht alle Türen offen; keine Anfrage aus dem wichtigsten europäischen Automobilland Frankreich erreichte den Konstrukteur. Frankreich betrieb erst dann auf eine eigentümliche Art »Headhunting« in Hinsicht auf Porsche, als dieser sich durch den Volkswagen mit fetten Lettern in die internationale Automobilgeschichte eingetragen hatte. Dies hieß nicht, dass sich das Ausland für Porsche nicht interessierte, nur kam die Anfrage eben nicht aus einem Land, das auf eine reiche Tradition im Automobilbau zurückblicken konnte, sondern aus der Sowjetunion, einem Entwicklungsland auf diesem Gebiet.
Im Mai und Juni 1931 verbrachte Porsche auf Einladung der sowjetischen Regierung knapp zwei Wochen in dem damals einzigen kommunistischen Staatswesen, das von oben eine Industrialisierung in großem Stil anschob und dafür nicht selten auf ausländische Experten zurückgriff.45 Auch wenn die Quellenlage in diesem Fall überaus schwierig ist, dürfte gesichert sein, dass den nunmehr selbstständigen Konstrukteur 1931 ein sowjetisches Angebot erreichte. Es war das Jahr, in dem der wirtschaftliche Austausch zwischen der kommunistischen Sowjetunion und dem Deutschen Reich Rekordniveau erreichte und speziell deutsche Ingenieure im Reich Stalins hoch im Kurs standen.46 Es war also kein Zufall, dass Porsche ins Visier der sowjetischen Industriepolitiker geriet. Am industriellen Aufbau des größten Landes der Erde mitzuwirken, war ein durchaus ehrenvolles Angebot und bezeugt die Wertschätzung, die Porsche von sowjetischer Seite zuteil wurde. Da keine ideologische Unterwerfung verlangt wurde, hätte ein im Kern unpolitischer Technokrat wie Porsche sich prinzipiell durchaus damit anfreunden können, am Aufbau des sowjetischen Sozialismus mitzuwirken. Da er sich in einer ökonomischen Lage befand, die ihm nicht erlaubte, sehr wählerisch zu sein, entschloss er sich zu einer ernsthaften Prüfung des Angebots, indem er sich vor Ort ein Bild von der Lage verschaffte. So reiste Porsche am 22. Mai 1931 über Berlin für zwei Wochen in das unbekannte Land im Osten.47 Dass er mit der sowjetischen Seite letztlich nicht handelseinig wurde, mag daran gelegen haben, dass er sich und seine Familie den Unwägbarkeiten der Existenz in einem kulturell so fremden Land nicht aussetzen wollte. Aber manches deutet auch darauf hin, dass die Absage erfolgte, weil ihm die von dem potenziellen Auftraggeber geforderten technischen Leistungen zu wenig anspruchsvoll waren. Dass Porsche eine mehrtägige Visite in Stalingrad absolvierte – einem Zentrum des gerade entstehenden Traktorenbaus –, spricht dafür, dass er vornehmlich für die Konstruktion von Traktoren eingesetzt werden sollte. Bei der Mechanisierung der Landwirtschaft mitzuwirken, hielt der Allrounder Porsche durchaus nicht für unter seinem Niveau – wenige Jahre später sollte er sich intensiv mit dem Entwurf eines Ackerschleppers beschäftigen –, aber diese bodenständige Tätigkeit allein hätte seinen schier grenzenlosen Erfindergeist nicht ausgelastet. Da in der Sowjetunion aber kein ausreichend großer Bedarf an Personenkraftwagen bestand, war es wohl nicht zuletzt die Reduktion seines beruflichen Portfolios, die Porsche von einem Engagement im Lande Stalins Abstand nehmen ließ.
War es aber nicht auch Heimatverbundenheit, die Porsche davon abhielt, in der Sowjetunion ein berufliches Auskommen zu finden? Die Frage nach der Beheimatung Porsches wirft einen erheblichen Erkenntnisgewinn ab, weil sie einen wichtigen Beitrag zur Typologisierung Porsches als Unternehmer leistet. Wenn man Porsche eine familienorientierte Unternehmensführung attestiert und in diesem Kontext die Familienvilla als innerfamiliäres Kommunikationszentrum einstuft, stellt sich die Frage, ob er durch die Absage an die Sowjetunion seine emotionale Zugehörigkeit zu diesem bestimmten Ort zum Ausdruck brachte und damit ein Heimatbekenntnis ablegte. Der Heimatdiskurs kann mithin wertvolle Einblicke in sein unternehmerisches Selbstverständnis liefern. Damit schließt man an jüngere wirtschaftshistorische Studien an, welche die regionale Verankerung von Unternehmen als identitätsstiftendes Herkunftsmerkmal in Rechnung stellen.48
Es lohnt sich, neuere Forschungen über Heimat für diesen Zweck heuristisch auszuwerten, wobei anzumerken ist, dass eine begriffsstarke und zugleich kulturhistorisch fundierte Beschäftigung mit dem komplexen Phänomen »Heimat« erst in den Anfängen steckt.49 Aus der Fülle oftmals unscharfer Heimatvorstellungen schälen sich zwei unterschiedliche Konzepte von »Heimat« heraus, die man als »naturales« beziehungsweise »konstruktivistisches« Verständnis von Heimat bezeichnen kann. Naturales Verständnis von Heimat bedeutet, dass Heimat als ein geographisch definierter Herkunftsort gilt. Heimatbindung entsteht gemäß dieser Lesart durch Verwurzelung in einem geographisch definierten Kulturraum, der im Idealfall mit dem Ort identisch ist, an dem man geboren ist, aufwächst und sich dauerhaft niederlässt. Dieses Verständnis von Heimat ist tendenziell immobil, weil es keine selbstgewählte Findung von Heimat erlaubt. Auch wenn heimatliche Verankerung ohne soziale Geborgenheit in einem überindividuellen Lebenskreis blutleer bleibt, beharrt diese Konzeption von Heimat darauf, dass die Orte von Kindheit und Jugend eine lebenslange emotionale Anhänglichkeit generieren. Die konstruktivistische Auffassung von Heimat betont hingegen die Mobilität von Heimat: Heimat wird delokalisiert und aus einer starren Ortsbezogenheit gelöst. In seine Heimat wird man daher nicht auf immer und ewig hineingeboren, sondern kann sich im Zuge individueller Mobilität Beheimatungen nach eigener Wahl schaffen – vorausgesetzt man wird fester Bestandteil verfestigter Gemeinschaften, welche das eigene Leben sozial wärmen und emotionale Geborgenheit stiften. Nach dieser Version können Menschen auf Wanderschaft problemlos eine zweite, dritte oder gar vierte Heimat erwerben, indem sie sich dauerhaft in stabile soziale Verkehrskreise integrieren. Der Ortsbezug von Heimat wird damit nicht suspendiert, weil heimatliche Geborgenheit nur gedeihen kann durch Festlegung auf einen räumlich fixierten Lebensmittelpunkt, der zugleich eine kulturräumliche Bindung impliziert. Aber er erlaubt es Arbeitsmigranten, sich auf ursprünglich fremde Kulturräume einzulassen, dort Wurzeln zu schlagen und auf diese Weise eine stabile neue Heimatbeziehung zu begründen.
Diese beiden hier präsentierten Heimatkonzepte bilden zwei Idealtypen von Heimat, die auf individueller Ebene durchaus kombinierbar sind. Bei Ferdinand Porsche registrieren wir eine spezifische Vermengung, die es ihm gestattete, sich eine emotionale Anhänglichkeit an seine Herkunftsregion zu bewahren und zugleich Stuttgart als heimatliche Destination für die Großfamilie aufzubauen. Dass er zeit seines Lebens die nordböhmische Gegend um Reichenberg, wo er aufwuchs und seine ersten beruflichen Gehversuche unternahm, als seine Heimat im Sinne der Gebundenheit an einen geographisch definierten Kulturraum verstand, wird unter anderem aus den wenigen Selbstzeugnissen ersichtlich, die wir von ihm besitzen. So ließ er in einem der ganz raren brieflichen Egodokumente seinen alten Schulfreund Emil Matzig aus seinem Geburtsort Maffersdorf tief in sein Innerstes blicken. In diesem Brief vom 19. März 193750 zog Porsche eine Bilanz seines Lebens: Er blickte zurück auf seine vielfältigen beruflichen Stationen (»Ich sah Maffersdorf, Wien, Wiener Neustadt, Stuttgart, Steyr und wieder Stuttgart«) und stellte sich die Frage, ob sein von Unrast bestimmtes Leben einen Ankerplatz benötige: »Ich gehe weiter. Wohin werde ich gelangen?« Porsche sah sich als einen von Entdeckerfreude Getriebenen, für den Stillstand unerträglich war. Es musste für ihn immerfort vorwärts gehen. Diese Einstellung kleidete er in die unmissverständlichen Worte: »Ich gehe weiter. Ich brauche keinen Rastplatz und kein Ziel. Der Wegweiser genügt mir. Hinauf!«
Trotz dieses unbändigen Vorwärtsdrangs hatte sich bei Porsche das emotional tief ausgeprägte Bedürfnis nach Beheimatung erhalten. Für ihn stand außer Frage, dass dieses ursprüngliche Gefühl von Heimat nur sein Heimatort vermitteln konnte. Daher legte er seine beruflichen Reisen so, dass er diesen möglichst oft aufsuchen konnte. Im Tagebuch seines Oberingenieurs finden sich mannigfache Hinweise auf solche Heimatbesuche – oft versehen mit dem Zusatz: Porsche »fährt von hier nach Maffersdorf, seiner Heimat«.51 Dass dieser vielbeschäftigte, ständig auf Dienstreisen befindliche Mann seiner Heimat regelmäßig Besuche abstattete, kann als Indiz für wirkliche Heimatverbundenheit gelten – in dem Sinne, dass Porsche sich an dem Ort seiner Kindheit und Jugend zu Hause fühlte. Als die Gemeinde Maffersdorf ihm im Januar 1943 die Ehrenbürgerwürde verlieh, wurde also nicht nur ein berühmter Sohn der Stadt bedacht, sondern ein in diesem Sinne Heimattreuer. Porsche bedankte sich unter anderem mit folgenden Zeilen an den Bürgermeister: »Sie wissen wohl selbst, wie eng ich meiner Heimat stets verbunden geblieben bin, obwohl ich sie in früher Jugend verlassen mußte, um in den großen Werken der Industrie Entwicklungsmöglichkeiten zu finden, die mir der heimatliche Boden nicht bieten konnte. Stets aber bin ich ein treuer Sohn dieses Bodens, immer wieder zurückkehrend zu dem Hause meiner Eltern in die gewohnte heimische Enge.«52
Die regelmäßigen Besuche in seiner nordböhmischen Heimat wurden Porsche durch seine tschechoslowakische Staatsangehörigkeit erleichtert. Er hatte nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns nämlich nicht die Staatsbürgerschaft der Republik Österreich erworben, sondern sein Anrecht wahrgenommen, als geborener Böhme der neu entstandenen Tschechoslowakischen Republik anzugehören. Das erlaubte ihm, sowohl von Wien als auch von Deutschland aus in seine Heimat zu reisen. Erst 1934 stellte er die Weichen für einen deutschen Pass. Man mag es auch als Verbeugung vor seiner neuen Heimat Stuttgart ansehen, dass Ferdinand Porsche sich für die deutsche Staatsangehörigkeit entschied. Diejenige der Republik Österreich zu erwerben, schied für ihn schon deswegen aus, weil Deutschland seinen wirtschaftlichen Aktionsradius bildete und nicht das kleine Österreich. Aber für jemanden, der im Dreiländereck Böhmen – Sachsen – Schlesien großgeworden war, lagen Dresden und Chemnitz geographisch ohnehin näher als Wien.
Trotz aller Anhänglichkeit an Maffersdorf war Porsche mobil und in der Lage, auch außerhalb Nordböhmens Wurzeln zu schlagen, was für den Zuschnitt seines Familienunternehmens entscheidend war. Maffersdorf blieb insofern unersetzbar, als die sich an diesen Ort knüpfenden sentimentalen Erinnerungen nicht austauschbar waren. Aber dies schloss nicht aus, dass Porsche eine zweite Heimat dort fand, wo das Herz seines Unternehmens schlug: in Stuttgart. Porsche fiel dieser Transfer auch deswegen leicht, weil sich der Kern des Mitarbeiterstabs der Porsche GmbH aus Altösterreich rekrutierte. Chefkonstrukteur Karl Rabe, ehemaliger Konstruktionschef der Steyr-Werke, und die Ingenieure Josef Kales,53 Walter Boxan, Josef Mickl, Karl Fröhlich54 und Josef Zahradnik55 waren sämtlich in der k.u.k.-Monarchie geboren, ebenso Porsches getreuer Fahrer Josef Goldinger. Bei seinem unentbehrlichen Privatsekretär Ghislaine Kaes handelte es sich sogar um ein enges Familienmitglied, nämlich den Sohn der Schwester seiner Ehefrau Aloisia, die Porsche in Wien kennengelernt hatte. Auf den ersten Blick erweckt dies den Anschein, als hätten transnationale Lebensformen der multikulturellen k.u.k.-Monarchie in Porsches Unternehmen überdauert. Unternehmer mit ihrer internationalen Vernetzung bringen für solche Lebensformen ohnehin eine besondere Aufgeschlossenheit mit.56 Doch grenzüberschreitende Familienbeziehungen, wie sie bei Porsche im Falle seiner Verwandtschaft in der Tschechoslowakei und Österreich in reichem Maße zu verzeichnen sind, bedeuteten keine Überschreitung des deutschsprachigen Kulturraums. Porsche und sein erweiterter Familienkreis in Gestalt der Stammbelegschaft waren keine Grenzgänger zwischen unterschiedlichen Sprachräumen, sondern blieben auf den deutschen Sprachraum fixiert. Das war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es Porsche sowie nahezu allen anderen Mitgliedern des erweiterten Familienkreises an Fremdsprachenkenntnissen mangelte und an der Neugier, sich außerdeutsche Kulturen auf dem Wege ästhetischer Bildung anzueignen.