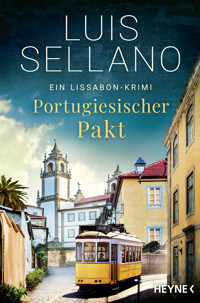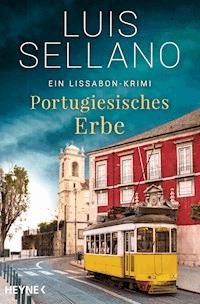11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lissabon-Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Nach gefährlichen Abenteuern in Lissabon hat der Expolizist Henrik Falkner sich in die Stadt am Tejo verliebt. Henrik übernimmt das Antiquariat seines Onkels Martin – und damit auch dessen Vermächtnis. Denn Martin hat nicht nur Kuriositäten aller Art, sondern auch Artefakte gesammelt, die in Zusammenhang mit ungelösten Verbrechen stehen. Als ein Mann in der Bar Esquina erstochen wird, ahnt Henrik, dass er in den nächsten Fall geraten ist. Zusammen mit der temperamentvollen Polizistin Helena begibt er sich auf die Spuren des Mörders. Doch dann wird Helenas Tochter entführt … Es beginnt eine Jagd durch die Gassen von Lissabon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Ähnliche
Das Buch
Nach gefährlichen Abenteuern in Lissabon hat der Expolizist Henrik Falkner sich in die Stadt am Tejo verliebt. Henrik übernimmt das Antiquitätengeschäft seines Onkels Martin – und damit auch dessen Vermächtnis. Denn Martin hat nicht nur Kuriositäten aller Art, sondern auch Artefakte gesammelt, die in Zusammenhang mit ungelösten Verbrechen stehen. Als ein Mann in der Bar Esquina erstochen wird, ahnt Henrik, dass er in den nächsten Fall geraten ist. Zusammen mit der temperamentvollen Polizistin Helena begibt er sich auf die Spuren des Mörders. Doch dann wird Helenas Tochter entführt … Es beginnt eine Jagd durch die Gassen von Lissabon.
Der Autor
Luis Sellano ist das Pseudonym eines deutschen Autors. Auch wenn Stockfisch bislang nicht als seine Leibspeise gilt, liebt Luis Sellano Pastéis de Nata und den Vinho Verde umso mehr. Schon sein erster Besuch in Lissabon entfachte seine große Liebe für die Stadt am Tejo. Luis Sellano lebt mit seiner Familie in Süddeutschland. Regelmäßig zieht es ihn auf die geliebte Iberische Halbinsel, um Land und Leute zu genießen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.
LUIS SELLANO
Portugiesische
Rache
EIN LISSABON-KRIMI
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für meine Eltern
»Quem não viu Lisboa, não viu coisa boa!«
(Wer Lissabon nicht gesehen hat, hat nichts Schönes gesehen.)
Portugiesisches Sprichwort
1
Henrik Falkner drückte die Hände auf den Bauch des Mannes, der drei Stunden zuvor ein Buch bei ihm gekauft hatte.
Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor. Warm pulsierte es aus der Stichwunde gegen seine Handfläche. Dunkel wie Portwein und klebrig wie der Kirschlikör, den sie unten amLargo de São Domingos ausschenkten.
Noch immer fühlte sich niemand dazu veranlasst, die laute Rockmusik runterzudrehen. Brian Johnsons überreizte Stimme dröhnte aus den Lautsprechern, unterlegt von treibenden Beats und den unverkennbaren Gitarrenriffs, die den Weg in die Hölle wiesen.
Der Mann am Boden starrte ihm mit geweitetem Blick entgegen. Aus Augen, so hell wie Gletschereis. Eine ungewöhnliche Farbe, die man in diesem Teil Europas eher selten zu sehen bekam. In dem klaren Blau spiegelte sich eine Mischung aus Vorwurf, Verzweiflung und Todesangst. Gegen keine dieser aufwühlenden Gefühlsregungen konnte Henrik etwas ausrichten, weshalb er dem Blick auswich, bevor ihm dieser ein Loch in die Seele brannte.
Victor hinter dem Tresen telefonierte bereits auffällig lang mit der Notrufzentrale, den Zeigefinger im Ohr, statt einfach nur den Ausschaltknopf der Musikanlage zu betätigen.
Sie stehen unter Schock. Alle!
Nicht nur der Barkeeper war mit der Situation überfordert. Die meisten Gäste waren binnen weniger Sekunden panisch nach draußen geflüchtet. Die Verbliebenen waren offenbar zu paralysiert, um davonzurennen. Sie waren von Henrik abgerückt, so weit es der enge Schankraum zuließ. Niemand bot an, Hilfe zu leisten. Was also hielt sie noch hier? Neugier? Er hoffte inständig, dass nicht schon Fotos oder gar Videos gemacht wurden. Sollte er jemanden dabei erwischen, würde er für nichts garantieren können.
Wegen der lauten Musik machte es kaum Sinn, beruhigend auf den Verletzten einzureden. Er hätte schreien müssen, und das schien völlig unangebracht. Also war alles, was er tun konnte, die Hände auf die Wunde zu pressen. Zu pressen und zu beten. Im Stillen feuerte er den Mann an durchzuhalten, als hätte dieser irgendeinen Einfluss darauf, wie viel Blut aus ihm heraussprudeln durfte. Der körperwarme, klebrige Lebenssaft bildete eine Pfütze unter dem Rücken des Verletzten, die mittlerweile so groß war, dass sie Henriks Knie umschloss. Seine Jeans sog die dunkle Flüssigkeit auf, aber er wagte nicht, sein Gewicht zu verlagern.
Endlich nickte ihm Victor zu, signalisierte, dass ein Rettungswagen unterwegs war. Gott sei Dank!
Und jetzt mach die verfluchte Musik aus!
Bevor er dem Barkeeper diese Worte entgegenbrüllen konnte, begannen plötzlich die Augenlider des Mannes zu flattern.
Früher hatte Henrik oft vergleichbare Situationen erlebt. Die Aussichtslosigkeit kratzte mit spitzen Nägeln an seinem Zwerchfell. Trotzdem hielt er an der Hoffnung fest, auch wenn es schwerfiel. Das Blut auf dem abgetretenen Dielenboden entsprach optisch wahrscheinlich nicht annähernd der Menge, die es wirklich maß. Ohne Zweifel war es viel. Viel zu viel – und die lebenserhaltenden Funktionen des Mannes reagierten drastisch. Soeben begann es mit unkontrollierten Muskelkontraktionen, die den Körper unter seinen Händen beben ließen und die nahende Ohnmacht ankündigten.
Der Anfall währte nur kurz, dann lag der Körper wieder still. Henrik spürte die Kälte an seinen Fingern, die plötzlich von dem Mann ausging und die eigentlich nur Einbildung sein konnte. Erneut tastete er nach der Halsschlagader und fand einen kaum wahrnehmbaren Puls. Ein Messerstich in den Bauch war extrem gefährlich. Ohne schnellen medizinischen Eingriff bot eine derartige Verletzung kaum Überlebenschancen.
Wo zur Hölle blieb der Notarzt?
Obwohl die Bar Esquina seinem Haus direkt gegenüberlag, hatte er es noch nie in dieses Etablissement geschafft. Jetzt, da die Kälte des heranrückenden Todes die Zeit einzufrieren schien, fragte er sich, warum er ausgerechnet heute hierhergekommen war. Er konnte es natürlich aufs Wetter schieben. Den ganzen Tag waren Schauer über die Stadt gezogen, begleitet von heftigen Böen, sodass er nach Feierabend keinen Drang verspürt hatte, noch hinauf ins Bairro Alto oder auf den Largo do Carmo zu gehen. Genauso wenig wie darauf, alleine zu Hause zu sitzen.
Zu Hause?
Seit Kurzem fiel es ihm erstaunlich leicht, die Stadt am Tejo als sein Zuhause zu bezeichnen. Lissabon veränderte sein Leben. Sie freundeten sich an, er und diese Stadt. Jeden Tag ein wenig mehr. Womit er auch jeden Tag einem Zustand näher kam, der die Bezeichnung Zufriedenheit verdiente.
Und nun das! Dieser Mann vor ihm auf dem abgetretenen Boden dieser Musikkneipe, aus dem das Leben sickerte. Das war wie ein Rückschlag. Wie schnell war das heimelige Gefühl der Zufriedenheit dahin. Wie schnell konnte etwas geschehen, das ihn zurück in die Dunkelheit taumeln ließ, aus der er sich gerade zu befreien begann.
Alles war so rasend schnell gegangen. Henrik hatte an der Bar gestanden und auf den Mojito gewartet, den er bei Victor bestellt hatte. Obwohl er vorher nie Gast des Esquina gewesen war, kannte er den Wirt vom Sehen, hatte mit ihm ab und an ein paar Worte gewechselt, wenn sie sich in den vergangenen Wochen zufällig auf der Straße begegnet waren. Meistens, wenn der Kneipenbesitzer die Sonnenschirme mit der Bierreklame aufspannte, welche die vier Tische vor der Bar beschatteten. Flüchtige, nachbarschaftliche Begegnungen, bei denen er immer wieder versprochen hatte, bald mal auf einen Drink reinzuschneien. Bis vor zehn Minuten war heute der passende Moment gewesen, um dieses Versprechen einzulösen.
In dem kleinen Schankraum hatte Gedränge geherrscht. Die Bar besuchten vor allem junge Leute, die gerne ausgelassen bis in den Morgen feierten. Studenten, Hipster, Yuccies, oder wie auch immer diese Generation sich neuerdings zu nennen pflegte. Mit ein Grund, warum Henrik die Bar bisher gemieden hatte. Nicht, dass er sich mit Mitte dreißig zu alt gefühlt hätte, um sich unter diese Leute zu mischen. Er war nur generell nicht der Partygänger und hatte gewiss auch heute nicht vorgehabt, da eine Ausnahme zu machen. Einfach ein Drink oder zwei, um das Gemüt zu beruhigen und die Nachbarschaft zu pflegen.
An den Tresen gelehnt, war er nicht dazu gekommen, auch nur an seinem Mojito zu nippen. Hinter ihm war plötzlich Unruhe aufgeflammt. Rufe hatten die Musik übertönt, gefolgt vom Kreischen einer Frau. Er war herumgefahren. Ein Stuhl kippte um. Leute wichen irritiert zur Seite. Dann taumelte der Mann aus der Menge und ihm direkt in die Arme. Erst als er ihn behutsam auf den Boden legte, sah er das Blut, das sein Hemd tränkte. Henrik hatte den durchnässten Stoff zur Seite geschoben und die Bauchverletzung freigelegt. Es hatte ein paar Sekunden gedauert, bis er den Mann im gedämpften Barlicht wiedererkannte.
Der Verletzte hatte sich bis kurz vor Ladenschluss im Antiquariat aufgehalten und nach langem Herumstöbern ein Buch erstanden. Ein Buch, das zu lesen er keine Gelegenheit mehr bekommen würde.
Überrumpelt von der dringenden Herausforderung, ein Leben zu retten, hatte Henrik zu spät damit begonnen, die Umgebung zu beobachten. Gerade so, als wäre er nach wenigen Monaten schon außer Übung, als wären die Instinkte und Reflexe eingerostet, die er sich über Jahre hinweg in seinem Job antrainiert hatte. Nun drängten die Fragen dafür umso rascher an die Oberfläche. Wer war kurz nach dem Vorfall aus der Bar gestürmt? Wer hatte sich verdächtig verhalten? Was hatte er selbst vor dem Zwischenfall wahrgenommen, ohne zu diesem Zeitpunkt einen Gedanken daran zu verschwenden?
Er studierte die konsternierten Gesichter der Leute, die zurückgeblieben waren. Bemerkte Entsetzen, Angst, Hilflosigkeit. Kein Gast vermittelte ihm den Eindruck zu wissen, was genau vor wenigen Minuten vorgefallen war. Minuten, die sich längst wie Stunden anfühlten.
»Hat jemand gesehen, was passiert ist? Quem era? Wer hat das getan?«, rief er.
Kopfschütteln. Ungelenkes Achselzucken. Ansonsten nur stummes Grauen und Betroffenheit.
Auch Victor hob bloß die Schultern und griff dann endlich nach dem Lautstärkeregler der Musikanlage. Er würgte den Refrain des Rocksongs ab. Für einen Moment dröhnte Henrik die Stille lauter in den Ohren als die Bässe und harten Riffs.
Henrik spürte Schweiß seinen Rücken hinunterlaufen. Empfand die schlaffe Leblosigkeit des Körpers unter seinen Händen. Seine eigene Machtlosigkeit. Das Kreuz tat ihm weh von der angespannten Haltung. Jemand weinte leise. Dann plötzlich flackerte geisterhaft blaues Licht über die Barterrasse ins Innere des Lokals. Was er so verzweifelt herbeigesehnt hatte, versetzte ihm jetzt einen Schrecken. Schon im nächsten Moment folgten hektische Schritte. Eine Hand legte sich auf seine Schulter und drängte ihn grob beiseite. Rotweiß gekleidete Männer schoben sich zwischen ihn und den Verletzten. Er drehte sich weg, wollte auf einmal nicht mehr wissen, ob sein Einsatz sich gelohnt hatte. Niedergeschlagen betrachtete er seine blutverschmierten Finger.
Anstandslos machten ihm die Leute Platz, und er verließ mit gesenktem Kopf die Bar.
2
Heißes Wasser prasselte auf ihn herab, ohne dass sich das Gefühl einstellte, endlich sauber zu sein. Das Klingeln an der Tür, während er noch unter der Dusche stand, wirkte wie ein Weckruf. Man musste kein Prophet sein, um zu erraten, wer um diese Zeit noch etwas von ihm wollte. Sie hämmerten bereits gegen die Haustür, als er mit dem Badetuch um die Hüften in den Flur trat. Wenn sie die Eingangstür weiter so bearbeiteten, würde sie aus dem maroden Türstock brechen. Alles an diesem Haus war alt, und er beeilte sich, den Türöffner zu betätigen. Wie eine Horde Büffel trampelten sie die Holzstiege empor. Er war beinahe enttäuscht, dass sie nur zu zweit daherkamen.
»Senhor Falkner?«
»Wer sonst!«, antwortete er.
Wenn ihnen sein Aufzug fragwürdig erschien, ließen sich die beiden Polizisten nichts anmerken.
»Warum haben Sie den Tatort verlassen?«, fragte der ältere, während er seinen Hosenbund samt schwer beladenem Gürtel zurechtrückte. Er war übergewichtig, schwitzte stark und atmete japsend. Sein Gesicht wirkte teigig, das spärliche dunkle Haar hatte er quer über seine Glatze gekämmt. Sein Englisch war gut verständlich, wie bei den meisten Lissabonnern. Mit ein Grund, warum Henrik sich bislang davor hatte drücken können, endlich einen Sprachkurs für Portugiesisch zu belegen.
»Mir war danach, das Blut abzuwaschen«, erklärte er. »Sie hatten ja keine Probleme, mich zu finden.«
»Weil es Zeugen gab, die beobachtet haben, wohin Sie verschwunden sind.«
Verschwunden!
Die Aufregung war unbegründet und überzogen. Die Leute in der Rua do Almada wussten mittlerweile, wo der alemão wohnte. Was sollte das? »Ich bin nicht abgehauen, ich wollte mich nur frisch machen«, erklärte er spöttisch und wies auf seine mit dem Handtuch umschlungenen Hüften.
Der Dicke verzog keine Miene. Sein junger Kollege, dem bislang kein Wort über die fleischigen Lippen gekommen war, postierte sich so, dass seine breiten Schultern den Zugang zur Treppe versperrte. Sein Kinnbärtchen war fein säuberlich ausrasiert, die Miene steinern. Die rechte Hand lag auf dem Griff der Dienstwaffe. Sie benahmen sich, fand Henrik, als hätte er den Mann erstochen und wäre nun auf der Flucht gestellt worden. Allein dass sie überhaupt in Erwägung zogen, ihn zu verdächtigen, missfiel ihm in höchstem Maße. Aber es gab Dringlicheres, als seinen Unmut darüber kundzutun. »Wird er es schaffen?«
»Wir brauchen Ihre Aussage!«, verlangte das Wabbelgesicht.
»Wissen Sie wenigstens, wer der Mann ist?«, hakte Henrik nach und verstieß damit gleich zu Beginn massiv gegen die eiserne Wir-stellen-hier-die-Fragen-Regel, was die Polizisten noch mehr gegen ihn aufbrachte. Ihre stechenden Blicke machten ihm deutlich, dass sie nicht vorhatten, ihm eine wie auch immer geartete Auskunft zu geben, sondern dass er sich glücklich schätzen durfte, nicht gleich niedergerungen und in Handschellen abgeführt zu werden. Still wünschte er sich Helena herbei, um seinen Bericht zu dem Vorfall im Esquina aufzunehmen. Nach ihr zu verlangen, war jedoch undenkbar, also machte er Platz und lud die beiden Uniformierten widerwillig zu sich in die Wohnung ein. Während der junge Polizist im Türrahmen stehen blieb, setzte sich der Dicke zu Henrik an den Küchentisch. Vorschriftsmäßig nahm er die Personalien auf und prüfte Henriks Papiere.
»Wie lange halten Sie sich hier schon auf?«
Ich halte mich hier nicht auf, ich lebe hier, lag ihm auf der Zunge, doch plötzlich fühlte er sich zu erschöpft, um weiter auf Konfrontation zu gehen. »Seit Juli.«
»Was ist der Grund Ihres Aufenthalts?«
»Ich führe das Antiquariat im Erdgeschoss.«
»Ihnen gehört das Haus.«
Keine Frage, eine Feststellung. Eigentlich wussten sie also alles über ihn. Sinnlos, sich darüber zu ärgern. »Ja. Eine Erbschaft.«
»War das der Grund, warum Sie Deutschland verlassen haben?«
»Ja!« Und nein, dachte er. Sein portugiesisches Erbe war bloß ein Anreiz gewesen, den wahren Grund behielt er für sich. Er würde nicht über seinen Verlust sprechen, genauso wenig wie über die Finsternis, die ihn danach gefangen gehalten hatte. Nichts von alldem würde er diesen Männern anvertrauen.
Die Uniformierten tauschten einen Blick. »Was ist drüben in der Bar passiert?«
Er schilderte das Geschehen aus seiner Sicht, auf die sachliche Weise, wie er es in seinem einstigen Beruf gelernt hatte. Bis vor einem knappen Jahr war er selbst bei der Polizei gewesen. Kriminalkommissar, Ermittler für Gewaltverbrechen. Er wusste, dass das hier lediglich eine vorläufige Anhörung war. Die beiden Streifenpolizisten verkörperten nur die Vorhut, das war keinesfalls sein letztes Gespräch mit den Behörden über den Vorfall im Esquina. Bereits im Sommer hatten einige fragwürdige Ereignisse dafür gesorgt, dass die portugiesische Polizei auf ihn aufmerksam wurde, bevor er überhaupt richtig aus dem Flieger gestiegen war. Er hatte sich mit den falschen Leuten angelegt und stand seither vermutlich unter Beobachtung. Unter anderem von Leuten, die ihn durchaus gerne losgeworden wären.
»Kannten Sie den Mann, auf den eingestochen wurde? Haben Sie ihn jemals zuvor getroffen?«
Was für eine eigenwillige Formulierung. Jemals zuvor. Der Mann hatte bei ihm ein Buch gekauft. Gab es auch dafür Zeugen? Hatte man ihn danach aus dem Antiquariat kommen sehen? War der Mann direkt im Anschluss in die Bar gegangen, hatte er sich womöglich mit jemandem getroffen und über seinen Erwerb berichtet?
»Nein!«, sagte Henrik, obwohl ihm das Risiko dieser Falschaussage bewusst war. Er fand keine Erklärung dafür, warum er log. Abgesehen von seiner Intuition, und dafür brauchte er keine Rechtfertigung.
»Halten Sie sich zu unserer Verfügung!«, verlangte der Dicke und erhob sich schwerfällig.
»Keine Angst, ich gehe hier nicht weg!«
3
Obwohl er sich lange bemühte, hielt es ihn schließlich nicht mehr im Bett. Er schlüpfte in eine Jogginghose und streifte ein T-Shirt über. Die Leuchtzahlen des Weckers zeigten auf kurz nach zwei. Er ging aufs Klo und wusch sich danach Hände und Gesicht. Einen Blick in den Spiegel vermied er. Die sommerliche Bräune täuschte allzu leicht über seinen Seelenzustand hinweg. Innerlich fühlte er sich nach wie vor blass, auch wenn ihn schon sehr lange kein depressiver Schub mehr ereilt hatte. Er war auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht übern Berg. Kein Anlass also, sein Spiegelbild zu betrachten und sich zu fragen, wer ihm da aus graublauen Augen entgegenstarrte. Er wusste, wie er aussah. Sein Haar, in dem immer mehr graue Strähnen auftauchten, hatte er nie zuvor so lang getragen. Noch ein paar Wochen, und er konnte es mit einem Pferdeschwanz versuchen. Die Ausrede, dass er hier noch keinen Friseur gefunden hat, war bloß vorgeschoben. Das alles war Teil einer Verwandlung, die er nicht absichtlich heraufbeschwor, gegen die er sich aber auch nicht wehrte. Nicht, weil er sich dazu nicht in der Lage fühlte, sondern weil er neugierig war, was diese Metamorphose letztlich aus ihm machen würde. Zumindest habe ich nicht weiter zugenommen. Ja, das war durchaus positiv. Wobei die neunzig Kilo immer noch zehn zu viel waren. Wenigstens daran sollte er aktiv arbeiten.
Andererseits – er war einfach zu selbstkritisch. Schon immer gewesen. Auch was sein Aussehen betraf und obwohl er eigentlich wusste, dass er für Frauen nicht uninteressant war. Aber das war ein anderes heikles Thema.
In der Küche trank er ein Glas Wasser. Das würde allerdings nicht ausreichen, um wieder einschlafen zu können, weshalb er erst gar nicht zurück ins Schlafzimmer schlurfte. Die Unruhe, die ihn geweckt hatte, hielt immer noch an. Etwas hatte seinen Instinkt aktiviert. Diese Gabe, die man auf der Polizeischule nicht erlernen konnte, sondern bestenfalls mitbrachte, wenn man sich für diesen Beruf entschied. Mein einziges, wirkliches Talent, das mich zu einem guten Ermittler gemacht hat.
Er vermisste seinen früheren Job. Fühlte die Leere, die gelegentlich aufkam, seit er den Kriminalkommissar an den Nagel gehängt hatte. Doch nicht mehr im Dienst des deutschen Polizeiapparats zu stehen lief ja nicht automatisch auf komplette Untätigkeit hinaus. Lissabon hatte ihm sehr schnell deutlich gemacht, dass seine Fähigkeiten, zu beobachten, zu analysieren und die richtigen Folgerungen zu ziehen, hier nicht verkümmern würden.
Barfuß tapste er die Treppe ins Erdgeschoss hinunter. Die hölzernen Stufen kommentierten jeden seiner Schritte mit mürrischem Knarren, so als würde sein Gewicht sie aus ihrem wohlverdienten Schlaf reißen. Vielleicht kam ihm das Ächzen der Stiege auch nur deshalb so übertrieben laut vor, weil die nächtliche Ruhe heute besonders prägnant wirkte. Selbst der übliche Lärm aus der Gasse fehlte. Keine Autos, keine knatternden Mopeds. Vor allem fehlte das Lachen und Plaudern, das Gläserklirren, untermalt von Rockmusik. Akustische Ausgelassenheit, verursacht von Leuten, die niemals schliefen. Die ihre Nächte in der Bar unter seinem Fenster verbrachten. Abgesehen von dieser Nacht. Die Polizei war zwar zum jetzigen Zeitpunkt bereits abgezogen, würde die Räumlichkeiten aber erst wieder freigeben, wenn sämtliche Untersuchungen des Tatorts abgeschlossen waren. Und selbst dann würde Victor erst mal jede Menge Blut aufwischen müssen. Diese Nacht war für ihn gelaufen. Rein ökonomisch betrachtet, ein verschmerzbarer Einnahmeverlust für den Barbetreiber. Die menschliche Schwäche der Neugier würde dafür sorgen, dass er morgen den Umsatz des Jahres machte. Darauf hätte Henrik sein Antiquariat verwettet. All jene, die davon Wind bekamen und für die Voyeurismus – wenn überhaupt – nur eine lässliche Sünde war, würden sich um den Tresen drängeln und bohrende Fragen stellen, während sie ihre Drinks orderten. Besonders dreiste Gäste würden Selfies machen, schräg von oben, damit man den dunklen Fleck auf dem Boden noch erahnen konnte, und sie dann über ihre Social-Media-Kanäle mit der Welt teilen. Henrik schüttelte sich diese pietätlosen Bilder aus dem Kopf. Gelegentlich überkamen ihn misanthropische Launen gegenüber seinen Mitmenschen. Oder vielmehr gegenüber dem rücksichtslosen Verhalten innerhalb der Gesellschaft. Ein Thema, in das er sich nur zu gerne hineinsteigerte und das zwangsläufig mit den schmerzlichen Erinnerungen an Nina endete. Wie sinnlos ihr Tod doch war, für die Welt, in der sie noch so viel Schönes hätte bewirken können. Er vermisste …
Nein, nicht Nina. Nicht jetzt!
Jetzt musste er sich auf etwas anderes konzentrieren. Brauchte einen freien Kopf, um dem Impuls nachzugehen, der ihn durchs Haus trieb. Er verzichtete darauf, Licht zu machen, und tastete sich durch die Dunkelheit wie ein Eindringling. Ein Gefühl, das ihn öfter befiel, wenn er auf die Leute traf, die mit ihm unter diesem Dach wohnten. Äußerlich stets um Freundlichkeit bemüht, vermittelten sie ihm unterschwellig, fehl am Platz zu sein, sich ihnen gegenüber falsch zu verhalten: nämlich weit weniger großzügig, als sie es all die Jahre vom Vorbesitzer gewohnt gewesen waren. Henrik war ein Fremdkörper in dieser Hausgemeinschaft, die er sich nicht ausgesucht hatte. Sein Onkel hatte ihn dort hineingedrängt, als er ihm das Gebäude in der Rua do Almada vermachte. Nun mussten sie mit ihm leben – so wie er mit ihnen. Eine Symbiose, in der er rein rechtlich der Wirt war, sich aber meistens als der Parasit fühlte, ohne etwas dagegen tun zu können.
Das Licht der Straßenlaterne, das durch das Fenster im Treppenhaus hereinfiel, wies ihm den Weg. Letztlich hätte er auch dem Geruch folgen können. Dieser unverkennbaren Ausdünstung, mit dem ihn das Antiquariat jeden Tag aufs Neue begrüßte. Selbst nach der langen Zeitspanne, die er dort nun schon ein und aus ging, hatte sich seine Nase mit diesem Bouquet der Jahrhunderte noch nicht richtig angefreundet. Schwer vorstellbar, dass sein Geruchssinn sich je daran gewöhnen würde. An das Aroma des Altertums, den eindringlichen Modergeruch, den Tausende von Büchern ausdünsteten. An das herbe Odeur des alten Leders, in das viele der Werke gebunden waren. An den Prozess der Zersetzung und den Staub, der von brüchigen, von Pilzfraß befallenen Papieren stammte, den stechenden chemischen Gestank der Komponenten, mit denen die Kladden vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten verleimt worden waren. Aufdringlich, rauchig, süß, exotisch. Abstoßend, aber auch anregend, ja sogar beruhigend, je nachdem wie er sich selber gerade fühlte. Olfaktorisch war von allem etwas dabei, jede Epoche trug ihren Duftstempel. Zeitweilig verschaffte ihm die Fülle der Gerüche das Gefühl von Verbundenheit, fast schon Geborgenheit. Nicht immer, aber immer häufiger in den letzten Wochen. Jetzt ist es passiert, ich fühle mich in diesem Mief zu Hause!
Dass er in stockdunkler Nacht in das vieldeutige Reich hinabstieg, das sein Onkel geschaffen hatte, kam jedoch eher selten vor. Die Überlegung, die ihn heute hier herunterführte, war abwegig. Und gleichzeitig auch nicht. Ein Buch dafür verantwortlich zu machen, dass man einem Mann ein Messer in den Bauch gerammt hatte, war, nüchtern betrachtet, ein ziemlich verwegener Ermittlungsansatz. Wer stach auf jemanden wegen einer vergilbten Schwarte ein? Doch jetzt, mitten in der Nacht und aus einem wirren Traum herausgerissen, schien ihm alles möglich. Vor allem, wenn das Buch im Antiquariat in der Rua do Almada gekauft worden war.
Wäre er nur aufmerksamer gewesen! Catia hätte gewusst, welches literarische Werk da über den Ladentisch gegangen war. Aber seine einzige Mitarbeiterin machte gerade Urlaub. Zwei ganze Wochen. Verdientermaßen, ohne Frage. Catia hatte das Antiquariat nach dem Tod seines Onkels allein weitergeführt. Nicht ganz uneigennützig, dennoch mit Sachverstand und Herzblut. Nachdem dann Henrik aus heiterem Himmel aufgetaucht war, sich als Erbe präsentiert und sie vor vollendete Tatsachen gestellt hatte, waren anfängliche Schwierigkeiten nicht ausgeblieben. Doch mittlerweile hatten sie sich zusammengerauft.
Freunde waren sie dabei nicht geworden, und das würde auch in naher Zukunft kaum passieren. Aber was die Arbeit im Antiquariat anging, hatte Catia wirklich Geduld mit ihm bewiesen. Dafür war er ihr dankbar – und wollte ihr das zeigen. Allerdings bedurfte es einiges an Überzeugungsarbeit, bis Catia zu der Einsicht gelangte, man könne ihn nach dreimonatigem Einlernen durchaus einmal alleine lassen. Vielleicht sogar für vierzehn Tage.
Und nun, kaum war sie weg, brauchte er sie wieder. Womöglich hatte er ja einen Fehler begangen und eines der wenigen, wirklich kostbaren Bücher aus dem Bestand nachlässig verschleudert. Ein Buch, für das es sich lohnte, das Leben eines Menschen zu riskieren.
Ganz abgesehen vom monetären Wert der literarischen Rarität, bestand da noch eine andere Möglichkeit. Was habe ich übersehen?
Henrik machte Licht, auch wenn er sich inzwischen zugetraut hätte, im Dunkeln durch das Labyrinth aus Regalen, Möbelstücken und auf dem Boden verteilten Bücherstapeln bis zur Verkaufstheke zu wandeln. Die orientalischen Lampen, die von der ergrauten Decke baumelten, zeichneten weiche, orangefarbene Kreise, die selbst am Tag nicht ausreichten, um den verstellten und verwinkelten Raum vernünftig auszuleuchten. Wer hier ein Buch aus den Regalen nahm, um darin zu blättern oder gar etwas zu entziffern, musste über ausgezeichnete Augen verfügen. Catia hatte sich vehement gegen seinen Vorschlag gewehrt, die angelaufenen Funzeln gegen lichtstarke LED-Strahler auszutauschen, um eine effizientere Verkaufsatmosphäre zu schaffen. Letztlich musste er ihr natürlich recht geben. Modernes, kaltes Licht würde die verwunschene Rätselhaftigkeit des Antiquariats zerstören. Außerdem beschleunigte grelles Licht den Verfall der betagten Dokumente. Wer sich ernsthaft für ein Buch interessierte, konnte schließlich auch vor die Tür treten, um sich darin zu vertiefen, lautete Catias Devise. Dafür stellte sie tagsüber neuerdings einen Stehtisch hinaus auf den schmalen Gehweg. Das war ihre Art, Kompromisse einzugehen.
Er fand auf Anhieb die Lücke, die das verkaufte Buch in der Regalreihe hinterlassen hatte. Dieser Bereich widmete sich hauptsächlich der portugiesischen Literatur aus dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert. So weit wusste er Bescheid. Catia pries gerne die Werke Fernando Pessoas an. Die von Maria Isabel Barreno, José Cardoso Pires oder einen frühen José Saramago. Sie verfügten aktuell zwar über keine der seltenen und begehrten Erstausgaben, aber selbst für eine dritte oder vierte Auflage eines der großen, portugiesischen Literaten waren Sammler bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Nur, was hatte in dem schmalen Spalt gesteckt, der nun zwischen den Bänden klaffte?
Und wo war das Buch jetzt?
Sofern die Polizei gründlich gearbeitet hatte, war es zusammen mit den Habseligkeiten des Mannes sichergestellt worden. Oder vielleicht war es auch in der Bar liegen geblieben, nachdem man den Verletzten abtransportiert hatte. Um Klarheit darüber zu bekommen, musste er wohl oder übel bis zum Abend warten.
Unzufrieden mit seinen nächtlichen Nachforschungen, löschte er das Licht. Dennoch konnte er sich nicht dazu durchringen, wieder ins Bett zu gehen. Gedankenversunken hockte er sich hinter dem Tresen auf einen mit Büchern gefüllten Karton, der gestern geliefert worden war und den er noch nicht ausgepackt hatte. Etwas, das man ohnehin besser Catia überließ, wenn man keinen Ärger provozieren wollte. Bücher über Bücher. Wie viele von ihnen bargen wohl ein Geheimnis? Wie viele waren dazu zweckentfremdet worden, eine versteckte Botschaft aus dem Jenseits für ihn zu bewahren?
Er unterdrückte ein Seufzen. Einerseits war Portugal seine Rettung gewesen. Der Aufbruch in die Fremde hatte ihm neuen Mut beschert, ihm die Kraft gegeben, die kalte Schwärze zu überwinden, die nach dem Tod von Nina zu seinem Gefängnis geworden war. Andererseits bedeutete Portugal dieses Erbe. Ein Erbe, das auch eine Bürde war. Eine Verantwortung, die sich ihm zwar schneller offenbart hatte, als ihm lieb war, deren wahrer Umfang sich aber bis zum heutigen Tag nicht einmal im Ansatz erfassen ließ. Das umstrittene Vermächtnis eines Unbekannten.
Er hatte Martin Falkner, den Bruder seiner Mutter, nie persönlich getroffen. Martin war für ihn bis vor wenigen Monaten nur eine Anekdote aus der falknerschen Familienchronik gewesen. Ein in Ungnade gefallener Abkömmling, über den nicht gesprochen wurde. Auch der Notar hatte neben den Erbschaftsdokumenten lediglich einen handgeschriebenen Brief von Martin für ihn bereitgehalten. Erst später hatte er versucht, zwischen den Zeilen der wenigen Sätze zu lesen. Eigentlich erst, nachdem sich die ominösen Andeutungen von Menschen häuften, die seinem Onkel nahegestanden hatten. Da keiner von ihnen je deutlich geworden war, verfügte Henrik nur über eine Unmenge vager Äußerungen und musste abwägen, wie viel Wahrheit darin verborgen lag. Alles, was er wusste, zu wissen glaubte oder auch nur ahnte, bezog sich auf solche verborgenen Hinweise, auf Anspielungen und Vermutungen.
Was seine Aufmerksamkeit erregte, konnte er kaum Geräusch nennen. Er war nicht einmal sicher, ob er es über seine Ohren oder über die Haut wahrgenommen hatte. Eine minimale Verschiebung der hermetischen Atmosphäre innerhalb des Antiquariats, die ihm vermittelte, dass er nicht mehr allein war. Die Anwesenheit einer anderen Person hatte das Klima verändert.
Aber wie?
Die Eingangstür war abgeschlossen, ein gewaltsames Öffnen wäre ihm nicht entgangen. Blieb nur der Weg über den Keller und das Treppenhaus. Auf dieselbe Weise, wie er selbst den Laden betreten hatte: durch die Tür im Flur, die er vorhin aus Rücksicht auf die nächtliche Stille bloß angelehnt hatte. Die Tür klemmte nämlich und konnte daher nur mit viel Schwung ins Schloss geschlagen werden.
Der Schalter für Licht und Erkenntnis befand sich nur eine Armlänge entfernt, doch er regte sich nicht. Die Dunkelheit schützte den Eindringling, aber auch ihn, solange er sich nicht bewegte. Flach atmend beschloss er zu warten. Sein Herz wummerte, und Adrenalin flutete seinen Körper. Konzentriert auf den schmalen Lichtstreifen, der von der Straße her durch einen freien Spalt im fast blinden Schaufenster in den Verkaufsraum fiel, harrte er aus. Die Bezeichnung Lichtstreifen war dabei noch maßlos übertrieben. Es handelte sich lediglich um einen Schimmer, der einen handbreiten Korridor aus düsterem Grau bildete; in ihm zeichnete sich kaum merklich die Kontur eines Regals ab. Henrik hielt die Luft an, als die Umrisse einer Person davor auftauchten. Eine Person, die sich katzenhaft durch die Dunkelheit auf ihn zubewegte.
Drei Meter vor dem Tresen hielt sie ruckartig inne.
Er sieht mich!
Unmöglich.
Nicht einmal er selbst konnte seine Hände erkennen, so satt war die Schwärze in der Ecke, in der er hockte. Und doch. Das Phantom regte sich nicht mehr, starrte stattdessen über den Verkaufstresen hinweg, starrte ihn an!
Henrik sprang auf und umrundete die Theke.
Die Gestalt reagierte sofort. Mit einer schnellen Drehung verschwand sie in die allumfassende Dunkelheit.
Henrik machte noch einen Schritt, dann explodierte etwas an seiner linken Schläfe. Ein Gongschlag zerriss die Stille. Er sah Sterne, wo keine waren, und taumelte wie ein angeschlagener Boxer zwischen die Regale. Wie hatte er diesen verfluchten Kupferkessel vergessen können, mit dem er selbst bei Licht schon mehrfach Bekanntschaft gemacht hatte? Nun hallte das bauchige Ungetüm dröhnend nach und schaukelte dabei quietschend an der Kette, an der es von der Decke hing. Das Dröhnen setzte sich in seinem Schädel fort und legte den einzigen Sinn lahm, der ihm bei den vorherrschenden Lichtverhältnissen geblieben war. Wild ruderte er mit den Armen, um sein Gleichgewicht wiederzuerlangen, während er vorwärtsstolperte.
Wo ist er hin? Schon durch die Tür?
Die Antwort folgte unmittelbar. Etwas rammte ihn von der Seite und beförderte ihn unsanft in Catias Esoterikecke. Im Fallen fegte er das sorgsam drapierte Arrangement aus Buddha-Figürchen, Klangschalen und Räucherstäbchenhaltern von dem indischen Teetisch. Unüberhörbar ging dabei einiges von den fragwürdigen Devotionalien zu Bruch. Er wirbelte herum und schaffte es irgendwie, einen Sturz zu vermeiden. Hektisch schnappte er nach allem, was ihm in die Finger kam, um es dorthin zu schleudern, wo er den Angreifer vermutete. Als seine Hände nichts mehr fanden, warf er sich blindlings hinterher.
Und traf sein Ziel.
Verblüfft darüber, dass seine Gegenattacke gelungen war, schlang er die Arme um die schwarze Gestalt, der ein überraschtes Zischen entwich. Immer noch benommen von der Kollision mit dem antiken Kupferkessel, mangelte es ihm allerdings an der nötigen Balance. Mit der Rechten verhakte er sich in einem elastischen Material, das keinen Widerstand bot. Das Phantom vollzog indessen eine rotierende Ausweichbewegung, die den Schwung vervielfachte, den Henrik mitbrachte, und die Fliehkräfte schleuderten ihn hinein in die undurchdringliche Finsternis zwischen den Bücherregalen. Die Holzdielen empfingen ihn mit aller Härte. Erneut schlug er sich den Kopf an, was einen weiteren Sternchenregen zur Folge hatte. Stechender Schmerz durchzuckte sein Rückgrat und jagte hinauf bis unter die Schädeldecke. Kurz bekam er keine Luft.
Bleib liegen, einfach nur liegen. Nur eine Sekunde, vielleicht auch zwei!
Seine Hände tasteten unbeholfen nach Halt. Bevor noch die erste Schmerzwelle verebbte, hörte er die Tür knallen und fühlte Dankbarkeit darüber, sich nicht sofort wieder aufrappeln zu müssen. Er hatte den Eindringling in die Flucht schlagen können, womit sich bewahrheitete, dass Angriff bisweilen die beste Verteidigung war. Mit brummendem Schädel befühlte er das, was er dem Phantom hatte entreißen können, bevor es ihn so gründlich zu Boden geschickt hatte. Als er begriff, was er da in Händen hielt, stülpte er es sich vorsichtig über die Augen und blickte hindurch. Das Nachtsichtgerät tauchte das Antiquariat in geisterhaft grünes Licht.
4
Wahrhaftig, für einen gewöhnlichen Dieb gab es hier nichts zu holen. Die paar wertvollen Schmöker rechtfertigten einfach keinen Einbruch. Und die Kasse wurde täglich geleert – sofern sie denn überhaupt eine Füllung erfuhr. Nein, wer mutwillig in das Antiquariat eindrang, kam aus anderen Gründen. Dieser verstaubte, skurril anmutende Laden war mehr, als er vorgab zu sein.
Jeder Tag, an dem Henrik sich durch das Inventar wühlte, konnte mit der Entdeckung einer versteckten Botschaft enden. Ein Zufallsfund gleich zu Beginn seines Aufenthalts in Lissabon hatte ihn das gelehrt und ihn auf die Spur eines schockierenden Verbrechens gebracht, das vor einem Vierteljahrhundert begangen worden war. Wenn er daran dachte, überlief ihn auch heute noch ein kalter Schauder. Seither begleitete ihn die Angst vor dem, was da noch aus dem Dunkel kriechen mochte. Es klang paranoid, aber bisweilen fühlte er sich umzingelt von unsichtbaren Feinden, die nur darauf lauerten, dass er einen falschen Handgriff tat und dabei aus Versehen irgendwelche chiffrierten Notizen freilegte. Rätselhafte Skizzen, enigmatische Schriftwechsel, nicht zu deutende Zahlenkolonnen, grünstichige Fotos mit Markierungen. Die Hinweise konnten sich überall verbergen. In einem Buch, das er zufällig aufschlug, auf einer Landkarte, die er entrollte, hinter einem Gemälde, das er leichtfertig von der Wand nahm. Das Antiquariat war ein verschlüsseltes Archiv ungeklärter Verbrechen. Wer es verstand, die Symbole zu lesen und die Fragmente richtig aneinanderzufügen, der konnte die Wahrheit zutage fördern. Konnte die Maske der Unschuld von den Gesichtern jener reißen, die bisher mit Macht, Geld und Beziehungen verhindert hatten, dass unschöne Flecken ihre weißen Westen besudelten. Lissabon war eine Stadt im Licht – und gleichzeitig ein Moloch. Wie in jeder anderen Metropole auf diesem Planeten existierte im Schatten von Glanz, Schönheit und Lebensfreude ein stinkender Sumpf aus Korruption, Gewalt und Wahnsinn. Und es gab genügend Leute in dieser Stadt, deren größte Sorge darin bestand, dass dieser Sumpf eines Tages trockengelegt werden mochte. Er, Henrik Falkner, verfügte über Indizien, die der Flurbereinigung dieser kriminellen Landschaft dienlich waren. Sein nächtlicher Besucher hatte diese Vermutung aufs Neue bestätigt. Gelegentlich zwang offenbar die Angst vor der Wahrheit jemanden dazu, zwielichtige Handlanger ins Antiquariat zu entsenden. Unter anderem solche, die mit Nachtsichtgeräten ausgerüstet waren.
Geht es wieder los?
War womöglich sein gestriger Kunde der Auslöser für einen erneuten Anlauf zur Erstürmung der Bastille gewesen?
Umhüllt von Dunkelheit, dachte er zum wiederholten Mal darüber nach, warum er geblieben war, als sich herauskristallisierte, was Martin ihm da hinterlassen hatte? Es wäre nur ein kleiner Schritt nötig gewesen, eine einfache Entscheidung. Zurück nach Deutschland. Sein Flugticket hatte zu diesem Zeitpunkt noch in seiner Tasche gesteckt. Doch mit jedem Tag, den er in Lissabon verbrachte, war diese Option weiter in die Ferne gerückt. Eine Abreise wäre nichts als eine feige Flucht gewesen. Und Feigheit gehörte nun einmal nicht zu seinen Tugenden. Er war zwar verzweifelt gewesen, aber in dieser Verzweiflung niemals feige. Darum war er geblieben. Und wegen seines ausgeprägten Gerechtigkeitssinns. Jedenfalls war es einfacher, sich darauf zu berufen, auch sich selbst gegenüber. Obschon die Aufgaben, die Martin für ihn vorgesehen hatte, schmerzhafte Begegnungen bereithielten, Gefahr für Leib und Leben bedeuteten, erschien ihm das immer noch besser, als dorthin zurückzukehren, wo er Nina verloren hatte. Lissabon war und blieb sein Weg zurück ins Licht.
Offensichtlich hatte Martin diese wichtige Entscheidung seines Neffen vorausgeahnt und ihn daher zu seinem Erben bestimmt.
Das heisere Klingeln in die nächtliche Stille hinein versetzte ihm einen gewaltigen Schreck – und half dabei, sich trotz der Schmerzen aufzurichten. Fordernd schellte es aus dem Büro. Als ginge er auf Eiern, stakste er auf nackten Sohlen durch den Laden, um nicht auf die scharfkantigen Überreste der tönernen Buddha-Statuen zu treten. Unversehrt gelangte er um die Verkaufstheke herum in den abgetrennten, fensterlosen Raum, in dem noch dieselbe Unordnung herrschte wie bei seiner Ankunft vor einem Vierteljahr. Das museumsreife Wählscheibentelefon klingelte bereits zum fünften Mal, als er es endlich erreichte. Wer zur Hölle rief um diese unchristliche Uhrzeit hier an? Seine Hand zitterte leicht, während er nach dem Hörer griff. Mit der anderen schaltete er das Licht ein.
»Estou!«
»Henrik!«
»Helena?« Erleichterung überkam ihn. »Verdammt, du hast mich erschreckt.«
»Du bist nicht ans Handy gegangen«, tönte es vorwurfsvoll aus der Leitung.
Natürlich, es lag oben, neben dem Bett oder im Wohnzimmer. Warum hätte er es auch mitten in der Nacht einstecken sollen?
»Und da hast du dir gedacht, du probierst es um drei Uhr nachts einfach mal im Antiquariat?«
»Ich hatte einen Einsatz …«, erklärte sie, nun deutlich leiser.
Eine mitfühlende Frage lag ihm auf der Zunge, aber letztlich war es immer schlimm, wenn das Dezernat für Gewaltverbrechen zu einem Tatort gerufen wurde.
»… und dann habe ich im Revier gehört, was bei dir passiert ist.«
Für eine Sekunde dachte er, dass sie doch unmöglich von dem Einbruch wissen konnte. Dann fiel ihm wieder ein, was gestern Abend passiert war.
»Mir geht’s gut«, teilte er ihr mit. Kopf und Kreuz taten ihm weh, und er musste ein paar unschöne blaue Flecken davongetragen haben, aber das wollte er ihr jetzt nicht erzählen.
»Der Fall ist bei mir auf dem Tisch gelandet.«
Hatte er sich das nicht vor ein paar Stunden noch gewünscht? »Das ist …«
»… Absicht, nehme ich an.«
Vermutlich hatte sie recht. Nachdem die Bearbeitung des Messerangriffs zur PJ, der Polícia Judiciária, weitergereicht worden und in Verbindung damit sein Name aufgetaucht war, hatte Helenas Vorgesetzter schnell reagiert. Genau wie Inspetora Helena Gomes von der Divisão de Investigação Criminal witterte auch Henrik pure Absicht dahinter.
»Du solltest vorsichtig sein!«, mahnte sie ihn. Ein unnötiger Ratschlag, den er nicht einfach so hinnehmen konnte.
»Hätte ich weggehen und den Mann verbluten lassen sollen?«
Sekundenlang herrschte Schweigen. Aus den Hintergrundgeräuschen schloss er, dass sie im Auto unterwegs war. »Wohin fährst du?«
»Bin auf dem Heimweg. Ich muss erst ein paar Stunden schlafen, bevor ich dir einen Besuch abstatte, um dich offiziell zu befragen.«
Er sah hinunter auf seine nackten Zehen. Auch er gehörte ins Bett. Was wäre wohl passiert, hätte er den Eindringling nicht überrascht? Hätte er dann überhaupt bemerkt, dass wieder mal bei ihm eingebrochen worden war? Er betrachtete das Nachtsichtgerät, das er immer noch in der Hand hielt.
»Henrik? Ist wirklich alles in Ordnung bei dir?«, hörte er Helena fragen.
Er setzte gerade dazu an, sich zu verabschieden, um den Gedanken fortzuspinnen, der ihm eben in den Sinn kam, da unterbrach ihn Helena. »Ich wollte dir noch sagen … Der Mann aus der Bar … er hat es nicht geschafft.«
5
Er war also tot.
Hinter Martins zugestelltem Schreibtisch kauernd, dachte er über den Mann nach, der unter seinen Händen verblutet war.
Henrik war bereits entschlossen gewesen, es für diesen Tag gut sein zu lassen und das Antiquariat zuzusperren. Bevor er jedoch den Plan in die Tat umsetzen konnte, hatte der Mann den Laden betreten. Der Kunde wollte keine Beratung, sondern bat darum, sich ungestört umsehen zu dürfen. Das kam Henrik nicht ungelegen. Er konnte nach wie vor keine fundierten Empfehlungen aussprechen, genauso wenig wie er in der Lage war, tiefergehende Fragen zu Autoren und Werken zu beantworten. Daher ließ er den Mann nur zu gern allein zwischen den Regalen stöbern und vergaß ihn sogar für eine Weile. Vor allem als der Chef einer Entrümplungsfirma anrief, der ihm die komplette Bibliothek eines verstorbenen Sammlers anbieten wollte und ihn deshalb beharrlich volllaberte. Nachdem er den aufdringlichen Geschäftemacher endlich abgewürgt hatte, vernahm er plötzlich Schritte zwischen den Regalen, was ihm erst wieder die Anwesenheit des späten Kunden ins Gedächtnis rief. Der Mann, ein unauffälliger Mensch, der nur das Nötigste sprach und ihm nicht in die Augen sehen wollte, trat an den Tresen und bezahlte. Wenn Henrik jetzt daran dachte, rückte für ihn plötzlich wieder das Buch in den Fokus. Das Vertrackte an dem umfangreichen Inventar des Antiquariats war ja, dass er nie sicher sein konnte, ob er nicht gerade dabei war, einen von Martins umfunktionierten Geheimnisträgern zu veräußern. Selbstverständlich prüfte er die Bücher, Karten, Handschriften, Radierungen, Kunstdrucke, selbst den Tand und die Antiquitäten sorgsam, bevor er sie den Kunden aushändigte. Und was dieses Buch betraf … Er konnte sich zwar nicht mehr an den Titel erinnern, aber daran, dass er genau hingesehen hatte und ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen war. Sonst hätte er es kaum so arglos in eine Papiertüte gepackt und dem Kunden ausgehändigt.
Doch jetzt war der Mann tot!
Martins Archivierungssystem war aber auch zu idiotisch; ein Dechiffrierprogramm der CIA wäre hier nicht fehl am Platz gewesen. Denn Martins Geheimnisse waren so undurchschaubar wie er selbst. Bis vor einem Vierteljahr hatte Henrik nur gewusst, dass sein Onkel irgendwie, irgendwo in der Ferne existierte. Und selbst seither hatte er nur äußerst wenig über Martin Falkner herausgefunden.
Sein Onkel war in den späten 1970ern der Liebe wegen nach Lissabon gezogen. Zusammen mit seinem Lebensgefährten, dem Kunstmaler João de Castro, erwarb er das Haus numero trinta e oito in der Rua do Almada, mitsamt dem Antiquariat. Dafür verzichtete er auf eine vielversprechende Karriere bei der deutschen Staatsanwaltschaft. Wohl aus dem einfachen Grund, weil er wusste, dass er sich auf Dauer nicht verstellen konnte. Nicht in der Lage war, nach außen hin seine wahre Neigung zu verbergen, die vor vierzig Jahren auf wenig Verständnis in jener Gesellschaft gestoßen wäre, in der er sich damals bewegte. Wollte er ein glückliches, zufriedenes Leben führen, musste er ausbrechen. Aus den gesellschaftlichen Zwängen ebenso wie aus der erzkonservativen Familie Falkner, die damals noch von Henriks Großvater Walter despotisch regiert wurde.
Nach allem, was Henrik bislang in Erfahrung hatte bringen können, war Martin eine erfüllende Zeit gegönnt gewesen, bis zu jenem schicksalshaften Tag im Jahr 1988, an dem João ermordet wurde. Ein Verbrechen, das niemals aufgeklärt wurde. Die örtlichen Behörden verspürten offensichtlich keine Veranlassung dazu, dem gewaltsamen Tod eines schwulen Künstlers besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Umstand, den Martin um keinen Preis der Welt hinnehmen konnte. Was er in Deutschland im Dienste der Staatsanwaltschaft gelernt hatte, erwies sich plötzlich doch noch als nützlich. Er ermittelte auf eigene Faust – und auch wenn es ihm in der ganzen Zeit nicht gelang, den Mörder seines Lebensgefährten hinter Schloss und Riegel zu bringen, waren seine kriminalistischen Recherchen doch nicht umsonst. In den darauffolgenden drei Jahrzehnten stieß er offensichtlich auf zahlreiche ungeklärte Verbrechen, die er auf eigenwillige Weise dokumentierte. Diese verborgenen Beweise waren Henriks eigentliches Erbe und wohl auch der wahre Grund, warum sein Onkel ihm dieses Antiquariat vermacht hatte. Ihm, dem Ex-Polizisten. Dem Witwer, der seine Frau viel zu früh durch einen Verkehrsunfall verloren hatte und dem ähnlich wie Martin damit gewaltsam die große Liebe entrissen worden war. Ihm, der einen tiefen Groll gegen die Justiz hegte, weil derjenige, der Ninas Tod unter Drogeneinfluss verschuldet hatte, eine viel zu milde Strafe dafür erhalten hatte. Weil der Vater des Junkies gute Beziehungen bis ganz nach oben hatte. Weil es Menschen gab, die sich dank Einfluss und Geld über Recht und Gesetz stellen konnten. Genau dieser Umstand verband sie beide.
Warum nur hatte sein Onkel mit der Offenlegung seiner Ermittlungen so lange gezögert? So lange, bis ihm der Tod zuvorgekommen war? Ob auf natürlichem Weg oder weil jemand das Risiko minimieren wollte, dass der eigentümliche Buchhändler doch noch etwas ans Tageslicht brachte, was niemand erfahren sollte.
Herzinfarkt, hatte die offizielle Todesursache gelautet. Allerdings glaubte keiner von denen, die Martin eng verbunden gewesen waren, wirklich an diese Diagnose. Das war auch so eine Sache, die Henrik nicht losließ. Nur hatte er bislang keine stichhaltigen Indizien gefunden, die ihm halfen, das Gegenteil zu beweisen.
Wie belastend Martins Material über Gewaltverbrechen, Intrigen und Korruption innerhalb von Polizei, Justiz, Verwaltung und Politik wirklich war, wusste niemand. Henrik hatte als Polizist zwar gelernt, richtig hinzusehen und Details zu entdecken, die anderen verborgen blieben, doch das war gar nicht das eigentliche Problem. Die Herausforderung bestand vielmehr darin, Martins absurdes Sammelsurium zu deuten und – im Idealfall – die einzelnen Verbrechen offenzulegen. Die Taten mächtiger, einflussreicher Gegner, für die, wenn sie ihre Position in der Gesellschaft in Gefahr sahen, unter Umständen auch ein Menschenleben nichts bedeutete.
Was hatte er nicht schon alles gefunden! Martins Aufzeichnungen und Notizen waren allgegenwärtig in den Büchern. Dazu kamen Unterstreichungen, von einzelnen Wörtern bis hin zu ganzen Textpassagen. Zahllose Querverweise, ohne dass er bislang sagen konnte, wohin diese wiederum führten oder wozu sie dienten. Es gab Anmerkungen auf den historischen Land- und Stadtkarten, den Plakaten und sogar auf den Gemälden, Radierungen und Illustrationen, die freie Wandflächen schmückten oder sich in einer Ecke stapelten. Eine Batterie Karteikästen mit altem Fotomaterial und Postkarten aus allen erdenklichen Epochen. Henrik fehlten schlichtweg die Zusammenhänge, die Verbindungen und konkreten Vermerke. Wer Martins Archiv verstehen wollte, musste ein Genie sein oder sich auf den Zufall verlassen.
Bislang hatten Henrik Geduld und Zeit gefehlt, um tiefer in die Materie einzudringen. Er hatte das letzte Vierteljahr hauptsächlich dazu benötigt, sich physisch wie psychisch zu akklimatisieren. Außerdem hatte seine erste Ermittlung hier auf derart spektakuläre Weise geendet, dass er es bis auf Weiteres als ratsam erachtete, noch eine Weile die Füße stillzuhalten. Und das nicht allein der Polizei wegen.
So war es ruhig geworden in den vergangenen Tagen. Auch wenn er es genoss, dass man schon länger nicht mehr versucht hatte, ihn zu überfahren oder von Dächern zu stoßen, hatte er sich doch gefragt, ob Martins geheimes Archiv tatsächlich in der Form existierte, wie er es sich in den vergangenen Wochen zusammengereimt hatte. Oder ob sein Onkel einfach komplett gaga gewesen war, ein wahnhafter Verschwörungstheoretiker, der seine ins Nichts führenden Fantastereien in Dutzende Bücher gekritzelt hatte.
Doch jetzt, so unverhofft, als wollte ihn das Schicksal eines Besseren belehren, war dieser Mann gestorben. Auch wenn es keinen Beleg dafür gab, dass dieser Vorfall mit seinem Erbe zu tun hatte, trotzte sein Bauchgefühl der Vernunft. Und das nicht allein der ungebetenen Kundschaft wegen, die dafür gesorgt hatte, dass ihm immer noch der Schädel dröhnte.
6
Er hatte nie groß darüber nachgedacht, wie sich der Herbst in Lissabon anfühlen würde.
So war der Sommer dahingegangen, ohne dass er es wirklich wahrgenommen hatte. Abgesehen davon, dass das Wetter nun weniger beständig war und die Tage im Oktober merklich kürzer wurden, blieb es tagsüber weiterhin warm – auch wenn die anstrengende Hitze hinter ihm lag. Nach Sonnenuntergang empfahl sich eine Jacke, wenn man draußen sitzen wollte, genau wie morgens, bevor die Sonne über die Hügel kam. Doch damit konnte er sich problemlos arrangieren, ja er empfand das Klima geradezu als perfekt. Winterkälte, wie er sie aus Deutschland kannte, war ihm immer schon zuwider gewesen.
Nach den gestrigen Schauern zeichnete sich heute wie zur Entschädigung ein klarer, sonniger Tag ab. Das Licht fiel weich in die Häuserschluchten und ließ bereits die Wärme erahnen, mit der sich in zwei, drei Stunden die Gassen füllen würden. Obwohl er kaum geschlafen hatte, war er früh wach geworden. Zu früh für portugiesische Verhältnisse; allerdings kannte er mittlerweile ein paar Läden, die um diese Zeit schon geöffnet hatten. Da Martin ein ausgesprochener Teetrinker gewesen war, fehlte im Hausrat die Kaffeemaschine. Henrik selbst hatte es zunächst nicht geschafft, eine zu besorgen, und war inzwischen ohnehin der Meinung, dass es dieser Anschaffung nicht mehr bedurfte. Er wohnte zentral in einer Stadt, die für erstklassigen Kaffee bekannt war. Fußläufig um ihn herum gab es zahlreiche Cafés und beinahe an jeder Ecke eine Pastelaria. In diesen meist recht beengten Lädchen, die irgendwo zwischen Bäckerei und Konditorei angesiedelt waren, pflegten die Lissabonner ihr Frühstück ein- oder, sofern man es ausnahmsweise doch mal eilig hatte, mitzunehmen. Pastelarias waren kleine Welten für sich, die dazu dienten, den Leuten ihren Start in den Tag zu erleichtern – vor allem zu versüßen. In den Auslagen und Vitrinen warteten neben den weltberühmten Puddingtörtchen, den Pastéis de Nata, auch zuckrige Köstlichkeiten wie Tartes de Amêndoa, Bolos de Arroz oder Mil Folhas. Alle hatte er sie schon durchprobiert, das meiste war ihm viel zu süß. Daher verleibte er sich für gewöhnlich zu seinem Galao, dem portugiesischen Milchkaffee, am liebsten ein Torrada ein: getoastetes Weißbrot mit Butter. Ihm knurrte bereits der Magen, wenn er daran dachte. Henrik strebte die nächstgelegene Pastelaria an. Häufig ging er ins Chiado Caffe oder ins Emenda, gleich neben dem Cinema Ideal, einem kleinen kommunalen Kino. Beide Pastelarias lagen in der Rua do Loreto, keine zwei Minuten von der Rua do Almada entfernt. Dazwischen, zwei Querstraßen weiter, am Largo Calhariz, befand sich eine von Lissabons zahlreichen Attraktionen. Hier hielt die Ascensor da Bica, eine der drei Standseilbahnen der Stadt, die stets für touristischen Wirbel in dieser Ecke des Viertels sorgte. Um diese Zeit war sie noch nicht in Betrieb, weshalb er seinen Weg unbehelligt fortsetzen konnte, ohne sich durch Urlaubertrauben schieben zu müssen. Dafür klingelte sein Handy. Er rechnete erneut mit Helena und nahm das Gespräch entgegen, ohne auf das Display zu schauen.
»Bom dia, Henrik!«
Seine Schritte gerieten ins Stocken. »Adriana!«
»Überrascht?«