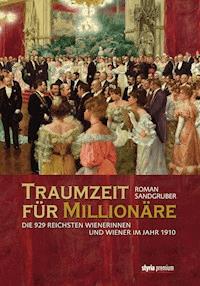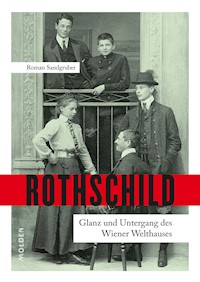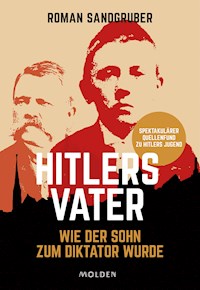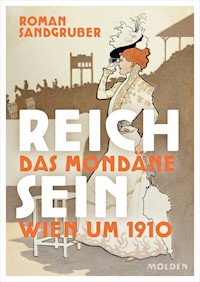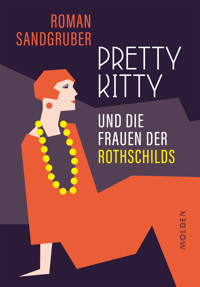
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Molden Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Sie waren Stilikonen der 1920er- und 1930er-Jahre, gehörten zu den elegantesten Erscheinungen der Wiener Gesellschaft und waren internationale Celebrities. Ihre Männer und Liebhaber trugen den Zaubernamen Rothschild und standen für unfassbaren Reichtum. Sie waren schön, aufregend, begehrenswert und maßlos teuer, zugleich verletzlich und manchmal auch verletzend. Kunstsinnig und weltgewandt, modebewusst und extravagant, zeigten sie bemerkenswerte Durchsetzungskraft und drängten ihre Männer nicht selten in den Schatten. In fünf brillanten Einzelporträts entreißt Rothschild- Experte Roman Sandgruber diese starken, emanzipierten Frauen dem Vergessen und zeigt, was Frausein vor einem Jahrhundert bedeuten konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
DER WEG DER GRÄFIN KITTY SCHÖNBORN, EINER DER SCHÖNSTEN FRAUEN UNSERER ZEIT, IST EIN ROMAN, VON DEM ALLE MÄDCHEN TRÄUMEN.
DIE BÜHNE, 1924
INHALT
SIE WAREN DIE NEUEN FRAUEN
DIE DIVA
KITTY ROTHSCHILD
DIE UNGEKRÖNTE KÖNIGIN
WALLIS SIMPSON, KITTY UND DER KÖNIG
DIE ABENTEURERIN
CLARICE ROTHSCHILD
DIE GELIEBTE
ALINE RINGHOFFER
DIE EXZENTRIKERIN
HILDA AUERSPERG-ROTHSCHILD
DIE STILLE
VALENTINE ROTHSCHILD-SPRINGER
AUF DER FLUCHT
IN AMERIKA
ANMERKUNGEN
QUELLEN- UND LITERATURNACHWEIS
BILDNACHWEIS
Impressum
Eine Ruderregatta gibt jungen Pariserinnen Gelegenheit, die farbenfrohe Sommermode von 1924 zu präsentieren: Kleider von Jean Patou, Georges Doeuillet, Martial et Armand und Jeanne-Marie Lanvin.
Die Welt der vornehmen Dame: kostbare Pelze, Barsoi-Windhunde und ein eleganter Sechs-Zylinder-Renault mit Chauffeur. Farblithografie von René Vincent, um 1920.
Die Frauen der Rothschilds gaben den Ton an, in der Mode ebenso wie bei den Events der High Society. Man beeindruckte beim Galopper-Derby in der Freudenau mit den elegantesten Toiletten und zeigte bei der Jagd seine „harte“ Seite: Clarice Rothschild mit Sohn Albert und Fürstin Mathilde Kinsky beim Derby 1935 (rechts oben) und bei einer Treibjagd im Tullnerfeld im Herbst 1935 (oben Mitte). Baronin Aline Ringhoffer erschien zum Derby 1933 in einem silbergrauen Musselinkleid und einem Hut aus dem Salon „Suzanne“ (in der Präsentation des „Wiener Salonblatts“ das Modell rechts außen).
Auch Kitty ist Kundin im Atelier von Jeanne-Marie Lanvin in der Rue Barbet-de-Jouy: drei charmante Crêpe-de-Chine-Kreationen der legendären Pariser Modeschöpferin aus dem Jahr 1924.
SIE WAREN DIE NEUEN FRAUEN
Frauen waren in der langen Geschichte der Familie und des Hauses Rothschild, das aus dem jüdischen Ghetto der Stadt Frankfurt am Main kommend einen märchenhaften Aufstieg nahm, eigentlich nicht vorgesehen.1 Sicher: Man hatte sie und man brauchte sie. Aber Mayer Amschel, der Stammvater der fünf Linien, hatte in seinem Testament die Rothschild-Leitlinie für alle Zeiten vorzugeben versucht: Rothschild sollte eine auf die männlichen Nachkommen beschränkte Familiengesellschaft sein und bleiben. „Ich verordne und will daher, dass meine Töchter und Töchtermänner und deren Erben an der unter der Firma Mayer Amschel Rothschild und Söhne bestehenden Handlung keinen Anteil besitzen und auch keinerlei Recht haben, diese Firma zu inspizieren und ihre Bücher, Geschäftspapiere oder Warenlager zu überprüfen …“2 Nur die Söhne sollten berechtigt sein, Einstellungen und Entlassungen von Personal vorzunehmen und ohne Rücksprache Geld aus der Firma zu nehmen. Das Wichtigste aber war: Kein Familienfremder, aber auch kein Schwiegersohn und keine Schwiegertochter sollten sich in das Geschäft einmischen können. Alle sollten sich verpflichten, das Geld auch durch ihr Heiratsverhalten in der Familie zu halten. Nur eine Rothschild sei einem Rothschild ebenbürtig und nur ein Rothschild könne eine Mitgift aufbringen, die einer Rothschild würdig sei, war das Rothschildsche Heiratsgebot. Man brauchte als Frau nicht einmal den Familiennamen zu ändern, wenn man heiratete.
Natürlich brauchte man Frauen. Gutle (1753–1849), die Stammmutter, war voll beeindruckender Weisheit und Bescheidenheit. Aus dem Frankfurter Ghetto kam sie nie hinaus, auch dann nicht, als das Ghetto längst aufgelöst und die Rothschilds ungeheuer reich geworden waren. Gutle gebar ihrem Mann Mayer Amschel Rothschild neunzehn Kinder, von denen zehn überlebten: fünf Knaben und fünf Mädchen. Die Mädchen zählten wenig. James, der jüngste ihrer fünf Söhne, der seine Nichte Bettina heiratete, schrieb in einem Brief an seinen Bruder Nathan: „Meine Frau ist ein wichtiges Stück Möbel.“3 Das klang härter, als es wohl gemeint war. Frauen seien „schlechte Kassierer“, schrieb Carl, der zweitjüngste der fünf Brüder.4 Mit Zahlen könnten sie nicht umgehen und für Geldangelegenheiten seien sie schlecht zu gebrauchen.
Salomon, der zweitälteste ihrer Söhne und Stammvater der österreichischen Linie, musste sich seine Frau noch im Frankfurter Ghetto suchen: Caroline Stern. Denn eine seiner Schwestern konnte er nicht gut heiraten. Caroline lebte ausschließlich in Frankfurt. Nach Wien kam sie nie. Salomon hatte zwei Kinder. Seine Tochter Betty vermählte er mit seinem Bruder James, seinen Sohn Anselm mit dessen englischer Cousine, die dieser nicht liebte. Sie lebte in Frankfurt und kam nur selten nach Wien. Anselm war ein Frauenfeind. Er hatte drei Söhne und vier Töchter. Aber nur die Söhne zählten. Die vier Töchter Julie, Mathilde, Louise und Alice waren kaum jemals in Wien. Aufgewachsen waren sie in Frankfurt. In Wien gab es daher bis ins 20. Jahrhundert kaum Rothschild-Frauen.
Als es ans Heiraten ging, kamen auch für Anselms Töchter wieder nur Rothschilds infrage. „Für uns Juden, und besonders für uns Rothschild ist es ein Glück, nicht mit anderen Familien in Berührung zu kommen, das macht einem immer Unannehmlichkeiten und kostet Geld“, meinte ihre Tante Charlotte aus der neapolitanischen Linie.5 Mathildes Entschluss, in die Heirat mit ihrem Cousin Willy aus Neapel einzuwilligen, erregte bei ihrer Pariser Tante Betty sogar Mitleid: „Jetzt bereitet sie sich mit einer wahrlich engelhaften Resignation auf die Opferung der schönsten Illusionen ihres jungen Herzens vor. Man muss sagen, dass die Aussicht, Willys lebenslanger Gefährte zu sein, keine junge Frau reizen würde, die wie sie aufgewachsen und mit einem kultivierten Geist gesegnet ist.“6 Willy war wirklich kein Traummann. Aber Mathilde fügte sich in ihr Schicksal.
Ihre um zwei Jahre ältere Schwester Caroline Julie hatte sich zwar durchsetzen können, als sie die Verbindung mit Willy ausschlug, in die dann Mathilde einwilligen musste. Aber dass sie letztlich einer von ihrem Vater und ihrem Schwiegervater arrangierten Ehe mit dem ebenfalls aus der neapolitanischen Linie kommenden Adolph zustimmte, war in gewissem Sinn ein Akt der Notwehr. Denn als ihr fast achtzigjähriger Großonkel Amschel, dessen Frau Eva 1848 verstorben war, sie, die noch keine 20 Jahre alt war, als Frau zu bekommen versuchte, war sie entsetzt, auch wenn die ganze Familie dagegen nicht allzu energisch Stellung zu beziehen wagte, um Amschel nicht womöglich derart stark zu vergrämen, „dass er sein Kapital aus der Firma zieht und eine Fremde heiratet“. Da willigte Julie lieber in die Heirat mit ihrem recht trockenen Cousin Adolph ein. Das Paar hatte keine Kinder und übersiedelte nach der Schließung der Neapolitaner Rothschild-Bank mit allen Kunstschätzen nach Paris. Er widmete sich seinen Sammlungen, sie ihrem Schloss und ihren Gärten am Genfer See. Bekannt war sie, ähnlich wie Mathilde, für die dicken Zigarren, die sie rauchte: elf bis zwölf teure Havannas pro Tag. Am Genfer See entdeckte sie auch ihre Leidenschaft für die Schifffahrt, den Segelsport und die Geschwindigkeit. Mit ihrem 24 Meter langen Boot Gitana wurde sie als „Yachting Lady“ berühmt, weil sie es 1876 schaffte, die Geschwindigkeit von 20 Knoten (ca. 36 km/h) zu überschreiten. 20 Jahre später stellte sie mit der Gitana II ihren eigenen Rekord mit 48 km/h ein. Wirklich bekannt aber wurde sie, nachdem „Sisi“, die österreichische Kaiserin Elisabeth, den Tag vor ihrer Ermordung bei ihr verbracht hatte.7
Glamourfrau von Welt: Kitty Gräfin von Schönborn-Buchheim, geborene Katherine Wolff, geschiedene Mrs. Dandridge, spätere Frau von Eugen von Rothschild. Foto, aufgenommen 1913 im Fotoatelier Madame d’Ora.
Sara Louise, die dritte der Töchter, ein „äußerst liebenswürdiges, blondes Wesen“, hatte bereits einen von der Familie nominierten engeren Verwandten als Bräutigam ausgeschlagen: den Londoner Bankier und Rentier Josef Mayer Montefiore. Als sie dann 1858 den aus Livorno gebürtigen Bankier und Industriellen Raimondo Franchetti heiraten wollte, stimmte die Familie widerwillig zu: Immerhin war er ein in den Grafenstand erhobener Jude und in Italien ähnlich bedeutsam wie die Rothschild in Österreich. „Ricco come Franchetti“ hatte denselben Klang wie „Reich wie Rothschild“ oder „Rich as Rockefeller“. Aber es war eine Ehe auf Distanz, ohne viel Liebe und große Gefühle. Sie lebte im Piemont in ihrem Schloss im Valle di Viù bei Turin, ihr Gatte in Venedig im aufwändig restaurierten Palazzo Cavalli-Franchetti. Sogar als er starb, war sie weit weg.8
Die jüngste der vier Schwestern Charlotte Alice heiratete lieber gar nicht und zog sich auf ihre riesigen Gärten in Mittelengland und in der Provence zurück. Immer hatte sie einen Spaten bei sich, mit dem sie ihre in Reih und Glied angetretenen Gärtner dirigierte und ein feldwebelartiges Regiment über sie führte. Nicht nur gegenüber den Angestellten herrschte ein militärischer Ton, sondern auch gegenüber noblen Besuchern. Als Königin Victoria die berühmte Gartenanlage besichtigte und versehentlich auf ein Blumenbeet trat, wurde sie von der Baronin energisch hinauskomplimentiert: „Get out!“ Die verdutzte Königin gehorchte, nannte ihre Gastgeberin in Zukunft aber nur mehr „die Allmächtige“.9
Auch die Frauen von Anselms drei Söhnen waren zutiefst unglücklich. Evelina, die aus der englischen Rothschild-Linie stammende Gattin Ferdinands, starb bei der Geburt des ersten Kindes. Auch das Kind war tot. Ferdinand heiratete nie mehr. Sein Bruder Nathaniel war homosexuell und heiratete nie. Und Bettina, die aus der französischen Linie kommende Frau von Anselms jüngstem Sohn Albert, erwartete in Wien kein gnädiges Schicksal. Sie gebar ihrem Mann sieben Kinder und starb im Alter von nur 34 Jahren an Brustkrebs. Albert heiratete nicht mehr.
Erst die fünfte und auch letzte Generation der österreichischen Rothschilds wagte den Ausbruch aus den strengen Grenzen des Judentums und der Familie. Von Alberts fünf Söhnen hielt sich nur mehr Alfons an die Vorgaben des Ururgroßvaters. Er hatte mit Clarice eine Partnerin aus der mit den Rothschilds eng verknüpften Familie Montefiore gewählt. Aber ob ihm seine Ehe viel bedeutete? Georg scheiterte am Traumbild einer schönen Frau, wurde wahnsinnig und verbrachte sein ganzes weiteres Leben, fast 40 Jahre, in geschlossenen Anstalten. Eugen wählte sich zwei nichtjüdische Glamourfrauen: zwei der größten Schönheiten der damaligen Welt. Oscar Ruben, der jüngste der fünf Söhne, beging im Alter von 20 Jahren nach einer missglückten, vom Vater nicht tolerierten Liebschaft mit einem christlichen, noch dazu nicht reichen Mädchen Suizid. Und Louis, der die Rolle des Chefs des Hauses übernommen hatte, hielt sich zwar bis ins hohe Alter an die Familienregel, keine Familienfremde oder gar eine Nichtjüdin oder Christin zu ehelichen. Aber als er sich als über Sechzigjähriger endlich zu einer Ehe entschloss, heiratete er in den katholischen Hochadel, auch wenn Hilda Auersperg ein sehr unkonventionelles Bild einer Aristokratin darstellte. Dass er sich vorher nie zu einer Heirat entschließen konnte, obwohl er sowohl mit Hilda Auersperg wie auch mit Aline Seybel, verheiratete Ringhoffer, und angeblich noch mit viel mehr Frauen eng befreundet war, mag vielleicht als ein renitentes Junggesellenstreben zu deuten sein – oder aber eher doch als Zögern, aus der Familientradition auszubrechen, was er erst nach dem völligen Zusammenbruch der Familie wagte. Alberts einzige Tochter Valentine, die durch ihre sprachliche Behinderung eigentlich die ohnmächtigste seiner Kinder war, hatte kaum sechs Monate, nachdem der übermächtige Vater tot war, den jüdischen, aber nicht der Familie zuzurechnenden Bankier Sigismund Springer geheiratet.10
Die Frauen der ersten beiden Generationen standen im Hintergrund und agierten im Verborgenen. Erst die dritte Generation der Rothschild-Frauen war in ungeheurem Reichtum aufgewachsen und hatte nie materielle Einschränkungen irgendwelcher Art verspüren müssen. Am Ende der fünften Generation war das schon wieder anders geworden. Flucht und Vertreibung verlangten allen Betroffenen hohe Opfer ab. Die Wiener Rothschilds der fünften Generation waren schwache Männer, die starke Frauen brauchten. Die Frauen dieser letzten Generation waren selbstbewusst, emanzipiert und weltgewandt. Sie waren in der ganzen Welt beheimatet, korrespondierten rasch wechselnd in Französisch oder Englisch mit zur Dekoration eingesprengten Fetzen Deutsch: „c’était très gemütlich“ … „too much heimweh“ … „going on a cross-country ausflug“. Sie taten das nicht, weil man nicht alle drei Sprachen perfekt beherrscht hätte, sondern weil solch ein Mix „très chic“ war. Um Geld brauchten sie sich nicht zu sorgen. Sie hatten es. Sie brauchten es nur auszugeben. Auch für ihre Selbstbestimmung brauchten sie nicht zu kämpfen. Sie hatten sie. Sie hatten die neuesten Kleider, die modischsten Frisuren, die teuersten Autos. Auch alle männlichen Hobbys und sexuellen Freiheiten wurden ihnen zugestanden. Sie waren die neuen Frauen: keine Hausfrauen, keine Mütter, schon gar keine Arbeiterinnen. Politisch waren sie konservativ, im Kunstgeschmack extravagant, aber nicht immer progressiv, im Konsumverhalten wegweisend, in der Gesellschaft vernetzt, doch für die gesellschaftlichen Verwerfungen des Jahrhunderts waren auch sie zu schwach.
Die Männer der fünften Generation waren zögerlich. Ihre Frauen waren stark: Kitty, die mit allen gleich gut umgehen konnte, mit den Spitzen der Welt und mit den einfachen Leuten in Enzesfeld. Clarice, die Abenteuerin, die sich durchkämpfte und zu behaupten wusste. Hilda, die Exzentrische, die aus verklemmten Verhältnissen heraus sich ihre Freiräume schuf. Aline, die Liebenswürdige und Liebenswerte, die zu energischen Schritten nicht fähig war, aber im Zusammenbruch aller Welten schlussendlich ihre seelische Ruhe fand. Und Valentine, die Stille, die durch ihre Herzenswärme hervorstach und ihre körperliche Beeinträchtigung beeindruckend zu meistern verstand.
Glücklich waren sie alle nicht, weder die Männer noch die Frauen. Das Schicksal meinte es zwar lange gut mit ihnen. Doch die Flutwellen des Nationalsozialismus und Antisemitismus und die Folgen eigenen Verschuldens schwappten über sie hinweg. Der Fluch des Ururgroßvaters stand immer noch im Raum: Im Familienimperium der Rothschilds, in dem Frauen keinen Platz haben sollten, blieb zuletzt auch für Männer kein Raum. Es gab keine männlichen Nachfolger mehr.
Eine selbstbewusste, weltgewandte Persönlichkeit, Role Model der Art-déco-Mode: Kitty, nunmehr Frau eines Millionärs, am Gipfel ihres Ruhms, 1928.
KITTY ROTHSCHILD
Kittys Geschichte könnte ein modernes Märchen sein. Es ist ein Märchen, von dem alle Kinder träumen. Und es hat mit allen Märchen das eine gemein, dass seine Anfänge mit einem delikaten Schleier aus Dichtung und Wahrheit umwoben sind. War es nicht ein amerikanisches Märchen, als Tochter eines nach Amerika ausgewanderten deutschen Arztes, der es in Philadelphia zu bescheidenem Wohlstand gebracht hatte, in das amerikanische Südstaaten-Establishment und in die Nachkommenschaft des ersten US-Präsidenten George Washington einzuheiraten? Aber von dort den Weg in die österreichische Hocharistokratie zu finden und zuletzt einen der reichsten Männer der Welt zu gewinnen, ist ein wirklicher Märchenstoff. Ein bisschen ist es auch ein opportunistisches Bäumchen-wechsel-dich-Spiel, begleitet aber von vielen Tragödien, von privaten und familiären Schicksalsschlägen, von den sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen der Zeit, zuletzt von der Vertreibung durch die Nationalsozialisten und vom viel zu frühen Tod in den heimatlichen USA, wo die Amerikanerin Kitty sich nicht mehr zu Hause, sondern wie in einem fremden Exil fühlte.
Viele waren verliebt in Kitty. Aber kannten sie Kitty überhaupt? Unter welchem Namen sollten sie sie suchen? Als Katherina Franziska Wolf, Kathrin Wolff, Catherine Spotswood, Gräfin Katharina Schönborn, Baronin Kitty Rothschild, Baronesse Eugène de Rothschild oder einfach als Pretty Kitty? Und wo sollten sie suchen? In Philadelphia, New York, London, Paris, Wien, an der Côte d’Azur oder in ihrem Schloss im niederösterreichischen Arbeiter- und Weinbauernort Enzesfeld? Es ist nicht so sehr der Umstand, dass sie zu ihrer Zeit als eine der schönsten Frauen der Welt galt und ihre Geschichte einem modernen Märchen gleicht, sondern dass Kitty eine wirklich besondere Frau war: eine blendende Unterhalterin und selbstbewusste Persönlichkeit, die sich in drei ganz verschiedenen Kulturen zu bewegen und zu behaupten wusste: im Amerika der Immigranten und des modernen Räuberkapitalismus, in den zentralen Orten der Hocharistokratie und in der High Society des alten Europa und im Arbeiter- und Weinbauernmilieu des Industrieortes Enzesfeld.
Aber Schönheit hat viel mit Geld zu tun, zumindest in Kittys Fall. „Schritt für Schritt“ und „Mann für Mann“ kam sie dem Gipfel der Gesellschaft immer näher. Die Zeitungen und Gesellschaftsjournale hofierten sie und überschlugen sich mit Superlativen, in Amerika, in Paris und auch in Wien: „Die Baronne Eugène de Rothschild gehört zu der kleinen Gruppe von Frauen auf der Welt, die international für ihren großen Chic bekannt sind“, schrieb die Vogue, die führende Modezeitschrift ihrer Zeit, im Jahr 1932: „Ihr Geschmack an Kleidung, Juwelen und Häusern ist einwandfrei, und sie ist eine Person von herausragender Bedeutung unter den Frauen der heutigen Generation.“ Als sie am 28. April 1925 Eugen Rothschild heiratete, war sie am Gipfel ihres Ruhms angelangt und hatte ihren Traummann gefunden. Aber der Weg war nicht einfach: Da hatte sie bereits zwei Ehen hinter sich und hatte ein Kind in Amerika, den 1905 geborenen Sohn William Lawrence, dessen früher Tod im Alter von 17 Jahren sie bitter traf, auch wenn sie sich vorher herzlich wenig um ihn gekümmert und ihn ab dessen viertem oder fünftem Lebensjahr sicher nie mehr gesehen hatte.
Katharina Franziska Wolff oder Wolf, die unter ihrem Kosenamen Kitty viel besser bekannt ist, wurde am 13. Marz 1885 als Tochter des deutschamerikanischen Arztes und Chemikers Dr. Lawrence Wolf und der aus Schottland stammenden Mary Olivia Keys im Zentrum der damals boomenden Handels- und Industriestadt Philadelphia geboren. Schon der Vorname war Programm. Katherina war viel zu streng, Cathrin zu bieder, Catherine zu amtlich. Aus der heiligen Katharina, der „Reinen“, wurde das widerborstige Kätzchen Kitty, das man aus Jane Austens berühmtem, 1813 erschienenen und bis heute viel gelesenen Roman Stolz und Vorurteil kennt. Catherine, die zweitjüngste von Mrs. Bennets fünf Töchtern, die von allen nur Kitty genannt wird, gilt in Austens Roman als schönstes, aber auch schwierigstes der fünf Mädchen: modebewusst und eitel, verletzlich und zugleich verletzend, berechnend, doch auch zielbewusst. Auch Cathrin Wolf schuf sich, obwohl sich ihr Nachname so viele Male änderte, mit Kitty eine unverwechselbare Identität und eine der wichtigsten Konstanten ihres Lebens. Sie wusste, wie wichtig ein Name war. Angeblich hatte sie drei Schwestern, von denen nichts Näheres bekannt ist. Die Zeitungen schrieben von den „beautyful Wolf girls in Philadelphia“. Kitty habe noch zahlreiche Verwandte in Philadelphia, berichtete der Evening Star im Jahr 1925, insbesondere einen Onkel Dr. Carl F. Wolff in 580, Park Avenue.11 Aber Kitty war die Einzige, die sich nach oben kämpfte. Und es brauchte viel Wandlungsfähigkeit, Starrsinn und Marketing, um das zu schaffen.
Ihre Kindheit ist in einem Wirrwarr aus einzelnen Nachrichtenfragmenten, Erinnerungslücken und Falschmeldungen versteckt. Kitty und ihre Verehrer haben später alles getan, um die wahre Kitty zu verbergen. Wie immer, wenn es wenige schriftliche Quellen gibt, explodieren die Mythen. 1903 tauchte erstmals die Geschichte von Kittys aristokratischer Herkunft auf: von ihren hochadeligen Münchener Verwandten, dem Onkel im Bayerischen Justizministerium, von der adeligen Tante, bei der sie gewohnt habe, von ihrer eigenen Rolle als Hofdame des bayerischen Königs oder gar bei der Kaiserin in Wien, die zu dem fraglichen Zeitpunkt nach der Jahrhundertwende aber gar nicht mehr lebte. Die amerikanischen Zeitungen waren da sehr erfinderisch und großzügig.
Die Vermutungen, dass es sich bei ihrem Vater, der im Oktober 1860 in die USA eingewandert war, um einen Baron handelte, der der Enge Alteuropas entkommen wollte, oder um einen bayerischen Revolutionär oder gar einen jüdischen Arzt, der zur Emigration gezwungen wurde, sind haltlos. Die Rede vom Adelstitel gehört zu den Geheimnissen, die Kitty selbst geschickt auszustreuen wusste. Ein Adelstitel, wenn auch ein nicht mehr auffindbarer oder gar nie vorhandener, konnte nur von Vorteil sein, nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in Amerika, obwohl es dort gar keine solchen Titel gab. Die jüdische Herkunft wurde später wohl nicht nur deswegen vermutet, weil es in Ansbach eine gar nicht so kleine jüdische Gemeinde gab, sondern weil damit ihre Heirat mit Eugen Rothschild leichter zu argumentieren gewesen wäre. Und revolutionär gesinnte jüdische Studenten gab es überall, nicht nur in München.
Dr. Lawrence Wolff oder Wolf stammte aus dem oberpfälzischen Ansbach. Die Familie war im dortigen katholischen Industriebürgertum gut vernetzt und dürfte recht prominent und wohlhabend gewesen sein. In den amerikanischen Volkszählungsunterlagen steht bei Lawrence Wolff der Geburtsort Ansbach/Bayern und als Geburtsdatum der 23. April 1845.12 Eine Nachschau in den Taufmatriken der Stadt Ansbach ergibt Genaueres: Johann Friedrich Ludwig Lorenz Wolf, dort noch mit einem „f“ geschrieben, war das fünfte Kind des Fabrikbesitzers Carl Anton Wolf und seiner Gattin Franziska Maria, geborene Kämmerer. Die Familie betrieb das Stärkemachergewerbe und hatte es zu einer kleinen Fabrik ausgebaut. Lorenz Wolf wurde am 23. April 1845 katholisch getauft. Der Taufpate, der allerdings nicht anwesend war, war Johann Kämmerer, Handelsmann und Gutsbesitzer zu Edelheim in der Pfalz. Aber auch sein Stellvertreter Friedrich Kleinod war ein angesehener Baumeister aus Ansbach.13 Die Herkunft war katholisch und das Milieu großbürgerlich. Der Sohn sollte passend zum Familienunternehmen Chemie studieren. Denn der Chemie, den synthetischen Farben, chemischen Grundstoffen und neuen Arzneimitteln, gehörte die Zukunft. In Amerika noch mehr als in Deutschland. Wolf erwarb in München neben einer chemischen und pharmazeutischen Ausbildung auch das Doktorat der Medizin.
Wolf ging nach Amerika, nach Philadelphia, wo er sich ein kleines Vermögen erwirtschaftete, mehrere chemische Patente erwarb, eine angesehene Stellung als Arzt erreichte und ein recht repräsentatives Haus in der Zwölften Straße bewohnte. 1884 wurde er im Journal of the American Medical Association als „einer unserer führenden Apotheker und Chemiker“ beschrieben. Damals hatte er das Amt des Präsidenten der Drogistenvereinigung inne, für deren Mitglieder er einen Empfang in seiner schönen Residenz gab und zu dem er eine ziemlich große Anzahl von Prominenten eingeladen hatte. Er betrieb eine kleine Fabrik, in der Convallaramin und andere wichtige Glykoside und Herzmittel aus Pflanzen extrahiert und zu einer ganzen Reihe nützlicher und praktischer Heilmittel verarbeitet wurden.14 Aber nicht nur als Chemiker hatte er sich einen guten Ruf erworben, sondern auch als Arzt. Er arbeitete am Deutschen Spital der Stadt Philadelphia und brachte es bis zum ärztlichen Leiter dieses Spitals und zum Professor für klinische Medizin am 1850 gegründeten Woman’s Medical College of Pennsylvania, der weltweit zweitältesten Institution für die ärztliche Ausbildung von Frauen.15 Die Aussagen von Schülerinnen belegen, dass er sich einen humanitären und emanzipatorischen Blick angeeignet hatte. Eine seiner Studentinnen, Mary Theodora McGavran, beschreibt ihn in ihrem Tagebuch: „Der Herr Doktor kam zu seiner üblichen Zeit – Er lud mich ein, einen Fall von Typhus auf der Station zu sehen – es war ein sehr schwerer Fall – Er erlaubte mir, den Patienten zu untersuchen und die Krankenakte zu studieren – Ich bekam mehrere Punkte. Von dort brachte er mich zu mehreren anderen Patienten – einer davon hatte Ekzeme. Er war überaus freundlich zu mir, sagte, er zeige sie mir gerne – ich schätze, er hatte nichts gegen Ärztinnen.“16 Offensichtlich ein Arzt, der nicht den damals gängigen Klischees dieses Berufsstandes entsprach.
Über Kittys Mutter, die aus Schottland gebürtige Mary Olivia Keys, weiß man recht wenig. So unbedeutend, wie man vermuten könnte, dürfte sie für Kittys Leben aber nicht gewesen sein. Von Kittys Kindheit in Philadelphia und ihrer Schulzeit und Ausbildung in dem Geviert zwischen der Zwölften Straße, der Spruce Street und der Chestnut Street, zwischen der Liberty Bell und dem Delaware River, gibt es nicht viel zu berichten. Wir wissen nichts über Kittys Schulen, über ihren Musikunterricht oder über sportliche Interessen. Aber Philadelphia, die Hauptstadt des Bundesstaates Pennsylvania und nach 1783 für einige Zeit auch Hauptstadt der neu gegründeten Vereinigten Staaten, konnte für amerikanische Verhältnisse viel bieten. Auch nach der Übersiedlung der Bundesverwaltung nach Washington war es noch lange das führende kulturelle, finanzielle und wirtschaftliche Zentrum der 13 Gründerstaaten geblieben: Mennoniten und Quäker waren in der Stadt längst zu einer Minderheit geworden. Waliser, Schotten, freigelassene Sklaven, Deutsche, Ulster-Schotten, Finnen, Schweden, niederländische Amerikaner und Iren siedelten sich an. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs die Stadt durch Einwanderung aus Irland, Südeuropa, Osteuropa und Asien sowie durch den großen Zustrom von Afroamerikanern aus den ländlichen Südstaaten und Puertoricanern aus der Karibik dramatisch an. Die Pennsylvania Railroad, die Hafenanlagen und die neuen Industriebetriebe beschäftigten zehntausende Zuwanderer. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich von nicht ganz 600.000 im Jahr 1860 auf 1,2 Millionen im Jahr 1900. Die Stadt war also nicht wesentlich kleiner als Wien mit damals 1,7 Millionen. Philadelphia war auch ähnlich multikulturell zusammengesetzt und rassistisch unterfüttert wie Wien. Rassentrennung und Antisemitismus spielten eine große Rolle. Die Katholiken waren die größte Einzelkonfession, obwohl alle protestantischen Glaubensbekenntnisse zusammen die Mehrheit bildeten. Die Oberschicht war exklusiv. Was zählte, war die Herkunft, erst dann kam das Vermögen. Mark Twain formulierte es so: „In Boston fragen sie, wie viel er weiß, in New York, wie viel er wert ist, und in Philadelphia, wer seine Eltern waren.“ Eine Abstammung aus England, Schottland und Deutschland sicherte einen Startvorteil. Was das Philadelphia um 1900 von Wien um 1900 unterscheidet, war nicht der Rassismus, sondern die Korruption und Misswirtschaft. Philadelphia galt anders als Wien als extrem schlecht verwaltete Stadt. In seinem bahnbrechenden Werk The Philadelphia Negro hatte der aus Philadelphia gebürtige Historiker und Stadtsoziologe William E. B. du Bois, selbst ein Afroamerikaner, im Jahr 1899 geschrieben: „Nur wenige Großstädte haben eine so anrüchige Bilanz für Misswirtschaft wie Philadelphia.“17 Das mag wohl auch der Grund sein, dass Kitty in einer der vielen Seuchen, die die Stadt immer wieder erschütterten, überraschend zur Vollwaise wurde. Beide Eltern starben im Jahr 1901.
Kitty, damals erst 16 Jahre alt, kam zu einer Münchner Tante namens Gretchen, wo sie Musik studierte. Aber dieses „Gretchen“ ist nicht wirklich fassbar. Und das Musikstudium? War es mehr als ein Klavierunterricht mit Hausmusik? Recht viel länger als ein Jahr kann es nicht gedauert haben, wenn Kitty wirklich erst nach dem Tod der Eltern nach München kam. Denn spätestens 1903 war sie wieder in New York, um zu heiraten. Doch das Interesse für Musik hat sich Kitty ein Leben lang bewahrt. München war um die Jahrhundertwende eine pulsierende Stadt: nicht so walzerselig wie Wien und nicht so marschverliebt wie Berlin. Das Münchner Bier genoss schon damals Weltruhm. „Nichts tun und Bier trinken, dann zur Abwechslung wieder schnell ein wenig in den Kirchen herumrutschen, das ist die ausschließliche Beschäftigung vieler Herren und Nichtherren in München.“18 Dieses Klischee gab es zwar. Doch es entsprach keinesfalls der Realität. München war kein einschläfernder Biergarten. Auch München war rasch gewachsen, in der Ära des Prinzregenten Luitpold, der von 1886 bis 1912 regierte, von 250.000 Einwohnern auf 600.000. So gemütlich, wie die Klischees es vermuten lassen, ging es nicht zu. Es wurde viel gebaut. Für den jungen Adolf Hitler, der in Wien nur vegetierte, war München das ersehnte, aber bei Weitem nicht wahre Paradies. Es war um 1900 sowohl eine Kunststadt als auch ein Zentrum der Frauenbewegung. 1884 eröffnete die Münchner Damen-Akademie, die nach dem Vorbild der Königlichen Akademie der bildenden Künste organisiert war. Hier arbeitete Gabriele Münter und schrieb sich Käthe Kollwitz ein, damals noch unter ihrem Mädchennamen Käthe Schmidt. Hier lebten die führenden Köpfe der Künstlergruppe „Blauer Reiter“. „Die Kunst blüht, die Kunst ist an der Herrschaft“, schrieb Thomas Mann, der 40 Jahre lang in München lebte. Nicht in der Politik, wohl aber in der Kunst wurde München zur Konkurrenz Berlins. Seit 1895 hatten Mozart-Aufführungen den Ruf der Stadt auch als Musik- und Opernmetropole begründet. Nicht zuletzt deswegen behielt Kitty immer ein starkes Feeling für die Musik. Zeitlebens liebte sie das Bier, die Oper und die Konzert- und Liederabende.
AUS WOLF WIRD SPOTSWOOD
Wo und wann Kitty den deutlich älteren Ingenieur und Börsenhändler Dandridge Spotswood kennengelernt hatte, ist unbekannt. Er war sicher kein Zahnarzt, wie später kolportiert wurde, und auf keinen Fall irgendwer: Die Spotswoods kamen aus dem amerikanischen Südstaaten-Gründeradel. Sie zählten zu den nahen Verwandten von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA. Sicherlich: In den Augen europäischer Adeliger war das kein Adel, schon gar nicht einer mit 16 Ahnen. Aber mehrere Generationen hindurch besetzten die Spotswoods wichtige Positionen in der Gesellschaft und Politik Virginias.19
Dandridge Spotswood war am 17. Mai 1872 in Petersburg, Virginia, geboren worden, als Sohn von William F. Spotswood (1827–1895) und Isabella Matoaca Dunlop Spotswood (13.3.1848–19.8.1922). Er hatte von 1893 bis 1896 an der Pantops Academy nahe Charlottesville, am Hampden-Sidney College in Virginia und an der Cornell University of Michigan eine solide Ausbildung erhalten. Als Industriemanager und Bergbauingenieur machte er in New York Karriere und verbrachte viel Zeit auf Reisen in den Vereinigten Staaten und in Europa.20 Im Mai 1903 jedenfalls wurde die Verlobung verkündet.21 Die Heirat folgte am 20. Juni 1904 in der New Yorker First Presbyterian Church in Greenwich Village. Die Zeitungen schrieben von der Hochzeit zwischen einem New Yorker Bankier und einer bayerischen Prinzessin, die in der Münchner Aristokratie tief verankert sei.22 Die Schlagzeilen waren reißerisch: „Broker heiratet Baroness“, „Eine internationale Romanze“.23 Der Bräutigam, ein Aktienhändler mit Büro im teuren Mills Building, Wallstreet No 25, der im Börsenviertel und in den exklusiven Zirkeln New Yorks wohlbekannt sei, stamme als ein direkter Nachkomme von Alexander Spotswood, dem ersten Gouverneur von Virginia, und als naher Verwandter des ersten Präsidenten George Washington, aus einer der ältesten Familien Virginias, und die Braut, eine Baronin von Wolf, sei eine exquisite Schönheit. Frau Wolf lebe mit ihrer Tante, Frau von Adelman, der Nichte des gegenwärigen bayerischen Justizministers, in München.24 Ihr Vater, Baron von Wolf, sei ein bekannter Rechtsanwalt in München gewesen, habe sich aber wegen seiner streng republikanischen Tendenzen mit der Regierung überworfen, sei verbannt und sein Vermögen konfisziert worden. Die Zeitungen schrieben schon damals, aber erst recht dann, als sie wirklich berühmt geworden war, von einem Adelstitel, den Kittys Großvater einst in Bayern geführt und den der Sohn in Amerika abgelegt habe. Alles, zumindest was die Braut betraf, sind falsche oder maßlos übertriebene und fantasiereich ausgeschmückte Geschichten.25
Am 19. Mai 1905 kam der Sohn William Lawrence zur Welt. Lange kann sich Kitty nicht um ihn gekümmert haben. Sie scheint schon damals, glaubt man den Society-Kolumnisten, ein recht bewegtes Leben geführt zu haben und soll sich den Anschein einer Baronin gegeben haben, die sie gar nicht war. In der New Yorker Gesellschaft war sie sehr präsent und war schon in den ersten Jahren ihrer Ehe häufig in den Zeitungskolumnen zu finden. Sie reiste regelmäßig nach Europa. Es gelang ihr, zu den höchsten Gesellschaftskreisen des alten Kontinents Zugang zu finden, namentlich zum englischen Königshof. Am 26. Mai 1909 kam es beim britischen Galopper-Derby in Epsom zu einem überraschenden Zusammentreffen mit dem englischen König Edward VII. Wie es Kitty geschafft hat, diese Kontakte zu bekommen und an den König heranzukommen, ihm einen Porzellanfrosch als Maskottchen zu überreichen und von ihm ein entsprechendes Diamantgegengeschenk zu erhalten, darüber mag man rätseln. Kitty hatte jedenfalls einflussreiche Freunde und Freundinnen in der Gesellschaft Philadelphias und New Yorks, die Zugang zum englischen Hof hatten. Und Kittys Glückwünsche wirkten: Edwards VII. legendäres Pferd „Minoru“ gewann das Rennen. Der Sieg von „Minoru“ war der erste für einen regierenden britischen Monarchen im Derby und entfachte in der englischen Öffentlichkeit einen beispiellosen Begeisterungssturm. Edward bedankte sich bei Kitty mit einer goldenen Brosche in Form eines Froschs. Der Frosch sollte sich bald als Prinz entpuppen.
Ein Jahr später, am 6. Mai 1910, starb der König. Bei der Krönung seines Nachfolgers George V. am 22. Juni 1911 in Westminster war Kitty wieder dabei: Die Zeitungen berichteten von einer wahren „Gem Show“, einer prachtvollen Versammlung kostbarer Juwelen.26 Mrs. Dandridge Spotswood, die Enkelin eines Barons, werde den vergoldeten Frosch tragen, der ihr von König Edward VII. geschenkt worden sei, war zu lesen. Drei amerikanische Frauen seien bei der Krönung prominent vertreten: zum einen die mit dem Earl of Granard, dem Stallmeister des Königs und Aufseher seines Gestüts, frisch verheiratete Beatrice Mills aus einer der prominentesten und wohlhabendsten Familien New Yorks und Philadelphias, daneben Helen Vivien Gould, die älteste Tochter des Millionärs und Präsidenten der in Philadelphia beheimateten Western Pacific Railroad, George Jay Gould I. Diese war mit dem irischen Aristokraten und Politiker John Graham Hope de la Poer Beresford, dem 5. Baron Decies, verheiratet, dem Leiter des königlichen Pferderennstalls. Die Dritte im Bunde war Kitty.27 Es ist klar, dass Kitty den engen Zutritt zum englischen Hof diesen beiden Freundinnen zu verdanken hatte, die sie aus Philadelphia und New York kannte.
EIN BILD GEHT UM DIE WELT
Kitty hatte früh gelernt, die suggestive Kraft der Symbole und Bilder einzusetzen: den Frosch als Talisman, den Namen Kitty als Botschaft und ein schönes Bild als Werbeträger. 1907 war sie von dem deutschamerikanischen Maler Wilhelm Heinrich Funk, der in Hannover geboren war, in München studiert hatte und zum Liebling der New Yorker Gesellschaftszirkel aufgestiegen war, porträtiert worden.28 Das Gemälde, das im Frühjahr 1908 auf der 83. Jahresausstellung der National Academy of Design in New York und bald darauf auch in einer Pariser Galerie zu sehen war, soll den damaligen Attaché an der österreichisch-ungarischen Botschaft in Berlin, den vornehmen, liebenswürdigen und reichen Grafen Erwin Schönborn-Buchheim so sehr begeistert haben, dass er sich nicht nur Hals über Kopf in das Bild, sondern auch in die darauf dargestellte Person verliebte. Graf Schönborn habe sich in ein Phantom verliebt, hieß es.29 Galeriemitarbeitern war aufgefallen, dass der Graf immer wieder in die Ausstellung kam, um stundenlang vor dem Porträt zu verweilen. Im Ausstellungskatalog war das Bild als „Dame in Gelb“ bezeichnet, da die Unbekannte ein gelbes Kleid trug und der Hintergrund in einem gelblich goldenen Schimmer erstrahlte. Das Porträt ist verschollen oder für die Öffentlichkeit nicht greifbar. Die schlechte Zeitungsreproduktion, die vorhanden ist, vermittelt jedenfalls keinen plausiblen Eindruck von der magischen Kraft des Bilds, das den Grafen so sehr in Bann gezogen haben soll.
Allerdings klingt die Geschichte von der „Dame in Gelb“, dem der Adelige durch die halbe Welt nach New York, Venedig, Ägypten und in die Schweiz nachgereist sei, um die Frau, die er auf dem Bild gesehen hatte, zu finden, ohnehin etwas zu märchenhaft, um wirklich glaubhaft zu sein. Aber die Medien glaubten und verbreiteten die Geschichte: Die Washington Post berichtete am 17. Dezember 1911, wie ein österreichischer Adeliger sich in ein Bild verliebte.30 Und was die amerikanischen Zeitungen schrieben, übernahmen auch die österreichischen: „Der Liebesroman eines österreichischen Aristokraten“, titelte das Prager Tagblatt am 2. Jänner 1912: „Vor wenigen Wochen erregte es in aristokratischen Kreisen nicht unbeträchtliches Aufsehen, als der 40jährige Graf Erwin Schönborn-Buchheim die morganatische Ehe mit der Amerikanerin Mrs. Katharina Wolf-Spotswood aus New York einging.“ Mrs. Spotswood sei wohl vermögend, meinte die Zeitung, aber nach amerikanischen Begriffen nicht reich. Vor allem: der Graf hätte sicher nicht um die halbe Welt fahren müssen, um Kitty zu finden, da sie bereits seit mehreren Jahren in Paris lebte, dort in der Rue Victor Hugo eine Wohnung gemietet hatte und als die schönste Amerikanerin der Stadt galt.31 Ihre Ehe war offensichtlich längst zerrüttet und gescheitert. Und es war auch nicht das erste Mal, dass sich jemand in ein Bild verliebte, und Schönborn war auch nicht der Einzige, der dabei einer großen Täuschung unterlag. Kitty war zwar schön. Aber ob sie ihrerseits den Grafen ebenfalls schön fand oder nur seinen Titel und sein Vermögen, ist unklar.
Graf Erwin Ferdinand Karl Rochus von Schönborn-Buchheim, der jüngere Sohn des ehemaligen österreichischen Herrenhauspräsidenten Erwin Friedrich Karl Graf von Schönborn-Buchheim und der Gräfin Franziska von Schönborn-Buchheim, geborene Gräfin von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg, war 1911 mit 40 Jahren nicht mehr ganz der jüngste. Er hatte im Husarenregiment Prinz Thurn und Taxis Nr. 9 (k. u. k. Husarenregiment „Graf Nádasdy“ Nr. 9) gedient und es dort bis zum Rittmeister der Reserve gebracht. Danach ergriff er die diplomatische Laufbahn und war längere Zeit der österreichisch-ungarischen Botschaft in Berlin als Legationssekretär zugeteilt. Seine diplomatische Karriere war eher bescheiden: 1899 Paris, dann Berlin, Kopenhagen und 1910 Sekretär der österreichisch-ungarischen Botschaft in Rom (Vatikan). Er war wie viele andere nachgeborene Aristokraten, die eine Position in der Diplomatie suchten, aber mit ihrem Leben nicht wirklich viel anzufangen wussten, viel auf Reisen. Vor allem hielt er sich gern in Paris auf. Im Dezember 1910, so berichtete das Neue Wiener Journal, reiste er wieder nach Paris.32 Er hatte Kitty gefunden. Man wollte heiraten. Doch die Familie des Grafen war gegen eine Verbindung mit der verheirateten und in ihren Augen namenlosen Amerikanerin. Es war weniger der Bruder des Grafen und Chef des Hauses Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim, damals „Obersterbland-Truchseß in Österreich ob und unter der Enns“ und „Erbobergespan“ des ungarischen Komitats Bereg, der Vorbehalte äußerte, sondern dessen erste Gattin Fürstin Donna Teresa Dentice di Frasso. Das Schicksal kam Kitty und ihrem Verehrer zu Hilfe. Denn die strenge Donna Teresa starb überraschend. Graf Karl, der schon längst ein Auge auf deren viel jüngere Nichte geworfen hatte, konnte sich sein Verlangen nunmehr auch legal erfüllen. Die junge und lebenslustige apulische Fürstin Donna Sofia Dentice di Frasso hatte weniger Standesdünkel und Vorbehalte als ihre alte Tante. Und auch Karl konnte unter diesen Umständen nicht mehr so leicht gegen die Heiratsabsichten seines Bruders opponieren. Der nicht standesgemäße Wunsch des Grafen Erwin Schönborn wurde nunmehr von der Familie akzeptiert. Sofia, die zwar auf dem apulischen Stammschloss in San Vito dei Normanni geboren worden, aber in Rom aufgewachsen war, war durch Sommeraufenthalte bei ihrer Großmutter Luisa im slowakischen Schloss Kravska mit der Wiener Gesellschaft bestens vertraut und konnte Kitty die Wege in die österreichische Hocharistorkratie und in die Wiener Gesellschaft öffnen.
Die amerikanische Ehe Kittys war rasch getrennt.33 Im laizistischen Frankreich ging das ohne große Probleme. Die katholische Kirche nahm eine presbyterianisch geschlossene Ehe ohnehin nicht zur Kenntnis. Einen Monat nach der Scheidung konnte mit dem vollen Segen der Kirche geheiratet werden.34 Die Trauung fand am 24. Oktober 1911 in St.-Honoré d’Eylau zu Paris im engsten Familienkreis statt.35 Die Trauzeugen waren prominent: Aufseiten des Bräutigams das Mitglied des ungarischen Magnatenhauses Graf Friedrich Karl Schönborn-Buchheim und der k. u. k. Legationssekretär bei der Botschaft in Paris Prinz Emil Fürstenberg, aufseiten der Braut Admiral William T. Swinburne, pensionierter Oberbefehlshaber des US-Pazifikgeschwaders und der amerikanischen Pazifikflotte, und Mr. B. Mott, Militärattaché bei der Pariser Botschaft der Vereinigten Staaten von Nordamerika.36
Nun war Kitty nicht mehr eine von den Zeitungen erfundene bayerische Baronin, sondern eine echte österreichische Gräfin, auch wenn das Nasenrümpfen nicht ausblieb, dass sie ja nicht als Gräfin, sondern als einfache Wolf zur Welt gekommen sei, und noch dazu geschieden sei, wenn auch kirchenrechtlich legal wieder verheiratet, weil die amerikanische Ehe nur als Zivilehe galt. Beharrlich wurde der männliche Vorname ihres Gatten in ihren Titel eingefügt: „Gräfin Erwin Schönborn.“ Aber Kitty brachte die Lockerheit Amerikas in die steifen Salons des alten Europa. Sie brauchte kein Korsett, keinen Reifrock und keine aufgetürmte Frisur. Junge Mode begann vor 1914 auch den Hochadel zu erobern. Das Paar ließ sich in Wien nieder. Das Palais der Schönborn lag in der Renngasse, direkt gegenüber der Rothschild-Bank und auf der verlängerten Achse der Herrengasse, wo die wichtigsten Adelshäuser der Monarchie aufgefädelt waren und sich alles um die imaginäre Achse des Hofes drehte.
Die Schönborn-Buchheim waren eine der reichsten Adelsfamilien der Habsburgermonarchie. Im Jahr 1910 besetzte Erwins Bruder Friedrich Karl die 57. Stelle im Ranking der größten Wiener Einkommenssteuerzahler.37 In Wahrheit war er noch sehr viel reicher, weil die großen Besitzungen der Familie in Ungarn nicht der österreichischen Einkommensbesteuerung unterworfen waren. Mit rund 134.000 Hektar in der Karpato-Ukraine zählten die Schönborn-Buchheim zu den größten Grundbesitzern Österreich-Ungarns und nachher, als das Gebiet an die Tschechoslowakei fiel, auch dieses neuen Staats. Aber Erwin war nur der jüngere, in der Erbfolge benachteiligte Bruder des Familienoberhaupts. Er war zwar auch reich und war auch ein Graf, aber nicht mit den Privilegien eines Stammhalters und Familienoberhaupts ausgestattet, und schon gar nicht mit den finanziellen und symbolischen Mitteln, die einem solchen zur Verfügung standen. Und mit der Aufhebung der Adelstitel nach dem Ende der Monarchie und dem Zerfall des Habsburgerreichs waren nicht nur die vornehmen Titel, die die Schönborn trugen, verloren, sondern war durch die in der Tschechoslowakei eingeleitete Bodenreform auch das ererbte Vermögen gefährdet.
Graf Erwin Schönborn hatte nach der Heirat seine diplomatische Karriere beendet und suchte sich ein neues Standbein zu schaffen. Er gedachte, seinen Wohnsitz in Budapest zu nehmen, wo er in die Direktion der ungarischen Landes-Industriebank Aktiengesellschaft berufen und zu deren Präsidenten gewählt worden war.38 Dass er bereits 1913 diese Position wieder aufgab, wirft Fragen auf. Ganz freiwillig und ganz ohne Konflikte schied er sicher nicht aus. Die Zeitungen meldeten: „In der heutigen Generalversammlung der hiesigen Landesindustriebank, einer Gründung der Prager Živnostenská Banka, haben der Direktionspräsident Graf Erwin Schönborn-Buchheim, der Vizepräsident Baron Bela Talkian und das Direktionsmitglied Johann Nebeczky auf ihre Stellen verzichtet. Die Demission wurde von der Direktion mit Stillschweigen zur Kenntnis genommen.“ Diese Veränderung in der Direktion soll angeblich mit der von der Bank befolgten antiungarischen Politik in Verbindung stehen, berichtete das Neue Wiener Journal im Jahr 1913.39 Aber man könnte vermuten, dass Graf Schönborn auch nicht die richtige Person für eine verantwortungsvolle Bankiersposition war. Doch Graf Erwin hatte schnell etwas Besseres gefunden: Noch im selben Jahr wurde er in den Verwaltungsrat der Unionbank, eine der sieben größten damaligen Wiener Banken, gewählt. Dort verblieb er bis 1922.40 Als aber in diesem Jahr der Bankier und größte Börsenspekulant der österreichischen Ersten Republik Siegmund Bosel die Union-Bank handstreichartig übernahm, war es auch mit Schönborns Stelle im Verwaltungsrat vorbei. Wovon er danach seinen Lebensunterhalt und seine Aufwendungen bestritt, ist nicht bekannt. So großartig wie früher kann es sicher nicht mehr gewesen sein.
Kitty tat alles, um den Anschluss in die Wiener Aristokratie und den Zugang in das Budapester Gesellschaftsleben zu finden. Wichtig war die Hilfe ihrer Schwägerin Donna Sofia Dentice di Frasso, mit der Kitty sich rasch anfreunden konnte. Ohne die äußerst unkonventionelle Donna Sofia wäre ihr der Weg in die sehr reservierte österreichisch-ungarische Adelsoberschicht nicht so leicht möglich gewesen. Wien war zwar eine Großstadt, damals die sechst- oder siebtgrößte der Welt. Aber so leicht war es nicht, die Stadt zu erobern. Kitty wurde zur Society-Queen: „Die Gräfin Kitty Schönborn, das Kird der Millionenstadt Philadelphia und in ihrem Wesen mehr Pariserin als Wienerin“, schwärmte die Zeitschrift Sport und Salon im Jahr 1916, „vereinigt alle gewinnenden Eigenschaften der Amerikanerin mit jener der Pariserin. So hat die bildschöne junge Frau sich rasch die größten Sympathien unserer Gesellschaft erworben, zu deren entzückendsten Erscheinungen sie zählt.“41 Sie erregte nicht nur als schöne Frau Aufsehen, sondern verstand es auch geschickt, ihre amerikanische Herkunft mit dem Pariser Flair zu verbinden. Man sah sie bei allen Veranstaltungen der vornehmen Gesellschaft, bei den Premieren, bei den Rennen, bei den Festen und in den eleganten Lokalen der Stadt. Bald kannte man „die schlanke, graziöse Dame, deren Wuchs, Gang und Blondheit auf den schönsten Typ österreichischer Aristokratinnen schließen lassen würde“, in allen vornehmen Zirkeln, meinte ein kundiger Beobachter. Der jungen, schönen Dame wurde zwar der Hof gemacht. Aber als eine „geborene Wolf“ war sie jenen doch nicht ebenbürtig, die im „Gotha“, dem genealogischen Handbuch der adeligen Familien, auf eine lange Reihe von Ahnen hinweisen konnten.
Fürstin Donna Sofia hingegen war mehr als ebenbürtig. Ihre Netzwerke und die der Grafen Schönborn brachen manchen Widerstand; eine Schwester Schönborns war mit dem Prinzen Konrad zu Hohenlohe-Schillingsfürst verheiratet, eine andere mit dem Prinzen Gottfried Hohenlohe-Langenburg, eine dritte mit dem Fürsten Max Egon Fürstenberg. Kitty beteiligte sich am Salonleben, an den Amateurtheateraufführungen und Wohltätigkeitsveranstaltungen und an allem, was eine Aristokratin halt so macht. Man fragt sich oft, was man tut, wenn man nichts zu tun hat. Aber Langeweile durfte in der feinen Gesellschaft nicht aufkommen. Es gab genug Zerstreuung. 1912 gab es eine unter dem Präsidium der Gräfin Karolyi stehende Charité-Revue im Budapester Uraniatheater: eine eher zwanglose Aneinanderreihung ernster und heiterer Szenen und Bilder, bei denen Mitglieder der ersten ungarischen Adelsfamilien mitwirkten. Die Journale schwärmten vom Glanz der Kostüme, die Graf Julius Batthyány entworfen hatte. Auch Kitty als nunmehrige „Gräfin Erwin Schönborn“ beteiligte sich als Tizians „Lavinia“ in der Szene „Gemäldegalerie“.42 Auch die Treibjagden, welche auf den gräflichen Landsitzen im Niederösterreich und Ungarn veranstaltet wurden, nahmen einen hervorragenden Platz unter den herbstlichen Sportsejours der großen Gutsbetriebe in Österreich-Ungarn ein. Für Kitty hatten die Gebräuche etwas Fremdartig-Altertümliches, ja barbarisch Wirkendes an sich. Natürlich ging man auch in Amerika zur Jagd, aber ungeregelter und freier. Die rituellen Akte, zu denen sich alle um das nach Farbe und Art fein sortierte, in Quadraten abgelegte, auf Farnkraut und Reisig gebettete und mit frischen Fichtenbrüchen verblendete Hoch- und Niederwild versammelten, hatten etwas Archaisches an sich. Die Strecke und die Namen der Schützen wurden verlesen. Alle standen sie für ein paar Minuten still, das Haupt entblößt und die Blicke gesenkt. Die Jagdhörner hallten. Ein Weidmannsheil! Erst dann wurde gegessen und gezecht. Für eine Amerikanerin waren solche Gebräuche schwer zu verstehen, auch wenn sie den Riten der indianischen Ureinwohner nicht unähnlich waren. Die Natur musste in einer feierlichen Zeremonie versöhnt und das Unrecht entsühnt werden, das man dem Wild angetan hatte.
Kitty bevorzugte die musikalischen Salons, die ihre neue Schwägerin Sofia zusammen mit der Expertise ihres Freundes, des Staatsoperndirektors Franz Schalk und dessen Assistenten Richard Strauss organisierte. In der Hauptstadt, die, wie Hermann Bahr schrieb, sanft in eine „schwüle Apokalypse“ abglitt, wurde der Salon von Sofia Dentice di Frasso zu einem der wichtigen Orte des Wiener Kulturlebens. Kitty hätte wenig mehr tun müssen als sich anziehen, umziehen und ausziehen, langweilige Teekränzchen besuchen, mit alten Damen Bridge spielen, mit jungen Verehrern Walzer tanzen und den honorigen Männern zusehen, wie sie die Vögel vom Himmel und die Hirsche in den Wäldern schossen.