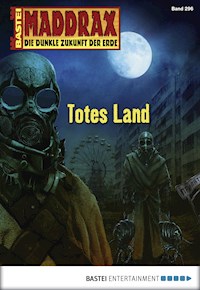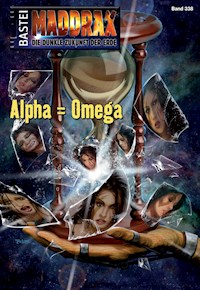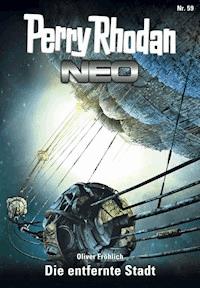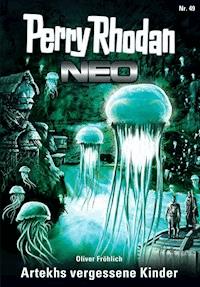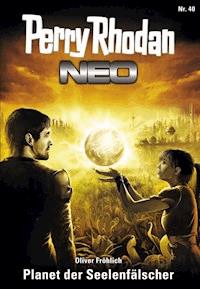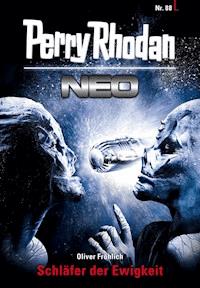1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Zamorra und Nicole stellen sich in Shoreham auf Long Island/USA einem Gegner, der von den Spuren einer schattenhaften Kreatur infiziert wurde. Diese Kreatur lebt in einer anderen Welt des Multiversums, weshalb der Infizierte versucht, ihr Zugang zu unserer Welt zu verschaffen und die auf Long Island dünn gewordene Barriere zwischen den Welten zu zerstören. Während des Einsatzes stellen Zamorra und Nicole fest, dass es im Jahr 1906 die Experimente von Nikola Tesla waren, die diese Schwachstelle verursacht haben ...
1. Teil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Ähnliche
Inhalt
Cover
Schatten über Wardenclyffe
Leserseite
Vorschau
Impressum
Schatten überWardenclyffe
(1. Teil)
von Oliver Fröhlich
Wenn Angst eine Gestalt hätte, wie sähe sie dann aus? Becky Sanders stellte sie sich als kleines, hässliches Biest vor. Mit riesigen, boshaften Augen. Mit Klauen, die sie in den Nacken ihres Opfers schlug, um sich daran festzuhalten und nicht mehr loszulassen, egal, wie sehr es sich schüttelte. Wahrscheinlich prangten Zähne in dem Maul. Scharfe Zähne, mit denen sie das Fleisch des Befallenen in blutigen Brocken herausriss.
Falls Angst so aussah, dann war das, was gerade in Becky Sanders Nacken saß, der große Bruder davon.
Sein Name lautete Panik.
You worship the sun
But you keep feeding the dark
(Amanda Palmer, Drowning In the Sound)
Becky drehte sich um. Nicht zum ersten Mal, seit sie den Heimweg von der Strandparty angetreten hatte. Wie die Male zuvor sah sie niemanden.
Und warum siehst du niemanden?, rief sie sich ins Gedächtnis. Weil da niemand ist, du dumme Ziege!
Es nützte nichts. Jemand verfolgte sie. Das fühlte sie. Das wusste sie. Dass sie niemanden sah, spiele keine Rolle. Genauso wie die Tatsache, dass es am Strand keine Versteckmöglichkeit für einen Verfolger gab.
Für einen eingebildeten Verfolger, Himmel noch mal. Was ist denn los mit dir?
Becky wusste es nicht.
Sie konnte sich nicht erinnern, in den zwanzig Jahren ihres Lebens jemals etwas Vergleichbares gespürt zu haben. Wieso auch? Sie war durchtrainiert, beherrschte mehrere Kampfsportarten und würde jedem, der ihr dumm kam, eine Lektion erteilen. Falls das alles nichts nützte, konnte sie locker weglaufen. Schließlich gewann sie regelmäßig die Shoreham Beach Challenges –und das, seit sie fünfzehn war. Warum also hatte die Angst am Tag zuvor ihre kalten Pranken um sie gelegt und seitdem nicht mehr losgelassen?
Becky hatte sich in Mindy's Hairforce One gerade eine Stiländerung gönnen wollen, weg von der wallenden Mähne, hin zu einer frechen Kurzhaarfrisur, als mitten im Schnitt aus keinem erkennbaren Anlass ihr Herzschlag beschleunigte. Die Kehle wurde ihr eng, und zwischen den Schulterblättern spürte sie ein intensives Ziehen. In diesem Augenblick wusste sie mit unerschütterlicher Sicherheit, dass sie nicht nur jemand beobachtete, sondern dass dieser Jemand sie umbringen wollte.
Wie eine Feuerwerksrakete explodierte Todesangst in ihr.
Noch während sie die Armlehnen des Friseurstuhls so fest umklammerte, dass die Fingerknöchel knackten, wurde ihr bewusst, wie albern diese Anwandlung war. Dennoch wuchs in ihr der kaum zu unterdrückende Impuls, aufzuspringen und davonzulaufen, weg von der unsichtbaren Gefahr.
Sie starrte in den Spiegel, sah ihre eigenen angstgeweiteten Augen, scannte mit hektischen Blicken den Frisiersalon. Beobachtete sie die Chefin Mindy nicht heimlich, während sie Shampoo- und Festigerfläschchen ins Regal sortierte? Oder dort an der Kasse, die alte Mildred Hopper, die sich alle zwei Wochen eine Betondauerwelle verpassen ließ. Glotzte sie nicht mit unverhohlener Neugier zu Becky herüber? Oder der Postbote, der der Aushilfe Linda gerade ein Paket überreichte und dabei unverschämt lachte, vermutlich über einen Witz auf Beckys Kosten.
Die Muskulatur in ihren Beinen spannte sich an, bereit zur Flucht. Erst als sich Becky der Absurdität bewusst wurde, dass sie gerade jeden Einzelnen im Salon verdächtigte, sie zu belauern und umbringen zu wollen, ließ das Gefühl der Bedrohung nach – aber nur für einen winzigen Augenblick.
Als Adele, Beckys Friseurin, den Langhaarschneider zur Seite legte und nach der Schere griff, drängten sich Becky Bilder davon auf, wie Adele ihr mit lautem Lachen die spitzen Klingen ins Ohr rammte, sie drehte, herauszog, wieder bis zum Anschlag hineinstieß, bis ins Gehirn, bis Blut spritzte, bis ...
Auf der obersten Ebene ihres Verstands wusste Becky, wie bizarr dieser Gedanke war. Viel tiefer jedoch, im Fundament ihres Unterbewusstseins, riss die Panik die Kontrolle an sich. Ohne es verhindern zu können, sprang Becky auf, stieß Adele zur Seite und rannte davon.
Sie wusste nicht, warum sie ausgerechnet zur Kundentoilette hetzte. Vielleicht weil ein Rest ihrer Vernunft den Ort auswählte, mit dem sie später ihr sonderbares Verhalten am plausibelsten erklären konnte.
Und tatsächlich, nachdem sich Becky für eine Viertelstunde in dem kleinen Raum eingeschlossen, dann auf Adeles besorgtes Klopfen und schließlich auf Mindys wiederholte Nachfrage beteuert hatte, dass es ihr gut ginge, legte sich der Panikanfall. Sie gönnte sich noch fünf weitere Minuten, spritzte sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht, kehrte zurück zum Frisierstuhl, den ihr Adele netterweise freigehalten hatte, und murmelte ein paar Brocken, denen man mit viel Phantasie hoffentlich »etwas Schlechtes gegessen« entnehmen konnte. Doch auch, wenn es ihr wieder besser ging, war die innere Unruhe nicht vollständig verschwunden.
Also ließ Becky den Rest des Haarschnitts mehr schlecht als recht über sich ergehen, gab ein selbst für die Umstände viel zu großzügiges Trinkgeld und rannte nach Hause, als wären die Chefin Mindy, die alte Mildred Hopper, der Postbote, Aushilfe Linda und Adele mit erhobener Schere allesamt hinter ihr her.
Am nächsten Tag, einem Freitag, meldete sie sich nach einer schlaflosen Nacht krank. Frank, ihr Boss und Inhaber von Long Island Pool & Garden, zeigte Verständnis, als Becky mit zittriger Stimme die Geschichte des verdorbenen Essens wiederholte. Vermutlich hatte er bereits von ihrem Aussetzer bei Mindy gehört. Die alte Mildred Hopper konnte der Verbreitung solcher Neuigkeiten selten widerstehen.
Frank wünschte ihr gute Besserung, aber die blieb aus. Im Gegenteil steigerte sich die innere Unruhe im Laufe des Tages zu einem schwer zu ertragenden körperlichen Missempfinden. Alle paar Minuten schien Beckys Herz zu stolpern. Ihr Magen krampfte sich zusammen, und Wellen von Nervosität schwappten über sie hinweg.
Sie tigerte von Fenster zu Fenster, um sich zu vergewissern, dass draußen auf der Straße oder zwischen den Bäumen niemand stand, der das Haus beobachtete. Das viel zu große Haus, in dem es immer wieder knackte und knarrte.
Ihre Eltern befanden sich auf einem mehrmonatigen Trip durch Europa. Rom, Paris, Barcelona und was sonst alles. Hatte sie sich anfangs über die sturmfreie Bude gefreut, verfluchte sie nun die bedrohliche Leere.
Becky verhedderte sich in einem Netz sich ständig wiederholender Gedanken. Sie überlegte, ob sie eine Freundin anrufen oder antexten sollte. Belinda zum Beispiel. Oder Nancy. Aber die würden sie nur auslachen. Richtig? Vielleicht gehörten sie ja sogar zu ... ja, zu was?
Bis Mittag schleppte sie sich dahin, versuchte vergeblich, das aushöhlende Gefühl zu ignorieren, doch bald wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen, als das Medizinschränkchen ihrer Mutter zu plündern und sich ein kräftiges Schlafmittel einzuwerfen.
Auf dem Sofa schlief sie durch bis in die Abendstunden. Traum- und angstlos.
Tatsächlich fühlte sie sich nach dem Erwachen zwar reichlich benommen von der chemischen Keule, mit der sie sich ausgeknockt hatte, aber immerhin hatte das Gedankenkarussell angehalten. Auch die Angst war zu einem fast unspürbaren Nagen abgeklungen.
Stattdessen hatte eine Rastlosigkeit von ihr Besitz ergriffen, die sie von der Couch aufspringen ließ und ihr diktierte, etwas zu unternehmen. Egal was, Hauptsache nicht still sitzen. Sie begann, die Küche zu putzen, was ihr angesichts der Tatsache, dass alle drei Tage eine Putzkraft das Haus auf Hochglanz brachte, rasch sinnlos erschien.
Also beschloss sie, zur Strandparty zu gehen. Es war zwar Winter, und die Temperatur hatte tagsüber gerade so die Zehn-Grad-Marke geknackt, aber vermutlich waren wie immer in diesen Monaten des Jahres Heizpilze aufgestellt. Ein paar Long Island Ice Teas schlürfen – denn wo schmeckten die besser als auf Long Island? –, mit den jungen Männern aus Shoreham tanzen und flirten, Hauptsache in Aktion sein und nicht nachdenken müssen.
Und tatsächlich funktionierte es.
Für etwa eine halbe Stunde.
Dann wurde ihr bewusst, dass sie sich inmitten von hundert oder mehr Menschen befand. Zwar hielten sich die wenigsten gerade auf der Tanzfläche auf, trotzdem erschien ihr die auf dem Sand errichtete Holzplattform plötzlich überfüllt. Von allen Seiten wurde sie angerempelt. Die eben noch lachenden Gesichter der Besucher verwandelten sich in Grimassen. Der eigentlich köstliche Geruch nach gegrillten Würstchen und Burgern wurde zu einem widerlichen Gestank. Die Musik dröhnte, die zuckenden Lichter schmerzten in den Augen, und die Schatten auf der Plattform wogten hin und her in einem scheinbar gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod.
Becky hielt es nicht länger aus. Sie stieß jemanden zur Seite, ohne sich zu entschuldigen oder auch nur darauf zu achten, um wen es sich handelte, sprang von der Tanzfläche und rannte los.
Nun blieben die Lichter und die Musik hinter ihr zurück, verkamen zu einer rasch verblassenden Erinnerung an einen Fiebertraum. Vor der Angst jedoch konnte sie nicht wegrennen.
Ihr Verstand sagte, dass niemand ihr folgte. Ihr Gefühl hingegen wusste, dass der Tod sie belauerte. Er hockte zwischen den Bäumen neben dem Strand. Oder er trieb im Nebel über dem Long Island Sound. Er grub sich unter ihr durch den Sand. Er klebte ihr an den Fersen. Er umgab sie, egal, wohin sie sich wandte.
Wieder nahm die Panik überhand. Das Gefühl von tausend lauernden Blicken rann ihr über den Nacken.
Zum wiederholten Mal schaute sie sich über die Schulter, sah aber niemanden.
Sicherheit gewann sie dadurch nicht. Im Gegenteil. Sähe sie einen Verfolger, wüsste sie wenigstens, mit wem sie es zu tun hatte.
Sie beschleunigte die Schritte. Erst verfiel sie in lockeren Trab, doch bereits nach wenigen Sekunden rannte sie, so schnell es der Sand unter ihren Füßen zuließ. Der Atem bildete Nebelwölkchen vor ihren Lippen.
Endlich erreichte sie den Abgang zur Sills Gully Road. Nach einem letzten ergebnislosen Blick nach hinten, spurtete sie die Straße entlang, an der nächsten Abzweigung auf die Briarcliff nach rechts und dann weiter und weiter und weiter, bis ihr die Lunge und die Füße brannten.
Sie durfte nicht anhalten. Nicht, wenn sie wusste, dass jemand hinter ihr war, egal, was ihre Augen behaupteten.
Sie wusste es!
Sie wusste-wusste-wusste es!
Links, rechts, weiter, ohne Pause, schneller, immer schneller, bis sie endlich das Haus ihrer Eltern im Mondschein sah.
Gleich hatte sie es geschafft. Gleich war sie daheim.
Doch obwohl sie ein selbst für ihre Verhältnisse rekordverdächtiges Tempo vorlegte, spürte Becky, wie sich die Gefahr näherte. Nicht mehr lange, und sie würde den kalten Atem der Bestie im Nacken fühlen. Oder eine Hand, die sie packte und zwischen die Bäume zerrte. Oder den Einschlag eines haarigen Leibs, der ihr in den Rücken sprang und ...
Sie erreichte die Haustür. Ihr Körper gierte danach, in Ruhe zu Atem zu kommen, aber Becky verweigerte ihm den Wunsch.
Keuchend und mit rasendem Herz fingerte sie in dem Handtäschchen nach dem Schlüssel. So groß war das Accessoire doch gar nicht, warum also fand sie ihn nicht?
Ein Knacken hinter ihr. Vielleicht nur eine streunende Katze, die von einem Ast gesprungen war. Vielleicht aber auch ...
Da! Der Schlüssel.
Sie zitterte ihn aus der Tasche, verfehlte dreimal das Schlüsselloch und beschimpfte sich für die fehlende Selbstkontrolle.
Wieder das Knacken. Näher diesmal. Oder?
Instinktiv drehte sie sich um. Stand dort auf der anderen Straßenseite im Garten der Woodleys nicht eine dunkle Gestalt? Neben dem Haus am Pool?
Ihr Herz setzte einen Schlag aus. Der Schlüssel entglitt ihrer Hand und klirrte auf den Boden.
Verdammt! Wie konnte man sich nur so dämlich anstellen wie die hilflosen, hysterischen Mädchen in irgendwelchen Horrorfilmen?
Vielleicht, weil du genau das bist? Hilflos und hysterisch.
Ohne die Gestalt im Garten der Woodleys aus den Augen zu lassen, ging sie in die Hocke und tastete nach dem Schlüssel. Der Kerl rührte sich nicht, beobachtete sie nur, kümmerte sich nicht darum, dass sie ihn entdeckt hatte. Der Kerl wartete darauf, dass sie den Blick abwandte, um in diesem Moment loszuspurten. Der Kerl ...
... war nur das Gestell mit dem Wasserschlauch, den Netzkäschern und anderen Reinigungsgeräten. Etwas, das Becky jeden Tag sah und das ihr nun, mitten in der Nacht, völlig grundlos Angst eingejagt hatte.
Und dennoch. Nur weil wer auch immer nicht im Garten der Woodleys stand, hieß das nicht zugleich, dass es ihn nicht gab. Schließlich konnte Becky seine Anwesenheit fühlen.
Sie hob den Schlüssel auf, rammte ihn ins Schloss und sperrte auf. Ein letzter Blick in die Nacht, dann huschte sie durch den Türspalt und drückte die Tür zu.
Schnell legte sie die Verriegelung um und hängte die Sicherheitskette ein.
Sie schaltete das Licht an, eilte von Fenster zu Fenster, vergewisserte sich, dass sie verriegelt waren, schloss die Vorhänge, durchsuchte sämtliche Zimmer nach Eindringlingen – und endlich fiel die Panik von ihr ab.
Es fühlte sich wie eine Befreiung an, als die zuletzt so eingeschüchterte Vernunft erst zaghaft, dann eindringlicher die Stimme erhob.
Etwas stimmt nicht mit dir, Becky, sagte sie. Vielleicht eine Störung in der Hirnchemie. Du wirst nicht verfolgt, sondern bist krank. Und was tut man, wenn man krank ist? Richtig. Man geht zum Arzt.
Sie nickte. Genau das würde sie tun. Gleich morgen früh. Auch wenn das ein Samstag war. Irgendeinen psychologischen Notdienst gab es bestimmt. Sie brauchte nur noch die Nacht zu überstehen. Aber das würde sie schaffen, und wenn sie ein weiteres Mal Moms Medizinschränkchen plündern musste.
Trotzdem ließ sie vorsichtshalber das Licht im gesamten Haus an.
Sie schlüpfte in ihren Pyjama und kroch ins Bett. Obwohl sie den Nachmittag verschlafen hatte, dämmerte sie selbst ohne chemische Unterstützung sofort weg und sank in einen wirren Traum: Sie nahm an der letzten Disziplin der Shoreham Beach Challenge teil, einem Fünf-Kilometer-Lauf am Strand. Schnell lag sie in Führung, wie sie es gewohnt war, doch nach und nach wurden ihre Beine schwer. Der automatisierte Bewegungsablauf bereitete ihr zunehmend Mühe. Ihre Gelenke und Sehnen schmerzten, die Muskeln brannten. Ein stetig größer werdendes Gewicht lastete auf ihren Schultern, bremste sie, verlangsamte ihre Schritte, machte sie zur Qual. Sie sank auf die Knie. Trotzdem durfte sie nicht aufgeben. Dort vorne, das Ziel, das Ende ihres Wegs, bald hatte sie es erreicht. Dennoch dauerte es eine Ewigkeit, beinahe ihr ganzes Leben, bis sie auf allen vieren entkräftet die Ziellinie fast schon berühren konnte – und kurz davor zusammenbrach.
Mit einem heiseren Keuchen schreckte sie aus dem Schlaf. Der Körperschmerz blieb, genauso die Kraftlosigkeit. Ihre Zunge fühlte sich an, als bestünde sie aus gedörrtem Holz. Der Mund war ausgetrocknet, als hätte sie zuletzt vor Jahrzehnten etwas getrunken.
Sie drehte sich zur Seite, achtete nicht auf den stechenden Schmerz in der Hüfte, und griff nach dem Wasserglas auf ihrem Nachtkästchen. In der Bewegung verharrte sie.
Ein eisiger Schrecken durchfuhr sie, als sie zwei Dinge erkannte. Erstens sah Becky ihre Hand nur verschwommen. Unscharf, als wäre sie über Nacht extrem kurzsichtig geworden. Was nicht völlig ausgeschlossen erschien, denn – zweitens – unscharf oder nicht, die Hand, auf die sie starrte, gehörte einer Neunzigjährigen. Verknöcherte Fingergelenke, runzelige, wächserne Haut voller Altersflecke.
Becky setzte sich auf und spürte erneut den Stich in der Hüfte. Heftiger diesmal. Er entrang ihr ein Ächzen.
Ein absonderlicher Gedanke durchzuckte sie.
Arthrose. Oder Rheuma. Oder Arthritis. Was auch immer der Unterschied sein mag.
Aber das war unmöglich. Sie war gerade mal zwanzig!
Sie schaute quer durchs Schlafzimmer zu dem Spiegelschrank. Das Gesicht, das ihr daraus entgegenstarrte, konnte sie wegen ihrer plötzlichen Kurzsichtigkeit nur undeutlich sehen. Wahrscheinlich war das besser so.
Allerdings sah sie ihre Haare, wenn auch nur als verwaschenen Fleck. Der reichte aus, um zu erkennen, dass sie zwar immer noch so kurz waren, wie Adele sie am Vortag geschnitten hatte, doch über Nacht waren sie schneeweiß geworden.
Wie erstarrt saß Becky im Bett und versuchte, das Unbegreifliche zu begreifen. Es gelang ihr nicht. Ihr Gehirn weigerte sich zu akzeptieren, dass sie sich in eine alte Frau verwandelt hatte.
Sie betastete ihr Gesicht und fühlte Falten und schlaffe Haut.
Und es war noch nicht vorbei, das verstand sie mit einem Mal. Das Leben rann aus ihrem Körper wie Wasser aus einem lecken Eimer.
Kraftlos sank sie zurück auf die Matratze.
Hinter ihr, durch das Schlafzimmerfenster, schickte die aufgehende Wintersonne ihre ersten Strahlen. Becky jedoch sah mit langsam erlöschendem Blick auf den Schatten, den sie im Sonnenlicht auf das Bettlaken warf. Lag es an ihren schlechten Augen, dass sie glaubte, er würde an den Rändern wabern und auf den Schatten zuwachsen, der sich als schmaler Streifen neben dem Kopfkissen abzeichnete?
Sie wusste es nicht. Und es kümmerte sie nicht.
Zwei Minuten später tat sie einen letzten röchelnden Atemzug, dann kümmerte sie überhaupt nichts mehr.
Château Montagne, zwei Tage später
»Ich weiß, du würdest am liebsten sterben«, sagte die Frau, und Zamorra stimmte ihr innerlich zu. Sein Herz raste, die Beine schmerzten und drohten jeden Augenblick einfach abzufallen. Aber egal, wie hinterhältig sie ihn anlächelte, er würde ihr den Triumph nicht gönnen. Nicht, dass sie von seinem Versagen überhaupt etwas mitbekäme.
»Das ging allen anderen vor dir an diesem Punkt genauso«, fuhr sie fort. »Und immerhin ist das ja auch Sinn der Sache, findest du nicht?«
Zamorra verstand nicht, wie ihre Stimme so ruhig klingen konnte. Hatte sie die Tortur der letzten fünfzig Minuten etwa nicht angestrengt? Warum rang sie kein bisschen nach Luft nach allem, was sie ihm angetan hatte?
»Ich! Werde! Nicht! Aufgeben!«, knurrte Zamorra. »Ich! Werde ...«
»Du willst aufgeben, richtig?«, fiel sie ihm ins Wort. Ihr Gesicht glänzte, Schweiß rann ihr über Stirn und Wangen, und trotzdem flackerte ihr Lächeln nicht mal für den Bruchteil einer Sekunde. Dieses freundliche, herzliche und deshalb umso hämischer wirkende Lächeln.
»Will ich nicht!«
»Wirst du aber müssen«, sagte eine Stimme neben ihm.
Zamorra zuckte zusammen. Er war so auf den Parcours auf dem Hometrainer im schlosseigenen Fitnessraum und die faszinierend unkaputtbare Trainerin auf dem Bildschirm konzentriert gewesen, dass er Nicole nicht hatte hereinkommen hören.
»Noch zehn Minuten, Nici«, ächzte er, »dann bin ich am Ende des Programms.«
»So wie du aussiehst«, sagte sie und lächelte dabei noch freundlicher als die Frau auf dem Monitor, »bist du längst am Ende. Du solltest dich schonen, du bist schließlich keine achtzig mehr.«
»Ja, ja. Ihr jungen Hühner unter siebzig denkt, ihr könnt mich wegen meines Alters verspotten. Nichts da! Den Rest des Programms stehe ich auch noch durch.« Er deutete auf den Bildschirm und die Frau mit der ruhigen Stimme. »Was soll denn sonst Hannah von mir denken?«
»Hannah also, ah ja. Dir ist schon klar, dass das nur eine Aufzeichnung ist, oder?«
»Es geht ums Prinzip.«