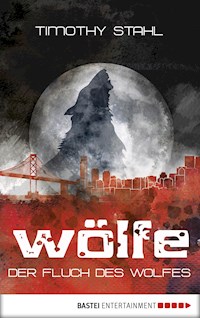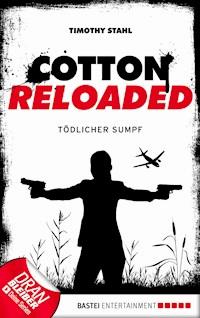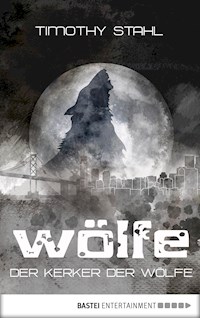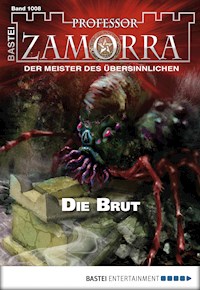
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Clément Neveu schreckte wie von einer Nadel gestochen aus dem Schlaf.
"Hast du das gehört?", fragte Lily. Seine Frau, offenbar genau wie er plötzlich wach geworden, hatte sich neben ihm im Bett aufgesetzt.
"Ja", flüsterte er. Genauso beunruhigt wie Lily lauschte Clément in die nachtstille Wohnung, ob sich das Geräusch wiederholte.
"Da!"
Lily sprang schon aus dem Bett. "Das war im Kinderzimmer!"
Clément brauchte ein, zwei Sekunden, um sich aus dem Laken zu befreien. Da war Lily bereits zur Tür hinaus, und als er selbst endlich in den dunklen Flur stürzte, stieß sie die Tür zum Kinderzimmer auf, um hineinzustürmen - und prallte zurück, als sei sie vor eine Wand gerannt.
Clément lief gegen Lily und sah dasselbe wie sie:
Eine dunkle Gestalt, die sich über die Wiege beugte und jetzt aufrichtete, das Kind von Lily und Clément in den Händen und wie eine Opfergabe erhoben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Die Brut
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Michael Lingg
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-8387-4898-6
www.bastei-entertainment.de
Die Brut
von Timothy Stahl
Clément Neveu schreckte wie von einer Nadel gestochen aus dem Schlaf.
»Hast du das gehört?«, fragte Lily. Seine Frau, offenbar genau wie er plötzlich wach geworden, hatte sich neben ihm im Bett aufgesetzt.
»Ja«, flüsterte er. Genauso beunruhigt wie Lily lauschte Clément in die nachtstille Wohnung, ob sich das Geräusch wiederholte.
»Da!«
Lily sprang schon aus dem Bett. »Das war im Kinderzimmer!«
Clément brauchte ein, zwei Sekunden, um sich aus dem Laken zu befreien. Da war Lily bereits zur Tür hinaus, und als er selbst endlich in den dunklen Flur stürzte, stieß sie schon die Tür zum Kinderzimmer auf, um hineinzustürmen – und prallte zurück, als sei sie vor eine Wand gerannt.
Clément schloss zu Lily auf und sah dasselbe wie sie: Eine dunkle Gestalt, die sich über die Wiege beugte und jetzt aufrichtete, das Kind von Lily und Clément in den Händen und wie eine Opfergabe erhoben …
Lily schrie, wie Clément sie – und noch keinen anderen Menschen – je hatte schreien hören: Tief und schmerzhaft schrill in einem, und vor allem laut. Dann stürzte sie ins Zimmer, dem Fremden entgegen, der ihr Kind aus der Wiege genommen hatte, um – ja, was?
Was hatte er mit ihrem Kind vor? Wollte er es entführen? Wozu?
In Cléments Kopf rasten die Gedanken, rangen miteinander.
Von ihnen war doch kein Lösegeld zu erpressen! Sie waren nicht reich, sie hätten keine Million aufbringen können, niemals. Aber vielleicht ging es um weniger, womöglich war dieser Einbrecher ein Junkie, der nur auf genug Geld für den nächsten Schuss aus war …
Irgendetwas fegte Cléments Überlegungen wie eine wütende Faust davon.
Dafür war jetzt keine Zeit!
Als Lily den Fremden fast erreicht hatte, setzte auch Clément sich sprunghaft wieder in Bewegung. Er schlug nach dem Lichtschalter neben der Tür, verfehlte ihn jedoch, sodass weiterhin nur das durch den Gardinenspalt hereinsickernde Licht einer Straßenlaterne für eine Ahnung von Helligkeit sorgte.
Lily sprang. Mit einem schier pantherartigen Satz warf sie sich auf die schemenhafte Gestalt, die noch nicht einmal eindeutig als Mann oder Frau zu identifizieren war. Gedrungen wirkte sie, geduckt, gerade so, als könne sie nicht wirklich aufrecht gehen.
Aber so ungelenk der Eindringling auch schien, wich er Lily doch mit affenartiger Gewandtheit aus, geriet damit allerdings – das Zimmer war nicht groß – in Cléments Nähe. Während Lily sich an der Wand abfing, schlug er nach der Gestalt und entlockte ihr – obwohl er nicht traf – ein Knurren, das dann doch verriet, dass der Fremde männlichen Geschlechts war.
Das Kind, das er fest an sich drückte – in Armen, die Clément im Dunkeln sonderbar lang vorkamen –, begann erstickt zu wimmern. Und Lily noch lauter zu schreien. Sie flog regelrecht heran, verkrallte sich einen Augenblick lang auf dem Rücken und im Nacken des Eindringlings. Sie grub ihm offenbar die Fingernägel tief in die Haut, denn auch er brüllte jetzt auf wie ein Tier, dann schleuderte er Lily mit einem Ruck über sich hinweg und gegen die Wand.
Ein Regal ging zu Bruch. Lily prallte mit den Trümmern lautstark zu Boden. Der bloße Anblick dieses Sturzes tat Clément vielleicht fast ebenso weh wie ihr, aber während er einen Moment lang wie gelähmt dastand, wirbelte Lily noch am Boden herum, schnellte wie ein Kastenteufel schon wieder hoch und warf sich aus dieser Bewegung heraus auf den klobigen Kerl mit ihrem Kind.
Der wich wieder aus, trotzdem erwischte Lily ihn noch mit der klauenhaft vorgestreckten Hand im Gesicht. Clément glaubte zu hören, wie ihre Nägel ihm die Wange aufrissen, und er selbst fühlte sich von etwas Nassem im Gesicht getroffen, das Blut oder Speichel des Fremden sein musste.
Lily verlor keine Sekunde. Sie fuhr herum und schwang die Fäuste mit einer solchen Wucht nach dem Fremden, als wären sie bleischwer und Lily fast übermenschlich stark.
Im herrschenden Dunkel vollzog sich der Kampf vor Cléments Augen wie ein irrer Schattentanz.
Lily, seine zarte, zierliche Lily! Die Angst um ihr Kind machte sie schier zum Tier. Wie eine Furie gebärdete sie sich. Clément schauderte, der Anblick von Lily in diesem Zustand blanker Raserei erregte ihn auf eine – in dieser Situation – völlig unpassende Weise. Was es auch war, das da in ihr geweckt worden war und sie vollkommen ergriffen hatte und steuerte – es …
… es wurde jetzt auch in ihm wach, loderte auf wie eine Stichflamme, die alles andere, alle Vorbehalte, alles Zögern und jede Schwäche verzehrte und nur Wut und Kraft übrig ließ.
Sie allein bestimmten nun, was Clément tat.
Dass er die Wiege gepackt und hochgerissen hatte, war ihm gar nicht bewusst geworden. Beinahe war ihm, als könnte er sich selbst dabei zuschauen, wie er mit dem Bettchen ausholte, um es mit aller Kraft dem Fremden über den Schädel zu schlagen.
Doch der Kerl schien auch im Hinterkopf Augen zu haben.
Er tauchte ab, die Wiege fuhr über ihn hinweg, entglitt Cléments Händen, flog aufs Fenster zu und raste in die Gardinen hinein. Glas splitterte, dann verschwand das kleine Bett durch die zerbrochene Scheibe und zerbarst drei Stockwerke tiefer auf der Straße. Der Wind erfasste die Gardinen und ließ sie vor dem Fenster flattern wie Fahnen, zwischen denen Clément weit im Hintergrund die nächtlich beleuchtete Kathedrale Notre Dame de Paris ausmachen konnte. Für einen Augenblick fiel etwas mehr Licht ins Zimmer, und er sah, dass der Mann einen schweren schwarzen Mantel zu tragen schien.
Mochte Cléments Attacke auch danebengegangen sein, so hatte sie den Eindringling doch für einen Moment abgelenkt. Diese Chance hatte Lily genutzt, um ihn von Neuem anzugehen – und es war ihr gelungen, ihr Kind zu packen!
Seine Beinchen wenigstens.
Mit einem Aufschrei warf sie sich nach hinten, um das Baby dem Kindsräuber ganz und gar zu entreißen.
Aber der ließ nicht los, hielt eisern fest, beide Arme um das Bündelchen Mensch geschlungen, das nun selbst brüllte, laut, durchdringend und grauenhaft. Kaum zu fassen, dass ein solcher Schrei seinen Ursprung in diesem kleinen Körper haben konnte.
Lily erwiderte ihn, wütend, angestrengt.
Der Fremde knurrte und ächzte.
Clément sprang Lily bei, packte mit zu, zog und zerrte mit der gleichen ungeheuren Kraft, über die sie beide unvermittelt verfügten.
Das Baby schrie noch lauter, durchdringender, jämmerlicher, herzerschütternder.
Vor Angst, vor Schmerz?
Vor Schmerz.
Denn im nächsten Augenblick … zerriss das Kind.
***
»Eine Kindesentführung … Gewissermaßen.«
Das war Inspektor Rousseaus Antwort gewesen, als Dr. Merci Bettencourt ihn gefragt hatte, worum es denn gehe bei dem Fall, zu dessen Tatort er sie in ihrer Eigenschaft als Polizeipsychologin zu kommen bat.
»Gewissermaßen?«, hatte sie nachgefragt.
Sie hatte das Kopfschütteln des jungen Inspektors durchs Telefon fast spüren können. »Das müssen Sie sich selber anschauen. Mir fehlen die Worte dafür! Kommen Sie?«
»Bien sûr.«
Durchaus neugierig war sie durchs nachmitternächtliche Paris ins 11. Arrondissement gefahren. Flackerndes Rot- und Blaulicht, das der dunstige Nieselregen über den Dächern weithin sichtbar widerspiegelte, hatte ihr den letzten Rest des Weges gewiesen. Sie war nach vierzig Jahren Globetrotting seit immerhin zehn Monaten zurück in Paris, aber jedes Sträßchen fand sie doch noch nicht auf Anhieb wieder.
Der Tatort – ein fünfstöckiger Altbau mit verzierter Fassade und hohen Fenstern – war mit Plastikband und quer auf Fahrbahn und Trottoir stehenden Einsatzfahrzeugen abgeriegelt, dazwischen ein paar Gendarmen, mittendrin ein Krankenwagen mit offenen Hecktüren, leer. Der Notarzt und die Sanitäter mochten noch im Haus sein.
Merci Bettencourt kannte einen der Flics vom Sehen, er ließ sie durch die Absperrung. Ein paar Schritte weiter blieb sie vor ein paar Trümmern, die mitten auf der Straße lagen, stehen. Weil das Kopfende mit einer der Kufen heil geblieben war, erkannte sie, dass es sich ursprünglich um eine Babywiege gehandelt haben musste. Außerdem lag vier, fünf Schritte weiter eine kleine Matratze auf dem nassen Kopfsteinpflaster.
Stumm fragend blickte Merci den Gendarmen an, doch der zuckte nur die Schultern.
Eine Kindesentführung. Gewissermaßen, echote Rousseaus Telefonstimme noch einmal durch ihren Kopf. Zwar konnte sie sich auf die Andeutung noch immer keinen Reim machen, aber …
»Doktor!«
Sie sah auf. Rousseau stand in der offenen Haustür und winkte ihr zu. Sie ging zu ihm. Der junge Inspektor, ein Schlaks mit dunklen Locken, war auffallend käsig um die markante Nase.
»So schlimm?«, fragte die Psychologin.
Rousseau schüttelte den Kopf. »Schlimmer. Kommen Sie.«
Im engen Treppenhaus war die Spurensicherung zugange. Vor einer Wohnungstür im ersten Stock sprach ein Uniformierter mit einer älteren Dame, die einen Morgenrock über dem Nachthemd trug.
»Wenn ich es Ihnen doch sage«, schnappte Merci im Vorübergehen auf. »Der Kerl hat sich bewegt wie ein Affe, ich hab es doch gesehen! Der ist die Treppe praktisch runtergehüpft und -geturnt und übers Geländer, so …« Mit dem Finger zeichnete die Frau eine Zickzacklinie in die Luft.
Merci warf, wie vorhin dem Flic draußen, Rousseau einen fragenden Blick zu; irgendjemand hatte einmal gesagt, ihre Augen könnten Fragen stellen, die man tatsächlich zu hören glaubte.
Der Inspektor, schon auf dem nächsten Treppenabsatz, winkte nur ab. »Das ist noch gar nichts. Sie werden gleich sehen, was ich meine.«
Als sie die Wohnung im dritten Stock betraten, roch Merci als erstes Erbrochenes, und dann sah sie die zugehörige Pfütze auf dem Teppichläufer im Korridor. Einer der Gendarmen, die sich in der Wohnung aufhielten, senkte verlegen die Augen.
»Ich kann’s Ihnen nicht verdenken, Kollege.« Der Inspektor legte dem Mann im Vorbeigehen eine Hand auf die Schulter.
Der säuerliche Gestank des Erbrochenen ging über in einen anderen, fauligen. Wie von einem verendeten Tier, das in einem muffigen Winkel verweste.
»Rousseau!«, zischte Merci ungeduldig. »Jetzt spucken Sie schon endlich aus, was hier …«
Sie fasste ihn am Arm und wollte ihn zurückhalten. Er trat zur Seite, damit sie in das Zimmer schauen konnte, auf dessen Tür er zugegangen war.
Das Wohnzimmer. Die Möbel waren teils umgekippt, teils zu Bruch gegangen. Nur das altmodische Sofa war heil geblieben. Darauf saßen …
Nein, unterbrach Merci sich in Gedanken.
…darauf kauerten eine Frau und ein Mann, wie zwei argwöhnische Raubtiere bereit, mit Klauen und Zähnen das zu verteidigen, was sie gemeinsam festhielten.
Und das brachte auch Merci Bettencourt fast zum Kotzen.
***
»Mon Dieu«, entfuhr es ihr. »Das ist ja …«
Es wollte ihr nicht über die Lippen, was das war.
Rousseau vollendete den Satz für sie: »… die Haut eines Kindes.«
Merci konnte lediglich nicken, und auch das nur mühsam.
Das Paar, das da mit irrem Blick und zu Fratzen verzerrten Gesichtern inmitten des verwüsteten Zimmers auf dem Sofa hockte, hielt die leere Haut eines Babys fest, und das so, als sei es noch ein ganzes Kind, das die beiden fest an sich drücken und unbedingt beschützen mussten.
Aber darin erschöpfte sich das Entsetzliche an diesem unfassbaren Bild noch nicht. Es bot nicht nur den grauenvollen Anblick einer zerschlissenen menschlichen Hülle, die vergilbt und stockfleckig war. Viel schrecklicher noch war, dass dieser … Balg nicht völlig tot zu sein schien.
Anstelle der Augen klafften in dem kleinen Gesicht, das schlaff wie nasses Leder war, nur noch schwarze Löcher, die eigentlich blind sein mussten, aus denen Merci sich aber trotzdem angestarrt fühlte, und …
Nein!, rief sie sich stumm zur Räson. Dieses Ding lebte nicht, und das nicht nur, weil es schlechterdings unmöglich war. Aber … etwas schien darin zu leben.
Etwas, das seinerseits die widernatürlichen Verbindungen zwischen der grässlichen Haut und den Eltern belebte!
»Habe ich zu viel versprochen?«, fragte Rousseau rau.
Jetzt brachte Merci nicht einmal mehr ein Kopfschütteln zustande. Ihr Blick wanderte wie tastend über das Geflecht dünner, knochenfarbener, kaum merklich pulsierender Wurzelgebilde, die von der Kindshaut ausgingen und ihre Spitzen in die Handrücken und Unterarme der Frau und des Mannes gebohrt hatten. Und unter dem leeren Babybalg wucherte – und das zusehends! – so etwas wie faseriger Schimmelflaum hervor, der sich und die ihn haltenden Hände in eine Art Kokon einzuspinnen begann.
Endlich gelang es Merci, ihren Blick loszureißen und auf Rousseau zu fixieren. Nur nicht mehr zum Sofa schauen!, mahnte sie sich.
»Was ist hier passiert?«, fragte sie. Es klang so energisch, als könnte es Rousseaus eigene Schuld sein.
Eigentlich rechnete sie damit, dass er sagen würde, er wüsste es nicht.
»Hier hat offensichtlich eine heftige Auseinandersetzung stattgefunden.« Der Inspektor wies in die Runde. »So wie in diesem Zimmer schaut es in der ganzen Wohnung aus. Und wie Sie sehen können, sind die Neveus verletzt.« Er deutete zum Sofa, aber Merci verkniff es sich, noch einmal hinzuschauen; ob der Mann und die Frau tatsächlich Verletzungen aufgewiesen hatten, wusste sie nicht – sie hatte nur Augen für das »Kind« gehabt.
»Nachbarn haben wegen des Lärmes die Polizei verständigt, aber als die Kollegen eintrafen, war schon alles vorbei«, fuhr Rousseau fort.
»Alles?«, hakte Merci nach. »Was meinen Sie damit?«
»Der Eindringling hatte sich bereits abgesetzt.«
»Aber es hat einen gegeben? Es handelte sich also nicht um einen Ehestreit oder dergleichen?«
Rousseau nickte. »Es ist jemand aus der Wohnung geflohen. Dafür gibt es Augenzeugen. Wir werden versuchen, Phantombilder anfertigen zu lassen, aber die Beschreibungen widersprechen sich jetzt schon so stark, dass ich da wenig Hoffnung habe.«
»Sie sprachen von einer Kindesentführung«, erinnerte Merci den Inspektor.
»In diesem Punkt sind sich die Zeugen einig – der Fliehende hatte ein Baby bei sich.«
»Tot oder lebendig?«
»Angeblich hat es noch geschrien.«
Merci schauderte und flüchtete sich dann vor den grausamen Bildern ihrer Einbildungskraft in eine weitere Frage.
»Warum haben Sie mich eigentlich hergebeten?«
Rousseau wies wieder zum Sofa, zu dem Paar und ihrem … Merci musste den kaum bezwungenen Brechreiz von Neuem niederkämpfen.
»Die Neveus sind praktisch nicht ansprechbar. Den Notarzt und die Sanitäter haben sie angegriffen, als sie sich ihnen nähern wollten. Den Doktor hat die Frau sogar gebissen. Ich dachte, Sie könnten vielleicht versuchen, die beiden …« Rousseau zuckte linkisch mit den Schultern.
»Sie zur Vernunft zu bringen, meinen Sie?«
»Nun … ja.«
Die Psychologin seufzte. »Ich bezweifle, dass mir das gelingen wird. Ich habe zwar keine Ahnung, was hier passiert ist und …«, jetzt fiel ihr Blick doch wieder auf den furchtbaren Balg und das, was er tat, »… noch vor sich geht, aber mit Vernunft und gut gemeinten Worten kommen wir hier vermutlich nicht weiter.«
Sie drehte sich ganz um. Da eine schnelle Lösung der Problematik nicht in Aussicht stand, tat sie wohl besser daran, sich an den schrecklichen Anblick des Ehepaars und seines … Anhängsels zu gewöhnen.
Sie trat einen Schritt ins Wohnzimmer hinein. Unter ihren Sohlen knirschten die Scherben eines von der Wand gefallenen und auf dem Parkett zerbrochenen Bilderrahmens. Sie bückte sich und hob das Foto, das darin gesteckt hatte, vom Boden auf.
»Irgendeine Idee, was wir tun könnten?«, fragte der junge Inspektor hinter ihr.
»Nein.« Merci drehte das Bild in den Händen. »Oder doch …«
Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit tauchte ein alter Studienkollege aus ihrer Erinnerung auf …
***
Die HÖLLE war neu ersonnen und geträumt. Im Gegensatz zum ersten Mal ließ LUZIFER der Entwicklung der Schwefelklüfte aber nur wenige Freiheiten. Er begann sie nach Gutdünken zu formen – und sah danach, dass nicht alles gut war im Sinne des Bösen. In seinem Sinne …
Darum entfernte LUZIFER aus dem Gewirk seiner Ideen all jene, die ihm nicht mehr gefielen oder unvollkommen schienen und irgendwann, morgen oder in Äonen, das Gesamte gefährden könnten.
So verwarf er einzelne Wesen und ganze Völker. Doch nicht alle ließ er gleich dem Vergessen anheimfallen …
Jede Kreation, die vielleicht noch zu gebrauchen sein mochte, legte er einstweilen nur ab in einer beiläufig erdachten Zwischenwelt, die er im Konstrukt seiner Gedanken mit einem X markierte.
Ihren Bewohnern jedoch, die sich der potenziellen Flüchtigkeit dieser Welt nicht bewusst waren, prägte sich die Markierung als Name ein:
Sie nannten ihre Heimat Yyx.
***
»Zamorra?«
»Merci!«
»Du hast dich nicht nur kaum, sondern gar nicht verändert«, sagte sie, während sie lächelnd und verblüfft den Kopf schüttelnd hinter ihrem Schreibtisch hervorkam.
Professor Zamorra erwiderte das Lächeln seiner ehemaligen Kommilitonin, mit der er seinerzeit an der Sorbonne studiert und an die er, wie er sich zu seiner eigenen Verwunderung eingestehen musste, seitdem praktisch nicht mehr gedacht hatte.
»Du aber auch nicht«, erwiderte er ihr Kompliment, ohne allzu sehr zu flunkern. Tatsächlich hatte er Merci Bettencourt auf Anhieb wiedererkannt. Damals wie heute erinnerte sie ihn an Catherine Deneuve – damals an die junge Senkrechtstarterin, heute an die Grande Dame der französischen Schauspielkunst.
»Alter Schmeichler«, sagte sie und küsste ihn auf die Wange. »Ich lasse dich, wenn wir hier fertig sind, nicht eher wieder weg, bis du mir dein Geheimnis der augenscheinlich ewigen Jugend verraten hast.«
Zamorra grinste schief und zwinkerte ihr zu. »Das würdest du mir sowieso nicht glauben.« Und das war nicht geflunkert. Bestenfalls würde sie ihn für einen Spinner halten, hätte er ihr erzählt, dass er von der Quelle des Lebens getrunken hatte und seitdem relativ unsterblich war, sprich, nicht mehr alterte; schlimmstenfalls hätte sie ihn wohl kraft ihres Amtes als Psychologin der Pariser Kriminalpolizei in die Klapsmühle einweisen lassen.
»Das werden wir ja sehen.« Merci wandte sich an Zamorras Begleiterin. »Mademoiselle Duval?«
»Nicole Duval, ja.« Sie gaben sich die Hand. »Sehr erfreut, Doktor Bettencourt.«
»Ganz meinerseits. Und sagen Sie doch bitte auch Merci.«
»Gerne. Wenn Sie mich Nicole nennen.«
Zamorra schob der sich anbahnenden Plauderei einen Riegel vor. »Wir sollten uns vielleicht besser gleich um deine … Patienten kümmern, Merci. Du hast die Sache am Telefon sehr dringend gemacht, und wir sind so schnell wie möglich gekommen. Nach allem, was du mir erzählt hast, könnte es durchaus auf jede Minute ankommen.«
»Natürlich, du hast recht.«