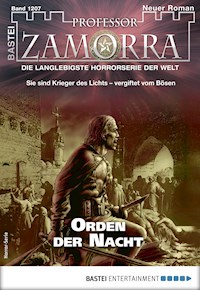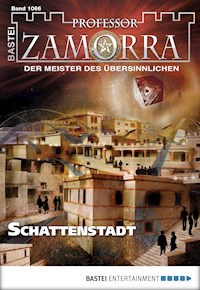
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dylan McMour ist nach seinem seltsamen Autounfall wieder gesund - und kann nun endlich mit seiner großen Liebe Nadja in das gemeinsam gekaufte Haus in Edinburgh einziehen. Doch damit sind die Probleme, die überhaupt erst zu dem Unfall führten, noch lange nicht vorbei. Und was hat es überhaupt mit der Miniaturerde auf sich, die sich immer noch im Château Montagne befindet? Wieder einmal macht Zamorra sich auf, das Geheimnis der rätselhaften Mini-Erde in seinem Schloss zu lösen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Schattenstadt
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Michael Lingg
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-1004-7
www.bastei-entertainment.de
Schattenstadt
von Adrian Doyle
Sie konnte es fühlen, etwas hatte sich verändert.SeineNähe,seinePräsenz hatten sich verändert.
Innerhalb weniger Augenblicke verdoppelte sich Nadja Bulkis’ Puls- und Atemfrequenz. Mit krampfhaft geschlossenen Lidern – als hätte sie Angst zu sehen, was um sie herum vor sich ging – schickte sie ihre Hand auf Wanderschaft, hinüber zu ihrem Verlobten. Ihr sechster Sinn prophezeite ihr aus noch unerfindlichen Gründen, dass seine Seite des Bettes verlassen sein würde. Und dass es dafürkeineharmlose Erklärung gab.
Aber sie irrte sich. Ihre Finger fanden und berührten Dylan McMour, und für einen Moment war sie maßlos erleichtert – bis sie den »Fehler« beging, doch noch die Augen zu öffnen …
Der vor gut zweieinhalb Monaten beendet geglaubte Albtraum hatte sie offenkundig wieder eingeholt: Lautlos schwebte die magische Kugel, die Dylan schon einmal heimgesucht hatte, knapp einen daumenbreit über seiner Stirn; ihr düsterer Glanz meißelte das Gesicht des Schotten gespenstisch aus der Dunkelheit.
Nadja Bulkis spürte, wie ihr die Kehle eng wurde. Nur mit Mühe gelang es ihr, den Angstschrei, der aus ihr heraus drängte, in einen Ruf umzumünzen.
»Dylan!«
Gleichzeitig dachte sie: Verdammt, verdammt, verdammt! Fängt das schon wieder an?
Ihr mehr als achthundertjähriger, ewig jugendlicher Verlobter reagierte nicht. Er sah fast genauso überwältigt aus wie damals, als die tennisballgroße, stilisierte magische Erdkugel zum ersten Mal über ihm geschwebt hatte – und kurz darauf sogar in seinen Kopf gesunken war, als wäre sie nicht stofflich, sondern eine bloße optische Täuschung. Die ihr anhaftende Magie hatte geschafft, was nichts und niemand zuvor vermocht hatte (auch, weil niemand geahnt hatte, dass sich in Dylans Kopf ein Geheimnis von kaum überschaubarer Tragweite verbarg): Sie hatte Erinnerungen freigesetzt, die über Jahrzehnte hinweg nicht mehr abrufbar für Dylan gewesen waren; Erinnerungen an einen Kampf um Leben und Tod, der im fernen Jahr 1894 in einer deutschen Großstadt stattgefunden hatte und von weitreichender Konsequenz für den Schotten, aber auch für den Rest der Welt, gewesen war.
Nadja erzitterte immer noch jedes Mal aufs Neue, wenn sie sich vergegenwärtigte, wen Dylan seinerzeit gegen eine dämonische Macht verteidigt hatte, über die auch heute noch nicht viel verbürgtes Wissen existierte.
Albert Einstein – den jungen Albert Einstein – hat er vor den Schatten gerettet. Einen Knaben von gerade einmal fünfzehn Jahren, der seine Genialität nie unter Beweis hätte stellen können, wenn Dylan ihn nicht damals vor dem Tod oder einem Schicksal, das noch schlimmer als der Tod wäre, bewahrt hätte!
Hier und heute im Jahr 2015 ahnte nur eine Handvoll Leute, dass die Gegenwart völlig anders hätte aussehen können, wäre Dylan knapp 130 Jahre zuvor nicht eingeschritten. Ohne Einsteins Geistesblitze und weltveränderndes physikalisches Verständnis hätte es so manche technische Errungenschaft entweder nie oder erst verspätet gegeben. Nadja hatte versucht, sich eine Welt ohne Albert Einsteins Einflüsse vorzustellen, war aber grandios gescheitert. Ihre Fantasie reichte bei Weitem nicht aus, um eine solche Kulisse zu entwerfen.
Was sie aber sicher wusste, war, dass ihre große Liebe einen hohen persönlichen Preis für ihre beispiellose Rettungstat hatte zahlen müssen. Der Kampf gegen die Schatten, die dem jungen Albert in der Fabrik seines Vaters Hermann und seines Onkels Jacob Einstein aufgelauert hatten, brachte Dylan an den Rand des eigenen Untergangs – und das, obwohl (oder vielleicht auch gerade weil) er magische Waffen besessen hatte, die ihn zu einem ernst zu nehmenden Gegner machten. Aber bis auf den Feuer- und den Schattenreif hatten alle anderen Mittel versagt. Und die Wirkung der beiden Reife hatte schließlich nicht nur die Schattenangreifer, sondern auch Dylan selbst überrascht: Ihre Macht hatte sich mit einer in keiner Weise mehr kontrollierbaren Gewalt gegen die Schatten entladen – vielleicht nur noch vergleichbar mit dem Aufeinandertreffen von Materie und Antimaterie. Wie Albert Einstein aus diesem magischen Inferno unbeschadet hatte hervorgehen können, war Nadja nach wie vor ein Rätsel. Aber die Geschichte dokumentierte genau dies mehr als eindrucksvoll – während sie wohl für alle Zeiten beharrlich verschweigen würde, wessen Einsatz all dies zu verdanken war.
Dylan selbst war nicht so glimpflich davongekommen wie der Knabe, aus dem ein Jahrtausend-Genie erwachsen sollte – aber immer noch glimpflicher als offenbar die Schattenkreaturen, die Albert nach dem Leben getrachtet hatten.
All das huschte im Bruchteil eines Augenblicks noch einmal vor Nadjas geistigem Auge vorbei.
Erneut schrie sie Dylans Namen.
Erneut erfolgte nicht die kleinste merkliche Reaktion, auch nicht darauf, dass sie ihn an den Schultern schüttelte, ihm Ohrfeigen verpasste, mit ihren Fäusten auf seinen Brustkorb trommelte.
Als all dies nicht fruchtete, wusste sie sich schließlich nicht mehr anders zu helfen, als mit ihrer Hand nach der schwebenden Kugel zu schnappen, auszuholen …
… und das schreckliche Ding gegen die Zimmerwand zu schmettern.
Was immer sie damit hatte ausrichten wollen, wurde von dem, was tatsächlich geschah, um Längen übertroffen: Eine lautlose Woge überschwemmte den Raum mit einer Flut von Impressionen, denen sich Nadja schon nach wenigen Augenblicken nicht mehr gewachsen sah. Die Ohnmacht, in die sie stürzte, war ihr Glück – sie verhinderte nicht weniger als das Ausbrennen ihres Gehirns …
***
Ihm war kalt.
Gletscherkalt.
Dylan atmete flach, als könnte jedes Luftholen seine Lungen sprengen. Der Frost drang in jede Zelle seines Körpers, in jeden Winkel seines Denkens.
Verzweifelt versuchte er, die Klauen des lähmenden Schlafs abzustreifen, der ihn mit einer Macht umklammerte, als wollte er ihn niemals wieder freigeben. Der unsterbliche Schotte erinnerte sich an keinen Traum oder irgendein Ereignis außerhalb seines Körpers, das diesen absurden Prozess, in dem er sich wiederfand, in Gang gesetzt haben könnte.
Ich bin wach. Ich könnte schwören, wach zu sein. Aber warum schaffe ich es dann nicht, das zu tun, was ich sonst bei vollem Bewusstsein zu tun vermag?
Einen Moment lang hegte er sogar den Verdacht, gar nicht mehr neben Nadja zu liegen, im Schlafzimmer jenes Hauses, das sie unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Frankreich in Danderhall möbliert bezogen hatten. Danderhall war der Edinburgher Stadtteil, wo sich auch die Privatschule befand, an der Nadja eine Stelle als Lehrerin angetreten hatte. Nadja, die er in Gedanken immer noch manchmal Harriet nannte, weil Harriet … Es war, als würde sich ein Vorhang heben.
In einem Moment war Dylan noch wie in Schwärze einzementiert gewesen, im nächsten stand er in strahlendem Sonnenschein im Freien, an einem Ort, den er noch niemals zuvor gesehen hatte.
Verrückt. Das … kann nicht wirklich sein. Das muss ich träumen!
Während er sich um seine eigene Achse drehte und Einzelheiten der traumhaften Umgebung in sich aufnahm, versuchte er erneut, sich ein Vorkommnis in Erinnerung zu rufen, das vor dem Zubettgehen darauf hingedeutet hätte, dass diese Nacht anders verlaufen würde als all die Nächte davor seit ihrem Einzug.
Wieder scheiterte er.
Es hatte keinen außergewöhnlichen Vorfall gegeben, nur den Austausch von Zärtlichkeiten, wie sie für zwei Liebende, die sich allein in ihren eigenen vier Wänden aufhielten, normal waren. Dylan genoss Harriets Nähe wie am ersten Tag.
(Nadja! Du musst aufhören, sie wie deine tote Liebe zu nennen, auch wenn du für dich selbst meinst, es mache keinen Unterschied! Noch verzeiht sie dir diesbezügliche Ausrutscher, aber das wird nicht ewig so bleiben.)
Er war eingeschlafen, seiner Erinnerung nach noch vor ihr – sie hatte am Rande seiner Wahrnehmung noch leise gesprochen, als er schon am Hinüberdämmern gewesen war –, und dann … dann …
… war dieser Traum gekommen.
Von dem er innerlich immer noch abstritt, dass es sich um einen Traum handelte. So seltsam träumte niemand, nicht einmal er. Die Sonnenstrahlen, die auf seine Haut fielen, wärmten wie reale Sonnenstrahlen, vertrieben die Eiseskälte, die immer noch tief in seinen Knochen zu stecken schien.
Er blickte an sich herab – und war noch irritierter als zuvor. Die Kleidung, die er trug, entsprach nichts, was er jemals tatsächlich getragen hatte. Nicht in mehr als achthundert Lebensjahren, in denen er bis auf die Antarktis alle Kontinente der Erde bereist und sich in den unterschiedlichsten Kulturen getummelt hatte. Als neugieriger, erlebnishungriger Mensch hatte er es nach seinem Sturz in die graue Vergangenheit nie lange an einem Platz ausgehalten. Sein Wissen um die – oft nur ungefähren, aber das hatte ihn nicht abhalten können – Orte und Zeiten, da auf der Welt Weltbewegendes geschehen war (Zeitreisende waren diesbezüglich klar im Vorteil), hatte ihn von einem Kontinent zum anderen gepeitscht. Allerdings hatte er sich oft in Geduld üben müssen, weil es auch schon einmal vorgekommen war, dass er sich gerne Amerika angesehen hätte, als Amerika noch gar nicht entdeckt gewesen war; jedenfalls nicht von einer Seemacht, die es ihm ermöglicht hätte, anzuheuern und mit einem ihrer Schiffe auf große Fahrt zu gehen. Eine seiner grandiosesten Erinnerungen drehte sich um die Expedition, an der er 1492 teilgenommen hatte. Auch wenn er es nicht auf die Santa Maria eines gewissen Cristóbal Colón – in der Gegenwart besser bekannt als Christoph Kolumbus – geschafft hatte, so war er immerhin auf der Pinta, einer der beiden Begleit-Karavellen, untergekommen.
Ein unvergessliches Erlebnis. Dem weitere vorangegangen oder gefolgt waren.
Wer außer mir kann schon behaupten, mit Leonarda da Vinci getafelt und über die allgegenwärtige Gefahr, die Dämonen verbreiten, diskutiert zu haben? Wer außer mir dümpelte wohl 1883 mit einem Dampfschiff in Sichtweite des Krakatau, als dieser mit der Wucht von 1000 Tonnen TNT explodierte und die Vulkaninsel fast vollständig zerstörte?
Bis heute konnte er, wenn er die Augen schloss, die pyroklastischen Ströme sehen, die über das Meer gerast waren. Es war ein Spiel mit dem Feuer gewesen, das jeder Logik entbehrte, sogar jedem natürlichen Überlebensinstinkt spottete, dennoch hatte Dylan das Gefühl gehabt, es tun zu müssen. Diesem und anderen einschneidenden Ereignissen beiwohnen zu müssen. Wer noch außer ihm hatte die Gelegenheit, mit dem Wissen der Zukunft die Pfade der Vergangenheit zu bereisen?
Lange vor seinem Sturz ins 13. Jahrhundert hatte er bezüglich des Krakatau-Ausbruchs in einem Bericht gelesen, dass Zeitzeugen vom lautesten Geräusch seit Menschengedenken sprachen. Er hatte die Eruption der Magmakammer nicht nur aus hoffentlich sicherer Entfernung beobachten, sondern auch den Lärm hören wollen, der dabei entstand.
Auch das ein Erlebnis, das bis heute in ihm nachwirkte.
Nachhallte.
Und jetzt? Wo bin ich jetzt? Hat mich am Ende ein zweiter Zeitsturz erfasst? Wurde ich erneut in tiefste Vergangenheit gewirbelt? Aber wohin genau? Und … warum?
Er merkte, wie die Gletscherkälte, aller äußeren Wärme zum Trotz, wieder Besitz von ihm ergreifen wollte. Wogegen er sich aber mit Vehemenz wehrte. Und gleichzeitig überlegte, welches Ereignis eine nochmalige unfreiwillige Zeitreise ausgelöst haben könnte.
Er fand keine Antwort darauf und flüchtete sich in die Überzeugung, dass hier andere Kräfte im Spiel waren. Keine temporären Verstrickungen, sondern …
Von einem Augenblick zum anderen stand Dylan nicht mehr allein zwischen all den Gebäuden, die an eine antike Kultur erinnerten. Da waren Menschen, massenhaft Menschen! Ihre Kleidung sah aus wie der Stoff, der Dylans eigenen Leib umschlang, locker über der Schulter verknotet und bis knapp unter die Knie fallend. Die Füße steckten in Sandalen. Der Teint der Menschen war bronzefarben, das Haar hell, fast weiß, die Gesichtszüge schmal und markant. Den Gestalten, die Dylan um sich herum gewahrte, haftete ausnahmslos etwas Künstlerisches, beinahe schon Versponnenes an. Gleichzeitig meldete sich eine Stimme in ihm zu Wort, die leise Zweifel daran anmeldete, es tatsächlich mit Menschen zu tun zu haben. Was er um sich herum entdeckte, waren die Klischees von Menschen, etwas, was die eigene Fantasie sich unter bestimmten Umständen zusammenreimen mochte.
Aber auch das, erkannte Dylan, war nur eine Vermutung; der Versuch, sich selbst gegenüber den Anschein zu wahren, dass er nicht so leicht zu täuschen sei.
Wem mache ich etwas vor? Alles hier ist Täuschung – meine eigene Anwesenheit in diesem Szenario inbegriffen!
Er war nun doch bereit, hinzunehmen, dass er träumte. Es konnte nur so sein. Warum hätte er erneut in die Vergangenheit geschleudert werden sollen – und selbst wenn tatsächlich, wie hätte er dann gleich passend für die Epoche – wann und wo immer es war – gekleidet sein sollen?
So etwas funktioniert nur über Einbildungskraft. Aber wann hört das auf? Wie kann ich mein Erwachen erzwingen?
In üblichen Träumen genügte es meist, sich darüber klar zu werden, dass man träumte – und schon kehrte man ins Bewusstsein zurück.
Hier schienen andere Gesetzmäßigkeiten zu gelten, sonst hätte die Kulisse längst weichen müssen.
Dylan entschied sich, die Sache, soweit es in seinen Kräften stand, zu forcieren. Beherzt steuerte er eine kleinere Gruppe von Männern und Frauen an, deren Kleidungsstil geschlechterübergreifend identisch zu sein schien.
»Kacke!«, blaffte er sie an. »Hat einer von euch auch nur den Hauch einer Ahnung, wie ich hierher komme – und was ich hier soll?«
Ihr verdutztes Starren legte den Verdacht nahe, dass sie seiner Sprache nicht mächtig waren, obwohl das in Träumen nicht unbedingt ein Problem darstellte.
»Schon gut, schon gut.« Er wollte die Gruppe stehen lassen und weitergehen, als eine der Frauen mit klangvoller Stimme sagte: »Du warst schon immer ein Sonderling, Narvesh. Aber es sei dir verziehen, denn du und ich, wir alle, wissen, dass deine physischen Stunden dem Ende entgegen gehen. Du bist ein Auserwählter wie wir. Und ein jeder geht damit auf seine Weise um. Wenn du dir darin gefällst, den Narren zu mimen – nur zu. Du weißt, im Letztatem ist alles erlaubt. Aber vielleicht gäbe es Sinnvolleres zu tun und zu genießen. Willst du dich meiner Führung überlassen?« Sie streckte die Hand nach ihm aus.
Dylan zögerte, aber dann schien sich ein Teil seines Körpers zu verselbstständigen, und er griff nach ihren Finger, verflocht die Seinen damit, als hätte er nie etwas anderes getan. Ihre Wärme strömte in seine Kühle, und ohne dass er es verhindern konnte (wollte?), erwachte ein unrechtes Verlangen in ihm.
Harriet! Nein …!
Wer war Harriet? Er war … Narvesh. Und bei ihm war Elja, die er begehrte, solange er denken konnte.
Sie zog ihn mit sich, von den anderen fort in die Schatten eines der Gebäude, die für alle Erwählten zur Verfügung standen. Es gab zahllose Rückzugsgebiete darin. Den Letztatmern wurde der Abschied von dem, was sie kannten, versüßt, wo immer es ging.
Es schien Narvesh so, als ginge Elja den Weg, den sie ihn entlang einiger Korridore führte, nicht zum ersten Mal, so sicher lotste sie ihn. Aber er stellte keine Fragen. Er versuchte, ganz im Sein zu atmen und zu denken. Schließlich sanken sie nebeneinander auf ein Lager aus blühendem Nachtgras, das seine volle Pracht nur im Dunkeln entfaltete und dabei selbst in allen Farben des Regenbogens leuchtete. Die von den Grasblüten freigesetzten Düfte legten sich wie ein betörender Schleier um die beiden Auserwählten, die sich gegenseitig aus den Roben schälten und dann dem hingaben, was ihre Herzen, mehr noch aber ihre Triebe, einforderten.
Narvesh verfiel einer Ekstase, die ihn alles um sich herum vergessen ließ. Und auch Elja schien die Vereinigung zu genießen. Jedenfalls, bis sie ihn unvermittelt und grob von sich stieß und mit flammenden Augen von ihm lossagte.
»Was … was hast du?«, stammelte er, noch überwältigt von dem, was sie ihm geschenkt hatte.
»Warum nennst du mich Harriet?«
»Harriet?« Er sah sie verständnislos an.
»So hast du mich genannt, während wir …«
»Du musst dich irren. Ich kenne niemanden, der so hieße. Es ist nicht einmal ein richtiger Name, das weißt du selbst.«
Aber sie hatte sich schon erhoben und streifte sich ihre Robe über. Die Sandalen fischte sie, als gelte es, ja keine Zeit zu verlieren, einfach vom Boden und hetzte dann, ohne sie anzuziehen, aus dem Raum.
Narvesh rief ihr hinterher, aber sie erhörte ihn nicht. Er vernahm nur, wie sich ihre Schritte entfernten – nackte Füße auf nacktem Steinboden –, bis schließlich nur die Stille und er in dem wundervoll duftenden Raum zurückblieben.
***
Château Montagne
Das Gewölbe mit den Regenbogenblumen erweckte stets den Eindruck, aus Raum und Zeit herausgelöst zu sein. Wann immer Zamorra den Weg über die abgewetzten Steinstufen nach unten fand, quasi in die Eingeweide des Schlosses eintauchte, überkam ihn dieses wohlige Gefühl von Beständigkeit, das er in keinem anderen Raum, keiner anderen Örtlichkeit des alten Gemäuers so stark empfand wie eben hier. Vielleicht war es auch die pure Exotik, die sich in dieser Sektion des Kellers in mehrerlei Hinsicht manifestiert hatte und ihm solches Behagen bereitete. Angefangen bei der Kunstsonne hoch im »Zenit« des Gewölbes, deren Licht und Wärme die Grundlage für ein Gedeihen der fantastischen Blumen bildete, von denen eine ganze Kolonie im Schlosskeller angesiedelt war. Die Regenbogenblumen verkörperten eine einzigartige Mischung aus purer Schönheit und märchenhaften Möglichkeiten. Zamorra vermochte die Male nicht mehr zu zählen, in denen die magischen Gewächse ihn gedankenschnell zu Einsatzorten gebracht hatten, die er auf konventionelle Weise nie noch rechtzeitig hätte erreichen können.