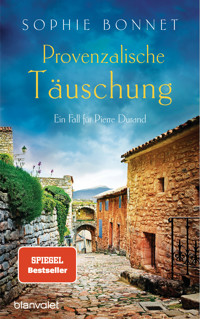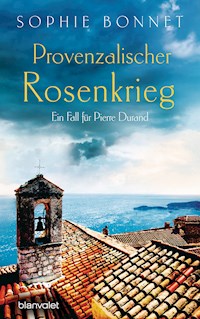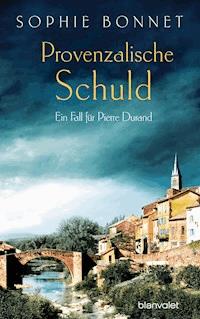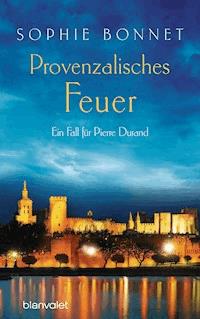14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Pierre-Durand-Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Türkisfarbenes Wasser, einsame Sandstrände und ein vergifteter Taucher – der 10. Fall für den liebenswerten Ermittler Pierre Durand!
Es ist Mai in Südfrankreich. Pierre Durand und seine frisch angetraute Frau Charlotte erfreuen sich an den weiten Sandstränden der Côte Varoise, wo sie ihre Flitterwochen verbringen. Doch als Pierre eines Morgens einen verunglückten Taucher entdeckt, ist es vorbei mit der Idylle. Die Polizei geht von einem Kreislaufversagen aus, der Notarzt allerdings hat Zweifel. Pierre verdrängt die Bedenken, er will Charlotte zuliebe den Urlaub nicht gefährden. Aber dann verschwindet der Arzt spurlos. Pierre beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Er stößt auf weitere seltsame Vorfälle, die mit dem Bau einer Wasser-Pipeline zu tun haben. Seine Flitterwochen scheinen endgültig ruiniert – bis Pierre unerwartete Unterstützung erhält …
»Niemand verbindet Genuss und Verbrechen so harmonisch wie Sophie Bonnet in ihren Provence-Krimis.« Hamburger Morgenpost
Lesen Sie auch weitere Romane der hoch spannenden »Pierre Durand«-Reihe!
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Ähnliche
Buch
Es ist Mai in Südfrankreich. Pierre Durand und seine frisch angetraute Frau Charlotte erfreuen sich an den weiten Sandstränden der Côte Varoise, wo sie ihre Flitterwochen verbringen. Doch als Pierre eines Morgens einen verunglückten Taucher entdeckt, ist es vorbei mit der Idylle. Die Polizei geht von einem Kreislaufversagen aus, der Notarzt allerdings hat Zweifel. Pierre verdrängt die Bedenken, er will Charlotte zuliebe den Urlaub nicht gefährden. Aber dann verschwindet der Arzt spurlos. Pierre beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Er stößt auf weitere seltsame Vorfälle, die mit dem Bau einer Wasser-Pipeline zu tun haben. Seine Flitterwochen scheinen endgültig ruiniert – bis Pierre unerwartete Unterstützung erhält …
Autorin
Sophie Bonnet ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Mit ihrem Frankreich-Krimi »Provenzalische Verwicklungen« begann sie eine Reihe, in die sie sowohl ihre Liebe zur Provence als auch ihre Leidenschaft für die französische Küche einbezieht. Mit Erfolg: Der Roman begeisterte Leser wie Presse auf Anhieb und stand monatelang auf der Bestsellerliste, ebenso wie die darauffolgenden Romane um den liebenswerten provenzalischen Ermittler Pierre Durand. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Hamburg.
Die Romane der Pierre-Durand-Reihe:
Provenzalische Verwicklungen · Provenzalische Geheimnisse · Provenzalische Intrige · Provenzalisches Feuer · Provenzalische Schuld · Provenzalischer Rosenkrieg · Provenzalischer Stolz · Provenzalischer Sturm · Provenzalische Täuschung · Provenzalische Flut
Sophie Bonnet
Provenzalische Flut
Ein Fall für Pierre Durand
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Troni
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
DK · Herstellung: kw
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN978-3-641-30980-0V001
www.blanvalet.de
Prolog
Die Morgensonne tauchte den Himmel in ein orange-violettes Farbenmeer, als das Luftkissenboot sich dem Ufer näherte. Noch war die Bucht ein milchig grauer Streifen, ihre Konturen waren verschwommen. Und doch erkannte er den bewaldeten Landvorsprung, den weit ins Wasser ragenden Steg, die konvex geschwungene Hotelfront mit den gleichmäßigen Balkonen.
»Die Plage du Rayol«, flüsterte er. »So ein verdammter Mist.«
Die ersehnte Küste hatte vor ihm gelegen wie das gelobte Land. Erleichtert hatte er auf sie zugehalten, nur um jetzt festzustellen, dass er viel zu weit abgetrieben war.
Er hatte gedacht, sich weiter westlich zu befinden, in der Nähe des Hafens von Le Lavandou. Von dort hätte ein Rettungshubschrauber ihn zum Hôpital de Sainte Marguerite in Marseille bringen können, dessen Centre hyperbare über moderne Überdruckkammern verfügte. Doch er hatte die Orientierung verloren, hatte immer wieder innegehalten, um gegen den Schmerz anzuatmen, der sein Innerstes in Stücke riss. Er brauchte dringend einen Arzt.
Er reduzierte die Geschwindigkeit und überlegte, was er tun sollte, doch die Benommenheit machte es ihm unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen.
Ratlos sah er zum Ufer. Der Morgennebel hatte sich gelichtet, die aufeinandergestapelten Liegestühle aus bespanntem Stahlrohr waren nun zu erkennen. Der türkisblau flatternde Windschutz.
Der Tag versprach schön zu werden. Vierundzwanzig Grad waren angesagt, bei leichten Böen. In weniger als einer Stunde würde sich der Strand mit Urlaubern aus dem Hôtel Le Bailli de Suffren füllen. Männern und Frauen, Kindern mit Sonnenhüten und Sandeimern. Die Gesichter eingecremt, zum Schutz vor der Maisonne. Doch jetzt war der Abschnitt menschenleer.
Mit zusammengekniffenen Augen betrachtete er die Strandlinie, während er mit den Fingern seine Stirn massierte, um die Benommenheit zu vertreiben. Sein Blick fiel auf die steil aufragenden Klippen links der Badebucht. Unwillkürlich musste er lächeln. Davor, im Schatten der Agaven, hatten sich Camille und er im Sommer vor drei Jahren zum ersten Mal geküsst.
Ihre Lippen waren warm und weich gewesen. Immer wieder hatte ihr Mund den seinen gesucht. Mit jedem Kuss war ein Stromschlag durch seinen Körper gegangen und das Verlangen nach mehr. Ihre Gegenwart genügte, um ihn zu entflammen. Daran hatte sich bis heute nichts geändert.
Das Verlangen, sie noch einmal im Arm zu halten, riss ihn zurück in die Gegenwart.
Er überlegte, wieder Fahrt aufzunehmen und der Küstenlinie weiter zu folgen, als ihn ein erneuter Krampf durchzuckte. Er würde es nicht bis Le Lavandou schaffen. Der Rettungshubschrauber musste hierherkommen, und zwar sofort.
Inzwischen war er bei den gelben Bojen angelangt, die den Badebereich abgrenzten. Er gab Gas, hielt direkt auf den Strand zu. Die Geschwindigkeit trieb den Bug in die Höhe, als ein fürchterliches Knarzen erklang und der Motor abrupt mit einem Ächzen erstarb.
Irritiert sah er in Richtung des Propellers, von dem das Geräusch ausgegangen war. Das Boot drehte jetzt wieder in Richtung des offenen Meeres. Hektisch versuchte er gegenzulenken, ohne Erfolg. Offenbar war die zwischen den Bojen gespannte Leine gerissen und hatte sich in der Schraube verheddert. In diesem Zustand, daran gab es keinen Zweifel, war das Boot manövrierunfähig.
Fluchend griff er nach seinem Mobiltelefon, in der Hoffnung, inzwischen wieder Empfang zu haben, doch es glitt ihm durch die zitternden Hände, prallte an der luftgefüllten Bordwand ab und fiel in hohem Bogen ins Wasser.
»So ein verdammter Dreck!« Ihm entfuhr ein Schluchzen, das in einen neuen Krampf überging. Der Schmerz hatte inzwischen eine Heftigkeit erreicht, die ihm die Luft nahm. Er schien im ganzen Körper zu sein. In den Muskeln, in der Lunge, im Herzen.
Erschöpft legte er sich auf den Boden vor dem Steuerstand. Ihm war sterbensübel. Es war nur auszuhalten, wenn er ganz ruhig dalag, den Rücken fest auf dem schwankenden Untergrund. Er versuchte, seinen Atem zu kontrollieren, lauschte dabei auf das Rauschen der Brandung, die in regelmäßigem Rollen ans Ufer schlug. Über ihm schrie eine Möwe.
Er wusste, was in seinem Körper vor sich ging, konnte jedes einzelne Symptom bis in die physiologischen Details deklinieren. Er kannte Taucher, die unter den Folgen gelitten und bleibende Schäden davongetragen hatten oder daran verstorben waren. Aber nie hätte er gedacht, dass ihm selbst je so etwas passieren würde. Ausgerechnet ihm mit seiner Erfahrung. Er hatte sich im Meer immer sicher gefühlt, zu Hause.
Und trotzdem war da dieser Impuls gewesen, aufzusteigen. Ein Impuls, der nicht mehr willentlich steuerbar gewesen war. Er fragte sich, wie es hatte geschehen können. Es musste einen Auslöser gegeben haben, der ihn so unkontrolliert hatte reagieren lassen.
Er schloss die Augen und versuchte, den Tag zu rekapitulieren. Hatte er einen Fehler gemacht? Etwas Wichtiges übersehen?
Er erinnerte sich, im Licht des frühmorgendlichen Sternenhimmels sämtliche Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt zu haben. Das Tarierjacket mit dem Inflatorschlauch, die Schnellablässe, den Bleigurt und die Verschlüsse der Ausrüstung. Die Druckgasflasche, den Atemregler und alle übrigen Gerätschaften.
Er hatte den Unterwasser-Metalldetektor geschultert und noch einmal seine Position überprüft, fernab der vielen Wracks, die bereits morgens von Tauchern umlagert waren.
Alles war bereit gewesen, er empfand Vorfreude, geradezu Euphorie bei der Aussicht auf das, was ihn dort unten zwischen Seegraswiesen und Korallen erwartete. Eine Sensation, deren Entdeckung er bislang nur mit zwei Menschen geteilt hatte, weil es unweigerlich Begehrlichkeiten wecken würde. Weshalb er zu Zeiten rausfuhr, wenn andere noch schliefen, und trotz der Gefahr alleine tauchte, ohne Buddy.
Bereits das Abtauchen hatte sich anders angefühlt als sonst. Er war enorm erschöpft gewesen, hatte sich zusammenreißen müssen. Aber die Nacht war auch kurz gewesen, und er verließ sich darauf, dass die Kälte des Wassers die Müdigkeit rasch vertrieb.
Um keinen Preis der Welt wollte er sich diesen Moment entgehen lassen, in dem er den Lohn für die Arbeit der vergangenen Wochen empfing.
Meter für Meter war er dem Meeresboden näher gekommen. Alles war ruhig und friedlich gewesen. Die Stirnlampe schickte ihr Licht durch die immer dunkler werdende Unterwasserwelt.
Er liebte diesen Ort. Die direkte Begegnung mit dem Meer. Die Stille, die Schwerelosigkeit in der Tiefe. Hier ließ man alle Sorgen, allen Stress, allen Lärm zurück. Wenn dann auch noch die Sonne das Licht an der Oberfläche brach und blaugrün flimmernd in die Tiefe streute, war es reine Magie. Eine Magie, die süchtig machte.
Hier unten fühlte er sich wie in einer anderen Galaxie, und er hätte die Augen schließen mögen, um sich einfach nur treiben zu lassen. In seiner Erinnerung sah er den teuren Metalldetektor von seinem Arm gleiten und weiter hinabtrudeln. Es war ihm auf unerklärliche Weise egal gewesen. Nun, mit einigem Abstand, wusste er, dass er einen besonders schweren Tiefenrausch erlitten hatte.
Selbstverständlich wusste er um die Gefahren des Zustandes, wenn man durch den im Blut freigesetzten Stickstoff in meditative Zustände geriet. Eine euphorisierende Erfahrung, die einen aus Raum und Zeit zu lösen schien. Er hatte schon Tauchschüler mit unstillbaren Lachanfällen erlebt, die sich schließlich auch auf ihn übertrugen. Aber er wusste damit umzugehen.
Dieses Mal jedoch war seine Wahrnehmungskraft einem traumartigen Zustand gewichen, der ihm unerklärlich war.
Und dann …
Was als Nächstes geschehen war, daran konnte er sich nicht mehr erinnern. Es war wie ein Filmriss, alles lag hinter einer dichten Nebelwand.
Er wusste nur noch, dass ihn eine plötzliche Angst überwältigt hatte. Und das Verlangen aufzutauchen war so übermächtig gewesen, dass er es nicht mehr kontrollieren konnte.
Noch nie hatte er eine derartige Panik gespürt.
Viel zu schnell war er nach oben gestiegen, ohne sich Zeit für die Dekompression zu lassen, ohne Zwischenstopp. Gegen jeden Verstand war er aus dem Wasser geschossen und hatte sich röchelnd ins Boot gehievt. Er hatte sich die Maske vom Gesicht gerissen und das Mundstück ausgespuckt. Sich dann von der Gasflasche und dem Gürtel befreit. Vom Tarierjacket und vom Neoprenanzug, der ihm auf einmal wie eine Zwangsjacke vorkam, obwohl er kaum noch die Kraft fand, ihn über die Funktionskleidung zu streifen und auszuziehen.
Dabei hatte er laut geflucht und seinen Frust in den Morgen geschrien, weil er wusste, dass etwas Furchtbares geschehen war, das nicht mehr rückgängig zu machen war.
Er hatte den größten Fehler begangen, den man als Taucher tun konnte. Und nun tanzten die Stickstoffbläschen durch seine Blutbahnen, als wäre er eine Flasche Mineralwasser, die man zu stark geschüttelt hatte. Die Bläschen würden die Arterien verstopfen, das Blut am Strömen hindern und unversorgtes Gewebe absterben lassen. Bereits jetzt spürte er eine zunehmende Taubheit im rechten Unterschenkel und in den Fingern. Dazu ein heftiges Ziehen im Rücken, als würden sich die Stickstoffbläschen auch in den Nervenbahnen sammeln.
Ihn fror. Trotz der Sonne, deren Strahlen sein Gesicht erreichten, trotz des warmen Windes, der ihm sanft über die Wangen strich.
Es war zweifellos zu spät, um schadlos aus der Sache herauszukommen. Und er fragte sich, ob er wirklich als Krüppel weiterleben wollte.
Mit einem Seufzen öffnete er die Augen. Die Farbe des Horizonts hatte inzwischen von Violett zu einem hellen Blau gewechselt. In diesem Moment stellte Camille vielleicht die Kaffeetasse in die Spüle und machte sich auf den Weg zur Arbeit.
Er dachte daran, wie er in der Frühe aufgestanden war. Er hatte sich verabschieden wollen, doch sie hatte geschlafen wie ein Murmeltier. Er hatte ihr Gesicht betrachtet, die hohen Wangen, die schmale Nase, hatte ihr mit den Fingerkuppen über das Haar gestrichen. Dann hatte er seine Sachen zusammengerafft und war in den noch dunklen Morgen gelaufen.
Camille …
Ein Gedanke durchzuckte ihn. Noch einmal rekapitulierte er den Abend, den Tagesbeginn, und auf einmal wusste er, was geschehen war.
Es war kein Zufall, dass er unter Wasser in Panik geraten war. Jemand hatte ihn vergiftet, auf eine ganz perfide Art. Und er wusste auch, wer es gewesen war. Wenn er es nicht rechtzeitig an Land schaffte, würde man das Ganze als einen tragischen Unfall abtun. Als eine unglückliche Verkettung von Zufällen.
Mit einem Stöhnen richtete er sich wieder auf. Er durfte nicht aufgeben, musste sich zusammenreißen, den Schmerz bezwingen. Er konnte nicht zulassen, dass dieser Plan aufging. Die Tat durfte nicht ungesühnt bleiben, und deshalb musste er so schnell wie möglich an Land, um davon zu erzählen.
Das Boot war bereits ein Stück abgetrieben. Er versuchte, die Distanz zum Ufer einzuschätzen, es waren mehr als einhundert Meter bis zum Strand. Er würde das letzte Stück schwimmen, er musste es wenigstens versuchen!
Mit aufeinandergepressten Lippen schleppte er sich zum Rand des Bootes und hob ein Bein über die Bordwand, um sich ins Meer gleiten zu lassen. Doch sein taub werdender Unterschenkel bremste die Bewegung, sodass er wie ein nasser Sack ins Wasser fiel. Kalte Wellen schlugen über ihm zusammen, und während er versuchte, an die Oberfläche zu kommen, sah er seine eigenen Luftblasen im Schein der Morgensonne.
Endlich stieß er durch und rang keuchend nach Luft. Er machte einen Schwimmzug, aber sein rechtes Bein gehorchte ihm nicht mehr, es hing schwer und tief, als wollte es ihn bis zum Meeresboden hinabziehen.
Die Angst überwältigte ihn. Sein Herz schlug einen Trommelwirbel.
Panisch begann er zu schreien und mit den Armen durch die Luft zu rudern – als er eine männliche Gestalt am Ufer wahrnahm, die sich ins Wasser stürzte und sich mit kräftigen Schwimmzügen auf ihn zubewegte. Er tauchte unter, schluckte Wasser. Stieß gegen etwas Warmes und trat um sich. Ungestüm und kopflos.
Eine plötzliche Ahnung, es nicht mehr zu schaffen, legte sich über seine Hoffnung. Mit dem Sprung ins Wasser hatte er viel riskiert.
Und alles verloren.
DREI TAGE ZUVOR1
»Sie hat Ja gesagt!« Luc sprang auf und öffnete das Fenster des Trauzimmers, durch das nun eine frühsommerlich warme Brise ins Innere drang. Weit lehnte er sich über die Brüstung, sodass Pierre Sorge hatte, er würde vornüberkippen. »Charlotte hat Ja zu unserem Chef de police municipale gesagt!«
Vom Platz erklang ohrenbetäubender Jubel, schallte bis hinauf ins Bürgermeisteramt. Er war begleitet von dem Getöse eines Tamburins und einer Flöte, deren Spieler kaum einen Ton trafen. Dafür stimmten sie die Melodie, in der Pierre ein okzitanisches Hochzeitslied erkannte, mit besonderer Verve an.
Charlotte, die links neben ihm saß, unterdrückte ein Kichern. »Der mit der Flöte ist Didier«, flüsterte sie mit breitem Lächeln. »Ich habe ihn üben gehört, als er die Ziegen versorgte. Ob du es glaubst oder nicht, er hat sich stark verbessert.«
Pierre lauschte andächtig, auch wenn die schrägen Töne in seinen Ohren brannten, und erwiderte ihr Lächeln.
Er hätte nie gedacht, dass er jemals heiraten würde. Dabei hatte er bereits bei ihrer ersten Begegnung vor drei Jahren gemerkt, dass Charlotte etwas ganz Besonderes für ihn war.
Zu jener Zeit war sie noch Chefköchin in dem luxuriösen Hotel Domaine des Grès gewesen und eine der Verdächtigen in seinem ersten Fall als Chef de police municipale. Er, der ehemalige Pariser Commissaire, hatte sie jedoch nie wirklich als Täterin in Erwägung gezogen, was nicht nur an ihrem offenen, herzlichen Wesen gelegen hatte. Sondern auch an der Anziehungskraft, die schon damals spürbar gewesen war.
Dennoch hatte es Monate gedauert, bis sie ein Paar wurden. Und mehr als ein Jahr, bis Charlotte zu ihm in das ehemalige Bauernhaus zog, das nun dank ihres Stilgefühls Wohnlichkeit und Atmosphäre ausstrahlte. Letzten Herbst hatte er ihr schließlich einen Heiratsantrag gemacht. Und nun war es so weit. Nur noch die Formalitäten, und Charlotte war seine ihm angetraute Ehefrau.
Als Pierre sie vor den Stufen der mairie zum ersten Mal in ihrem Brautkleid gesehen hatte, da hatte es ihm glatt die Sprache verschlagen, und er hatte die Träne, die sich aus seinem Augenwinkel löste, mit einer raschen Handbewegung daran gehindert, sich auf den Weg über die Wange zu machen.
Charlotte war bezaubernd schön in ihrem taillierten weißen Chiffonkleid, dessen weiter Rock bis über den Boden reichte, weshalb sie ihn zum Gehen an einem Knopf befestigte. Sie hatte es mit ihrer Trauzeugin Anouk in einem Brautmodenladen in Aix-en-Provence entdeckt und es bis zu diesem Augenblick vor Pierre versteckt gehalten. Das schulterlange kastanienbraun gelockte Haar trug sie mit einer Spange zusammengesteckt, die mit echten Jasminblüten dekoriert war. Das ovale Gesicht hatte sie dezent geschminkt, Wangen und Lippen in der Farbe von Rosenholz, passend zu den manikürten Nägeln.
Aber auch er hatte sich schick gemacht. Beiger Anzug, weißes Hemd, sogar eine Weste hatte er sich vom Herrenausstatter aufschwatzen lassen. Weil sie so wahnsinnig elegant und gleichzeitig maskulin sei, hatte der Mann behauptet. Und weil sie genau das Richtige sei zu dieser Jahreszeit. Man wisse ja, wie kühl der Mai oft sei, sogar Regen sei angesagt. Nicht nur deshalb würde er selbst niemals im Mai heiraten. Es sei einfach der falsche Monat für derartige Feste.
Ganz vorsichtig zog Pierre das gerade abgesteckte Jackett wieder aus. »Warum?«
»Mariages de mai ne fleurissent jamais«, sagte der Herrenausstatter näselnd, die Stecknadeln zwischen den Lippen. »Hochzeiten im Mai blühen nie auf. Dieser Monat ist der Jungfrau Maria gewidmet und der Verehrung der Verstorbenen. Es bringt Unglück, mit einer derart lebendigen Feier darüber hinwegzugehen.« Er nahm die Nadeln aus dem Mund und seufzte tief. »Ich kann gar nicht glauben, dass der Pfarrer der Église Saint-Michel die Trauung trotzdem durchführt.«
»Wir heiraten nicht kirchlich«, antwortete Pierre knapp. »Außerdem halte ich nichts von diesem mittelalterlichen Unsinn.«
Der Herrenausstatter hob die Brauen. »Dann lassen Sie in Gottes Namen wenigstens die Hochzeitsnacht aus, um die Heilige Jungfrau nicht zu entehren.« Er sah Pierre unverwandt an und zuckte, als der nicht antwortete, mit den Schultern. »Na, wenigstens heiraten Sie nicht an einem Freitag oder an einem Tag mit einer neun im Datum.«
Pierre hatte nicht weiter nachgehakt. Kurz hatte er überlegt, einen anderen Ausstatter zu wählen, aber der Anzug saß hervorragend, und in einem Anflug aus Trotz nahm er sogar die Weste. Vorsichtshalber hatte er am Morgen schnell noch etwas Salz in die Jackentasche gestreut, um das angemahnte Unglück von vornherein abzuwehren.
Und so saß er nun im Trauzimmer der mairie und ihm war viel zu warm in der Maisonne, die vom stahlblauen Himmel brannte und den Raum aufheizte.
»Sie spielen jetzt schon vier Minuten«, kam es flüsternd aus den Reihen hinter ihnen. »Dabei sind wir noch gar nicht fertig. Wie lange dauert das denn noch?«
Pierre wandte den Kopf. Charlottes Vater Richard warf einen skeptischen Blick auf seine Armbanduhr. Seine Frau Fabienne, die sich verstohlen mit dem Taschentuch eine Träne der Rührung aus dem Augenwinkel tupfte, legte ihm beschwichtigend eine Hand auf den Arm.
Auch Charlotte hatte sich umgedreht und zwinkerte ihrem Vater zu. »Ein bisschen Geduld brauchst du noch. Das Stück geht knapp zehn Minuten.«
»Die werden doch nicht etwa die lange Version spielen!« Marianne Levy, die auf der anderen Seite des Amtstisches saß und mit dem Stift auf das vor ihr liegende Dokument getippt hatte, richtete sich abrupt auf und sah stirnrunzelnd in Richtung des Fensters.
Die Kuratorin des Burgmuseums, nach kurzer Interimszeit in eilig einberufener Wahl als Bürgermeisterin von Sainte-Valérie bestätigt, war eine korpulente Frau von ausgesprochener Fröhlichkeit und mit einem Hang zu farbenfroher Kleidung. Zur Durchführung der Trauung jedoch trug sie ein dunkelblaues Kostüm, über der Schulter eine breite Schärpe mit den Landesfarben und sah aus wie die Nationalheilige höchstpersönlich.
»Monsieur Chevallier«, rief sie jetzt gegen den Lärm der Flöte und des Tamburins an. »Würden Sie sich bitte wieder setzen? Wir sind noch nicht ganz fertig. Ohne die Unterschriften der Brautleute ist die Ehe nicht offiziell geschlossen.«
Luc, der eben noch jovial aus dem Fenster winkte, als sei er der Bräutigam und nicht der Trauzeuge, strich sich mit hochroten Wangen über das kurze, struppige Haar. »Sehr wohl, Madame le maire. Pardon.«
Im Raum wurde leise gekichert.
Die Bürgermeisterin schob den Brautleuten das Dokument zu, nickte zufrieden, als die Unterschriften platziert waren, und sah die beiden Trauzeugen fragend an.
»Wer von Ihnen hat die Ringe?«
»Die gibt es doch erst draußen«, sagte Anouk mit verschwörerischem Grinsen.
»Stimmt, das hätte ich fast vergessen.« Madame Levy lachte. Mit einem Strahlen sah sie Pierre und Charlotte an. »Damit sind Sie nun Mann und Frau. Sie dürfen sich küssen.«
Das ließen die beiden sich nicht zweimal sagen.
Weiße Tauben stiegen flatternd in den Himmel, als das frisch getraute Paar Hand in Hand die Place du village betrat, auf dem sich blumengeschmückte Bögen formierten, durch die sie nun zu schreiten hatten. Gehalten wurden die Stangen von ihren Freundinnen und Freunden, von denen sich nicht wenige für traditionell provenzalische Kleidung entschieden hatten. Die Frauen trugen weite Röcke in Orange und Blau, das Haar von Häubchen und wagenradgroßen Strohhüten verdeckt. Die Männer graue Zylinder und rote Bauchbinden.
»Ist das nicht wunderschön?«, flüsterte Charlotte ergriffen und sah Pierre unter einem Tränenschleier an.
»Ja.« Pierre nickte nicht minder gerührt, und gemeinsam tauchten sie in den duftend bunten Blumentunnel.
Den ersten Bogen hielt Gisèle, die Empfangsdame der mairie. An der goldenen Kette baumelte ihre Brille, die sie immer zum Lesen aufsetzte, sie musste vergessen haben, sie abzulegen. Ihr gegenüber stand Penelope, die junge Schreibkraft der Wache, deren hoher blonder Zopf unter dem Häubchen vollständig verschwand. Sie lachte über das ganze Gesicht und winkte mit der freien Hand, als Pierre zu ihr sah, und er winkte fröhlich zurück. Neben ihr warteten Robert Lechat, der junge Commissaire aus Cavaillon, mit seiner Frau und Immobilienmakler Farid Al-Ghanouchi, der Pierre vor drei Jahren das ehemalige Bauernhaus verkauft hatte. Und der seinen Zylinder in dem Moment, als Charlotte und Pierre an ihnen vorbeizogen, übermütig in die Luft warf.
Zum Spiel von Flöten und Trommeln liefen Charlotte und Pierre unter den Bögen hindurch, lachend, glücklich. Gefolgt von ihren beiden Trauzeugen, Charlottes Eltern und Pierres Vater Alain, der seine neue Lebensgefährtin eng im Arm hielt.
Während sie in gebeugter Haltung durch den Tunnel aus Blumengirlanden schritten, versuchte Pierre, jeden einzelnen Gratulanten zu begrüßen – Madame Duprais und Madame Farigoule, Martin Cazadieu mit seinem Freund Ian, Barinhaber Philippe und seine Frau Georgette – , bis er einsah, dass zu viele Spalier standen, um jeden von ihnen einzeln willkommen zu heißen. Also ergab er sich der fröhlichen Stimmung und stieg am Ende des Bogentunnels mit Charlotte über den geschmückten Ast, den die Gäste ihnen in den Weg gelegt hatten. Als Symbol, dass sie von nun an gemeinsam alle Hindernisse zu überwinden vermochten.
Als sie vor den schleifengeschmückten Ziegen Cosima und deren maronenbraunem Töchterchen Lilou zum Stehen kamen, gab Didier Carbonne Lilou, an deren Hals eine kleine Schachtel angebracht war, einen Klaps.
»So, hübsche junge Dame, bring den beiden die Ringe«, sagte er feierlich.
Sie trabte auf Pierre zu, und er ging in die Hocke, um die Schachtel in Empfang zu nehmen, als ein lautes Kläffen erklang, und die Ziege innehielt.
»Lilou, hierher!«, rief Pierre, doch die kleine Ziege spähte mit geweiteten Augen zu dem Hund der Roziers hinüber, der sich losgerissen hatte und mit lautem Bellen auf sie zustürmte, als wäre sie ein junger Hase, den es über ein Feld zu jagen galt.
Hinter ihm stürzte sein Besitzer Arnaud über den Platz, er keuchte und schwitzte, doch es gelang ihm nicht, den Hund einzuholen.
»Beaufort, verdammt, bleib endlich stehen!«
Einige Gäste stellten sich dem Jagdhund in den Weg, versuchten, die Leine zu ergreifen, die er hinter sich herschleifte. Aber der Hund entwischte ihren Armen, Händen und Füßen, schlüpfte durch deren Beine und hatte nur noch Augen für das Zicklein, das mit panischem Blick das Weite suchte.
Unter lautem Kläffen, Rufen und Meckern ging es rund um den Platz, zwei Mal, dann hatte Ziegenmama Cosima die Faxen dicke und stellte sich dem Jagdhund in den Weg. Mit drohend gesenktem Kopf. Und als Beaufort auswich, galoppierte sie mit ihren kurzen Beinen und unerwarteter Geschwindigkeit hinter ihm her und rammte die kleinen Hörner in seine Hinterläufe.
Jaulend kniff Beaufort die fedrige Rute ein und ließ sich sogar freiwillig von seinem Besitzer wieder an die Leine nehmen. Unter dem erleichterten Aufatmen der Umstehenden schob Cosima ihre Tochter zurück an ihren Platz, den Kopf stolz erhoben.
»Gut gemacht, meine Hübsche«, sagte Pierre und tätschelte die tapfere Ziegenmama. Dann nahm er Lilou das Kästchen vom Hals, und Charlotte und er steckten sich die Ringe unter dem Applaus der Gäste gegenseitig an die Finger.
Nur wenige Minuten später erklang die Musik einer Folkloregruppe, und im Nu war der Platz gefüllt mit Paaren, die zu den Klängen hüpften, sich im Kreis drehten und dabei ausgelassen lachten. Selbst der Gastronom Albert Petit, den er noch nie hatte tanzen sehen, wirbelte seine Gattin herum. Und als Pierre sich mit Charlotte in den Reigen der Tanzenden einreihte, fiel ihm auf, dass Penelope und sein Assistent Luc ganz besonders gut harmonierten. Zumindest in diesem Punkt.
Um sieben Uhr zog die Hochzeitsgesellschaft weiter zum Burgmuseum, in dessen kerzengeschmücktem Kaminzimmer später das Festessen stattfinden sollte. Es ging die Treppen hinauf bis zu den Zinnen, wo die Feier mit einem Sektempfang startete.
Die Aussichtsplattform des Burgturms war mit üppig bewachsenen Kübeln geschmückt, in denen Rosen, junger Lavendel und Jasmin blühten. Über den ganzen Bereich waren Stehtische mit weißen Hussen verteilt, dekoriert mit Windlichtern und Blumengestecken. Kellnerinnen und Kellner trugen Tabletts mit dem hauseigenen Crémant, der wunderbar feinperlig war, wie Pierre fand. Dazu kleine Schalen mit Oliven, crudités und Appetithäppchen aus dünn gewalktem Weißbrot, in das mit Frischkäse bestrichener Räucherlachs gerollt war.
Als Pierre und Charlotte zu den Klängen eines Jazztrios alle Glückwünsche entgegengenommen und mit jedem Gast angestoßen hatten, stellte er sein Glas auf einem der Stehtische ab und nahm Charlotte bei der Hand.
»Wohin führst du mich?«, fragte sie, obwohl ihr Blick sagte, dass sie es längst ahnte.
»Zu der Stelle, an der wir uns zum ersten Mal geküsst haben.«
Hand in Hand gingen sie an den Rand der Plattform zu den mannshohen Zinnen und blickten durch die Auslässe über die in der gleißenden Abendsonne leuchtenden Dächer von Sainte-Valérie hinab ins Luberontal. Zu Füßen des Dorfes lag der Flickenteppich aus frühlingshaft blühenden Wiesen und Feldern, in deren Farben sich das Rot des Mohns mischte. In seiner Leuchtkraft nur von dem Gelb der Ginsterbüsche übertroffen, die sich entlang der Straße ins Tal zogen.
Pierre betrachtete Charlottes Gesicht, das sie der Abendsonne entgegenreckte. Es wirkte ganz weich im goldenen Licht. Die Augen hatte sie geschlossen, der Mund war leicht geöffnet, als trinke sie den Duft des Jasmins, der zu ihnen herüberwehte.
»Es gibt da eine Sache, die wir nie so richtig besprochen haben«, sagte sie leise, ohne die Lider zu heben.
Ihm wurde warm. »Du meinst …?«
Charlotte wandte den Kopf und sah ihn an. »Ich habe beschlossen, die Pille abzusetzen.«
»Ich …« Das weiche Timbre des Sängers drang zu ihnen herüber. Paroles, Paroles, Paroles, spielte die Band. Mais c’est fini le temps des rêves – aber die Zeit der Träume ist vorbei, sang er und imitierte dabei die weibliche Singstimme. Pierre atmete tief ein und wieder aus. »Ich weiß, wie wichtig dir das Thema Kinder ist.«
»Und? Was sagst du dazu?«
Pierre lächelte, obwohl ihm angesichts der immensen Verantwortung, die damit auf sie zukam, mulmig zumute war. Der Gedanke, mit der Geburt eines Kindes seine Freiheit zu verlieren, hatte vor nicht allzu langer Zeit noch heftige Beklemmungen ausgelöst. Aber mit Charlotte konnte er sich so einiges vorstellen.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes, schallte es zu ihnen. Du bist für mich die einzige Musik, die die Sterne auf den Dünen tanzen lässt.
»Ich bin bereit«, sagte Pierre tapfer.
Er zog sie an sich und gab ihr einen langen Kuss, als hinter ihnen ein zaghaftes Räuspern erklang.
»Entschuldigt bitte die Störung«, sagte Anouk. »Aber dürfte ich die Braut für einen Moment entführen? Die Catering-Firma hat eine Frage wegen des Essens.«
»Selbstverständlich.«
Pierre trat einen Schritt zur Seite und blickte Charlotte nach, die ihrer Trauzeugin die Treppe hinunter zum Kaminsaal folgte, als sein Vater auf ihn zugeschlendert kam, eine Zigarette in der Hand.
Alain sah gut aus, man merkte ihm die sechsundsiebzig Jahre nicht an. Das noch immer volle graue Haar war zurückgegelt, der elegante Anzug schmal geschnitten. Wo dem pensionierten Juristen im letzten Herbst noch ein dichter Bart den verwegenen Ausdruck eines Künstlers verliehen hatte, war nun ein exakt gestutzter Dreitagebart, der ihm – das musste Pierre zugeben – ausgesprochen gut zu Gesicht stand.
Jetzt winkte er eine Kellnerin heran und nahm ihr zwei Gläser Crémant vom Tablett, von dem er eines Pierre reichte.
»Na, mein Junge, du hast ja gar nichts zu trinken.«
Pierre ergriff das Glas und spürte, wie er sich unwillkürlich verspannte. Er hatte noch nie ein besonders gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt. Was er darauf zurückführte, dass Alain ihn nach dem Tod der Mutter mit seiner Trauer allein gelassen hatte. Stattdessen hatte er Gefallen daran gefunden, sich immer neue Freundinnen zuzulegen, die von Mal zu Mal jünger wurden. Seine neueste Flamme hieß Audrey, eine dunkelhaarige Schönheit mit knallrot geschminkten Lippen und eng anliegendem Leopardenkleid, die mit ihren fünfunddreißig sogar ein Jahr jünger war als Charlotte.
Pierre prostete seinem Vater zu und rief sich zur Raison. Bei ihrem letzten Treffen hatten sie sich dazu entschlossen, die Vergangenheit ruhen zu lassen und nach vorne zu blicken. Sich in ihrer Unterschiedlichkeit zu nehmen, wie sie waren.
»Gut siehst du aus«, sagte Alain, nachdem er einen Schluck getrunken hatte. Er zog an der Zigarette und blies den Rauch aus, während er Pierre ausgiebig musterte. »Hast du abgenommen? Ich hatte dich dick in Erinnerung.«
»Ich war nie dick.«
»Entschuldige bitte, du warst richtiggehend fett.«
Pierre starrte seinen Vater an. Am liebsten hätte er ihm eine scharfe Erwiderung entgegengeschleudert, aber er war fest entschlossen, sich den Tag nicht verderben zu lassen.
»Ich habe vor fünf Wochen zu joggen begonnen«, erklärte er mit gespielter Ruhe. »Ich will mehr für meine Gesundheit tun.«
Dass er seit einigen Wochen auf den Zucker im Kaffee verzichtete und nach Möglichkeit allzu fette Speisen und vor allem Weißbrot tunlichst mied, erzählte er nicht. Es war einfach an der Zeit gewesen, er hatte sich selbst nicht mehr im Spiegel leiden mögen.
Alle zwei, drei Tage stand er jetzt eine Stunde früher auf, um zu laufen. Erst war es eine Qual gewesen, aber dann hatte er gemerkt, wie gut ihm das regelmäßige Training tat. Zwar würde er niemals derart sportlich sein wie sein Kollege und Freund Robert Lechat, der jeden Morgen joggte. Aber er wollte sich nie wieder derart gehen lassen, das hatte er sich geschworen.
»Darf ich ehrlich sein?«, fragte Alain, als würde er seine Zunge sonst immer im Zaum halten.
»Nur zu«, knurrte Pierre.
»Ich hätte nie gedacht, dass du tatsächlich einmal heiraten würdest. Versteh mich nicht falsch, ich freue mich wahnsinnig für dich. Aber weißt du, mein Sohn«, Alain Durand legte einen Arm um Pierres Schulter, »bei aller Unterschiedlichkeit: In diesem Punkt sind wir aus demselben Holz geschnitzt. Eine zu enge Bindung ist uns unerträglich. Es schnürt uns die Luft ab, habe ich recht? Ich kann nur hoffen, dass eure Ehe hält. Ich meine, ich wünsche es dir von ganzem Herzen.«
Pierre atmete tief ein. »Charlotte ist die Richtige. Es ist für immer, du wirst sehen.«
»Na, wenn du das sagst … Hübsch ist sie ja, mein Junge, da hast du wahrlich Glück gehabt.« Alain nahm die Hand von Pierres Schulter und schaute zu seiner Freundin, die etwas verloren mit ihrem Sektglas am Eingang zur Plattform stand. »Ist Audrey nicht sexy? Schade, dass sie nicht kochen kann.« Damit wandte er sich um und ging in ihre Richtung. Die Arme weit ausgebreitet wie ein Walfänger auf Kutterfahrt.
Pierre sah ihm missmutig nach. Er hatte in den Monaten ohne Kontakt beinahe vergessen, wie anstrengend sein Vater bisweilen war. Er hoffte, dass Alain sich später nicht dazu berufen fühlte, eine launige Rede zu halten.
»Was guckst du so sauertöpfisch? Ist dir etwa eine Laus über die Leber gelaufen?«
Unbemerkt war Didier Carbonne neben ihn getreten. Das schüttere Haar stand wirr zu allen Seiten ab, und den schlecht gestutzten Bart hatte Pierre noch nie in Form gesehen. Und doch ließen der viel zu große Anzug, der am hageren Körper schlotterte, und die geschnittenen Fingernägel erkennen, dass der ehemalige Uhrmacher sich für diesen Anlass zurechtgemacht hatte.
»Die Laus ist gerade entschwunden«, antwortete Pierre und grinste.
Er mochte den betagten Uhrmacher. Schon immer, trotz aller Schlitzohrigkeit, mit der er sich durchs Leben schlug. Vor allem bei der Beschaffung von Nahrungsmitteln erwies Carbonne sich als enorm findig. Eine Überlebensmaßnahme, wie Pierre inzwischen wusste, Folge einer nicht anerkannten Kriegsverletzung und einer Grundsicherung, die ihn nicht ausreichend ernährte. Anlass genug, ihm regelmäßig mit Arbeit und Essen unter die Arme zu greifen.
»Gut schaust du aus«, sagte Pierre anerkennend.
»Und du erst.« Der Alte zeigte auf sein Handgelenk. »Bis auf diese fürchterliche Armbanduhr. Die wirkt, als hättest du sie aus einem Kaugummiautomaten gezogen.«
»Immerhin funktioniert sie.«
Pierre lachte. Seit er zum ersten Mal in Carbonnes ehemaliger Uhrmacherwerkstatt gestanden hatte, zog dieser ihn mit seiner Uhr auf. Er hatte sie vor etlichen Jahren als Zugabe für ein Jahresabonnement der Le Monde erhalten. Inzwischen war das Chrom an den Gehäusekanten abgeblättert, und auch das Lederarmband zeigte deutliche Gebrauchsspuren.
»Zeit für eine neue.« Umständlich nestelte Carbonne an seiner Anzuginnentasche, zog ein verblichenes Holzkästchen hervor und hielt es Pierre hin. »Das ist für dich. Geschenkpapier gibt’s nicht, das wird ohnehin nur weggeworfen. Na los, mach schon auf!«
Pierre nahm es entgegen und öffnete den Deckel. Vor ihm lag ein alter, auf Hochglanz polierter Chronograf mit hellbeigem Ziffernblatt und schwarzer Lünette.
»Eine Uhr?« Überrascht sah er auf.
»Es gibt noch mehr Geschenke. Wir Dorfbewohner haben uns eine hübsche Überraschung für euch ausgedacht, aber das hier ist etwas, das ich dir schon lange geben wollte.«
»Sie ist wunderschön. Nur viel zu wertvoll, das kann ich nicht annehmen.«
»Papperlapapp! Die Uhr habe ich mal vor vielen Jahren für einen Kunden angefertigt, der sie bezahlt und nie abgeholt hat. So sind sie nun mal, die Urlauber. Werfen mit ihrem Geld um sich und verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Seitdem liegt sie bei mir in der Werkstatt herum.« Er grinste und entblößte seine Zahnlücken. »Was ist denn nun, nimmst du sie oder nicht? Du kannst damit sogar tauchen gehen. Sie ist bis zu zwanzig Meter wasserdicht.«
Pierre strich über das metallene Armband. Es war der erste von einem Uhrmacher angefertigte Chronograf, den er je besessen hatte.
»Ich werde sie in Ehren halten.« Feierlich band er seine alte Uhr ab und legte die neue an. »Sie ist wunderschön, vielen Dank.«
»Nicht wahr?« Carbonnes Augen glänzten. »Ich danke dir, für alles, was du für mich getan hast.« Er rieb sich den struppigen Bart und wirkte auf einmal sehr verlegen.
Weil Pierre wusste, dass der Alte überschwängliche Umarmungen hasste, klopfte er ihm unbeholfen auf die Schulter, als sich in diesem Moment Charlotte durch den Ausstieg zur Plattform schob.
»Pierre, kommst du? Die Gäste nehmen gerade ihre Plätze ein.«
»Aber sicher, ma douce.«
Er nahm Didier Carbonne am Arm, der seine Hand mit der geknurrten Bemerkung wieder abschüttelte, er sei schließlich kein hilfloser Tattergreis und könne gut allein laufen. Dann folgte Pierre seiner frisch Angetrauten hinab in den über und über mit Kerzen, Blumen und Efeu geschmückten Kaminsaal. Bereit, den neuen Lebensabschnitt gebührend zu feiern.
2
Das Morgenlicht fiel in einem schmalen Streifen durch den Spalt zwischen den Vorhängen, als Pierre die Augen aufschlug. Irritiert rieb er sich die Lider, dann endlich wusste er, wo er sich befand: im Zimmer des geschmackvoll eingerichteten Hotels in Rayol-Canadel-sur-Mer, einem ruhigen unscheinbaren Ort zwischen Saint-Tropez und Le Lavandou. Hier sollten sie acht wundervolle Flitterwochentage verbringen.
Schlagartig war er wach. Er warf einen Blick auf die neue Taucheruhr, die auf dem Nachttisch lag, es war nicht einmal sieben. Neben ihm schlief Charlotte, sie atmete tief und gleichmäßig. Ihre braunen Locken bedeckten das Kissen und umrahmten ihr Gesicht. Mit zarten Fingern strich er über das Haar, ganz vorsichtig, um sie nicht zu wecken, dann setzte er die nackten Füße leise auf den Holzboden und ging zum Fenster. Schob den Vorhang ein winziges Stück beiseite.
Das Farbenspiel, das ihm entgegenleuchtete, war wundervoll. Die Sonne hatte sich gerade über dem Meer erhoben und ließ die wenigen Wolken orange und violett schimmern. Die Luft wirkte kühl und klar, und Pierre beschloss, die Zeit zu nutzen, um noch vor dem Frühstück joggen zu gehen.
Den letzten Lauf hatte er am Abend vor ihrer Hochzeit absolviert, und das war bereits vier Tage her. Auf der Feier hatte er geschlemmt wie in alten Zeiten, er hatte gar nicht anders gekonnt. All die guten Speisen, der zarte Rinderbraten, das Erdbeersorbet mit Sahne vom Nachtischbüffet, von dem er sich zweimal genommen hatte.
Alle Speisen waren nach Charlottes Rezepten gefertigt, und sie hatte sich bei der Auswahl selbst übertroffen. Eigentlich waren Spargel mit pochiertem Ei auf Parmesanschaum und Seezunge mit getrüffeltem Kartoffel-Sellerie-Stampf geplant gewesen. Doch nachdem sie den Ort für die Feier festgelegt hatten, war Charlotte unsicher geworden, ob der Aufwand für das Catering-Team nicht viel zu groß war. Sie hatte ihre Pläne verworfen und in ihrem ureigenen Perfektionismus immer neue Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts ersonnen, die nicht nur köstlich schmeckten, sondern auch gut vorzubereiten waren. Und Pierre musste alles probieren. Was er gerne tat.
Sie schmorte und dämpfte und vakuumierte, als gelte es, einen Michelin-Stern zu ergattern. Alle paar Tage duftete es in der Küche nach Knoblauch, Kräutern und Röstaromen, und anfangs freute er sich auf das Ergebnis ihrer Kochkunst, die immer mehr zur Küchenschlacht wurde. Je öfter sie gekocht hatte, desto häufiger war er joggen gewesen, und irgendwann war er nicht mehr dagegen angekommen und hatte ermattet Einspruch erhoben.
»Ma douce«, hatte er zärtlich geflüstert, als sie wieder einmal mit fettverspritzter Schürze und erhitzten Wangen vor ihm stand, um sein Urteil einzuholen. »Egal, was wir am Ende servieren: alles, was du da kochst, ist köstlich. Wir haben genügend Auswahl. Es ist gut jetzt.« Damit hatte er Charlotte die Schürze abgebunden, um sie in die Arme zu nehmen, und sie hatte tief und schwer geseufzt. Fast schien sie dankbar für seinen Einspruch.
Schließlich gab es für jeden Tisch dreistöckige Vorspeisen-Etageren, auf denen Rotbarben-Rillettes und tartare de taureau mit frittierten Kapern lagen, dazu gebackener Ziegenkäse mit Lavendelhonig und Schälchen mit Spargelcremesuppe, Kerbel und Croutons. Als Hauptgang standen Fisch, Fleisch oder ein veganes Gericht zur Wahl.
Darauf folgte ein Büffet mit verschiedenen Desserts und Käsevariationen. Opulente Köstlichkeiten, die sich die Gäste anschließend zur Musik eines DJs von den Hüften zu tanzen versuchten. Gekrönt wurde der kulinarische Teil des Abends von einer pièce montée, einer pyramidenförmig zulaufenden Hochzeitstorte aus sahnecremegefüllten, zuckerglasierten Brandteigbällchen, die in einer Tanzpause in den Saal getragen wurde.
Am Ende des Abends hatten alle versichert, dass sie lange nicht mehr so gut und reichlich gegessen hätten. Und da die Gäste nicht alles verzehrten, bat Didier Carbonne um Frischhaltedosen, die er für die nächsten Tage füllte. Der Rest ging an eine mit dem Burgmuseum verbundene Organisation für Bedürftige.
Beim Gedanken an den Abend musste Pierre lächeln.
Es war ein rauschendes Fest gewesen, wie es schöner nicht hätte sein können. Obwohl sein Vater tatsächlich eine Rede gehalten hatte, in der er Geschichten vom »kleinen Pierre« zum Besten gab. Die Erzählungen hatten für diverse Heiterkeitsausbrüche gesorgt, die er tapfer ertragen hatte. Aber Pierre hatte das Ganze mit Humor genommen, viel zu sehr genoss er das Beisammensein mit seiner Charlotte und den Gästen. Und so hatte er seinen Stolz heruntergeschluckt und sich mit seiner großen Liebe zum Takt der Musik gedreht, bis ihm die Füße brannten.
Pierres Lächeln wurde breiter, als er daran dachte, wie müde er und Charlotte gewesen waren, als sie endlich um fünf Uhr morgens in die Federn sanken. Viel zu müde für eine Hochzeitsnacht.
Der Sonntag hatte der Familie und den weit angereisten Freunden gegolten. Am Montag hatten sie frühmorgens in die Flitterwochen fahren wollen. Sie hatten sich die Côte Varoise ausgesucht mit ihren einsamen Buchten und langen Sandstränden.
Doch es hatte Ewigkeiten gedauert, bis sie endlich loskamen. Sie hatten erst Charlottes Eltern zum Bahnhof nach Avignon gebracht und anschließend Alain und Audrey, die spontan ihren Aufenthalt in Sainte-Valérie verlängerten, mit Ausflugstipps versorgt. Dann hatten sie Charlottes Berlingo, der wegen anstehender Lieferaufträge in Sainte-Valérie benötigt wurde, vor der Épicerie abgestellt und den reservierten Leihwagen aus Stéphane Poncets Autowerkstatt abgeholt. Einen weißen Renault Twingo, der bereits vierundachtzigtausend Kilometer gefahren, aber noch gut in Schuss war.
Als sie den Wagen endlich auf dem Hotelparkplatz abstellten – entnervt angesichts des unerwarteten Verzugs – , war es bereits fünf Uhr gewesen. Doch beim Betreten der Anlage war die Anspannung von ihnen abgefallen, und sie hatten sofort entschleunigt.
Der Außenbereich war mit farbenfrohen Sträuchern bepflanzt, mit Stechpalmen und Rosmarinbüschen. Charlotte, die sofort die Fotosuche ihres Browsers aktivierte, um die Namen der erdbeerroten, gelben und violetten Blüten zu erfahren, fand Flaschenputzer, Strauchmargeriten, Zierknoblauch und Kreuzblumen.
Das Hotel war offenbar erst vor Kurzem erbaut worden und bestand aus einem größeren Komplex, der sich hinter einem ausladenden Pool gruppierte, rechts davon ein modernes Restaurant mit bodentiefen Glasfronten.
Am beeindruckendsten jedoch war die Aussicht. Vor ihnen tat sich ein überwältigendes Panorama auf. Hinter sanft abfallenden, dicht bewachsenen Hügeln lag das Meer. Die Nachmittagssonne beleuchtete das Wasser, in dem tausende Brillanten zu funkeln schienen. Reflektierte die Klippen einer vor der Bucht liegenden Insel, als bestünden sie aus purem Gold.
»Das ist die Île du Levant«, erklärte Charlotte. »Sie gehört zu einer Gruppe aus drei Inseln, auch Îles d’Or genannt, die goldenen Inseln. Jede einzelne hat ihre Besonderheiten. Diese hier besteht zum größten Teil aus einem militärischen Sperrbezirk, dessen Betreten streng verboten ist. Mitte der Sechzigerjahre hat man von der zugehörigen Militärbasis aus noch Tests zum Start von Mittelstreckenraketen durchgeführt. Heute finden hier vor allem Schulungen und Trainings für die Streitkräfte statt. Der restliche Teil der Insel gilt als Mekka für Nudisten.«
Pierre grinste. »Militär und Nacktheit auf einer Insel? Du machst Scherze.«
»Nein, das ist tatsächlich so«, lachte Charlotte. »Nacktheit ist dort völlig normal. Im Ort selbst sollte man zumindest mit einem Stringtanga bekleidet sein, aber an den Strandabschnitten herrscht Textilverbot.«
»Und was sind die Besonderheiten der anderen beiden Inseln?«
»Port-Cros ist die naturbelassenste, sozusagen das Herzstück des ersten Nationalparks Europas, der auch maritime Zonen einschließt. Die Insel Porquerolles ist wohl am bekanntesten wegen der feinen Sandstrände und dem türkisblauen Wasser.«
Pierre sah sie überrascht an. »Woher weißt du das alles?«
»Ich habe mich informiert.«
Charlotte zog den Reiseführer aus ihrer Handtasche, der neben einem dicken Buch über Kindererziehung Beigabe des Hochzeitsgeschenkes ihrer Eltern gewesen war. Sie schlug eine mit einem rosa Klebestreifen markierte Seite auf.
»Porquerolles müssen wir uns auf jeden Fall ansehen. Die Insel ist zwar autofrei, aber es gibt viele gut ausgebaute Radwege, auf denen man sie erkunden kann.«
Pierre hatte folgsam genickt. Für einen kurzen Moment fühlte er sich an seinen Schwiegervater erinnert. Als sie ein Wochenende mit Charlottes Familie in Châteauneuf-du-Pape verbracht hatten, hatte Richard zu jeder Gelegenheit den Reiseführer konsultiert und alle daran teilhaben lassen. Was zuweilen ein wenig anstrengend gewesen war. Aber bei Charlotte war das natürlich etwas ganz anderes.
Der Wind wehte die salzige Meeresluft herüber, als Pierre seine Joggingschuhe schnürte und vor das Hotel trat. Der Rezeptionist hatte ihm eine Strecke empfohlen, die entlang dem Jardin des Méditerranées führte, dem botanischen Garten der Domaine du Rayol. Und weiter zu einer Treppe, der Escalier fleuri, 1925 aus Schiefer vom Massif des Maures gebaut, über die man zu einem kleinen Strandabschnitt gelangte.
Es sei keine der fotogenen Badebuchten, die man in den sozialen Netzwerken finde, hatte der Mann ihm erklärt. Nicht zu vergleichen mit der Plage de Pramousquier oder der Plage de la Fossette, wo es ein hervorragendes Restaurant mit gutem Ambiente gebe. Man könne ihn auch nicht mit jenen Naturständen westlich des Cap Bénat vergleichen. Dafür sei es beinahe wie eine Privatbucht, an die nur die Bewohner des Ortes kämen und die Gäste des Hôtel Le Bailli de Suffren, das in den Sechzigerjahren erbaut worden war, als es noch kein Küstenschutzgesetz gab.
In dem Versuch, sich die Strecke einzuprägen, warf Pierre einen letzten Blick auf die mit rotem Stift bemalte Umgebungskarte, dann faltete er sie zusammen und steckte sie zu seinem Mobiltelefon und der Trinkflasche in die Gürteltasche, bevor er sich in Bewegung setzte.
Nach zwölf Minuten erreichte Pierre die Hauptverkehrsstraße, die den bergigen Teil des Ortes von dem meerzugewandten trennte. Der Himmel hatte inzwischen ein helles Milchblau angenommen, es war kein Wölkchen mehr zu sehen.
Er ließ eine Kolonne vorbeifahrender Autos durch, dann überquerte er die frei gewordene Straße und bog in die Avenue Courmes, die in einer weiten Kurve zum botanischen Garten führte, flankiert von Oleanderbüschen, Kakteen und blühendem Thymian.
Der intensive Geruch exotischer Pflanzen stieg Pierre in die Nase, als er den Parkplatz der Domaine du Rayol passierte. Der Weg führte stetig abwärts, und er hielt kurz an und warf einen Blick auf den entfalteten Plan, um sich zu orientieren. Es lag noch eine ordentliche Strecke vor ihm, und er musste zugeben, dass er länger brauchte als erwartet. Und dass er den Rückweg fürchtete, der ausnahmslos bergauf führte.
Sein Atem ging schnell, als er endlich die alte Treppe erreichte, die sich wie eine überdimensionierte Prachtallee vor ihm auftat, als wäre sie für Napoleon persönlich errichtet worden. Es gab vier Abschnitte, an deren Anfang und Ende tönerne Amphoren standen. Die Treppe war so steil, dass er spontan beschloss, den Heimweg über die seitlich davon entlangführende Straße zu nehmen und ohne den Umweg über den botanischen Garten zum Hotel zurückzukehren.
Mit in die Hüften gestützten Händen blieb er stehen und blickte die Stufen hinab, die am Hôtel Le Bailli de Suffren und an hoch gewachsenen Palmen vorbei direkt auf das smaragdgrün schimmernde Meer zuzulaufen schienen. Am Horizont lag die im Morgendunst dunkel und unnahbar wirkende Île du Levante, ausgestreckt wie ein müder Wal.
Pierre joggte weiter, die Treppe hinab. Die vom Rezeptionisten angepriesene Badebucht wollte er auf jeden Fall noch sehen.
Die Stufen endeten an einem von hüfthohen Büschen umsäumten Sandplatz auf einer Klippe unterhalb des Hotels. Vollkommen außer Atem suchte Pierre sich einen Platz auf der Aussichtsplattform und lehnte sich gegen die Brüstung. Das vor ihm liegende Wasser wirkte jetzt fast türkis, änderte im weiteren Verlauf ganz abrupt seine Farbe: erst Azurblau, dann, weiter hinten, dunkles Stahlgrau.
Weiße und gelbe Bojen schaukelten im Wind, dazwischen eines dieser modernen Luftkissenboote, schmal und lang. Dem Aufbau nach gehörte es zu einer Tauchschule.
Pierre strich sich das von den Böen zerzauste Haar nach hinten.
Die morgendliche Stille tat gut. Der Strand, durch die vorspringende Klippe in zwei Teile separiert, war menschenleer. Rechts eine verschlossene Bar, gestapelte Liegen hinter einem flatternden Windschutz mit der Aufschrift Boukarou Beach.
Pierre schloss die Augen und lauschte dem Geräusch der Brandung, die schaumig an das Ufer rollte. Genoss die Brise auf seinen erhitzten Wangen, bevor er die Lider wieder hob.
Plötzlich zog das einsame Boot seine Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann in Shorts und engem Shirt schwang ein Bein über die Bordwand, es wirkte unbeholfen, fast, als wäre er betrunken. Jetzt fiel er wie ein nasser Sack ins Meer und begann hektisch mit den Armen zu rudern und laut zu schreien.
»Zut!«, rief Pierre aus. Der Mann schien tatsächlich betrunken, er kämpfte mit dem eher ruhigen Wasser, als befände er sich in einem Sturm.
Zweifellos brauchte er umgehend Hilfe.
Hastig sah Pierre sich um.
Der Strand war zu weit entfernt, er hielt nach einem näheren Zugang zum Meer Ausschau, fand ihn in Form von schmalen Stufen, die er nun hinablief. Er rannte über die unebenen Steine, über die sich anschließenden Holzbohlen, vorbei an Agaven, Strandhafer und straff gezogenen Drahtzäunen. Hörte sein eigenes Keuchen, spürte das Klopfen seines Herzens, bis er endlich unten angelangt war und auf die Ausläufer der Klippen trat, wo er mit fliegenden Fingern die Nummer des Notrufes wählte. Mit bellender Stimme gab er seinen Standort durch. Er riss sich die Sporthose samt Hüfttasche vom Leib, zog Schuhe und Socken von den Füßen und legte sein Handy in den Kleiderhaufen, dazu seine neue Taucheruhr, die ihm zu wertvoll war, um ihre Wasserfestigkeit auf die Probe zu stellen. Dann stürzte er sich, in Unterhose und Sporthemd bekleidet, ins Meer.
Das Wasser war kalt und brachte seine Haut zum Brennen. Er schwamm mit kräftigen Zügen, ignorierte das Stechen in der Lunge. Kraulte, als ginge es um sein eigenes Leben – bis er endlich den Mann erreichte, der noch immer mit den Armen ruderte. Den Kopf mehr unter Wasser als an der Luft.
Da Pierre wusste, dass ein in Panik geratener Schwimmer auch für den Retter gefährlich werden konnte, näherte er sich von hinten und machte sich mit beruhigenden Worten bemerkbar, doch der Mann strampelte ohne Unterlass, sodass ein Tritt ihn am Oberschenkel traf.
Pierre unterdrückte ein Fluchen. »Ganz ruhig«, sagte er beschwörend, und als auch das nichts half, wurde er energischer. »Hören Sie gefälligst auf zu zappeln! Sonst kann ich Sie nicht an Land bringen.«
Endlich zeigte sich der in Not Geratene erschöpft und ließ sich rücklings am Kopf umfassen, sodass Pierre ihn im Schleppgriff auf dem Rücken schwimmend ans Ufer ziehen konnte: Keuchend und völlig außer Atem kamen sie im Sand nebeneinander zum Liegen.
»Das war knapp«, flüsterte Pierre und strich sich mit beiden Händen das Wasser aus dem Haar, als der Gerettete auf einmal von einem Krampfanfall geschüttelt wurde und sich vor Schmerzen zusammenkrümmte.
Abrupt setzte Pierre sich auf und beugte sich über ihn. »Was ist mit Ihnen, wie kann ich helfen?«
»Arzt«, stieß der Mann zwischen zusammengepressten Lippen hervor. »Ich … brauche Hilfe.«
»Ich habe einen Notarzt gerufen, er müsste jeden Moment eintreffen.«
»Ist … gut«, flüsterte der Fremde, dessen Zähne nun zu klappern begannen. »Alles wird taub. Meine Beine, meine Hände. Ich kann sie nicht mehr …«
Sein Gesicht war fahl. Viel zu fahl. Pierre legte ihm eine Hand auf die Brust. Das Herz raste, stolperte, als absolviere es einen Hürdenlauf.
Der Mann keuchte. »Etwas stimmt nicht mit meinem Körper.« Er rang nach Worten. »Vergiftet«, stieß er dann heiser hervor.
»Sie sind vergiftet worden?« Sofort war Pierre alarmiert. »Wissen Sie, womit? Und wer es getan hat?«
Der Fremde nickte heftig und schien etwas sagen zu wollen, dann zuckte er in sich zusammen. Er hatte offenbar furchtbare Schmerzen.
»Haben Sie etwas Vergiftetes gegessen oder getrunken?«
»Gegessen. Einen …« Er brach ab. Unfähig, weiter zu antworten.
»Halten Sie durch«, flehte Pierre, zutiefst beunruhigt. Nach der Einnahme giftiger Substanzen, so hatte er einst gelernt, sollte man dem Betroffenen reichlich zu trinken geben. Er sah hinüber zu dem Felsen, wo neben seinen Schuhen und dem Telefon auch die Wasserflasche lag. »Ich bin gleich wieder bei Ihnen.«
»Warten Sie, Monsieur.« Der Mann hob den Kopf, das Gesicht war inzwischen kalkweiß. »Rufen Sie bitte … Camille an und erzählen Sie ihr, was passiert ist. Die Nummer lautet …«
Der Fremde versuchte, sie ihm zu diktieren. Die Zunge klebte ihm am Gaumen. Er leckte sich über die Lippen und suchte im Geiste nach den Ziffern, die sich irgendwo im Crescendo des Schmerzes verborgen hielten. Dann legte er erschöpft den Kopf ab und schloss die Augen, ohne eine einzige davon zu nennen.
Pierres Herz machte einen Satz. Er war drauf und dran, ihn zu verlieren! »Bleiben Sie wach, hören Sie? Um Himmels willen, bleiben Sie bei mir.«
An das, was danach geschah, konnte er sich später nicht mehr genau erinnern. Alles lief automatisch ab. So, als stünde er neben sich und folge einer oft gelernten Übung.
Als er den eintreffenden Wagen oben bei den Parkplätzen hörte, hatte er den Verunglückten bereits in die stabile Seitenlage gedreht und den immer schwächer werdenden Puls kontrolliert. Erst als der Arzt den Notfallkoffer samt Sauerstoffflasche neben ihm abstellte, das Ohr an den Mund des Bewusstlosen hielt und schließlich seine Vitalfunktionen überprüfte, erhob sich Pierre von seinem Platz und ging zu den zurückgelassenen Sachen.
Der Wind strich über sein nasses Haar und über das Shirt, das ihm feucht am Körper klebte. Er fröstelte. Erst jetzt bemerkte er, wie ausgekühlt er war. Pierre zog die Trainingshose, Socken und Sportschuhe an, legte die Hüfttasche um und band seine neue Uhr ums Handgelenk. Dann griff er nach dem Mobiltelefon und wählte die Nummer der Polizei.