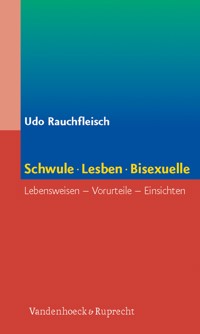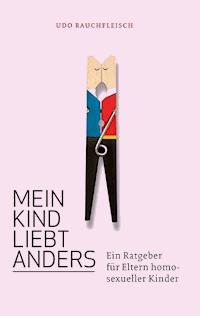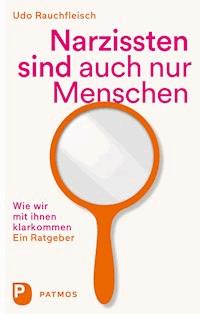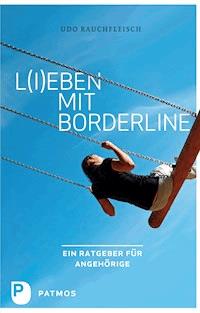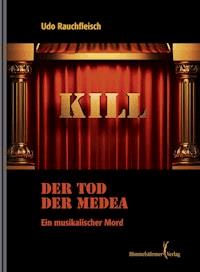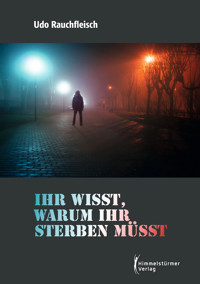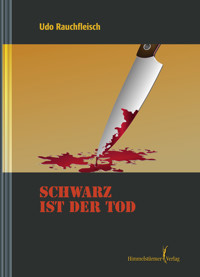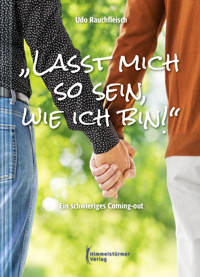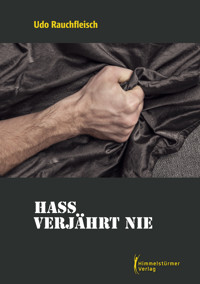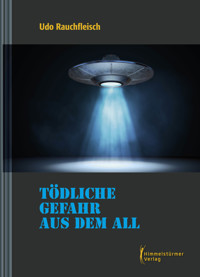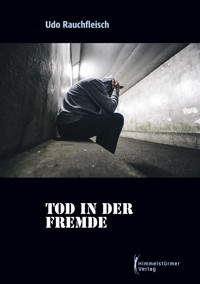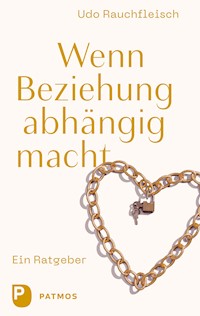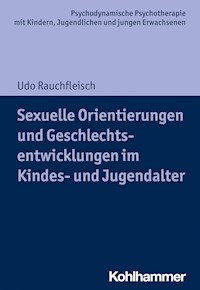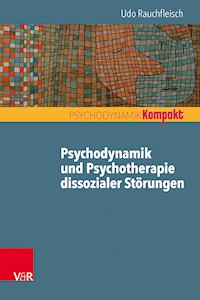
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Menschen mit dissozialen Störungen sind bei Psychotherapeuten oft unbeliebte Patienten. Sie gelten als schwer behandelbar und wenig motiviert. Die enge Verquickung von psychischen und sozialen Problemen stelle eine besondere Herausforderung dar. Im Unterschied dazu vertritt Udo Rauchfleisch aufgrund seiner über 50-jährigen Erfahrung mit diesen Patienten die Ansicht, dass diese Personen von einer psychodynamisch orientierten Behandlung sehr wohl profitieren. Psychoanalytische Konzepte bieten die Möglichkeit, die Entwicklung und das Verhalten dieser Patienten zu verstehen und für die Therapie zu nutzen. Es bedarf allerdings einiger Modifikationen der üblichen Vorgehensweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben vonFranz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Udo Rauchfleisch
Psychodynamik undPsychotherapiedissozialer Störungen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Paul Klee, Abseitig, 1934/akg-images
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2566-6401ISBN 978-3-647-99987-6
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
1Vorbemerkungen
2Zur Diagnostik dissozialer Menschen
3Zur Entwicklung dissozialer Menschen und ihren Folgen
3.1Psychodynamische Besonderheiten
3.2Ich- und überichstrukturelle Besonderheiten
3.3Die narzisstische Störungskomponente
3.4Eine mir wichtige Zwischenbemerkung
4Spezifische therapeutische Probleme
4.1Die erhöhte Impulsivität, das »handlungsmäßige Inszenieren innerer Konflikte in der Außenwelt«
4.2Die »mangelnde« Motivation
4.3Die Manipulationstendenzen und Funktionalisierung der Beziehungen
4.4Ablehnung und Entwertung der therapeutischen Angebote
5Übertragung und Gegenübertragung
5.1Übertragung
5.2Gegenübertragung
6Wichtige Behandlungsaspekte im Überblick
6.1Dauer der Behandlung
6.2Behandlungsrahmen und Grenzsetzung
6.3Verstärkter Einbezug der sozialen Realität
7Fazit
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten und Patientinnen hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 70 bis 80 Seiten je Band kann sich die Leserin, der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Soziale Arbeit, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Dissoziale Verhaltensweisen und Persönlichkeitszüge finden wir bei Patienten mit ganz unterschiedlichen Diagnosen und auch als Spektrumvariante in der Normalbevölkerung. Es geht dabei um eine soziale Auffälligkeit, die sich durch Regelübertretungen und Nichteinhaltung sozialer Normen äußert. Je nachdem wie stark solche sozialen Regelübertretungen auch andere Menschen in Mitleidenschaft ziehen, spricht man von dissozialen oder sogar antisozialen Störungen der Persönlichkeit.
Viele Patienten, die in Behandlung sind, weisen aber eine chronisch verlaufende dissoziale Entwicklung auf, die nicht das Vollbild einer Persönlichkeitsstörung erfüllt. Diese Patienten und Patientinnen, die immer wieder mit den Gesetzen in Konflikt kommen, gelten vielfach als ungeliebte Störenfriede im Praxisalltag oder in den Fachkliniken.
Gerade dieser Gruppe von Hilfe suchenden Menschen ist das vorliegende Buch gewidmet. Aus großer klinischer Erfahrung schöpfend und mit einer erkennbar menschlich mitfühlenden Haltung wird diese Patientengruppe vom Autor in den Fokus genommen. Das Buch möchte mit Vorurteilen aufräumen und zum psychodynamischen Verständnis dissozialer Menschen beitragen.
Den statischen Persönlichkeitsmodellen der Diagnostik, die ausschließlich mit negativen Begriffen operieren, werden neuere Ansätze zur dimensionalen Beschreibung gegenübergestellt. Eine entwicklungsorientierte Perspektive verweist auf kindliche Traumatisierungen und Mangelzustände, da oft diesen Patienten ihre Eltern aufgrund eigener emotionaler und sozialer Probleme nicht gerecht werden konnten. Frühe, durch Projektionen verzerrte Introjekte von Elternfiguren dürfen beim Therapeuten in der Gegenübertragung nicht zu schlicht negativen Haltungen gegenüber diesen versagenden Elternfiguren führen, weil dadurch die Patienten und Patientinnen selbst solche Vorbehalte auch gegen sich gerichtet erleben – wenn ihre inneren Bilder diese Elternfiguren enthalten. Die ausbeuterische Qualität von Beziehungen kann als Überlebensstrategie in desolaten Kindheitssituationen verständlich gemacht werden. Ichstrukturelle Besonderheiten und eine narzisstische Störungskomponente werden tiefgehend gewürdigt. Die Ressourcen der Betreffenden werden hervorgehoben.
Ein Kapitel über spezifische therapeutische Probleme befasst sich mit der erhöhten Impulsivität, den Motivationsproblemen, den Manipulationstendenzen und der Entwertung des therapeutischen Angebots. Übertragung und Gegenübertragung werden in einem eigenen Kapitel abgehandelt und verdeutlicht.
Eine Übersicht über wichtige Behandlungsaspekte schließt den therapeutischen Rahmen, die Therapiedauer und die Beachtung der sozialen Realität mit ein. Das Fazit betont die Bedeutung des Funkens von Hoffnung, den Therapeuten immer atmosphärisch vermitteln sollten, damit die Patienten aus ihren desolaten Lebenssituationen heraus neue Möglichkeiten erkennen können. Therapeutinnen und Therapeuten müssen die Leistung vollbringen, trotz aller Widrigkeiten an der Therapie für die Patienten festzuhalten und Stabilität zu bieten.
Ein wichtiges Buch über eine ungeliebte, aber bedürftige Patientengruppe. Eine von klinischer Erfahrung tief geprägte praktische Anleitung für Therapeuten und Helfende, die Probleme benennt und Hoffnung vermittelt, wo andere diagnostische Instrumente Unveränderbarkeit signalisieren.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
1 Vorbemerkungen
Dissoziale Verhaltensweisen und Persönlichkeitszüge finden sich bei ganz verschiedenen Menschen. Es können Personen mit neurotischen Störungen sein. Dissoziale Manifestationen finden wir aber auch bei Menschen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis oder bei dementen Patient_innen1 und auch bei Menschen, die psychisch gesund sind.
Mit der Charakterisierung »dissozial« beschreiben wir Personen, die sich nicht an die gesellschaftlichen Regeln halten und dadurch sozial auffällig werden. Es können eher geringfügige Abweichungen von den Normen sein, die eine bestimmte Gesellschaft als verbindlich erklärt. Es können aber auch gravierende Normverletzungen in Form von Gewalttaten und anderen Verletzungen der Integrität anderer Menschen sein. Bei dieser zuletzt erwähnten Gruppe wird im Allgemeinen die Diagnose einer »dissozialen« oder »antisozialen Persönlichkeitsstörung« gestellt (vgl. Dulz, Briken, Kernberg u. Rauchfleisch, 2017).
In den psychiatrischen und psychologischen Praxen sowie in Kliniken und anderen Institutionen treffen wir häufig mit Patient_innen zusammen, die nicht zu der engeren Gruppe der dissozialen bzw. antisozialen Persönlichkeiten gehören, sondern eine chronisch verlaufende dissoziale Entwicklung aufweisen. Vor allem um diese Gruppe von Patient_innen geht es in diesem Buch. Es sind nicht die Menschen, über deren spektakuläre Taten die Boulevardpresse in reißerisch aufgemachten Reportagen berichtet, nicht die »Unholde«, mit denen das Sensationsbedürfnis der Leser_innen befriedigt werden soll. Es sind vielmehr Personen, die immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten und deshalb auch mitunter lange Haftstrafen verbüßen müssen und deren Leben von Überschuldung, Problemen im Bereich von Arbeit und Wohnen, von Beziehungskonflikten, Substanzabusus, den verschiedensten psychischen Symptomen, aber auch von Aggressivität und Resignation geprägt ist.
Es sind vielfach unbeliebte Patient_innen (Rauchfleisch, 2011), deren Prognose als eher schlecht eingestuft wird und von denen es heißt, sie eigneten sich wegen ihrer »vielen sozialen Probleme« nicht für eine Psychotherapie, sondern bedürften eher einer sozialen Begleitung, sie verhielten sich oft »impulsiv« und seien »nicht für eine Psychotherapie motiviert«. Die Folge dieser Einschätzung ist ein geringes therapeutisches Engagement für sie, was sich nicht zuletzt darin niederschlägt, dass diese – zahlenmäßig keineswegs kleine – Patient_innengruppe im Allgemeinen nicht in den Curricula der psychotherapeutischen Ausbildungsinstitutionen auftaucht. Ich selbst habe dieses Manko in meiner psychoanalytischen Ausbildung erlebt und habe mich deshalb im Rahmen meiner therapeutischen Arbeit mit dissozialen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie in meiner forensischen Tätigkeit intensiv mit dieser Art von Patient_innen in Forschung und Praxis beschäftigt (beispielhaft seien die folgenden Publikationen genannt: Rauchfleisch, 1981, 1999, 2013, 2017a).
In vielen Kliniken und Kriseninterventionsinstitutionen werden diese Patient_innen von den am wenigsten erfahrenen Kolleg_innen behandelt, die sich wegen der fehlenden Vorbereitung auf diese Patient_innen häufig überfordert fühlen. Die Folge ist, dass sie aufgrund dieser Erfahrung später beispielsweise in der eigenen Praxis nicht bereit sind, Patient_innen dieser Art zu übernehmen. Das vorliegende Buch möchte Hilfe bieten zum Verständnis der Psychodynamik von dissozialen Menschen und Möglichkeiten psychotherapeutischer Interventionen darstellen.
1Der in diesem Buch verwendete Gendergap, die mit Unterstrich gefüllte Lücke, dient der sprachlichen Darstellung aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten, auch jener, die über das Zweigeschlechtersystem hinausgehen.
2 Zur Diagnostik dissozialer Menschen
Wie oben ausgeführt, finden wir dissoziale Verhaltensweisen und Persönlichkeitszüge bei völlig unterschiedlichen Menschen. Wie der Begriff »dis-sozial« zeigt, geht es um Abweichungen von einem normkonformen Verhalten. Im Gegensatz zu allen anderen Diagnosen der ICD und des DSM werden in diesen Diagnosekatalogen zur Beschreibung dieser Patient_innen nur sozial negative Etikettierungen verwendet.
So ist in der ICD-10 die Rede von einer sie auszeichnenden »Missachtung sozialer Verpflichtungen« und einem »herzlosen Unbeteiligtsein an Gefühlen für andere«. Es fehle diesen Menschen an Schuldbewusstsein, und sie seien durch nachteilige Erlebnisse, einschließlich Bestrafung, »nicht änderungsfähig«. Ferner wiesen sie eine »Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen« auf, obwohl sie keine Schwierigkeiten hätten, Beziehungen einzugehen; es bestehe eine »sehr geringe Frustrationstoleranz« und eine »niedrige Schwelle für aggressives, einschließlich gewalttätiges Verhalten«, und sie zeigten eine »deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierungen für das Verhalten anzubieten, durch welches die Betreffenden in einen Konflikt mit der Gesellschaft geraten« sind.
In ähnlicher ausschließlich negativer Weise charakterisiert das DSM-5 diese Patient_innen als egozentrisch und in ihrer persönlichen Zielsetzung am eigenen Nutzen orientiert. Es fehle ihnen Anteilnahme an den Gefühlen, Bedürfnissen oder dem Leiden anderer sowie an Reue nach dem Verletzen oder Misshandeln anderer Menschen. Als problematische Persönlichkeitsmerkmale werden genannt: Neigung zur Manipulation, Gefühlskälte, Unehrlichkeit, Feindseligkeit, Neigung zu riskantem Verhalten, Impulsivität und Verantwortungslosigkeit.
Bei dieser weitgehend statischen Sicht der Persönlichkeit dissozialer Menschen ist interessant, dass das Alternativmodell des DSM-5 in Sektion III das Konzept der Beeinträchtigung im Funktionsniveau der Persönlichkeit einführt. Dies stellt in diesem Symptomkatalog eine psychodynamische Erweiterung dar, wie sie auch von psychoanalytischer Seite von Kernberg (2009) vertreten wird. Mit Kernberg können wir bei den Persönlichkeitsstörungen zwischen drei Funktionsniveaus unterscheiden. Die Beurteilung, ob ein Patient einem hohen, mittleren oder tiefen Funktionsniveau zuzuordnen ist, erfolgt anhand der folgenden Kriterien:
–höhere oder archaische Abwehrformationen,
–besser oder schlechter integriertes Ich und Überich,
–Vorherrschen prägenitaler oder genitaler Konflikte.
Ähnlich wie bei der Symptomschilderung der ICD-10 und des DSM-5 rangiert die »antisoziale Persönlichkeit« auch bei dieser Differenzierung nach dem Strukturniveau am negativen unteren Rand des Spektrums (vgl. Clarkin, Yeomans u. Kernberg, 2008; siehe auch Rauchfleisch, 2019a). Sie wird hinsichtlich ihrer Schwere nur noch von der seit etlichen Jahren wieder verwendeten Diagnose »psychopathische Persönlichkeit« übertroffen (zum Konzept der Psychopathie siehe Hare, 1970, 2000, 2008).