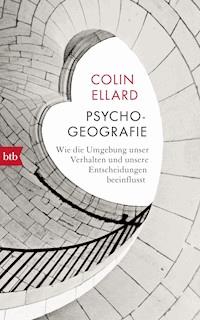
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Warum sind im Café die Tische am Rand schneller besetzt als in der Mitte? Weshalb werden Krankenhauspatienten schneller gesund, wenn sie ins Grüne blicken? Wieso schüchtern uns Kirchen ein? Colin Ellard nimmt uns mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Psychogeografie und erläutert, wie die Umgebung unser Verhalten tagtäglich beeinflusst – egal ob Zuhause, am Arbeitsplatz, auf dem Weg durch die Stadt oder draußen im Freien. Als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Experimentalpsychologie gibt er Einblick in die Mechanismen, die dabei wirksam sind, und zeigt auf, was wir im Alltag daraus lernen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Ähnliche
Buch
Warum sind im Café die Tische am Rand schneller besetzt als in der Mitte? Weshalb werden Krankenhauspatienten schneller gesund, wenn sie ins Grüne blicken? Wieso schüchtern uns Kirchen unweigerlich ein?
Unser Verhalten, unsere Gefühle und unsere Entscheidungen werden vielfach von äußeren Faktoren beeinflusst, ohne dass wir uns dessen bewusst sind – egal ob zu Hause oder am Arbeitsplatz, in öffentlichen Gebäuden, auf dem Weg durch die Stadt oder draußen in der Natur. Colin Ellard, einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Experimentalpsychologie, nimmt uns mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Psychogeografie und erklärt, wie die Umgebung, wie Architektur und Stadtplanung, unser Verhalten tagtäglich beeinflussen.
»Einfach brillant.«
New York Times Book Review
Autor
COLIN ELLARD ist Neurowissenschaftler und Experimentalpsychologe und gilt als »einer der besten Wissenschaftsautoren« (Los Angeles Times). Er forscht an der angesehenen kanadischen University of Waterloo und leitet dort das Urban Realities Laboratory – eine interdisziplinäre Einrichtung, die kognitive Neurowissenschaften und Stadtplanung miteinander verbindet. Ellard lebt in Kitchener, Ontario.
Colin Ellard
PSYCHOGEOGRAFIE
Wie die Umgebung unser Verhalten und unsere Entscheidungen beeinflusst
Aus dem Amerikanischen von Sigrid Ruschmeier
Für Kristine
Inhalt
Vorwort
ERSTES KAPITELDie Natur im Raum
ZWEITES KAPITELOrte der Zuneigung
DRITTES KAPITELOrte der Lust
VIERTES KAPITELOrte der Langeweile
FÜNFTES KAPITELRäume der Angst
SECHSTES KAPITELRäume der Ehrfurcht
SIEBTES KAPITELRaum und Technologie: Die Welt in der Maschine
ACHTES KAPITELRaum und Technologie: Die Maschine in der Welt
ZUM GUTEN SCHLUSSWieder zu Hause
Dank
Anmerkungen
Zur weiteren Lektüre empfohlen:
Register
Vorwort
Vor etwa fünfzig Jahren – ich war noch keine sechs und hatte noch keinen Gedanken daran verschwendet, was ich mit meinem Leben einmal anfangen wollte – besuchte ich mit meinem Vater Stonehenge. Das war, lange bevor es dort Verhaltensregeln oder Kontrollen gab, geschweige denn einen Zaun. An einem Frühlingsmorgen wanderten wir zwischen den riesigen Steinblöcken auf der leeren Hochebene von Salisbury umher, strichen mit den Händen über die glatten Steine und sprachen eher wenig. Es bedurfte keiner Worte. Es reichte, dort zu sein. Ich war so klein, dass ich natürlich nicht begriff, was für ein gewaltiger Zeitabstand zwischen uns und den Schöpfern dieser Anlage lag. Mein Kopf war auch noch nicht vollgestopft mit all dem Wissen aus Schule und Studium und den komplexen Gedanken und Überlegungen, die es mir nun als Erwachsenem schwer machen, vor einem solchen Monument einfach nur die Gefühle zuzulassen, die es hervorruft.
Klar war mir, dass ich vor etwas Uraltem und Wichtigem stand und dass, ganz einerlei, wer diese gigantischen Steine in Form geschlagen und aufgestellt hatte – es ernst gemeint hatte. Allein die unglaubliche Arbeit, die das Ganze gekostet haben musste, sprach Bände. Aber welche Geheimnisse Stonehenge barg, ahnte ich nicht, und obwohl meine Neugierde bei diesem ersten Besuch geweckt wurde, fragte ich mich nicht nach seinem Sinn und Zweck. Ich war mit meinen Empfindungen beschäftigt. Ich fühlte mich nämlich noch kleiner als ein sechsjähriger Knirps ohnehin, der sich an der Hand seines Vaters an einem solch befremdlichen Ort befindet. Ich atmete schneller und verspürte eine gewisse Beklemmung, weil mir vielleicht doch schwante, dass Menschen dieses gigantische Werk errichtet hatten, weil sie nach etwas Erhabenem trachteten, an dem ich aber nicht teilhaben sollte. Und während ich um die Säulen herumging, an ihnen emporschaute und sie betastete, überlief mich ein angenehmes Gruseln, weil wir, mein Vater und ich, vielleicht gar nicht hier sein durften und die Riesen, die diesen Ort gestaltet hatten, womöglich bald zurückkommen würden.
Mein Vater, der im Baugewerbe tätig war, erlebte diesen Tag vermutlich ganz anders als ich. Was er beruflich machte, wusste ich damals gar nicht genau, erst als Teenager bekam ich immerhin so viel mit, dass ich verstand, er konnte kaum ein Bauwerk anschauen, ohne im Kopf gleich eine Bestandsaufnahme von Größe und Form der benutzten Materialien zu machen und zu überschlagen, ob die Konstruktion stabil genug war, um den Elementen und dem täglichen Gebrauch durch die Menschen zu trotzen. Mein Vater war Kostenplanungsingenieur, und er musste im Entwurf des Architekten Maße, Kosten und Nutzen beurteilen und im Verlauf der Arbeit dafür sorgen, dass der fertige Bau der Vorstellung des Architekten entsprach und zudem innerhalb des veranschlagten Budgets oder sogar darunter blieb. Ich glaube schon, dass er auch gefühlsmäßig und spontan auf ein Gebäude reagieren konnte, aber das geschah sicher stets getrennt von seiner rationalen Betrachtungsweise, die in Fragen der Konstruktion, der technischen Umsetzung und der Wirtschaftlichkeit begründet war.
Heutzutage finde ich mich in einer Situation wieder, die der meines Vaters damals in Stonehenge wahrscheinlich gar nicht unähnlich ist. Ich bin ein Architektur- und Design-Fan. Ich bin fasziniert von den vielfältigen Wirkungen, die die Bauart eines Gebäudes oder die Anlage einer Straße auf meine Gefühle und Gedanken ausüben können, und um diese Wirkungen gewissermaßen hautnah zu erleben, habe ich Reisen durch die ganze Welt unternommen. Von Beruf bin ich Experimentalpsychologe und untersuche, wie uns Gebäude beeinflussen. Um eine Innenansicht der menschlichen Reaktionen auf die jeweilige Umgebung zu bekommen, greife ich auf ein breit gefächertes wissenschaftliches Instrumentarium zurück. Ich finde heraus, ob Bewohner eines Gebäudes aufmerksam sind (und auf was sie ihre Aufmerksamkeit richten) und ob und wann sie aufgeregt, gelangweilt, glücklich, traurig, ängstlich, neugierig oder eingeschüchtert sind. Ich möchte die Verbindung zwischen Gebäuden, die mein Vater so sorgsam ausmaß, und dem, was im Inneren ihrer Besucher vor sich geht, aufzeigen und verstehen.
Dabei überschreite ich ständig die Grenze zwischen meinem simplen Staunen als Sechsjähriger, also der emotionalen Reaktion auf die gebaute Welt, und meiner vernunftgesteuerten, kritischen Reaktion als in diesem Bereich forschender erwachsener Wissenschaftler. In diesem Buch möchte ich Ihnen von beiderseits dieser Grenze berichten.
Fast alle Menschen auf der Welt machen Tag für Tag Erfahrungen mit gebautem Raum – zu Hause, am Arbeitsplatz, in Amts- und Geschäftsgebäuden, in Vergnügungs- und (Aus-)Bildungsstätten. Wir alle ahnen, dass diese Orte gezielt so geplant und gebaut sind, dass sie unser Denken und Tun beeinflussen, und oft suchen wir sie ja auch gerade deshalb auf, weil wir diese Einflüsse erleben wollen. (Etwa in Kirchen oder Freizeitparks.) Doch obwohl wir alle gefühlsmäßig auf die Architektur von Gebäuden und Orten reagieren, haben wir natürlich im Alltag oft weder Zeit noch Lust, ihre Wirkung genauer aufzudröseln und uns klarzumachen, was wir da empfinden.
Andererseits wollen viele von uns als engagierte Bürger überall auf diesem Planeten – heute vielleicht mehr denn je – verstehen, wie Orte funktionieren, ja, wir wollen sogar dazu beitragen, dass sie besser funktionieren. Denn zum einen wissen wir, dass wir vor gewaltigen Veränderungen stehen. Verstädterung, Ballungsprobleme in Städten, Klimawandel und der enorme Energiebedarf in immer neuen Regionen der Welt fordern uns alle zum Nachdenken darüber auf, wie wir unsere eigene Umwelt gestalten, unser Überleben sichern und unsere psychische Gesundheit erhalten wollen. Zum anderen speist sich dieser neue Wunsch nach Mitgestaltung unserer Lebensschauplätze aus den neuen, uns zur Verfügung stehenden Erfindungen wie Smartphones oder dem Internet. Leichter als je zuvor können wir miteinander in Verbindung treten und Ideen, Bilder und sogar Informationen über unsere geistig-seelische und körperliche Befindlichkeit austauschen.
Ich bin überzeugt, wenn wir, im Großen wie im Kleinen, bessere Orte einrichten wollen, müssen wir mit der Beobachtung der komplexen Beziehungen zwischen unseren eigenen Erfahrungen und den Orten beginnen, an denen wir sie machen und in die sie später ja auch wieder eingehen. Daran können sich alle beteiligen. Und um diese Beziehungen zu verstehen, müssen wir uns des Arsenals sowohl der neuen wissenschaftlichen Theorien als auch der modernen Technologie bedienen. Das ist doppelt dringlich, weil die gleichen Technologien, mit denen wir die menschliche Reaktion auf Orte untersuchen können – von standortbezogenen Smartphone-Apps bis zu Sensoren, welche die biometrischen Daten von Straßenpassanten messen –, zunehmend auch zur Optimierung der traditionellen Planungsinstrumente eingesetzt werden, die unsere Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse und Entscheidungen beeinflussen. Mehr noch, diese Technologien definieren vom öffentlichen Raum bis zur Bedeutung einer Wand oder Mauer alles neu und revolutionieren zum Guten wie zum Schlechten die Art und Weise, wie uns unsere Umgebung berührt.
■ Wie es mit dem Bauen anfing
Der Wunsch, Umgebungen so zu gestalten, dass sie die Gefühle und das Handeln der Menschen beeinflussen, ist alt, ja, sogar älter als alle anderen Errungenschaften der menschlichen Zivilisation: älter als die schriftliche Kommunikation, als der Städte- und Siedlungsbau und sogar älter als der Beginn der Landwirtschaft. Die Wurzeln dieser planerischen Bemühungen liegen in der Südtürkei, unweit der Stadt Urfa, in den uralten Ruinen von Göbekli Tepe. Sie sind mehr als elftausend Jahre alt und bestehen aus einer Reihe von Mauern und Säulen, von denen manche mehr als zehn Tonnen wiegen.1 Als architektonisches Zeugnis ist Göbekli Tepe, abgesehen von ein paar sehr simplen, von Menschenhand erbauten Behausungen, das älteste uns bekannte Bauwerk. Ja, Göbekli Tepe wurde ebenso viele Jahrtausende vor Stonehenge errichtet wie Stonehenge vor unserer heutigen Zeit. Aber es ist insofern wichtiger, als es lange gehegte Auffassungen über die Ursprünge des Bauens über den Haufen wirft. Vor seiner Entdeckung war es nämlich gängige Meinung, dass Ackerbau und Viehzucht und die damit einhergehende Sesshaftigkeit der Menschen unsere baulichen Tätigkeiten und letztendlich den Bau von Städten erst in Gang gesetzt hätten. Aber damit hatte man das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt. Die Steine in Göbekli Tepe sind offenbar von Jägern und Sammlern, die sich von ihrer Jagdbeute ernährten, dort aufgestellt worden und nicht von sesshaften Bauern. Die ausgegrabenen Mauern sind höchstwahrscheinlich die allerersten, die nicht errichtet wurden, um Besitz und Familie vor Feinden, den Unbilden der Natur und den neugierigen Blicken der Nachbarn zu schützen, sondern zu anderen Zwecken. Welchen genau lässt sich nach so langer Zeit nicht mehr herausfinden, aber die wenigen Zeugnisse menschlichen Treibens dort – Tierknochen, Reste von Feuerstellen und in Säulen gemeißelte Piktogramme menschlicher Figuren und großer Vögel, Schlangen und fleischfressender Säugetiere – legen die Vermutung nahe, dass Göbekli Tepe als religiöse Kultstätte diente. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es auch eine Pilgerstätte, die über viele Jahrhunderte gebaut und umgebaut, besucht und verändert wurde. Klar ist, dass niemand dort wohnte. Vielleicht sollte der Ort zum Nachdenken und Beten inspirieren, und die Reliefs der grauenerregenden Kreaturen, die man dort fand, waren als Totems gedacht, die den Menschen die Furcht vor den schrecklichen Gefahren nehmen sollten, denen sie in ihrem Leben als Jäger fortwährend ausgesetzt waren. Möglicherweise wurde Göbekli Tepe auch als »Ort des Heilens« erbaut wie Stonehenge – was darauf verweisen würde, dass wir Menschen auch deshalb zu bauen begannen, weil wir uns unserer Endlichkeit bewusst wurden. Womit diese frühen Bauwerke den beginnenden Kampf gegen die Sterblichkeit spiegeln würden. In der Geschichte des Bauens, besonders des Bauens zu religiösen Zwecken, kann man vieles als den kollektiven Versuch interpretieren, den Tod auszutricksen – was wiederum beweist, dass wir schon früh die Wirkung von Erbautem auf unsere Gefühle verstanden haben.
Ungeachtet der geringen Kenntnisse darüber, welche Überlegungen hinter dem sorgfältigen Bau von Göbekli Tepe standen – immerhin sechstausend Jahre vor Erfindung des geschriebenen Wortes! –, drängt sich eines auf: Es handelt sich womöglich um das allererste Auftauchen des vielleicht entscheidenden Charakteristikums der Menschheit: Wir bauen, um Wahrnehmungen zu ändern und unser Denken und Fühlen zu beeinflussen. Und versuchen dadurch, das menschliche Handeln zu organisieren, Macht auszuüben und, last but not least: Geld zu verdienen. Beispiele dafür gibt es in der menschlichen Geschichte zuhauf.
■ Wie Raum uns berührt
Als ich zum ersten Mal im Petersdom war, sah ich, wie andere Besucher beim Anblick des gigantischen, vor Reichtümern und grandiosen Kunstwerken strotzenden Kuppelgewölbes auf die Knie fielen. Diese sehr menschliche Reaktion ist natürlich kein Zufall. Bauwerke wie der Petersdom wurden ausdrücklich so geplant, dass die Leute sich darin anders fühlen sollten. Man wollte Gläubige wie Ungläubige anregen, ihre Beziehung zum göttlichen Universum neu zu bewerten, man wollte ihre Ängste mit dem Versprechen auf ein Leben nach dem Tode beschwichtigen und hoffte, auch dann noch Macht über sie und ihr Verhalten auszuüben, wenn sie das Kirchengebäude längst verlassen hatten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben tatsächlich ergeben, dass Orte erhabener Schönheit, seien es atemberaubende Naturphänomene wie ein sternenübersäter tiefschwarzer Himmel, die Schluchten des Grand Canyon oder aber ein von Menschenhand geschaffenes Kunstwerk wie die Decke eines Sakralbaus, messbaren Einfluss darauf haben können, wie wir uns fühlen, wie wir andere behandeln und sogar wie wir das Verstreichen der Zeit wahrnehmen.2
Derart erhabene Erfahrungen mit Orten machen wir im Alltag natürlich eher selten. In einem Gerichtsgebäude (wo wir vielleicht ein Knöllchen bezahlen wollen) sind wir ebenfalls mit hohen Decken, kunstvollem Stuck, schweren Säulen und Pfeilern konfrontiert, aber das alles soll lediglich dazu dienen, dass wir uns im Angesicht der Obrigkeit kleinfühlen. Psychologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Beschaffenheit solcher Räume über unsere unmittelbaren Gefühle hinaus auch unsere Einstellungen und unser Verhalten beeinflusst. Sie machen uns zum Beispiel gefügiger und sorgen dafür, dass wir uns einem größeren, mächtigeren Willen unterwerfen.
In einem Einkaufszentrum wiederum wollen wir vielleicht nur einen bestimmten Gegenstand kaufen, sagen wir, einen Mixer, doch wir merken schon bald, dass wir in einen fast hypnotischen Zustand geraten, in unserer Widerstandskraft und Zurückhaltung nachlassen und bereitwillig Geld für etwas ausgeben, das wir gar nicht brauchen. Dieser Zustand – dessen Herbeiführung das hehrste Ziel der Profis ist, die Verkaufsräume entwerfen – kommt nicht von ungefähr, sondern ist bis ins Detail geplant. Ja, Kaufleute betreiben ein regelrechtes Wettrüsten im Kampf um unsere Portemonnaies, seit wir genug Geld für Dinge haben, die wir wollen, aber nicht brauchen.
Wenn wir durch eine breite Vorortstraße mit monotonen Reihen identischer Nullachtfünfzehnhäuser und großen, leeren Rasenflächen spazieren, kommt es uns vor, als würde die Zeit schmerzlich langsam verstreichen, und wir langweilen uns ganz genauso wie die Teilnehmer an den ersten Experimenten zur sensorischen Deprivation in den 1960er-Jahren. Ein Spaziergang über einen innerstädtischen belebten Straßenmarkt mit bunter Warenvielfalt, köstlichen Essensdüften und munterem menschlichem Treiben kann uns indes in beste Stimmung versetzen. Diese gegensätzlichen Reaktionen sind leicht an unserem Körper abzulesen, an unserer Haltung, an unseren Augen- und Kopfbewegungen und sogar an unserer Hirntätigkeit. Wo wir auch hingehen, unser Nervensystem und unser Gehirn werden von dem, was wir erleben, sozusagen massiert. Vielleicht verbreite ich nur Binsenweisheiten, aber wie man menschliches Erleben bebauter Schauplätze beeinflussen kann, ist, wie schon erwähnt, mittlerweile mit nie da gewesener Raffinesse und Kunstfertigkeit messbar.
Planern und Architekten steht nicht nur eine viel größere Vielfalt an Materialien und Verfahren zur Verfügung als je zuvor, auch die Grunderkenntnisse der Humanwissenschaften, der Soziologie, der Psychologie sowie der Kognitions- und Neurowissenschaften dringen immer weiter in die Welt des Planens und Bauens ein. Mit leistungsstarken neuen Untersuchungsmethoden in den Neurowissenschaften können wir die körperlichen Vorgänge, in denen sich unser geistiges Leben manifestiert, präzise wie mit dem Chirurgenskalpell voneinander trennen und bestimmen. Durch die neuen Einsichten in das Innenleben unseres Gehirns, basierend auf einem Jahrhundert der sorgsamen Experimente in den Kognitionswissenschaften, verstehen wir die wesentlichen Elemente der mentalen Erfahrung stetig besser und inzwischen so differenziert, dass wir unser Verhalten auf den chaotischen Schauplätzen unseres Alltagslebens in hohem Maße erklären und vorhersehen können. Zudem entwickeln sich immer rascher Technologien, mittels derer wir das Verstandes- und Gefühlsleben von Individuen aus der Distanz, also nicht invasiv erkunden können. Wir werden geradezu überschwemmt von Apparaturen, mit denen wir an unserem Herzschlag, an unserer Atemfrequenz, unserem Gesichtsausdruck, unseren Augenbewegungen und unserer Schweißdrüsentätigkeit unsere Gedanken ablesen können – sogar an der Art, wie wir unser Handy streicheln oder auf es einschlagen! Die neuen Technologien helfen den Forschern zu verstehen, wie genau unsere Umgebungen – vom Inneren der Häuser bis zu den Straßen einer Stadt – unsere Gefühle und unser Verhalten beeinflussen. Ebenso sind sie ein nie da gewesener Vorteil in einem Spiel, das so alt ist wie Göbekli Tepe. Das Spiel heißt »Verhaltenssteuerung durch gezielte Nutzbarmachung unserer natürlichen Reaktionen auf unsere Umgebung«.
■ Die neue Wissenschaft der Emotionen
Traditionell hat man bei der Beschreibung des menschlichen Gehirns immer scharf zwischen dem Bereich unterschieden, der für alles Kognitive zuständig ist – das Wahrnehmen, Denken, Schlussfolgern und Entscheiden –, und dem, in dem die Gefühle, Triebe und Emotionen beheimatet sind. Im Alltag reden wir noch oft vom Gegensatz zwischen Herz und Verstand, und auch in unserer heutigen Literatur, in Film und Fernsehen werden wahre Schlachten zwischen Verstand und Gefühl geschlagen. Unsere Sprache selbst verrät unsere (Vor-)Urteile. Zum Beispiel reden wir von »objektivem« Denken, als wollten wir als idealen Typus des rationalen Denkens eine gleichsam kartesianische Abkopplung von dem propagieren, was uns im Alltagsleben an- und vorantreibt, nämlich von dem, was wir vermuten und ahnen. In Shakespeares Stücken, Jane Austens Romanen und Dostojewskis größten Werken geht es immer um das Ringen zwischen Herz und Verstand. In einem moderneren Kanon, zum Beispiel der mythischen Welt von Star Trek, finden wir es normal, dass ein Außerirdischer wie der Erste Offizier Spock oder der Androide Lieutenant Commander Data fähig sind, sich ohne einen Anflug von Gefühl vollkommen vernünftig zu verhalten und dass man ein solches Verhalten als adaptiv, also situationsgerecht, bewerten kann.
Historisch vertraten auch wissenschaftliche Theorien diese Meinung. In den Neurowissenschaften herrschte die Auffassung, dass kennzeichnend für uns als Menschen sei, dass unser Neocortex in unserer Entwicklung immer dominanter wurde und dort, in der äußeren Schicht der Großhirnrinde, die »höheren« Funktionen abliefen. Das mit Bedeutung aufgeladene Adjektiv »höher« hob auf die reine Vernunft ab, und unter der kognitiven Krone brodelte das manchmal so genannte Reptiliengehirn, wo sich die tierischen Triebe und Instinkte austobten und dafür sorgten, dass wir unermüdlich Betätigungsmöglichkeiten für die (wie es ein Witzbold einmal formulierte) »vier Fs des motivierten Verhaltens« suchten: Fressen, Fighten, Fliehen und … Sich Reproduzieren. Implizit ging man sowohl im alltäglichen als auch im wissenschaftlichen Diskurs davon aus, dass diese beiden Areale unseres Gehirns – das tiefere Innere, das unsere Tier-Ichs beherbergt, und die entwickeltere äußere Hülle – ein antagonistisches Gegensatzpaar bildeten und einander auf ewig entgegengetaktet waren und wir deshalb oft in einem dumpfigen Morast von Gefühlen, die wir von unseren entwicklungsgeschichtlichen Vorfahren geerbt hatten, verzweifelt um Vernunft rangen.
Obwohl das beschriebene Vorurteil tief in unseren Köpfen verankert ist, deuten die Ergebnisse der modernen Neurowissenschaft und Psychologie auf eine sehr andere Beziehung zwischen Affekten und Denken hin. In seinen Untersuchungen von Personen mit herdförmigen Verletzungen in Arealen des Frontallappens, die einmal als der Hotspot des rationalen Denkens betrachtet wurden, hat António Damásio gezeigt, dass solche Verletzungen genau deshalb das adaptive Entscheiden und Verhalten beeinträchtigen, weil sie wichtige Verbindungen zwischen unserem emotionalen und kognitiven Ich unterbrechen. Es stellte sich heraus, dass die »Bauchgefühle« oder, mit Damásios Worten, »die somatischen Marker«, von denen wir uns bei Entscheidungen nicht selten leiten lassen und die auch überwiegend sinnvoll sind, tatsächlich in tieferen, den Emotionen vorbehaltenen Teilen unseres Gehirns entstehen, gleichzeitig aber wichtige Bahnen bilden, mit deren Hilfe wir vernünftige Ziele aufstellen und adäquate Pläne machen können.3
Das Urteilen, scheinbar so überaus rational, ist tief in unseren Gefühlszuständen verwurzelt. Und was wir von Hirnverletzten über die wichtige Rolle der Emotionen bei der Regulierung rationalen Verhaltens gelernt haben, wird von modernen Untersuchungen bestätigt, die unter Zuhilfenahme der Hirnbildgebung und Hirnstrommessung erfolgt sind. Die Bereiche unseres Gehirns, die Gefühle verarbeiten, sind überall verteilt, und zwar von den Stammhirnstrukturen, die ankommende Empfindungen körperlicher Zustände registrieren, einschließlich des Zustandes unseres Herzens, bis weit in die höheren Regionen des Cortex. Sie alle sind reichlich mit Schichten durchsetzt, die das Wahrnehmen und Erinnern möglich machen. Man kann die Bedeutung solcher Befunde für unser Gesamtverständnis dessen, wie das Gehirn für einer jeweiligen Situation angemessenes, also adaptives Verhalten sorgt, gar nicht hoch genug einschätzen – aber sie entgehen natürlich auch der Aufmerksamkeit derer nicht, die ihre ganz eigenen Gründe haben, uns zu beeinflussen. Der expandierende Bereich der Neuroökonomie gründet sich zum Beispiel hauptsächlich auf die Annahme, dass menschliches Verhalten fast nie ausschließlich logischen Prinzipien folgt und dass man, wenn man bis ins Einzelne verstehen will, wie der Mensch sein Handeln steuert, auch seinen kuriosen Status als lebende Denkmaschine berücksichtigen muss. Diese Maschine wiederum ist so konstruiert, dass wir nach den Prinzipien der natürlichen Auslese überleben und von verschiedensten Wünschen angetrieben werden, die zwar nicht der reinen Logik gehorchen, aber vermutlich den Fortpflanzungserfolg garantieren. Am wichtigsten bei diesen Wünschen ist die Rolle der Affekte. Derzeit ist die Anwendung neuroökonomischer Prinzipien auf dem Markt noch im Versuchsstadium, und die praktische Umsetzung hinkt dem genauen Wissen hinterher. Aber die Kluft zwischen Theorie und Praxis wird bald geringer werden.
Die neuen Ideen zur Schlüsselrolle der Emotionen bei der Steuerung von Alltagsverhalten haben auch Konsequenzen für das Verständnis unserer Psychogeografie, das heißt, dessen, wie uns unsere Umgebung beeinflusst. Die These, dass Orte unsere Gefühle und Gefühle unsere Entscheidungen beeinflussen, ist zwar nicht gerade brandneu, doch das Ausmaß, in dem unser Denken und Fühlen vermischt sind und die genannten Einflüsse auf unser Tun und Sein einwirken und es verändern, wurde bisher erheblich unterschätzt. Die neue Neurowissenschaft birgt freilich weitere überraschende Erkenntnisse, und die deuten auf eine sogar noch engere Beziehung zwischen unserer inneren Natur sowie der Technik und den Bauwerken hin, mit denen wir zu tun haben.
■ Spiegelneuronen, Embodiment und Technologie
Anfang der 1990er-Jahre entdeckte der Neurophysiologe Giacomo Rizzolatti an der Universität Parma bei einem Rhesusaffen ein eigenartiges neues Neuron in einem Bereich des Frontallappens.4 Mit Hilfe sehr feiner Elektroden zeichneten er und sein Team die Aktivitäten einzelner Neuronen auf und entdeckten, dass manche mit hoher Frequenz feuerten, wenn der Affe seine Hand nach einem Futterhappen ausstreckte, ihn ergriff und sich ins Maul steckte. Solche Zellen, die die Organisation komplexen Handelns kodieren und vermutlich eine Rolle darin spielen, sind im Gehirn von Primaten (unserem natürlich auch) nicht ungewöhnlich. Erstaunlicher an Rizzolattis Zellen war, dass sie ebenfalls feuerten, wenn der Affe ein Video anschaute, auf dem ein anderer Affe sich ein Häppchen einverleibte. Rizzolatti nannte diese Neuronen Spiegelneuronen. Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung entging ihre Bedeutung einer größeren wissenschaftlichen Gemeinde; Rizzolattis erster Versuch, seine Erkenntnisse in der renommierten Zeitschrift Nature zu veröffentlichen, schlug fehl, weil man sie schlicht nicht interessant genug fand. Doch inzwischen und in Übereinstimmung mit anderen Entdeckungen zu den Spiegelsystemen im Gehirn werden Rizzolattis Arbeiten als erster kleiner Schritt zu einem dramatisch neuartigen Verständnis vieler entscheidender Fragestellungen in der Psychologie erkannt – etwa wenn es darum geht, warum wir das Verhalten anderer derart genau verstehen und Empathie dazu entwickeln können oder, allgemeiner formuliert, wie unser Gehirn eine Verbindung mit unserer Umgebung herstellt.
Alles in Rizzolattis Befunden deutet darauf hin, dass unser Gehirn so konstruiert ist, dass wir die Verhaltensmuster anderer simulieren und verstehen bzw. sogar nachempfinden können. Untersuchungen des Gehirns mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass dann, wenn wir sehen, wie jemand ein Gefühl mit einer bestimmten Mimik ausdrückt, bei uns die gleichen Gehirnbereiche aktiviert werden, wie wenn wir dieses Mienenspiel selbst hervorbringen. Es sieht alles danach aus, als müssten wir, um die räumlichen Grenzen zu überwinden und zu fühlen, was unsere Mitmenschen fühlen, den Ausdruck ihrer Gefühle spiegeln. Hinzu kommt, dass Menschen, deren Gehirn in für den Ausdruck von Emotionen befassten Bereichen verletzt ist, Schwierigkeiten haben, die Gefühlsäußerungen anderer zu verstehen. Das Spiegelneuronensystem bietet uns offenbar einen Weg durch die Grenzen unseres Körpers, um ausführlich in Kontakt mit anderen Wesen und eventuell mit anderen Dingen zu treten.
Bei einem Experiment zur Demonstration der Spiegelneuronen setzt man die Teilnehmer an einen Tisch mit einer auf sie zulaufenden Trennwand. Links neben die Trennwand müssen sie ihre linke Hand legen – sie sehen sie also nicht mehr –, und vor sie, rechts neben die Trennwand, legt man das Gummimodell einer menschlichen linken Hand. Dann sehen die Teilnehmer, wie der Experimentator sanft die Gummihand streichelt, und spüren gleichzeitig, wie ihre eigene Hand gestreichelt wird. Nach kurzer Zeit empfinden sie die künstliche Hand als eigene. Und wenn der bisher Streichelnde plötzlich mit dem Hammer auf die Gummihand schlägt, zeigen sie heftige physiologische Reaktionen, im Prinzip, als wäre der Hammer auf die eigene Hand niedergesaust.5 Etwas Ähnliches hat man in einer simulierten außerkörperlichen Erfahrung beobachtet. Dabei konnten die Teilnehmer ihren eigenen Körper in einer bestimmten Entfernung als Bild betrachten, das eine Kamera in einen von ihnen getragenen Virtual-Reality-Helm projizierte. Sie entwickelten nun rasch das Gefühl, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden.6 Nachdem ich zum ersten Mal von diesen Experimenten gehört hatte, führte ich einige Demonstrationen zu dem Phänomen in meinem eigenen Virtual-Reality-Labor durch. Es funktionierte wie versprochen: Die Probanden berichteten von einem gespenstischen, schwer zu beschreibenden Gefühl des Getrenntseins vom eigenen Körper, und ich hatte das klammheimliche Vergnügen, mit einem Holzstock meinen mit dem VR-Helm bewehrten Chef zu traktieren, während dieser auf dem Boden lag.
Dass das Gehirn Körperräume rasch neu kartiert, um benachbarte Dinge mit einzubeziehen, ist auch in weniger bizarren Situationen beobachtet worden. Wenn man einen langen Zeigestock in die Hand gedrückt bekommt, um beispielsweise Objekte damit zu verschieben, nehmen bestimmte Bereiche im Gehirn eine Neukartierung vor, sodass der Zeigestock tatsächlich ein Teil des Körpers wird.7 Es ist hochwahrscheinlich, dass unsere Geschicklichkeit bei der Benutzung aller Arten von Alltagstechnologie, wie auch der Computermaus, aus dieser schnellen Neukartierung der wahrgenommenen Grenzen des Körperraumes herrührt.
Insgesamt verweisen das Spiegelneuronensystem und die beschriebenen Experimente darauf, dass unser Gehirn über leistungsstarke Plastizitätsmechanismen verfügt, mit denen es die Barrieren zwischen der äußeren Grenze unseres Körpers und anderen Menschen oder Dingen innerhalb unserer Reichweite überschreiten kann. Dadurch werden nicht nur unsere Fähigkeiten gestärkt, vom Bleistift bis zum Touchscreen viele verschiedene technische Hilfsmittel zu benutzen, sondern man kann auch vermuten, dass wir vor allem deshalb an den Gefühlen unserer Mitmenschen teilhaben können, weil wir ihren körperlichen Zustand konkret spiegeln, beispielsweise mit einem – wenn auch noch so verstohlenen – Gesichtsausdruck.
■ Wonder-Woman-Posen, kalte Beziehungen und wackliger Boden unter den Füßen
In einem der Internet-Vorträge auf der TED-Talks-Website referierte die Sozialpsychologin Amy Cuddy kürzlich über ihre Forschungen zur Körpersprache und vertrat den Standpunkt, dass unsere Körperhaltung nicht nur unsere Stimmung beeinflussen kann, sondern auch die chemischen Prozesse in unserem Körper. Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihrer Untersuchungen, die sie gebeten hatte, Superhelden und -heldinnen wie Wonder Woman zu imitieren und Imponierposen einzunehmen, schnitten in simulierten Job-Bewerbungsgesprächen besser ab und waren risikofreudiger als andere Kandidatinnen und Kandidaten. Schon nach zwei Minuten des »So-tun-als-ob« stieg ihr Testosteronspiegel in messbarem Ausmaß, während der Spiegel des Stresshormons Cortisol sank. Diese Ergebnisse sind nur einige aus einer neuerdings sintflutartigen Fülle von Experimentierberichten, aus denen hervorgeht, dass unsere Art des Bewegens und Posierens nicht von unseren Gedanken, Stimmungen und Verhaltensweisen getrennt ist.8 So fand man zum Beispiel heraus, dass wir dominanter wirken, wenn wir aufrecht sitzen und auf einen Laptop- oder Tabletbildschirm schauen statt auf ein kleineres Handy.9 Oder dass wir freundlicher und geselliger sind, wenn wir ein Heißgetränk in der Hand halten.10 Oder dass Probanden, die auf einem wackligen Stuhl saßen, auch ihre gerade aktuelle Liebesbeziehung als weniger stabil einschätzten.11 Solche Ergebnisse sind mehr als nur Kuriosa aus dem Labor. Sie verweisen darauf, dass die Verbindungen zwischen selbst herbeigeführtem Verhalten verschiedenster Art – Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Bewegungen – zu unserer psychischen Verfassung in beide Richtungen verlaufen. Mit anderen Worten: Wir meinen im Allgemeinen, dass wir lächeln, weil wir glücklich sind, aber die Ergebnisse der Experimente legen den Schluss nahe, dass wir umgekehrt auch glücklich werden, weil wir lächeln. (Und genau dieser Effekt ist in vielen Kontrolluntersuchungen dokumentiert worden.)
Angesichts dessen, was wir jetzt über die von Giacomo Rizzolatti erstmals beschriebenen Spiegelneuronensysteme wissen, leuchten die genannten Ergebnisse vollkommen ein und passen genau zu der Auffassung von der Organisation des Gehirns, die vom Primat der Körperzustände ausgeht. Wir empfinden, weil wir etwas tun. Wenn wir die Effekte von Gefühlszuständen körperlich simulieren, sei es, weil wir sie an einem anderen beobachten oder weil uns der Experimentator darum gebeten hat, erleben wir sie also auch selbst – inklusive der weitreichenden damit einhergehenden Änderungen in unserer Physiologie.
Wie wirken sich solche Effekte auf unsere Beziehung zu Bauwerken aus? Nehmen wir das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Von außen sieht es nüchtern und nichtssagend aus. Es besteht lediglich aus vielen Reihen schwarzer, unterschiedlich großer Betonquader in einem regelmäßigen Raster schmaler Gehwege. Auch die Höhe der Quader variiert, und sie stehen auf einem leicht welligen Untergrund. Dem weiter entfernt stehenden Betrachter bleibt großenteils verborgen, wie machtvoll das Denkmal ist. Das spürt man erst, wenn man hineingeht und darin herumläuft. Als ich das Mahnmal mit meiner Frau besuchte, setzten wir uns ein paar Minuten lang an den Rand und rätselten herum, was die Installation uns im Einzelnen wohl vermitteln wollte. Dann erkundeten wir ihr Innenleben. Die Gehwege waren so schmal, dass wir nicht nebeneinander herlaufen konnten, und wir wurden schon bald getrennt und erwischten immer nur einen kurzen Blick aufeinander. An den Kreuzungen der Gehwege konnten wir allerdings immer durch lange, enge, leere Korridore bis hinaus zu den Rändern des Mahnmals sehen und wurden von dort wiederum von den Blicken aller von dort Hineinsehenden aufgespießt. Zwischen den Quadern, die uns die Sicht auf die Außenwelt versperrten, waren wir desorientiert, und weil wir ständig voneinander getrennt wurden, fühlten wir uns verloren und auf den Gehwegen mit dem freien Blick zur Außenwelt immer wieder visuell durchbohrt. All das erzeugte ein heftiges Gemisch von Gefühlen: Furcht, Beklemmung, Trauer und Einsamkeit. Peter Eisenman, der Schöpfer des Mahnmals, hatte es geschafft, dass viele kleine, aber wirkmächtige Echos der Gefühle mitschwangen, die im Zweiten Weltkrieg verfolgte Juden empfunden haben müssen, und es war ihm gelungen, dass man diese starke Erfahrung nur machen konnte, wenn man sich auf die Anlage einließ. Nur wenn man hindurchlief und sich verirrte, waren Leid und Angst spürbar und nachempfindbar.
Obwohl Eisenmans Mahnmal ein »Zweckbau« ist und mit Absicht darauf ausgelegt, in den Besuchern bestimmte Gefühle auszulösen und auf diese Weise der Opfer zu gedenken und die Toten zu betrauern, werden wir in den folgenden Kapiteln sehen, dass es bei Weitem nicht ungewöhnlich ist, wenn Bauwerke spontan Gefühle in uns erwecken. Entweder geplant oder zufällig bringen uns Gebäude dazu zu fühlen, indem sie uns zum Handeln bringen – ganz ähnlich wie wir uns selbst wohlfühlen, wenn wir das glückliche Lächeln eines kleinen Kindes spiegeln. Diese Verbindungen sind tief in unser Nervensystem eingeschrieben, in Schaltkreise, die ursprünglich dazu angelegt waren, dass wir Erfahrungen miteinander teilten und adaptiv auf die Risiken und Chancen reagierten, vor die uns unsere natürliche Umwelt stellte.
■ Die gebaute Welt smart machen
Seit Jahrtausenden dient die herkömmliche Mauer oder Wand der Aufgabe, menschliches Handeln zu beeinflussen. Wände und Mauern schränken die Bewegungsfreiheit ein und blockieren die Sicht. Sie bieten Privatheit und Schutz. Ja, John L. Locke behauptet in seinem Buch Eavesdropping: An Intimate History, dass die Mauer/Wand uns vor der geistigen Belastung schützen soll, die uns droht, seitdem wir aus winzigen bäuerlichen Siedlungen in größere Dörfer und schließlich Städte umgezogen sind, wo wir ständig das Handeln von Fremden mitbekommen und es schwierig wird, die Übersicht darüber zu behalten, wer wem gerade was antut.12 Mauern und Wände verstärken oder etablieren gesellschaftliche Konventionen und kulturelle Normen. Die Erfindung von Räumen, die allein dem Schlaf vorbehalten waren, veränderte unsere Ansichten zur Sexualität. Die Anlage traditioneller muslimischer Häuser und sogar Straßen ist materieller Ausdruck der Haltung zur Trennung der Geschlechter und Generationen. Noch vor einem Jahrhundert hätte man fast alle psychologischen Wirkungen der gebauten Umwelt allein auf die Geometrie und das Erscheinungsbild der von Mauern und Wänden umschlossenen Gehäuse zurückführen können.
Jetzt allerdings erleben wir einen dramatischen Wandel in unserer Interaktion mit dem bebauten Raum. Die handgemachte Mauer ist in vielerlei Hinsicht ein Auslaufmodell. Die Anfänge des Wandels liegen weit zurück: Telekommunikationseinrichtungen wie Telefon, Radio und Fernsehen ermöglichten es uns zuerst, mehr oder weniger ohne Zeitverzögerung aus der Entfernung und ohne Augenkontakt zu interagieren. Durch die Massenkommunikationsmittel konnten wir mit vollkommen Fremden Erfahrungen teilen, obwohl dieses Teilen oft anonym und einseitig war, zum Beispiel wenn Tausende oder sogar Millionen Zuschauer im Fernsehen eine beliebte Sendung oder ein Sportereignis verfolgten. Doch wie altmodisch wirken diese Technologien in der heutigen Welt, in der so viele von uns mit Smartphones unterwegs sind, also mit leistungsstarken Computern, die aufzeichnen, wo wir sind und wo wir hingehen, und die es uns ermöglichen, mit allen, die ein ähnliches Gerät bei sich tragen, nach Belieben zu kommunizieren. Unsere Telefone verbinden uns nicht nur ständig miteinander, sondern auch mit nahezu unerschöpflichen Informationsmengen. Und diese Verbindungen sind zweiseitig: Ob wir nun vertraute oder aber neue Pfade beschreiten, unsere Geräte verstreuen auf diesem Planeten Informationen, zu denen der Planet dann seinerseits Zugang hat. Wir haben Apps, die unseren Aufenthaltsort und unsere derzeitige Tätigkeit in die Welt hinausposaunen – mittels bestimmter Fitnessaccessoires werden sogar Angaben zu unserer Gesundheit verraten! Wir sind lebende Signalanlagen, die persönliche Daten – wer wir sind, wie es uns geht und was wir machen – aussenden. Und dank dieser Signale, die wir ins All schicken, sind wir überall zugleich.
Aber nicht nur das Wunder des modernen Mobiltelefons füllt den Äther mit Daten über unser Handeln und Denken. Auch die gebaute Welt wird zunehmend mit Sensoren bestückt. Überwachungskameras sind seit Jahren gang und gäbe und werden inzwischen mit einer Technik kombiniert, die unsere Mimik, wie und wo wir hinschauen, unsere Herz- und Atemfrequenz sowie unsere Körpertemperatur vermisst. Das aufkommende »Internet der Dinge«13 verknüpft diverseste Geräte und Gebäude in einem gewaltigen elektronischen Informationsstrang – vom Temperaturregler in der Wohnung bis zur Verkehrssteuerungsanlage oder den Internet-Verkaufsportalen für Eintrittskarten aller Art. In der Folge können die Beziehungen zwischen den Menschen und ihrem alltäglichen Umfeld permanent überwacht, gemessen und angepasst werden.
Die jüngste Version des Wearable Computing, die wahrscheinlich den tiefgreifendsten Einfluss auf die Alltagsbeziehung zu unserer Umgebung haben wird, sind die Geräte, die wir vor den Augen tragen. Menschen sind überwiegend visuelle Wesen. Obwohl unsere anderen Sinne durchaus eine Rolle spielen, wenn wir uns in Orte hineinversetzen und eine Verbindung zu ihnen aufnehmen, ist es der Blick, der die Grenzen des gebauten Raumes am nachhaltigsten festlegt. Was und wen wir sehen und wie wir unsere eigene Sichtbarkeit für andere einschätzen, ist die wichtigste Determinante für unser Verhalten in der gebauten Umgebung.
Deshalb ist ein Gerät wie die Google-Brille nicht nur eine neue tragbare Rechnerschnittstelle, sondern eigentlich der Beginn einer Technologie, die in diese uralte Verbindung zur Außenwelt eindringt. In seiner derzeitigen Gestalt ist Google Glass nicht viel mehr als eine Art Head-up-Display (HUD), mit dessen Hilfe wir durch einen kurzen Blick nach oben einen nicht abreißenden Strom von Informationen über unsere Umwelt empfangen können. In Wirklichkeit ist die Brille aber nur einen kleinen Schritt entfernt von einem Gerät, das uns vielleicht einmal einen vollständigeren digitalen Overlay in unserem Blickfeld beschert, der unsere Bewegungen verfolgt und im Update Informationen zu dem liefert, was wir sehen. Solche erweiterten Realitäten werden in Forschungseinrichtungen schon seit geraumer Zeit genutzt; einige rudimentäre Arten stehen auch Smartphone-Benutzern zur Verfügung. Die volle Durchsetzung solcher Technologien würde, zumindest was den Sehsinn betrifft, viele Prinzipien der herkömmlichen Architektur obsolet machen. Joseph Paradiso vom visionären Media Lab des MIT erläutert es folgendermaßen: »Alles kann zum Display werden. Oder vielleicht werden direkt auf Ihre Netzhaut Photonen gemalt, sodass es keine große Rolle mehr spielt, was Sie sehen. Umgebungen werden dann eine wie auch immer geartete Kombination aus dem, was Sie leibhaftig sehen, und dem Virtuellen sein.«14
Die Macht (und vielleicht die Gefahr) solcher elektronischen Mauern oder Wände besteht darin, dass Begrenzungen aus Photonen im Gegensatz zum traditionellen Mauerwerk aus Stein in einem Augenblick aufgebaut und wieder eingerissen werden können. Nicht nur das, sie können auch vollkommen auf die Benutzer zugeschnitten werden. Die richtigen Informationen vorausgesetzt, können Sie und ich in ein und demselben physischen Raum sein, aber etwas vollkommen anderes sehen, das sich auf unsere jeweilige Persönlichkeit, unsere Interessen sowie auf unser bisheriges Konsumverhalten gründet. Wir alle bewohnen ja längst eine jeweils individualisierte Welt. Was wir sehen und wie wir auf Sinneseindrücke im Alltag reagieren, ist schon immer von unserer eigenen, einzigartigen Geschichte bestimmt worden. Wenn aber diese Geschichte zum offenen Buch und die entsprechenden Daten den Technologieanbietern verfügbar gemacht werden, die uns Scheuklappen vor die Augen setzen können, dann sind wir bald in unserer eigenen Geschichte gefangen. Die Welt versorgt uns nicht mehr mit erfrischend Neuem und anderem, sondern läuft Gefahr, sich in eine Reihe von sich selbst verstärkenden Feedback-Schlaufen zu verwandeln, die ähnlich zustande kommen wie unsere Browser-Chronik. Alles, was wir sehen, kommt durch den Spiegel dessen, was wir schon einmal gesehen haben, zu uns zurück.
■ Der Weg vor uns
Um nicht wie ein ausgemachter Technikfeind zu klingen, sollte ich jetzt vielleicht anmerken, dass ich nicht den Zeiten hinterherweine, als wir Menschen in der freien Natur um Feuerstellen herumsaßen und uns gegenseitig sowie unsere spärlichen Besitztümer mit Argusaugen bewachten. Ich empfinde eine gesunde Begeisterung für Technologie, bin normalerweise jemand, der ein neues Gerät als Erster benutzt, und mir absolut bewusst, wie viel leichter und gesünder unser Leben durch die verschiedenen technischen Errungenschaften geworden ist. Ich kann mir deshalb sehr wohl vorstellen, wie der Gebrauch neuer Technologien, die die realen und virtuellen Welten des Planens und Bauens miteinander verschmelzen und aufregende Neuerungen in responsiven Umgebungen verheißen, den Alten, Schwachen und Unterprivilegierten vieles im Leben erleichtern kann. Und ganz offen möchte ich hier schon vorwegnehmen, was auf den folgenden Seiten augenfällig wird – dass nämlich die genannten Entwicklungen, einschließlich der mobilen Datenerfassung und der Speicherung biometrischer Daten sowie der Erzeugung virtueller und erweiterter Realitäten, für Wissenschaftler, die ähnliche Forschungen wie ich betreiben und die ich in diesem Buch schildern werde, ein Füllhorn ergiebigster Daten bieten. Einfach ausgedrückt: Diese Werkzeuge erlauben Forschern wie mir, detaillierter und umfassender zu verstehen, wie die physische Umgebung, in der wir leben, unser gesamtes Handeln beeinflusst.
Gedämpft wird meine Begeisterung für diese Technologie und ihr Veränderungspotential in Bezug auf unser Sein und Handeln natürlich insofern, als ich weiß, wie und dass sie missbraucht werden kann. Zunehmend umfassendere Erkenntnisse der Kognitiven Neurowissenschaften führen in Kombination mit der modernen Datenerfassung dazu, dass man unsere Gehirne mit nie dagewesenen Informationsmengen füttern und damit die Beziehung zwischen uns und der Welt vollkommen umgestalten kann. Und all diese Möglichkeiten sind nirgendwo so wirksam wie in der Kampfbahn unserer seelischen Zustände, von denen wir jetzt wissen, dass sie sehr vielen unserer Handlungen zugrunde liegen.
Mit diesem Buch will ich aber nicht die Alarmglocken läuten, damit wir uns zurückhalten und die Risiken gar nicht erst eingehen, sondern ich möchte den Versuch unternehmen, das unmittelbar vor uns liegende Terrain darzustellen und auszuloten. Wie bei jedem großen wissenschaftlichen Fortschritt besteht auch bei diesem, der allem Anschein nach sämtliche Aspekte unseres Lebens beeinflussen wird, die beste Strategie darin, dass wir uns mit Wissen bewaffnen und hoffen, dass wir klüger werden.
ERSTES KAPITELDie Natur im Raum
■ Geschichten aus dem Outback
Ganz zu Beginn meines Berufslebens – als Folge gewisser impulsiver Entscheidungen und mit ein bisschen Glück (oder Pech, das wusste ich damals nicht so genau) – stolperte ich zusammen mit einem wahren englischen Gentleman, dem Neurowissenschaftler Lindsay Aitken, durch das australische Outback. Wir hatten uns verirrt. Einigermaßen aufgeregt kämpften wir uns durch das raue Spinifexgras, behielten in panischer Angst vor den womöglich darin lauernden Zecken – vor den Krokodilen und Schlangen sowieso – unsere Umgebung argwöhnisch im Auge und spitzten die Ohren, um wenigstens die Schritte unseres Führers John Nelson irgendwo ausmachen zu können. John war ein nicht mehr junger, gestandener Feldbiologe und mit seinen vierzig Jahren Busch-Erfahrung bisher wie ein keineswegs alter Hase kreuzfidel vor uns hergesprungen. Wir suchten ein Tier namens Zwergbeutelmarder, ein mit dem Tasmanischen Teufel verwandtes, kleines, fleischfressendes Beuteltier, das von den Farmern im Northern Territory Australiens zu Unrecht als Landwirtschaftsschädling betrachtet wird. Wenn wir ein paar Exemplare gefangen hatten, wollten wir damit zu unserem Standort in Melbourne, ein paar Tausend Kilometer weiter südlich, zurückkehren.
Ich gestehe freimütig, dass ich meine Energien weniger auf die Wunder der Natur als auf das Ersinnen gotteslästerlichster Flüche in Richtung Nelsons verwandte, der uns, schadenfroh, wie er war, natürlich nur vormachte, er habe uns im Stich gelassen. Etwaige Gedanken an die angeblich beruhigende Wirkung eines Aufenthalts in der Natur vermieste er mir gründlich. Als typischer Stadtmensch war ich absolut nicht in meinem Element. Das Adrenalin schoss mir durch den Körper, und verängstigt und desorientiert, wie ich war, wünschte ich mir nur inbrünstig, heil und gesund aus dem Busch zu entkommen. Hektisch warf ich verschreckte Blicke von Ort zu Ort. Hier wimmelte alles vor Gefahren; ich hätte nicht einmal gewusst, wo ich Schutz hätte finden können!
Als Lindsay und ich atemlos und mit hochroten Wangen Nelson endlich einholten, stand er triumphierend, ein süffisantes Grinsen im Gesicht, mit einem Fuß auf einem Baumstumpf und zeigte auf eine gigantische Spirale, die so dick war – dicker als mein Bein –, dass ich einen Moment brauchte, um zu kapieren, was ich da anstarrte. Eine riesige Schlange! »Ein Python. Ihr könnt ein Foto machen, wenn ihr wollt. Sie schläft. Und habt ihr gemerkt, dass ihr an einem Krokodil vorbeigekommen seid?« Trotz Nelsons Versicherung, er habe nie den Kontakt zu uns abgebrochen, selbstverständlich gehört, wie wir hinter ihm hergestapft und -gestolpert seien, und stets gewusst, dass uns »eigentlich« nichts passieren könne, dauerte es eine Weile, bis Lindsay und ich überhaupt wieder ein Wort mit ihm wechselten.
Jetzt habe ich sicher ein extremes Beispiel dafür beschrieben, was passiert, wenn sich moderne Städter in eine echte Wildnis begeben, doch es beleuchtet eine interessante und wichtige Tatsache der conditio humana: Wir haben uns eine Umgebung geschaffen, die so anders ist als die, in der sich unser Körper und unser Gehirn entwickelt haben, dass die meisten von uns, kaum dass wir in die Wildnis zurückkehren, feststellen müssen, dass uns fast alle Techniken nichts nützen, mit denen wir normalerweise unsere Interaktionen mit dem Ort um uns herum regeln. Wir wissen weder, wie wir uns bewegen, noch, wohin wir gehen, ja, nicht einmal, wohin wir schauen müssen.
Obwohl wir von den Verhältnissen, die uns ursprünglich einmal geprägt haben, derartig weit entfernt sind, lieben die meisten von uns den Kontakt zur Natur (wenn auch vielleicht zu einer milderen Variante als der im Northern Territory Australiens). Es ist uns angeboren, dass uns Orte locken, die für unsere Urahnen noch den Unterschied zwischen Leben und Tod ausgemacht hätten. Unsere teuersten Immobilien befinden sich oft auf dem Gipfel von Bergen oder an Felswänden gegenüber großen Wasserflächen. Selbst in städtischen Umgebungen legen wir großen Wert auf schöne Ausblicke auf die Natur. Wenn wir zum ersten Mal eine Stadt besuchen, bewegen wir uns spontan auf alle Grünflächen oder Gärten zu, die es dort gibt. In Vancouver, einer Stadt, die elegant zwischen den Rocky Mountains im Osten und dem Pazifischen Ozean im Westen gelegen ist, dürfen Bauherren von Gesetz wegen nicht den Blick auf die Berge oder das Meer verbauen: Die Verbindung mit der Natur ist dort unantastbar.
Nach der epochemachenden Beobachtung des Forschers Roger Ulrich von der Texas A&M University, dass Krankenhauspatienten, die von ihrem Bett aus ein bisschen Gras und ein paar Bäume sehen konnten, schneller gesund wurden und weniger Schmerzmedikamente brauchten als die, die nur Betonwände sahen15, ist dieses von den meisten von uns intuitiv empfundene Wissen in den letzten dreißig Jahren von wissenschaftlicher Seite mit einer Lawine von Beweisen bestätigt worden. Die Natur kann Schmerzen lindern, Mut machen und heilen. Und wenn das zutrifft, dann müssten wir durchschnittlichen Stadtbewohner eigentlich trotz der Tatsache, dass wir mit Grammatik und Vokabular der natürlichen Umgebung nicht mehr vertraut sind, immer noch Rudimente irgendeiner tiefen, archaischen Verbindung mit jenen Landschaften haben, die unsere Spezies prägten. Und richtig, wir werden sehen, dass diese Verbindung tief in unseren Körper und unser Nervensystem eingeschrieben ist und auch heute noch unser Verhalten an Orten (zu den einen fühlen wir uns hingezogen, von den anderen abgestoßen) ebenso beeinflusst wie unsere Gefühle, unser Stressempfinden und sogar das Funktionieren unseres Immunsystems.
■ Die Biologie der Habitatselektion
Warum ein bestimmtes Tier sich für ein bestimmtes Habitat entscheidet, ist eine der elementarsten und wichtigsten Fragen in der Biologie, und ihr sind viele Tausend Forschungsstudien gewidmet. Die Fähigkeit, ein Milieu zu finden, das günstig für Futtersuche und Partnerwahl ist sowie Schutz vor Fressfeinden gewährt, ist unerlässlich für den biologischen Erfolg – der natürlich darin besteht, bis zum fortpflanzungsfähigen Alter zu überleben und für Nachkommen zu sorgen. Viele Studien haben gezeigt, dass Tiere bemerkenswerterweise nicht nur imstande sind, die besten verfügbaren Orte für sich auszuwählen, sondern dass sie sogar vorhersehen können, wie dieser Ort ihren zukünftigen Bedürfnissen dienen wird.
Der Grünwaldsänger zum Beispiel, ein kleiner, in den Fichtenwäldern des östlichen Nordamerika nistender Singvogel, richtet sich sein Revier in den ersten Sommermonaten vorzugsweise in Amerikanischen Rotfichten ein, obwohl sie weniger Futter bieten als die benachbarten Weißfichten. Aber wenn die Nester gebaut sind und die hungrigen Jungvögel Nahrung brauchen, gibt es im Rotfichtenwald die reichere Ernte. Aus irgendeinem Grunde wird der Waldsänger so gesteuert, dass er sich an den Orten niederlässt, an denen er besser seine zukünftigen Elternpflichten erfüllen als seine derzeitigen Bedürfnisse befriedigen kann.16 Nicht zufällig konzentrieren sich viele Untersuchungen zur Habitatselektion auf Nistvögel. Der Bau eines Nestes erfordert erhebliche Anstrengungen, und es ist deshalb wichtig, dass sich der dafür ausgesuchte Ort für die Dauer der Brut- und Aufzuchtperiode nicht allzu sehr verändert, dass er Schutz und die richtige Mischung an Futter zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft bietet, also dann, wenn dieses Futter entscheidend für das Überleben der Nachkommen ist. Viele andere Tiere haben es mit der Habitatselektion ein wenig leichter. Wenn sie an einem Ort nicht genug Futter finden, suchen sie sich einfach eine grünere Weide wie zum Beispiel die Elch- oder Karibuherden, die auf der Suche nach fressbarem frischem Moos hinter der Frostgrenze herziehen.
Trotz zahlreicher Hinweise, dass Tiere bei der Auswahl ihres Habitats die mannigfaltigsten Umweltfaktoren berücksichtigen können, wissen wir auffallend wenig über die eigentlichen Mechanismen, die dabei im Spiel sind. Was veranlasst den Grünwaldsänger auf der rein praktischen Ebene des Wahrnehmens und Handelns, sich für die Rotfichten zu entscheiden? Warum genau bevorzugt er diese Baumart? Leider können wir uns über die Mechanismen des beschriebenen Tierverhaltens kein Wissen aus erster Hand verschaffen, denn Tiere in der freien Wildbahn lassen sich ungern in den Kopf schauen. Laborexperimente haben sich bisher eher auf sehr schlichte Umgebungsvarianten konzentriert, und das Tier konnte seine Präferenz nur durch die Verweildauer in einem Bereich ausdrücken, den es aus mehreren aussuchen konnte. In Experimenten in einem Aquarium mit einer Art Doktorfisch, der den entzückenden Namen Manini trägt (im Urban Dictionary17 definiert als »ausgeflippter … krasser Mensch«), hat sich zum Beispiel gezeigt, dass diese Tiere ihre Ruhezeiten lieber in flachen Bereichen mit wenig Tarnung verbringen als im tiefen oder offenen Wasser.18 Experimente mit verschiedenen Spezies der Saumfingerechsen haben ergeben, dass sie auf kleine Pfähle klettern und erst nach sorgsamer Inspektion ihrer Umgebung losgehen und sich ein Grasfleckchen aussuchen.19 Dank dieser Experimente verstehen wir die Mechanismen, die der Habitatselektion zugrunde liegen, zwar ein bisschen besser, können aber noch lange nicht im Einzelnen erfassen, warum diese Tiere dort hingehen, wo sie hingehen.
■ Habitatselektion beim Menschen
Obwohl Menschen in extrem unterschiedlichen Habitaten leben und gedeihen können, kommen doch einige der besten und frappierendsten Hinweise zu den Mechanismen der Habitatselektion aus Experimenten mit menschlichen Teilnehmern. Das rührt zum Teil daher, dass man erheblich leichter im Innenleben von Menschen herumforschen und untersuchen kann, in welchem Ausmaß wir einen Typus von Ort einem anderen vorziehen. Wir haben die verschiedensten Instrumente und Möglichkeiten, von der schlichten Selbstaussage (Motto: Darf ich Sie mal etwas fragen?) bis zur Messung des physiologischen Zustands eines Probanden, der gerade unter einer Vielfalt von Ortstypen auswählt.
Seit der Antike haben sich alle möglichen Fachleute dafür interessiert, warum Menschen sich für bestimmte Szenerien in der Natur entscheiden. Mittlerweile haben Philosophen, Künstler, Geografen, Landschaftsarchitekten und Psychologen aller Couleur ihre Meinung dazu geäußert. Der US-amerikanische Geograf Jay Appleton hat in seinem hervorragenden Buch The Experience of Landscape20 viel von diesem Interesse herausgearbeitet und zusammengefasst. Als Ausgangspunkt nahm er biologische Untersuchungen der Habitatselektion bei Vögeln, Echsen und vielen anderen Tieren. Einen großen Stellenwert räumt Appleton der Erkenntnis des niederländisch-britischen Verhaltensforschers Niko Tinbergen ein, die besagt, dass es für ein Tier überlebenswichtig sei, »zu sehen und nicht gesehen zu werden«. Sowohl vom Standpunkt des Jägers als auch des Gejagten liegen die Vorteile auf der Hand, wenn man eine Umgebung gut überblicken kann und gleichzeitig vor Entdeckung geschützt ist. Appleton behauptet mit besonderer Betonung auf dem evolutionären Zusammenhang zwischen Mensch und Tier, dass dieses Prinzip auch eine Rolle bei unserer ästhetischen Bevorzugung von bestimmten natürlichen Landschaften spielt. Er spricht von »prospect and refuge«, und schon die Begriffe »gute Sicht« und »geschützter Raum« drücken ja aus, dass man sehen, aber nicht gesehen werden will. In gewisser Weise war Appletons Theorie Teil des missing link in den biologischen Untersuchungen zur Habitatselektion. Vielleicht wandern die Grünwaldsänger, Saumfingerechsen und Maninis dieser Welt ganz einfach deshalb in bestimmte Habitate, weil sie sich dort wohlfühlen.





























